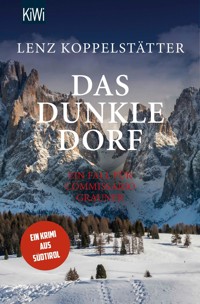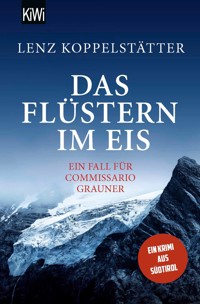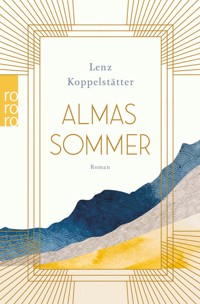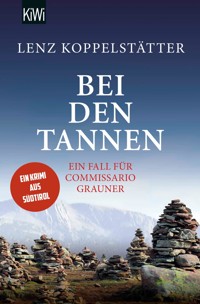
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Grauner ermittelt
- Sprache: Deutsch
Mord im Sarntal Gefährlicher Aberglaube, tödliche Delikatessen und ein finsteres Kapitel der Südtiroler Geschichte: Sein siebter Fall lässt Commissario Grauner an seinem Verstand zweifeln. Im Sarntal, im Herzen Südtirols, liegt zwischen Schluchten und mit wilden Latschenkiefern bewachsenen Hängen eines der besten Restaurants der Welt: das Tan. Ausgerechnet eine berühmte Goumetkritikerin kommt hier unter mysteriösen Umständen zu Tode. Commissario Grauner, dem schon von seiner Frau Alba zubereitete Speckknödeln zum Glück reichen, begibt sich auf Spurensuche in die Welt der feinen Speisen. Für die eigenwilligen Dorfbewohner steht schnell fest: Die Köchin war es. Schließlich sei sie eine Nachfahrin einer der letzten Frauen, die im 16. Jahrhundert im Zuge der brutalen Hexenprozesse auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden waren. Obwohl die Ermittler von derlei Gerüchten nichts wissen wollen, müssen sie sich fragen: Soll hier eine jahrhundertealte Rechnung beglichen werden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Lenz Koppelstätter
Bei den Tannen
Ein Fall für Commissario Grauner
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Lenz Koppelstätter
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Lenz Koppelstätter
Lenz Koppelstätter, Jahrgang 1982, ist in Südtirol geboren und aufgewachsen. Er arbeitet als Medienentwickler und als Reporter für Magazine wie Geo Saison oder Salon. Alle sechs Bände der Krimireihe um Commissario Grauner, »Der Tote am Gletscher«, »Die Stille der Lärchen«, »Nachts am Brenner«, »Das Tal im Nebel«, »Das Leuchten über dem Gipfel« und »Das dunkle Dorf« waren ein großer Erfolg bei Leserinnen, Lesern und Presse.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Im idyllischen Sarntal, im Herzen Südtirols, liegt zwischen Schluchten und mit wilden Latschenkiefern bewachsenen Hängen eines der besten Restaurants der Welt. An einem warmen Spätsommertag kommt ausgerechnet hier, im Tan, die berühmt-berüchtigte Gourmetkritikerin Carla Manfredi unter rätselhaften Umständen ums Leben. Ein Fall für Commissario Grauner, dem die Welt der Gourmets, zugegeben, bislang ein Rätsel geblieben ist. Er jedenfalls liebt nichts mehr als die selbst gemachten Knödel seiner Alba und ein Glas Rotwein. Doch für Gemütlichkeit bleibt vorerst keine Zeit. Denn für die eigenwilligen Sarner steht bereits fest, wer für Manfredis Tod verantwortlich ist. Die als Hexe verrufene Köchin des Tan. Unruhe macht sich breit. Und schon kurz darauf spitzen sich die Ereignisse vor Ort auf dramatische Art zu. In seinem siebten Fall ermitteln Grauner und seine Kollegen in der Welt der Sterneküche – und in einem Tal, das seine ganz eigene, finstere Geschichte hat.
Hinweis für E-Reader-Leserinnen und Leser
Wenn Sie sich die Karte in Farbe und zoombar ansehen möchten, dann geben Sie bitte die folgende Internetadresse im Browser Ihres Computers oder Smartphones ein:
www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/die-karten-zu-bei-den-tannen
Hinweis für Leserinnen und Leser auf dem Smartphone/Tablet oder am Computer
Sie möchten sich die Karte zoombar anschauen? Dann tippen bzw. klicken Sie bitte auf die Abbildung. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der entsprechenden Website-Ansicht.
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum Buch
Prolog
Karten zum Buch
26. August
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
27. August
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
28. August
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
29. August
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Epilog
Danke
Leseprobe »Was der See birgt«
Personen und Handlungen dieses Romans sind frei erfunden. Im Burgfried von Reinegg sind das Flehen und Zerren mancher verdammten Seelen noch zu hören und zu spüren. In Bezug auf Ortsbeschreibungen nimmt sich das Buch Freiheiten heraus.
Prolog
Es gibt da drei Schwestern, so erzählen es die Leute im Tal, und wenn etwas passiert, etwas Schlimmes passiert, in diesem Tal im Herzen Südtirols, so etwas Schlimmes, wie es der liebe Gott nur alle paar Jahrzehnte passieren lässt, dann ist die Familie der drei Schwestern daran schuld. Denn so ist es immer schon gewesen.
Die drei Schwestern, das sind die Jöchler Hedwig, die älteste, hagere Gestalt, blasser Teint, pechschwarzes Haar. Die Jöchler Lisa, die mittlere, kastanienbraunes Haar, Sommersprossen, rote Pausbacken. Die Jöchler Susanne, die jüngste, das Nesthäkchen, die Nachzüglerin, goldblondes Haar. Alle drei sind sie ledig, weil sich kein Mannsbild mit so einer einlassen will. Alle drei sind nicht getauft, weil der Herr Pfarrer, recht hat er, so sagen die Leute im Tal, kein Kind taufen lässt, von dem man nicht weiß, wer der Vater ist. Denn dann würde er ja Probleme bekommen, der Pfaff, und zwar mit dem lieben Gott, seinem Chef sozusagen, dem Unfehlbaren, weil, wenn man nicht weiß, wer der Vater eines Kindes ist, dann könnte ja auch, auszuschließen ist es jedenfalls nicht, der Teufel seine Finger im Spiel gehabt haben.
Das alles erzählen sie über die Jöchlerinnen, die Leute im Dorf, und die, die nicht mehr leben, die schon oben beim lieben Herrgott sind oder unten beim Beelzebub, die haben früher ganz Ähnliches erzählt, über die Mutter der drei Schwestern. Und die, die viel länger schon in ihren Gräbern verrotten, die erzählten ganz Ähnliches von der Großmutter und von der Urgroßmutter – und so geht das schon seit Anbeginn der Zeit. Von den Jöchlerinnen kommt nichts Gutes, darauf kannst du Gift nehmen, das sagen die Leute im Dorf. Das erzählen die Älteren den Jüngeren, und die Jüngeren erzählen es ihren Kindern und Kindeskindern, und so wird es auf ewig weitergehen. Das ist das Gesetz der dunklen Welt.
Da kann die Sonne noch so hell über dem Sarntal strahlen, heller als sonst irgendwo, da kann der hellblaue Himmel noch hellblauer glitzern über Südtirol, hellblauer als sonst irgendwo, der pulvrige Schnee auf den Gipfeln kann noch pulvriger schimmern als sonst irgendwo, die sattgrünen Wiesen noch sattgrüner leuchten als sonst irgendwo, die kerngesunden Kühe noch kerngesünder muhen als sonst irgendwo.
Nichts hilft gegen die Jöchlerinnen. Auch nicht, dass man keine Jöchlerin je innerhalb der Friedhofsmauern begraben hat, was selbst, wenn man wollte, nicht ginge, weil sich die Jöchlerinnen immer schon, wenn es an der Zeit war zu gehen, wie die wilden Tiere in den Wald verkrochen haben und einfach nicht mehr daraus hervorgekommen sind.
Nein, es ist kein Kraut gewachsen gegen diese Jöchlerinnen. Man muss wohl, das sagen sie, die Leute aus dem Sarntal, das Schlimme, das sie bringen, hinnehmen. Beten, einfach beten, weiter beten. Vielleicht, das sagen sie nicht laut, die Leute aus dem Sarntal, aber sie ahnen, vermuten, flüstern es, immer schon, vielleicht sind die Jöchlerinnen die Strafe Gottes. Gottes Strafe und Teufels Beitrag für alles, was sie selbst, die Sarnerinnen und Sarner, über die Jahrzehnte und Jahrhunderte so alles angestellt haben. Für alles Schlimme, Schreckliche, Unverzeihliche, das sie stets, dem eigenen Gewissen zur Erleichterung, den Jöchlerinnen untergeschoben haben.
Iss so, hatte sie in einem ihrer unzähligen Bestseller einmal geschrieben, als ob jeder Bissen dein letzter wäre. Der letzte Bissen ihres Lebens nun bestand aus feinster Wildhasenpastete auf einem Tannenzapfenchip, gekrönt von einer Walderdbeere, die wiederum mit drei Tröpfchen Bärlauch-Espuma garniert war.
Sie schloss die Augen, so wie sie das immer tat. Sie versuchte, alles auszublenden, doch es gab so viel auszublenden, ihr Leben war derart turbulent, alles ausblenden, das war ein Ding der Unmöglichkeit.
Vorgestern war sie noch in San Francisco gewesen, bei einer exklusiven Chardonnay-Verkostung, zuvor war sie eine Woche durch Japan gereist, um eine für sie persönlich organisierte Seminarreihe über antike Techniken der Sushi-Zubereitung zu besuchen, gestern hatte sie schließlich in der Nähe von Modena, in dem Dörfchen Rubiera, am Flüsschen Secchia, Station gemacht. Dort hatte sie den Chefredakteur der Frankreichausgabe ihres Gourmetmagazins Sette Forchette getroffen.
Sie hatten sich zu einem Mittagessen beim Ausnahmekoch Antonio Martin zusammengefunden, der in einer alten Scheune am Flüsschen, wo er auch geboren und aufgewachsen war, sein Gourmetrestaurant führte. Sie hatte mit Martin vor vielen Jahren einmal eine Affäre gehabt, kurz, leidenschaftlich, professionell, so wie sie es bevorzugte. Sie waren immer noch befreundet, sehr gut befreundet sogar, sie erzählten sich vieles, beinahe alles, hatten kaum Geheimnisse voreinander. Im Gegenteil. Sie teilten ein paar Geheimnisse, von denen sonst niemand wusste.
Martin hatte das Lokal leer räumen lassen und an diesem Tag keine anderen Gäste hereingelassen, geschlossene Gesellschaft, dabei hatte sie ihm, diesem liebenswerten Nervenbündel von Spitzenkoch, doch vorab extra, weil sie es schon ahnte, ausrichten lassen, dass er ihretwegen bitte nicht das gesamte Lokal auf den Kopf stellen möge. Sie hatte dann selbst noch einmal angerufen, um zu unterstreichen, dass er sich – Antonio, mein lieber Antonio, ich bitte dich, dio mio!, beim Leben meiner Hunde, große Gourmetkritikerinnenbitte – bloß keine Umstände machen sollte. Er hatte nicht auf sie gehört.
Nun also war sie im Sarntal. Endlich wieder. Dass sie die Konsistenz dieses Chips stets genossen hatte, dachte sie noch. Gleichzeitig verschmolz sie mit der von ihr vor Jahren entwickelten Schmatztechnik, die sie in einem ihrer Bestseller – Die Kunst des Kauens – beschrieben hatte. Der Tannenzapfengeschmack mit dem Gusto der feinen Wildhasenpastete und dem Hauch Waldbärlauch. Mit der Zunge drückte sie die weiche Walderdbeere gegen die Innenseite der Schneidezähne, sie spürte, wie der Saft der Erdbeere auf das Gemisch aus Bärlauch, Tannenzapfen und Wildhase tropfte. Sie hoffte, etwas zu schmecken, und ja, für den Bruchteil einer Sekunde war ihr, als schmeckte sie tatsächlich etwas. Alles in ihr bebte, das waren stets die Momente gewesen, für die sie lebte, die Momente des absoluten Glücks, das sie beinahe nur noch hier verspürte. Nur noch so selten.
Doch dann, innerhalb von Sekundenbruchteilen spürte sie, dass etwas nicht stimmte. Erst dachte sie, dass es mit einer der Zutaten zu tun haben musste, die sie soeben geschluckt hatte, vielleicht war eine nicht von bester Qualität, oder … Sie hatte solche Angst, den Gedanken zu Ende zu denken. Sie schaffte es auch nicht.
Denn ihr wurde nun schwindelig, sie versuchte aufzustehen, sich am Stuhl festzuhalten, griff daneben, wankte leicht, drehte sich halb. Wankend sah sie noch einmal durch die bodentiefe Fensterfront auf die Lichtung hinaus, die den Blick über das Tal freigab. Am Horizont schimmerten die Dolomitengipfel in der prallen Mittagssonne, der Schlern, der Rosengarten, das Weißhorn, die Marmolata. Ihr blieb kurz die Luft weg, ob der Schönheit. Aus kurz wurde lang. Sie japste, schnappte, nichts, kein Sauerstoff, der Blick verschwamm, von rechts sah sie eine Gestalt herbeieilen, dann eine zweite, sie verlor jegliches Zeitgefühl, erkannte gerade noch die Gesichtszüge der Chefköchin, Hedi, auf die sie einst eine Hymne verfasst hatte.
Dann wurde ihr schwarz vor Augen. Hedis Stimme klang gedämpft, wie aus einer fernen Welt.
»Signora Manfredi …«
Sie duzte ihre Lieblingsköchinnen und Lieblingsköche stets, von denen ihr viele zu Freundinnen und Freunden geworden waren. Diese aber siezten sie weiterhin, eine Carla Manfredi duzte man nicht. Auch nicht, wenn man sie eine Freundin nannte, und selbst dann nicht, wenn sie vor einem zusammenbrach, nicht mehr atmete, nur noch zitterte, Schaum im Mundwinkel.
War es das nun? War das ihr Ende? Hier im Tan, in diesem göttlichen Waldrestaurant? Ein paar verwirrte Erinnerungsfetzen folgten: das Gesicht eines der Sushi-Köche im japanischen Hinterland nahe Nagano. Die intensive Farbe des ganz vorzüglichen 2009er The Judge Chardonnay aus dem nördlichen Napa Valley. Der Blick auf das Flüsschen Secchia, die Ebene, den Nebel. Antonios noch schlaftrunkene Augen, sein ungekämmtes Haar, seine letzten Worte, die allerletzten. Sie verstand. Nun verstand sie. Er hatte sie immer geliebt. Er hatte stets alles für sie getan. Alles.
Sie dankte ihm, dann froren die Gedanken ein. Sie spürte es regelrecht. Es war also wohl doch nicht so, dass das ganze Leben an einem vorbeizog, keine Kindheitserinnerung, keine Erinnerung an die Eltern, denen sie ihr Leben lang nicht verzeihen konnte, dass sie nicht an sie geglaubt hatten. Hirnstillstand, nur die Ohren hörten noch das Winseln ihrer beiden Hunde, die stets, darauf bestand sie, unter dem Tisch sitzen durften, während sie speiste.
Dann war da nichts mehr. Carla Manfredi wurde achtundfünfzig Jahre alt. Sie hinterließ das bedeutendste Gourmetmagazin der Welt, eine Wohnung in der römischen Via dei Condotti mit Blick auf die Spanische Treppe, ein geschätztes Vermögen von rund dreißig Millionen Euro, ein Bankschließfach mit Goldschmuck im Wert von rund 1,2 Millionen, einen Bentley, cremefarben, Baujahr 1972, einen Afghanischen Windhund und einen Volpino Italiano, die beide, so lautete das Gerücht, ihr Hundefutter nur anrührten, wenn es vorab mit feinstem, kalt gepresstem sizilianischem Olivenöl garniert und mit zweiundsiebzig Monate gereiftem Parmesan untermischt worden war.
26. August
1
Es war nun bereits über ein halbes Jahr her, doch Grauner hatte sich all die Wochen und Monate nicht überwinden können, hierherzukommen. Er sah sich um, Silvia Tappeiner, seine Assistentin, hatte ihm erklärt, wo es ungefähr lag. Sie war anfangs jeden Tag hier gewesen, das wusste er, und auch jetzt noch kam sie mindestens einmal die Woche vorbei.
Mit dem Tod eines Kollegen ging jeder anders um. Man musste jedem seine Art der Trauer, der Bewältigung, des Verdrängens, des Friedenschließens mit dem Unumkehrbaren lassen.
Commissario Johann Grauner, der nicht nur Kommissar bei der Mordkommission in Bozen war, sondern auch Viechbauer, auf einem Hof hoch über dem Eisacktal, musste verdrängen, um wenigstens tagsüber für ein paar Stunden Frieden zu finden. Denn im Schlaf holten ihn die Dämonen wieder ein. Nacht für Nacht, seitdem es passiert war, Anfang des Jahres. Der Tod eines engen Kollegen war das Schlimmste, was einem Polizisten geschehen konnte.
Ja, die Dämonen waren wieder da. Auch die altbekannten Rückenschmerzen waren zurück. Ein paar Jahre waren sie weg gewesen. Oder waren es neue, andere Rückenleiden? Er hatte seine früheren Schmerzen stets auf den körperlichen und seelischen Stress zurückgeführt. Ein paar Jahre, es war die Zeit, in der er den Mord an seinen Eltern aufgeklärt glaubte, hatte er eine unerwartete, wohltuende rückenschmerzfreie Leichtigkeit erlangt, doch das war nun wieder vorbei. Vielleicht waren diese neuen Schmerzen, so überlegte er, während er zwischen den Grabsteinen des Friedhofs von Bozen umherirrte, kein Zeichen von Stress, sondern vielmehr seines voranschreitenden Alters. War es das also schon wieder, mit dem unbeschwerten Leben?
Grauner unterdrückte einen Fluch, hob nur böse die Faust zum Himmel. Er schaute sich um, sah alte Frauen und alte Männer zwischen den Gräbern umherschleichen. War er jetzt einer von denen, die es zum Friedhof zog, um sich schon mal umzusehen, weil das ewige Friedhofsdasein Tag für Tag näher kam? Aber nein, verwarf er den Gedanken, er war ja nicht deshalb hier.
Er hatte geweint, als es geschehen war, seine Frau und seine Tochter waren bei ihm gewesen. Bei der Arbeit musste er stark sein, für seine Mitarbeiter da sein. Er hatte bei den Begräbnisvorbereitungen mitgeholfen. Solange es etwas zu tun gegeben hatte, war es ihm gelungen zu verdrängen.
Er hätte eigentlich gar nicht hier, in Bozen, begraben werden sollen. Doch dann stellte sich heraus, dass die Raten für das Grab seiner Familie schon seit Jahren nicht mehr bezahlt worden waren. Niemand hatte sich darum gekümmert. Das Grab war ausgehoben, die Knochen der Ahnen waren beseitigt und neue, fremde Tote ins Grab gelegt worden.
Grauner und Tappeiner hatten sich der Sache sofort angenommen, ein unbelegtes Grab gekauft und alles Weitere veranlasst.
Doch je näher der Tag des Begräbnisses gekommen war, der Moment, in dem man einfach still dasteht, den soeben noch lebenden, lachenden, glücklichen Kollegen im Sarg weiß, den Sarg in der Erde verschwinden sieht, desto schlimmer wurde alles.
Nein, er hatte beim Begräbnis nicht dabei sein können. Es war einfach nicht gegangen. Er hatte es einfach nicht geschafft. Er habe die Grippe, hatte er am Telefon gelogen und ob der tumben Lüge hatten ihn tatsächlich sofort Fieberschübe und Schüttelfrost heimgesucht. Er hatte sich tagelang mit Schuldgefühlen im Bett gewälzt. War er schuld am Tod des Kollegen? Die Antwort darauf war immer gleich. Er war der Vorgesetzte gewesen. Niemand hatte ihn beschuldigt. Nur er selbst fühlte sich schuldig. Irgendwie. Sie beide hatten anfangs ihre Schwierigkeiten miteinander gehabt, waren sich über die Jahre dann aber nähergekommen. Jüngere Kollegen sollten niemals vor ihrem Chef sterben. Nie!
Er zog das Handy hervor, scrollte zur Nachricht von Tappeiner, in der sie ihm den Standort des Grabs beschrieben hatte. Er vermutete bereits, dass ihn sein Unterbewusstsein hier so hilflos herumirren ließ, weil es ihn nicht an diesem Grab stehen haben wollte. Ihn nicht den schlichten Grabstein, das darauf angebrachte Foto erblicken lassen wollte. Das junge Gesicht, das bübische Lächeln. Nicht den Namen …
Aus dem Augenwinkel sah er, wie das Handy aufleuchtete. Er hatte den Klingelton, wie immer, ausgemacht. Auch das Vibrieren. Tappeiner. Er rang mit sich, hob schließlich verärgert ab. Sie schoss los, ohne Begrüßung. Er wusste, was das bedeutete.
»Wo?«, fragte er nur. Dann legte er auf. Und machte kehrt.
2
»Wo?«, fragte er, »wo ist er?«
Sie schaute verlegen zu Boden. Schaute auf das Chaos. Am Anfang hatte sie ein paarmal für ihn aufgeräumt, auch für ihn gekocht, sie hatte ihn bemuttert, hatte es gerne getan, doch irgendwann hatte sie beschlossen, dass es aufhören musste. Nur wenn sie aufhörte, würde er wieder in die Selbstständigkeit zurückfinden.
Dachte sie. Hoffte sie. Irgendwie.
»Bei ihm?«, fragte er weiter.
Sie nickte.
Nun schaute er zu Boden. Ebenso verlegen. Schweigend. Es war nun ein halbes Jahr her, dass er tot war, sie hatten immer noch keinen Weg gefunden, darüber zu reden. Da war nur Schweigen. Gemeinsames verlegenes Schweigen. Vielleicht musste das so sein, dachte sie.
Sie hatte anfangs jeden Tag am Grab gestanden. Noch heute, ein halbes Jahr später, stand sie jede Woche einmal da. Sie legte frische Nelken hin. Sprach zu ihm. Piero war tot. Piero Marché, Sovrintendente della Polizia di Stato.
Es war alles so schnell gegangen. Er hatte zwei Schüsse abbekommen. Einen Lungendurchschuss, einen Schuss in den Bauch. Er hatte sofort zurückgeschossen und musste Igor Koloff getroffen haben, der Krankenhausflur war mit dessen Blut bedeckt gewesen. Koloff hatte es nicht in Saltapepes Zimmer geschafft, die Spurensicherung hatte rekonstruieren können, dass er über die Feuertreppe geflohen war, vor dem Eingang der Notaufnahme hatte die Blutspur geendet.
Er wurde drei Wochen später aus der Moskwa gefischt. Kehle durchgeschnitten. Igor Koloff, genannt Иису́с, war tot. Und seine Verlobte, Cleo Garebani, ebenso. Erschlagen in ihrer Einzelzelle. Wohl von Inhaftierten anderer Camorra-Clans und mithilfe korrupter Aufseher, welche die Mörder zu ihr gelassen hatten. Der Garebani-Clan war am Ende. Saltapepe in Sicherheit. Vor ihnen. Aber nicht vor sich selbst.
Piero Marché war als Held gestorben. Er hatte nicht leiden müssen. Vielleicht würde ihnen das ein bisschen Trost spenden, irgendwann. Er war gestorben, um ihn zu retten. Sie drehte sich zu Claudio. Sein Gesicht war finster, seine Schläfen ergraut, er sah, ein halbes Jahr später, zehn Jahre älter aus. Aus dem Krankenhaus war er nach wenigen Wochen entlassen worden, die körperlichen Wunden waren verheilt, die seelischen nicht. Er hatte wochenlang nicht geredet, seine Wohnung nicht verlassen, er hatte Schreianfälle bekommen, wenn sie die Vorhänge beiseitegeschoben oder die Fenster geöffnet hatte.
Sie war manchmal die Nacht über bei ihm geblieben. Aus Angst, er würde alles beenden wollen. Es durfte nicht zu Ende sein. Er musste wieder zu sich finden. Zu ihnen finden. Sonst wäre Pieros Tod umsonst gewesen.
Als der Frühling verging und der Sommer kam, wurde es etwas besser. Er kochte manchmal, für sich oder für sie beide. Meistens Pasta al Pomodoro. Wenig Knoblauch, viel Olivenöl, etwas Basilikum. Es war die beste Pasta, die sie bis dahin gegessen hatte.
»Außerirdisch gut«, hatte sie gesagt.
Er hatte gelächelt. Es war das erste Mal seit Monaten, dass sie ihn hatte lächeln sehen.
»Du müsstest die Pasta al Pomodoro meiner Mutter kosten, Silvia«, hatte er geantwortet, »die schmeckt wirklich wie von einer anderen Welt.«
Sie strich ihm übers Haar, sprang auf, zog die Vorhänge beiseite, öffnete die Fenster, die warme, etwas stickige Augustluft drang ins Innere. Auch das Hupen der Autos, das Quietschen der Reifen, das Rattern eines Zuges, der den Eisack entlangraste. Der Bozen-Lärm.
»Steh auf, Claudio. Komm mit in die Questura!«
Es war vor drei Wochen gewesen, da hatte er es endlich bis ins Treppenhaus geschafft, auch hinaus, ein paar Schritte die Straße rauf und runter. Dann rüber zum Eisack, die Promenade entlang. Zum Bäcker, zum Gemüsehändler, in ein Café, eine Pizzeria. Doch weiter war er nicht gekommen. Der Polizeipsychologe war zweimal bei ihm gewesen. Ein drittes Mal hatte er ihm nicht mehr aufgemacht. In der Questura war er seit Januar nicht mehr aufgetaucht.
»Geh, Silvia«, er winkte ab, schloss die Augen, zog die hellblaue Bettdecke hoch. »Grüß mir den Grauner schön.« Dann verschwand er unter der Decke, auf der das Vereinslogo des SSC Napoli abgebildet war.
3
Es war kaum Verkehr in Bozen. Über dem Talkessel hing eine dicke, muffige Hitzeglocke. Die Stadt war wie leer gefegt. Ihre Einwohner hatten sich hinter den geschlossenen Fensterläden ihrer Wohnungen verkrochen, oder sie hatten es den Touristen gleichgetan und waren in die Täler, auf die Berge und an die Seen geflüchtet.
Der Asphalt dampfte, auf den Talferwiesen war das Gras verbrannt, der Wasserstand der Talfer war auf einem Rekordtief, das Schmelzwasser des Winters längst aus dem Sarntal hinausgeflossen. Selbst in der Mitte des Baches ragten bereits einige größere Steine aus dem Wasser. Am Rande des Bachbetts waren Sandbänke zum Vorschein gekommen, auf denen sich vereinzelt Bozner dem Sonnenbad hingaben.
Grauner lenkte den Panda die Straße entlang ins Sarntal hinein, die Fahrbahn durchzog die Sillschlucht, die sich hinter Bozen auftat, ihre Felsen ragten steil und von den Gezeiten der Jahrtausende flach geleckt in die Höhe, Tunnel taten sich auf, zwischen den Tunneln ging es neben der Straße steil die Schlucht hinab, nur die Leitplanke trennte Fahrbahn und Abgrund.
Schnell hatte er die große Stadt hinter sich gelassen, tat sich eine völlig neue Welt vor ihm auf. Grauner öffnete das Fenster einen Spaltbreit, drehte die Klimaanlage zurück und Mahlers Fünfte weiter auf. Er hatte eine Weile genug gehabt von Mahler, hatte es kurz mit Brahms versucht, dann mit Kammermusik, dann mit Wagner, schließlich, wenn auch nur etwa zehn Minuten lang, mit Alban Berg, vergebens. Er hatte sich von Sara das neue Album von Beyoncé andrehen lassen. Sara hörte schon länger kein Heavy Metal mehr. Sie hörte nun Pop. Harry Styles. Billie Eilish. Beyoncé. Mit den ersten beiden konnte er nicht viel anfangen, aber Beyoncé gefiel ihm gar nicht so schlecht. Er hatte das Album einen Nachmittag lang den Kühen vorgespielt. Wenn auch mit schlechtem Gewissen seinem Mahler gegenüber.
Er hatte sich am nächsten Morgen beim Melken nicht getraut, von der Milch zu kosten, er hätte es nicht ertragen, hätte sie genauso gut geschmeckt wie nach der Mahler-Beschallung. Oder besser gar. Natürlich wusste er nicht, ob Mahler die Kühe bessere Milch geben ließ. Aber er wollte es eben glauben. Das reichte doch manchmal im Leben. Sich selbst ein bisschen belügen, sich selbst ein bisschen verschaukeln, das musste doch erlaubt sein, oder? Er jedenfalls gestattete es sich.
Er wünschte sich noch ein paar schöne, sorglose Arbeitsjahre, dann die Pension. Glücklich mit Alba, seiner Frau. Wissend, dass Sara, seine Tochter, sehr bald irgendwo erfolgreich studieren würde. Sie wollte weg. Er hatte damit seinen Frieden gemacht. Er hatte schließlich verstanden: Es gab nur eine einzige, kleine Chance, dass sie den Hof eines Tages doch übernehmen würde. Wenn er sie heute ziehen ließ. Nur dann würde sie morgen, irgendwann, vielleicht, er hoffte es so sehr, zurückkehren. Er musste sie gehen lassen, um sie nicht zu verlieren.
Alba hatte ihm diese Taktik nahegelegt. Ihm, dem Taktiker. Doch im Privaten war ihm Taktik fremd. Privat platzte immer alles sofort aus ihm heraus. Alles Gefühl, alles Verlangen. Er konnte nicht anders. Er wollte nicht anders. So war er, so mochte er es, so liebte ihn seine Frau, so, er ahnte, hoffte es, liebte ihn auch seine Tochter.
Die kühle Luft umfing nun sein Gesicht, er schaute auf die Wiesen, die hier im Sarntal selbst im August noch saftig waren, er schaute auf die Kühe, die genügsam grasten, mit dem Schwanz die Fliegen verscheuchten, ins scheinbare Nichts glotzten. Gott, wie er diese Tiere liebte, wie er sie verehrte, ihren unbeirrbaren Stoizismus, da konnte man sich noch so viele Philosophen der Stoa zu Gemüte führen, Panaitos, Seneca, Aurel und wie sie alle hießen, er hatte manche von ihnen flüchtig studiert in seiner Jugend – keiner von ihnen, so weise sie auch waren, konnte ihm so viel geben wie das Beobachten einer Kuh.
Über den Wiesen lagen die Wälder, über den Wäldern die Felsen, über den Felsen die Gipfel, und darüber leuchtete die buttergelbe Sonne am wolkenlosen Himmel. Grauner sog gierig die Würze des Kuhmists ein, der sich fein in die Frischluft mischte, er erreichte den Hauptort des Tals, Sarnthein, lenkte den Panda durch die engen Gassen, musste einem Traktor Platz machen, dann einem Bauern, der seinen Ochsen spazieren führte.
Vor der Bar saßen ein paar Männer. Weingläser in der Hand. Einer rauchte Zigarre, ein zweiter Pfeife, einer hatte sich hinter dem Südtirol Kurier versteckt. Grauner hatte vor ihnen gehalten, aufgewirbelter Dorfstaub legte sich auf die Windschutzscheibe. Sie taten einige Sekunden lang so, als bemerkten sie ihn nicht. Nur langsam, gemächlich, herablassend drehten sich zuerst der eine, dann ein zweiter, schließlich auch der mit der Zeitung zu ihm hin.
Dorfstolz. Der Commissario liebte es. Die Sarner waren besonders stolze Talmenschen. Von den Boznern wurden sie als Hinterwäldler verlacht. Sie wiederum lachten nicht über die Bozner, ignorierten sie vielmehr, was viel schlauer und stolzer war. Insgeheim fragten sie sich wohl, wie blöd diese Bozner sein mussten, da draußen im Hitzekessel zu leben, wo doch hier drinnen im Tal die Welt das Paradies war.
Grauner fragte nach dem Restaurant Tan, er hatte schon einige Male von dem Lokal gehört, ihm war bekannt, dass es ein ganz besonderes sein sollte, weltbekannt, doch er hatte keine Ahnung, wo genau es sich befand, und das, obwohl er sich im Sarntal gar nicht mal so schlecht auskannte. Schon manches Mal war er hier gewesen. Zum Wandern und Skifahren, zweimal beruflich.
Einmal war es ein Fehlalarm gewesen. Ein Bauer hatte aufgeregt die Polizei gerufen. Jemand habe seine Bäuerin entführt, umgebracht wahrscheinlich. Doch dann hatte sich herausgestellt, dass die Bäuerin schlicht keine Lust mehr auf ihren Bauern gehabt und einen anderen gefunden hatte. Den Dorfmechaniker. Ermittlung eingestellt.
Der zweite Einsatz war kein Fehlalarm gewesen. Ein Tischlerlehrling hatte seinen Tischlermeister erpresst. Der Meister hatte mit Marihuana gedealt, er hatte im Wald von Pens, unterhalb des Penser Jochs, eine kleine Plantage bewirtschaftet. Die Ware ließ er seiner Kundschaft in ausgehöhlten Holzpellets zukommen. Der Lehrling wollte ins Geschäft einsteigen. Fifty-fifty. Sonst, so drohte er, würde er alles dem Bürgermeister verraten. Als der volltrunkene Meister den Lehrling daraufhin packte, ihn zur Holzschneidemaschine zog und die Maschine anmachte, erklärte sich der Lehrling bereit, sich eventuell mit zwanzig Prozent zufriedenzugeben. Dann schrie er nur noch. Zuerst um Hilfe. Dann um seine rechte Hand, die auf den mit Holzspänen übersäten Tischlereiboden fiel. Dann um seine linke, dann verstummte er. Für immer.
Die stolzen Männer schauten zu Boden, ganz verlegen erschienen sie Grauner plötzlich, nur ab und an sahen sie auf und warfen ihm einen feindseligen Blick zu, aber da war auch noch etwas anderes, eine Mischung aus Neugierde und Schauder. Der eine hatte sich schließlich wieder hinter der Zeitung versteckt, ein anderer zeigte zögerlich eine der Straßen entlang.
»Da«, sagte er, »immer da entlang, zum Dorf hinaus, die Wiesen hoch, in den Wald hinein.«
Ein Weiterer trat etwas näher an Grauners Panda heran, bückte sich zum Fenster hinab, kniff die Äuglein zusammen. Starrte ihn an. Grauner starrte zurück. Blicken standhalten, das konnte er. Das hatte er ein Leben lang geübt. Ganz am Anfang seiner Polizeikarriere tat er sich schwer damit, sah weg, sobald ihn einer anstarrte. Ein Zeichen der Schwäche, das lernte er bald. Dann übte er. Zuerst im Schlafzimmer, vor dem Spiegel. Dann im Stall. Mit Marta, Mitzi, Margarete, Bella, Burgunda, Lisbetta, Johanna, Marianna, Kunigunda. Als selbst der Ochs, Blacky, den er einst hatte, zuerst zu Boden blickte, da wusste er, jetzt konnte er es.
Er betrachtete das Gesicht des alten Mannes. Ein Bauer wohl. Viechbauer. So wie auch er einer war. Nur Viechbauern stand das Leben so sehr ins Gesicht gezeichnet, die Natur, die harte Arbeit. Tiefe Furchen durchzogen die von der Sonne gegerbten Wangen. Die Augenbrauen standen wild, wie von einem Stromschlag zerzaust, in alle Richtungen ab, die Lippen waren beinahe schwarz.
»Fremder!«, krächzte der Mann schließlich. »Wenn ich Sie wäre, würde ich nicht da hochfahren. Ich würde umdrehen, wieder nach Bozen hinausfahren.«
Die Männer im Hintergrund nickten. Grauner hob eine Augenbraue.
»Weil da oben das Böse ist«, fuhr der Mann fort und kam noch ein bisschen näher, verschwörerischer, gut gemeinter Blick jetzt. »Weil es wohl wieder so weit ist. Weil das Böse gewütet hat. Die Polizei ist schon hoch, vor einer Stunde etwa. Doch da oben ist alles verloren. Weil das immer schon so war.«
»Alles verloren«, grummelte einer der Männer aus dem Hintergrund.
»Jetzt hilft nur noch beten. Wenn überhaupt«, murmelte ein anderer.
»Das Böse, das Böse …«, flüsterte Grauner mehr in sich hinein. Dann schmunzelte er. Die Männer hatten keine Ahnung, wer er war. Sie hatten keine Ahnung, dass er immer dahin musste, wo das Böse war, wo Böses geschehen war.
Das Dorf Sarnthein verschwand im Rückspiegel, die Sandstraße führte ihn in Schlangenlinien den Hang empor und an einer saftigen Wiese entlang. Die Kühe drückten sich in die matten Schatten der Fichten und Tannen, bald führte auch der Weg in den Wald hinein. An einem Zaun, der die Wiese von den Bäumen trennte, entdeckte Grauner ein kleines Holzschild, das einen Pfeil bildete. Drei eingeritzte Buchstaben darauf.
»Tan«, flüsterte er.
Alles um ihn verdunkelte sich. Das grüne Geflecht ließ die Augustsonne nicht in den Schatten des Waldes stechen. Der Duft war betörend. Es roch nach trockenem Harz, feuchtem Holz, nach frischer Erde. Nach Glück. Erneut wand sich die Straße in engen Kurven in die Höhe, dann tat sich eine Lichtung auf. Er sah das blaue Blinken der Polizeiwagen, sah Polizisten und Mitarbeiter der Spurensicherung hastig umherlaufen und zwischen den Bäumen einen kleinen quadratischen Holzkubus mit einer großen Glasfensterfront nach Süden hin.
Grauner bremste, neben den Polizeiwagen entdeckte er einen alten cremefarbenen Bentley. Er wusste, dass manche Menschen beim Anblick von Oldtimern von Glücksgefühlen übermannt wurden. Bei ihm war das nicht so. Er hatte sich heute sowieso kein Glücksgefühl verdient, fand er. Schon beim Losfahren hatte ihn das schlechte Gewissen ereilt, denn kurz war er froh gewesen, dass Tappeiner ihn angerufen hatte. Froh darüber, umkehren zu dürfen, nicht an Marchés Grab treten zu müssen. Sein Tod lastete so schwer, erdrückte ihn beinahe. Er hoffte, ein neuer Fall, dieser Fall, würde alles besser machen. Er verfluchte sich selbst, seine Gedanken. Was für eine böse, böse Hoffnung.
4
Die Dame, die selbst jetzt, tot, noch immer nobel und elegant aussah, lag rücklings auf dem Boden. Sie wirkte wie einbalsamiert. Ihre Haare waren etwas altmodisch geföhnt, überhaupt konnte man meinen, sie käme aus einer anderen Zeit. Sie trug einen violetten Seidenblazer, eine eierschalenfarbene, befleckte Seidenbluse und ein dünnes Goldkettchen um den Hals. Grauner glaubte, in der Form des goldenen Anhängers eine Gabel erkennen zu können.
Die Tote trug eine schwarze Hose, ihre Füße steckten in dunklen Strümpfen, die ebenfalls eierschalenfarbenen Stöckelschuhe hatte wohl einer der Männer von der Scientifica, wie die Spurensicherung in Italien genannt wurde, ordentlich neben ihr aufgestellt. Ein schlichter Holzstuhl lag umgekippt neben der Frau und den Schuhen.
Grauner blickte die Umstehenden an, Silvia Tappeiner, seine Assistentin, Max Weiherer, den Chef der Scientifica, und Staatsanwalt Martino Belli, seinen Vorgesetzten. Tappeiner nickte ihm zu, Weiherer ebenso. Belli schielte auf den gedeckten Tisch, neben dem die Tote lag.
Die weiße Tischdecke war unbefleckt. Silberbesteck lag neben dem halb leeren Teller. Grauner konnte nicht genau erkennen, was sich darauf befand. Viel war es nicht. Zwei kleine Törtchen. Eines ganz. Eines umgestürzt, halb gegessen. Von dort, wo die Ermittler standen, und auch vom Tisch aus bot sich ein atemberaubender Blick in die Ferne. Über die Wälder hinweg, hinunter zu den Wiesen, auch die in der Sonne glitzernden Dächer von Sarnthein waren zu erkennen. Weiter im Süden, hinter dem Taleingang und noch hinter Bozen, war sogar das weiße Schimmern der Dolomiten zu sehen.
Grauner ließ das Panorama auf sich wirken, dann schaute er wieder auf den Tisch und auf das halb verzehrte Gericht. Der Commissario aß am liebsten in seiner Stube und am liebsten das, was ihm seine Alba kochte.
Vor vielen Jahren hatte er sich in den Kopf gesetzt, nun auch einmal das Kochen zu erlernen, so schwer konnte das doch nicht sein. Seine Alba half ja schließlich auch im Stall mit, warum sollte er dann nicht, als Gegenleistung sozusagen, in der Küche Hand anlegen.
Er überraschte sie einmal, eines Abends. Gedeckter Stubentisch. Kerzenlicht. Dieses undefinierbare Etwas auf den Tellern, das laut Rezept leckere Löwenzahnnocken sein sollten. Sie war wirklich tapfer an jenem Abend, aß gut die Hälfte der Nocken. Spülte jeden Bissen mit reichlich Lagrein hinunter. Sie bemerkte wohl, wie viel Mühe er sich gegeben hatte. Sie war die tollste Frau, die er sich nur vorstellen konnte.
»Herr Johann Grauner«, flüsterte sie ihm im Bett vor dem Einschlafen ins Ohr. Herr Johann Grauner, so nannte sie ihn nur, wenn es ihr wirklich ernst war. »Mein lieber Herr Johann Grauner, ich liebe dich wirklich sehr, alles, na ja, fast alles an dir liebe ich. Ich will für den Rest meines Lebens mit dir zusammen sein, aber bitte, bitte, bitte überlasse das Kochen mir.« Er war beleidigt, versuchte, es nicht zu zeigen, ahnte, dass sie es trotzdem sah. Er kochte seitdem nie mehr.
Er sah nun, wie sich Staatsanwalt Belli dem gedeckten Tisch näherte, interessiert das Gericht begutachtete. Grauner wunderte sich, dass sich um sie herum nur dieser eine Tisch befand. Das war doch ein Restaurant hier, wo saßen die restlichen Gäste? Hier hatte doch, so schätzte er, mindestens ein Dutzend Tische Platz.
Belli beugte sich immer tiefer über den Teller, schnupperte, schaute sich um, schien nach dem Törtchen greifen zu wollen, zögerte. Klar, dachte sich Grauner, dass sich der Herr Staatsanwalt bei einem Fall in einem Restaurant mehr fürs Essen als für das Opfer interessierte. Er schaute zu Weiherer, der sich gleich vergessen würde, dessen war er sich gewiss. Irgendetwas anfassen an einem von ihm zu untersuchenden Tatort, Todsünde.
»Herr Staatsanwalt, bei allem Respekt, lassen Sie …« Weiherer sprach überraschend kühl und ruhig.
»Ja, ja, Weiherer, ich weiß schon. Nichts anfassen. Spuren … bla, bla, bla … aber ich kann doch nicht diese Köstlichkeit … es wäre doch eine Schande, diese Köstlichkeit hier …«
Weiherer trat nun ebenso an den Tisch, nahm den Teller in die Hand, die in einem dünnen Plastikhandschuh steckte, hob ihn hoch.
»Es geht mir nicht nur um die Spuren, Herr Staatsanwalt.«
Belli schaute überrascht.
»Es geht mir um Ihr Leben.«
Weiherer senkte den Teller wieder, deutete dann auf die Törtchen. »Wir vermuten, dass diese Dame vergiftet worden ist.«
Sofort wanderten alle Blicke zum Teller. Belli erblasste, trat drei Schritte zurück, stolperte beinahe über den umgekippten Stuhl.
»Wie kommt ihr zu der Annahme?«, fragte Grauner überrascht. So kannte er den Chef der Spurensicherung gar nicht. Weiherer war keiner, der Vermutungen äußerte, keiner, der sich in die Belange von Kollegen einmischte. Ob jemand vergiftet wurde oder nicht, das festzustellen, war nicht Aufgabe der Spurensicherung. Das machte die Gerichtsmedizin. Außerdem: Wie wollte er das so schnell, noch hier vor Ort, festgestellt haben? Dafür musste die Leiche obduziert werden. Und das würde dauern. Mindestens eine Nacht.
»Vielleicht hat sich die Dame einfach verschluckt«, der Commissario hob die Schultern.
Weiherer schüttelte den Kopf. »Ich habe mir erlaubt nachzusehen«, er öffnete den eigenen Mund, deutete mit dem Zeigefinger hinein, dann auf die Leiche, »wir haben keine Speisereste gefunden. Weder in der Speiseröhre noch in der Luftröhre.«
Grauner schaute zur Toten, die wirkte, als schliefe sie friedlich. »Vielleicht hatte sie einen Herzinfarkt.« Grauner überlegte, er konnte sich an keine Frau aus seinem Bekanntenkreis erinnern, die jemals einen Herzinfarkt erlitten hatte. Herzinfarkte waren eher Männersache. Aber ausgeschlossen war es ja wohl nicht.
Tappeiner räusperte sich. »Grauner, nach dem, was uns der zum Todeszeitpunkt anwesende Kellner erzählt hat, sah es auch nicht nach einem Herzinfarkt aus. Auf dem Teller haben sich laut dessen Aussage drei Pastetentörtchen befunden. Die Dame habe eines gegessen, vom zweiten probiert, dann sei sie plötzlich vom Tisch aufgestanden, habe sie nach Luft geschnappt, sich nicht an die Brust gefasst, sondern ihren Hals umklammert, schließlich sei sie zu Boden gefallen, röchelnd, mit Schaum vor dem Mund, dann war sie tot.«
»Vielleicht war sie ja auch gegen eine der Zutaten allergisch«, warf Grauner hinterher. Er blickte weiterhin skeptisch drein.
Tappeiner blieb stumm, schaute nur ernst. Grauner kannte diesen Blick. Sie winkte ihn zu sich heran, drehte sich dann um und ging voran. Alle folgten ihr. Sie gingen nicht zurück zur Eingangstür, sondern zu einer zweiten Tür, Tappeiner öffnete sie, schritt weiter voran, hinaus ins Freie, auf ein kleines Wiesenstück hinter dem Haus. Am Ende der kleinen Wiese begann der Wald.
Zwischen den ersten großen Bäumen stand, Grauner rieb sich die Augen, doch ja, er sah ganz recht, eine Küchenzeile aus massivem Stein. Daneben entdeckte er eine Feuerschale aus Bronze. An einem Baum stapelte sich Brennholz. Auf der anderen Seite des Baumes standen zwei Polizisten. Neben ihnen lagen zwei Hunde, ein großer schlanker, ein kleiner wuscheliger. Sie rührten sich nicht. Grauner war sofort klar, sie waren tot.
»Jetzt noch mal schön von vorne«, sagte der Commissario und blickte in die Runde, »wer ist die Tote? Was ist passiert? Was machen diese beiden toten Hunde hier? Und was ist das überhaupt für ein eigenartiges Restaurant mit nur einem Tisch und einer Küche im Wald?«
Wenige Minuten später hatte sich der Commissario einen vagen Überblick über die Geschehnisse verschafft. Tappeiner war mit einigen Polizisten als Erste am Tatort gewesen, sie hatte bereits kurz mit der Chefköchin und dem jungen Kellner des Tan sprechen können, welche die nun tote Dame bewirtet hatten. Die beiden hatten ihr den Namen der Toten mitgeteilt, Carla Manfredi, eine Gourmetkritikerin aus Rom.
»Manfredi ist nicht irgendeine Gourmetkritikerin«, war Staatsanwalt Belli geschwind dazwischengegangen, »Carla Manfredi ist die Gourmetkritikerin schlechthin. Sie ist die Chefredakteurin von Sette Forchette, das Tan zählt zu den weltweit wenigen Empfehlungen des Magazins. Seit Jahren versuche ich, hier zu speisen«, fuhr Belli fort, »aber um in diesen seltenen Genuss zu kommen, muss man sich auf eine Onlinewarteliste setzen lassen. Ich warte schon seit Ewigkeiten und habe bereits mit zahlreichen mir zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, mich auf der Liste weiter nach vorne zu schwindeln, aber nichts hat bislang geholfen. Noch nicht einmal Carlo Minestroni, mein guter Freund, Unterstaatssekretär im Gesundheitsministerium …«
»Warum speiste die Tote alleine hier?«, unterbrach Grauner den plappernden Belli, der nun ein Gesicht machte, als hätte der Commissario ihm die blödeste aller Fragen gestellt. Er genoss den seltenen Wissensvorsprung auf einem fallrelevanten Fachgebiet sichtlich und kostete diesen nun vollends aus.
»Commissario, Commissario, in welcher Welt leben Sie denn …«
Grauner spürte, wie sich die Wut in ihm zusammenbraute. Er mochte die Welt, in der er lebte, ganz gerne. Er musste in keine Scheinwelt fliehen, so wie Belli, der anscheinend bereits ganz vergessen hatte, dass sie gerade ermittelten.
»… eine Carla Manfredi isst immer alleine. Zumindest beruflich. Das ist in jedem Zeitungsartikel über sie nachzulesen. Ich habe sie alle gelesen. Verschlungen. Eine wie die Manfredi setzt sich doch nicht in ein voll besetztes Restaurant. Wobei, dass sie stets alleine isst … aß, stimmt so ganz auch wieder nicht. Genauer genommen isst sie zu dritt.«
Er drehte sich zu den beiden toten Hunden.
»Die essen … äh … aßen stets mit. Tja, ein Jammer. Die Hunde dürfen … äh … durften diese unnachahmliche Spitzenküche genießen, und ich hänge auf den hintersten Plätzen einer Warteliste, ein Skandal eigentlich, nicht? Ich meine ja nur …«
Grauner hörte ihm schon nicht mehr zu. Er hatte über all die Jahre gelernt, im Gespräch mit Belli auf Stand-by zu schalten, dessen Geplapper nur noch stückweise wahrzunehmen. Er drehte sich zu Weiherer und Tappeiner, sah, wie sich Belli sofort den beiden dabeistehenden Polizisten zuwandte und weiterplapperte.
»Die Hunde haben auch von dem Essen gekostet«, murmelte Grauner.
Der Spurensicherer und seine Assistentin nickten.
»Deshalb die Vergiftungsvermutung.«
Wieder das Nicken. Grauner verstand. Das leuchtete ihm ein. Er überlegte kurz, dann erteilte er Befehle.
»Weiherer, sobald ihr mit der Toten fertig seid, möchte ich, dass sie unverzüglich in die Gerichtsmedizin nach Bozen gebracht wird. Sie und ihre beiden Köter. Wir müssen schnellstmöglich wissen, ob sie tatsächlich allesamt vergiftet worden sind. Wer war zum Zeitpunkt des Todes hier anwesend?«
Er drehte sich zu Tappeiner.
»Nur die zwei bereits genannten Personen. Hedwig Jöchler, genannt Hedi. Dreiundvierzig Jahre alt. Sie ist die Köchin und Besitzerin des Lokals und arbeitete alleine hier in dieser Waldküche. Ihre Hilfsköche und Hilfsköchinnen kommen nur abends dazu. Auch die Servicebrigade hatte heute Mittag frei. Nur der eine Kellner war anwesend: Paolo Sensi. Beide, Jöchler und Sensi, sitzen drüben bei den Polizeiautos. Je zwei Beamte sind bei ihnen, auch ein Polizeipsychologe.«
Grauner machte sich wieder auf in Richtung des Holzquadrats, bog dann nach rechts ab, um an der Seite des Gebäudes, am Waldrand entlang, wieder nach vorne, zum Parkplatz zu gelangen. Die anderen folgten ihm. Schließlich drehte er sich noch einmal um und rief: »Tappeiner, ich möchte, dass du den Kellner, diesen Sensi, noch einmal ausführlich befragst. Ich kümmere mich um Hedwig Jöchler.« Dann schaute er zum Staatsanwalt, der immer noch plapperte. Er hoffte, Belli würde bald fertig sein. Er brauchte ihn noch.
5
Grauner hatte die Köchin noch etwas warten lassen, er hatte sich Belli noch einmal geschnappt, der, ganz seinen Gepflogenheiten widersprechend, den Tatort diesmal nicht bei der erstbesten sich ihm bietenden Möglichkeit verlassen hatte, um nach Bozen zurückzukehren und sich in den Garten des Laurin zu setzen, um dort bei Sekt, Fischvorspeisen und Schokokonfitüre den Nachmittag zu verbringen.
Vielleicht war der Staatsanwalt noch hier, weil es, im Gegensatz zu den angenehm kühlen Höhen des Sarntals, selbst im schattigen Hotelgarten in diesen Wochen zu stickig war.
Grauner hatte Belli wieder hinten am Waldrand entdeckt, wo die Küche stand. Die beiden toten Hunde waren inzwischen von den Spurensicherern weggebracht worden. Fast andächtig stand Belli da, die Augen geschlossen, tief ein- und ausatmend.
»Hier also …«, er musste Grauner gehört haben.
Der Commissario hatte absichtlich ein paar Ästchen unter seiner Stiefelsohle zum Knacken gebracht, um den Vorgesetzten auf sich aufmerksam zu machen.
»Hier also findet das Wunder statt.«
Grauner war längst klar, dass ihm Belli einiges über die Tote und die Köchin erzählen konnte. Er sträubte sich, aber er musste mehr aus ihm herausholen. Grauner war in den vergangenen Monaten deutlich auf Distanz zum Staatsanwalt gegangen. Der Mann hatte ihn über die Jahre immer wieder mal zur Weißglut gebracht, doch diese Art Zorn war stets recht schnell verflogen. Oft hatte er sich kurz darauf bereits dafür geschämt. Doch seitdem Belli vor einem halben Jahr Saltapepes Leben fahrlässig aufs Spiel gesetzt hatte, wollte der Zorn nicht mehr weichen. Im Gegenteil, inzwischen empfand er sogar eine gewisse Verachtung für Belli. Gepaart mit Gleichgültigkeit. Er nahm ihn nicht mehr ernst, seinen Vorgesetzten, was fatal war, er konnte, wollte es jedoch nicht ändern. Er musste daher allzu oft schauspielern, musste Belli schmeicheln, ihm Honig ums Maul schmieren, um kurz und knapp das zu erfahren, was er erfahren wollte. Ja, er hasste es. Aber was blieb ihm übrig?
»Dottore!«
Dottore war immer gut, die Anrede per Titel wirkte stets Wunder. »Wie gut, dass Sie noch hier sind. Was würde ich ohne Sie machen, dieser Fall macht mir zu schaffen, das ist nicht mein Metier, ich brauche Sie, erzählen Sie mir alles über die Tote. Und alles über die Köchin. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Sie sind ein Meister darin, das Wichtigste in wenigen Sätzen auf den Punkt zu bringen. Ich bin ganz Ohr.«
Belli, das hatte Grauner so oft schon erlebt, war keiner, der merkte, wenn man ihn lobend belog.
Etwa zwanzig Minuten später verabschiedete Grauner den Staatsanwalt an dessen Limousine und ging zu den Polizeiwagen. Im Augenwinkel sah er Tappeiner, die sich in einem Wagen sitzend mit einem jungen Mann, ganz in schwarz gekleidet, blasses, knochiges Gesicht, rasiertes Haupt, unterhielt. Das musste der Kellner, Paolo Sensi, sein.
Der Commissario sah zwei Wagen weiter eine Frau auf dem Beifahrersitz, Tür geöffnet, sie starrte scheinbar ins Leere. Er trat näher heran, musterte sie. Ihre Augen waren türkisgrün, wie die einer Katze, sie war schlank, dünn beinahe, hatte schneeweiße Haut und schwarzes, gelocktes Haar. Sie trug ein tannengrünes Leinenhemd, eine gleichfarbige Schürlsamthose, einen blauen Schurz, knallrote Bergschuhe. Sie sah nicht wie eine Köchin aus.
Hedwig Jöchler, das hatte der Staatsanwalt ihm erzählt, war vor einigen Jahren schlagartig weltberühmt geworden. Zuvor hatte sie hier im hintersten Tal eine kleine, unscheinbare Jausestation betrieben. Der Parkplatz war Ausgangspunkt zahlreicher Wandertouren, Jöchler verkaufte den Wanderern leckere, mit Wurst, Käse und Kräutern aus dem Tal belegte Brote für unterwegs, die Rückkehrer empfing sie mit einer stärkenden Suppe.
Eines Tages kam ein Reisejournalist des Corriere della Sera vorbei, dem die Suppe wohl ganz vorzüglich schmeckte, er schrieb eine kleine, schwärmende Kritik und postete außerdem ein paar Fotos auf Instagram, wo er einige Tausend Follower hatte. Später im Sommer kam die Mailänder Schickeria ins Tal. Wer in jenem Sommer vor einigen Jahren nicht aus der Modemetropole ins hinterste Sarntal aufbrach, sich nicht von irgendeinem Sarner Bergführer zu horrenden Preisen auf irgendeinen Gipfel schleppen ließ, wer in keins von Hedi Jöchlers Jausenbroten biss, das Hineinbeißen nicht im Netz festhielt, der brauchte gar nicht mehr aufzutauchen bei den spätsommerlichen Mailänder Aperitifrunden, der hatte nichts erlebt.
Eines Augustabends kam schließlich ein junger Mann zur Jausestation, er aß, genoss. Er fotografierte, so erzählte man es sich, das Essen nicht. Er stellte sich der Köchin vor, sein Name sei Giulio Torrinesi, und er wolle in ihre Kochkunst investieren, einen Deal mit ihr machen. Er präzisierte: Er wolle hier am Waldrand im hintersten, obersten Eck des Sarntals ein kleines Gourmetrestaurant mit ihr aufbauen, alles genau so machen, wie sie es sich wünschte. Er sagte, er würde für die Finanzierung sorgen und ihr einige Architekten vorstellen, sie dürfe entscheiden, wie das Restaurant auszusehen habe. Er wollte außerdem unten im Tal, am Dorfrand, ein neues Apartmenthaus errichten. Zuletzt versprach er ihr, sie bei allem, was von da an kommen würde, fifty-fifty zu beteiligen.
Sie schlug, so jedenfalls lautete die Legende, sofort ein. Sie stellte nur drei Bedingungen: Sie überließ es dem Investor, den Architekten auszuwählen, wollte aber, dass die Küche nicht im Restaurant, sondern im Wald stehen sollte. Sie bestand außerdem darauf, dass sie nur mit Zutaten aus dem Sarntal kochen würde. Hauptsächlich mit Fleisch, Kräutern und Gemüse ihrer Schwester Lisa, die eigentlich als Grundschullehrerin arbeitete, in ihrer Freizeit aber Jägerin war und außerdem einen üppigen Garten am Dorfrand pflegte. Sie forderte zudem, dass ihre andere Schwester, die jüngste, das Nesthäkchen, Susanne, sobald sie alt genug sein würde, auch mit ins Unternehmen einsteigen dürfe.
Wenige Monate nach Eröffnung des Tan war Carla Manfredi erstmals zu Gast gewesen. Zuvor hatten wohl einige ihrer geheimen Tester inkognito vorbeigeschaut. Wenige Wochen nach Manfredis Besuch erschien eine Lobeshymne in ihrem Magazin. Von ihr höchstpersönlich verfasst, was sehr selten vorkam. Nun kamen die Gäste aus aller Welt angereist. Herbeigepilgert. Das Tan entpuppte sich als absolute Erfolgsgeschichte.
»Welchen Grund könnte Hedwig Jöchler haben, diese Restaurantkritikerin aus dem Weg zu räumen?«, hatte Grauner den Staatsanwalt gefragt.
Belli hatte die Arme weit geöffnet. »Da gibt es nur einen Grund, Grauner«, hatte er blitzschnell geantwortet.
Der Commissario hatte überrascht geschaut, er hatte seine eigene Frage eigentlich als rhetorisch verstanden und keine Antwort erwartet.
»Manfredi ist keine, die zweimal an einem Ort isst. Soweit ich weiß, macht sie das nur bei Köchen, mit denen sie sehr, sehr gut befreundet ist. Nur in Ausnahmefällen …« Grauner gewährte Belli seine Spannungspause. Dann half er nach. »Nur in Ausnahmefällen …«, Belli machte ein ernstes Gesicht, »… kommt sie wieder. Es heißt, dass zunächst ein halbes Dutzend Testesser zu einem Lokal geschickt wird, bevor Manfredi dort erstmals speist, bevor sie entscheidet, das Lokal im Magazin positiv zu erwähnen. Und die Testesser kommen auch danach immer wieder, um sich regelmäßig der Qualität zu vergewissern …«
Grauner ahnte die Pointe. »Und was passiert, wenn ein einst gepriesenes Lokal nicht mehr den Erwartungen der Testesser entspricht?«, fragte er ungeduldig dazwischen.
»Dann tritt die Ausnahme ein – und die Manfredi sitzt wieder am Tisch. Sie kündigt sich an, sie erwartet, wie immer, alleine zu speisen, sie alleine entscheidet schließlich, ob ein Lokal mit einem ordentlichen Verriss dem erlauchten Kreis wieder entrissen wird. Glauben Sie mir, Grauner, es gibt nichts Wunderbareres für einen Spitzenkoch, als zu den Restaurants der Sette Forchette zu zählen …«
Er sprach nicht weiter, Grauner vervollständigte den Satz. »Und es gibt nichts Schrecklicheres, als irgendwann nicht mehr dazuzugehören.«
Belli blickte immer noch ernst drein. »Dem Verriss folgen die Tragödien, ausnahmslos, immer. Wirtschaftlicher Ruin. Depressionen. Abstürze. Amokläufe. Selbstmorde.«
Grauner überlegte. »Aber es hätte ja auch sein können, dass Manfredi ihren Testessern widerspricht. Dass sie Hedwig Jöchlers Kochkünste weiterhin ganz wunderbar findet.«
Belli sog geräuschvoll die Luft ein. »Klar«, antwortete er schließlich, »das hätte sein können. Aber, Sie müssen wissen, Manfredi sucht … äh … suchte sich ihre Mitarbeiter sehr genau aus, das habe ich einmal in einem Artikel eines Journalisten der New York Times gelesen, der sie monatelang begleitete. Sie hätte es sicher als persönliches Versagen gesehen, wäre sie je zu einem anderen Schluss als ihre Mitarbeiter gekommen. Kurz, soweit ich weiß, ist das noch nie passiert.«
Grauner ging weiter auf Hedwig Jöchler zu, ihre Augen schienen durch ihn hindurchzustarren. Er blieb etwa einen Meter vor ihr stehen, räusperte sich.
»Hier?«, fragte sie trocken und blinzelte.
»Was, hier?«, fragte er zurück.
»Hier wollen Sie mich verhören, Herr Kommissar?«
Grauner schwieg einige Sekunden. Er versuchte, aus dem Gesicht dieser Frau etwas herauszulesen, irgendetwas. Manche Menschen trugen die Emotionen auf ihrer Haut, in ihren Augen, in ihren Bewegungen, Zuckungen, sie konnten nicht anders. Nicht jedoch Hedwig Jöchler, die Wunderköchin. Sie zeigte keinerlei Emotion. Ihr Gemütszustand war nicht zu erraten.
»Ich werde Sie verhören, Frau Jöchler, ja. Aber das kommt später. Jetzt möchte ich mit Ihnen sprechen, einfach nur sprechen, Sie ein bisschen kennenlernen.«
Sie grinste. Das Grinsen sagte: Ich spiele hier die Spielchen, nicht Sie, Herr Kommissar.
»Hier?«, fragte sie erneut.
»Nein«, antwortete Grauner. »Lassen Sie uns ein bisschen spazieren gehen. Sie kennen den Wald hier oben, nehme ich an, nicht? Zeigen Sie ihn mir.«
Sie stand wortlos auf und ging an ihm vorbei, er folgte ihr, sah Tappeiners verwunderten Blick aus dem Augenwinkel, Hedwig Jöchler verschwand zwischen den Tannen und Fichten, er ging hinterher.
Schnell wurde es dunkler, umgaben sie nur noch die Geräusche, Gerüche und Farben der Natur. Das morsche Holz knackte unter ihren Füßen, das Moos an den Nordseiten der Baumstämme dampfte, ein Nebelschleier benetzte den Waldboden. Es ging bald steil bergan.