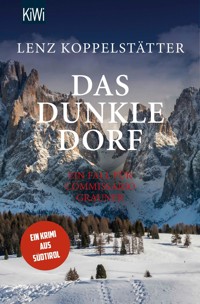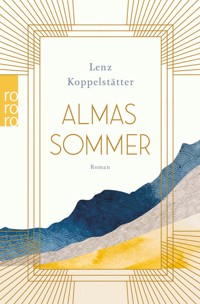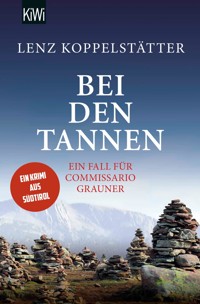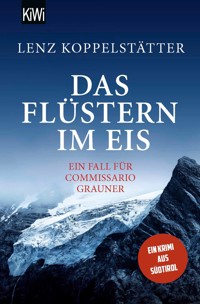
9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Grauner ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein tödlicher Wettkampf in schwindelerregender Höhe – Commissario Grauner ermittelt in seinem neunten Fall in den eisigen Gipfeln Südtirols. In Sulden, an der gefrorenen Nordwand des Ortler, hat sich die internationale Kletterszene versammelt. Zwei der besten Eiskletterinnen der Welt, eine Italienerin und eine Iranerin, treten gegeneinander an, um einen neuen Rekord aufzustellen. Doch während oben am Berg ein Unwetter aufzieht, machen Commissario Grauner und sein Kollege Saltapepe eine grausige Entdeckung: Der Chef der örtlichen Bergrettung liegt ermordet in der Turnhalle des Dorfes. Als die iranische Kletterin nach dem Wettkampf spurlos verschwindet und in ihrem Hotel eine weitere Leiche gefunden wird, beginnt für Grauner und Saltapepe ein Wettlauf gegen die Zeit. Schnell wird klar, dass in dem idyllischen Bergdorf nicht nur die eisigen Naturgewalten eine tödliche Gefahr darstellen. »Das Flüstern im Eis« ist ein atmosphärischer Südtirol-Krimi voller Spannung und überraschender Wendungen, der Fans von Regionalkrimis und Urlaubskrimis begeistern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Lenz Koppelstätter
Das Flüstern im Eis
Ein Fall für Commissario Grauner
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Lenz Koppelstätter
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Lenz Koppelstätter
Lenz Koppelstätter, Jahrgang 1982, ist in Südtirol geboren und aufgewachsen. Er arbeitet als Medienentwickler und als Reporter für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und Salon. 2015 startete bei Kiepenheuer & Witsch die Krimireihe um den Südtiroler Commissario Grauner, die ein großer Erfolg bei Leser:innen und Presse ist.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Eine verschwundene Extrembergsteigerin, zwei rätselhafte Morde im oberen Vinschgau und ein Wettlauf gegen die Zeit: In seinem neunten Fall ermittelt Südtirols beliebtestes Duo in luftigen Höhen.
In Sulden, an der eisigen Nordwand des Ortler, hat sich die internationale Kletterszene versammelt. Eine Italienerin und eine Iranerin, die besten Eiskletterinnen der Welt, treten gegeneinander an, um einen neuen Rekord aufzustellen. Commissario Grauner und sein neapolitanischer Kollege Saltapepe haben derweil andere Sorgen: Unten im Tal wurde ein Toter gefunden. Matthias Lechthaler, der Chef der örtlichen Bergrettung, liegt in der Turnhalle des Dorfes, eine Mistgabel steckt in seiner Brust.
Während die Ermittler Spuren sichern, bahnt sich oben am Gipfel eine Katastrophe an. Ein Gewitter zieht auf, die iranische Athletin kommt nie in der Schutzhütte an. Am nächsten Morgen wird ihr Eispickel am Rande einer Felsspalte gefunden – und in ihrem Hotel ein weiterer Toter. Schnell ahnen Grauner und Saltapepe, dass es nicht nur die unzähmbaren Naturgewalten auf dem Dach Südtirols sind, die sie fürchten müssen.
Hinweis für E-Reader-Leserinnen und Leser
Wenn Sie sich die Karte in Farbe und zoombar ansehen möchten, dann geben Sie bitte die folgende Internetadresse im Browser Ihres Computers oder Smartphones ein:
www.kiwi-verlag.de/karten-fluestern-im-eis
Hinweis für Leserinnen und Leser auf dem Smartphone/Tablet oder am Computer
Sie möchten sich die Karte zoombar anschauen? Dann tippen bzw. klicken Sie bitte auf die Abbildung. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der entsprechenden Website-Ansicht.
Inhaltsverzeichnis
Hinweis
Motto
Prolog
Karten zum Buch
1. Juli
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
2. Juli
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
3. Juli
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
4. Juli
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Epilog
Danke
Leseprobe »Was der See birgt«
Personen und Handlungen dieses Romans sind frei erfunden. In Bezug auf Ortsbeschreibungen nimmt sich der Autor Freiheiten heraus.
Kurz ist die Freude des Gipfelglücks, ewig währt der Muskelkater.
Prolog
Der Berg ist nicht gut, der Berg ist nicht böse. Er ist einfach da. Weil irgendetwas vor vielen Millionen Jahren dafür gesorgt hat, dass es ihn gibt. Gott? Ja, womöglich Gott. Oder ein großer Zufall. Ja, eher ein Zufall. Jedenfalls kühlte unsere Welt, die einst höllengleich glühte, ab, die Ozeane und das Land entstanden. Die Kontinentalplatten prallten aufeinander, rangen miteinander, die europäische und die afrikanische. Die eine schob sich unter die andere, die bog sich, faltete sich zusammen. Die Spitzen der Alpen ragten empor – und mittendrin er. Dieser wunderschöne, vom Gletschereis ummantelte Berg. Der höchste Südtirols. Der König, wie sie ihn nannten, König Ortler.
Wahrscheinlich musste man das so machen, dachte der Lechthaler Matthias, man musste einer solch immensen Masse, wie der Berg eine war, einen Namen geben. Um sie erfassen zu können. Ein Riese aus Stein und Eis, an dem die Wolkenfetzen hingen, als wären sie angeklebt.
Ein Leben ohne den Ortler, das konnte und wollte sich der Lechthaler nicht vorstellen. Das erste Mal war er mit sechs Jahren am Gipfel gewesen. Normalroute. Mit seinem Vater. Als er dreizehn war, kraxelte er die steile Nordwand hoch. Im Alter von achtzehn versuchte er, das alles hinter sich zu lassen. Er zog in die Welt hinaus, trampte, heuerte auf Containerschiffen an, sah Berge, die noch viel höher und mächtiger waren als sein Ortler.
Er kehrte in ein Kloster ein. Durfte bleiben, freundete sich mit einem der Priester an. Der lehrte ihn die Kampfkunst der Shaolin.
Nach drei Jahren fragte ihn ein Mönch, was sein größter Wunsch sei. Und der Lechthaler Matthias musste nicht lange nachdenken. Er sagte, er vermisse sein Tal, sein Dorf, seine Berge. Es sei an der Zeit, zurückkehren. Er konnte nicht ahnen, was die Heimreise für ihn bereithalten würde.
Warum soll ich noch einmal in die Welt da draußen reisen, sagte sich der Lechthaler Matthias, der inzwischen über sechsundsechzig Lenze zählte, die Welt kommt doch eh jeden Sommer zu mir ins Tal. Mutige, oft auch übermütige Touristen, die er auf den Gipfel des Ortlers brachte, knapp viertausend Meter über dem Meeresspiegel.
Ein paar versuchten es ohne die Hilfe eines erfahrenen Bergführers. Die musste er dann oft in seiner Zweitfunktion als Bergretter suchen. Weil sie viel zu spät losgegangen waren, weil sie das schlechte Wetter nicht vorausgeahnt hatten, weil sie sich verlaufen hatten. Weil sie einfach nicht gemacht waren für den Berg.
Der Ortler ist nicht böse, sagte der Lechthaler Matthias stets, er ist auch nicht gut. Er muss nicht bezwungen werden. Bezwingen, nein, nein, dieses Wort benutzte er nie. Das benutzten stets nur die anderen. Die jüngeren Kollegen. Bezwingen? Wie lächerlich. Als ob man das könnte. Einen Berg bezwingen. Wo doch die meisten Menschen noch nicht einmal sich selbst zu bezwingen vermochten. Den Hunger und den Durst. Die Lust. Das Herz.
Durch das Fenster seiner Kammer, hier, in der Julius-von-Payer-Hütte, hoch oben am Ortler, sah er die umliegenden Gipfel glitzern. Die Suldner unten im Tal beendeten wohl gerade die Mittagspause, begannen wieder mit der Arbeit. In der Ferne schrie ein Bartgeier, der irgendwo in einer Felswand sein Nest hatte, und der Motor eines Autos jaulte auf, das über den Pass des Stilfser Jochs fuhr.
Aus der Stube im Erdgeschoss war das Rumoren der ersten Bergsteiger zu hören, die es hochgeschafft hatten, die sich stärkten, Gulaschsuppe, Hirtenmakkaroni, Holundersaft, Vernatsch.
Der Lechthaler Matthias erhob sich, das kurze Nickerchen hatte gutgetan, das Bett knarrte, er schlüpfte in die Pantoffeln, öffnete die Holztür, stieg die Stufen hinab. Dicke, warme Luft schlug ihm entgegen. Er konsultierte den Kalender, auf dem die Gipfelbuchungen für den kommenden Tag eingetragen waren. Sie, die Bergführer, waren heute zu dritt. Er, der Egger Helmut und der Staffler Lukas.
Lechthaler, Chef der Bergrettung, zudem Bergführer und Leiter einer Kampfsportschule unten im Dorf, lugte in die Stube hinein. Er versuchte, die etwa zwei Dutzend Menschen, die da saßen, einzuordnen.
Beim Egger hockten vier junge Burschen mit roten Wangen. Sie aßen schweigend ihre Suppe. Die konnten was. Und doch waren sie schlau genug, mit einem Bergführer zu gehen. Die würden früh in den Betten liegen und sich morgens als Erste aus den Federn schälen. Sich die Gesichter mit kaltem Gletscherwasser waschen, noch im Dunkeln mit Stirnlampen aufbrechen und wenige Stunden später am Gipfelkreuz sein.
Beim Staffler saß ein Pärchen. Mitte fünfzig vielleicht. Sie stocherte in einem Salat herum. Er hatte ein Meraner Würstchen vor sich auf dem Teller liegen, ein zweites in der einen Hand, in der anderen ein Weißbier. Kauend und schmatzend quatschte er auf den jungen Bergführer ein. Die beiden schafften es bis zum Klettersteig, höchstens bis zum Fuße der Gletscherwand. Darauf hätte der Lechthaler seine ganze Ausrüstung verwettet.
Er trat ein. Sofort drehten sich alle zu ihm, ihm war klar, dass er eine Art Legende war, auch wenn ihn das nicht unbedingt freute. Keiner kannte diesen Berg besser als er, auch die anderen Bergführer nicht. Einmal, vor ein paar Jahren, hatte ihn ein Kunde gefragt, wie oft er schon am Gipfel gewesen sei.
»Sicher ein paar Hundert Mal«, hatte er geantwortet. Danach dachte er noch einmal darüber nach und stellte fest, dass das nicht stimmen konnte, dass er jeden Sommer rund vierzigmal am Kreuz stand, dass so viele Sommer vergangen waren, seitdem er aus Asien zurückgekehrt war, dass er demnach um die tausendsechshundertmal dort oben gewesen sein musste.
Die Bergsteiger in der Stube steckten die Köpfe zusammen, flüsterten. Die jungen Buben beim Egger beugten sich über eine Gebirgskarte, die sie auf dem Tisch ausgebreitet hatten. Lechthaler ließ den Blick durch den Raum schweifen und wollte sich gerade wieder umdrehen, als er sie sah. Er erkannte sie sofort. Sie hatte am kleinsten Tisch Platz genommen. Mit dem Rücken lehnte sie an der holzvertäfelten Wand, über ihr hingen Aquarelle und vier Soldatenhelme aus dem Großen Krieg.
Er löste sich aus seiner Starre, ging mit wackeligen Knien auf sie zu. Ihr Gesicht war alt geworden, tiefe Falten zogen sich durch ihre Haut. Nur die Augen waren jung geblieben. Und strahlten voller Kraft, Liebe und Stolz. Wie früher. Er hatte nicht damit gerechnet, nach allem, was geschehen war.
»Du«, sagte Lechthaler, als er an ihrem Tisch angelangt war. »Tatsächlich.«
Sie lächelte.
1. Juli
1
Grauner versuchte, halbwegs freundlich zu schauen. Was sollte er auch tun? Würde er zu erkennen geben, wie es in ihm zuging, dann würde er seinem Gegenüber einen derartigen Schreck einjagen, dass es sofort seine blöden Sachen in seinen blöden Koffer verstauen und mit seinem blöden Auto vom Hof fahren und verschwinden würde. Für immer.
Nichts wäre Grauner, der hier oben, über der tiefen Schlucht des Eisacktals, Viechbauer war und unten im Tal, in Bozen, Commissario der Polizia di Stato, lieber. Aber er hatte seiner Frau etwas versprochen. Und er war so ein Mensch, der zumindest versuchte, Versprechen einzuhalten. Auch wenn ihm das im Alter, zumindest in letzter Zeit, zunehmend schwerfiel.
Er spürte Albas Hand auf seiner Schulter. Er liebte sie. Sogar noch mehr als die Kühe in seinem Stall, sogar noch mehr als diesen Part in Mahlers Zweiten, der klang, als würden der Wald und die Berge und die Wiesen mit im Orchester sitzen.
Es überraschte ihn immer wieder, was so eine kleine Geste Albas in ihm bewirkte. Wie ihn diese Hand auf der Schulter zu beruhigen vermochte. Das konnte nur sie, Alba, die Liebe seines Lebens.
Sara, seine Tochter, konnte das nicht. Natürlich liebte er auch sie, ja, auch sie mehr als die Kühe, mehr als Mahler, seine kleine Sara, aber, putteiga puttinziga, das musste jetzt doch auch einmal gesagt werden: Seitdem sie sich mit ihrem Mickey im fernen Wien herumtrieb, Agrarwissenschaften studierte und die Übernahme des Grauner-Hofs vorbereitete, seitdem er ihr gesagt hatte, dass sie natürlich das eine oder andere verändern könne, seitdem drehte die total durch.
Vor drei Monaten hatte sie ihnen die Ideen eines befreundeten Architekturstudenten aus Graz zugeschickt. Grauner war beim Durchsehen der Unterlagen während des Abendessens beinahe ein Stück Knödel im Hals stecken geblieben. Das Schindeldach des Hofes sollte einer begrünten Fläche weichen. Der alte Hühnerstall? Weg. Für einen Naturteich.
»Was wollt ihr?«, fragte Grauner den jungen Mann, der immer noch vor ihm stand, mitten in der Stube. Nun hatte sich auch dessen Freundin zu ihnen gesellt, die dem Commissario schon seit drei Tagen mit ihrem Getue auf die Nerven ging.
»Dieses Stallbaden, das wollten wir mal ausprobieren. Sara hat uns so davon vorgeschwärmt. Das müssen wir unbedingt noch machen, bevor wir heute Abend aufbrechen, um nach Venedig zu fahren.«
Die Freundin nickte.
Alba trat vor, nickte ebenso. »Stallbaden, aber ja doch«, sagte sie, »natürlich macht ihr das heute noch, als krönenden Abschluss eures Aufenthalts. Mein Mann Johann und ich, wir werden alles für euch vorbereiten, wir rufen euch dann. Ja?«
Das Pärchen zog sich strahlend in Saras Zimmer zurück und schloss die Tür.
»Stallbaden?«, fragte Grauner. »Was soll das denn sein?«
Sara hatte ihnen gesagt, dass im Juli ein paar Freunde von ihr kommen und in ihrem Zimmer übernachten würden.
Testbesucher, so hatte sie sie genannt, sie kannten sich mit Marketing aus, mit modernen Urlaubskonzepten, sie wolle mit ihnen gemeinsam überlegen, was auf dem Hof, auf Grauners Little Farm, alles möglich wäre.
Seit drei Tagen waren die beiden nun hier, der Björn und die Elsa. Am ersten Tag hatten sie mit Alba im Kräutergarten Unkraut gejätet. Nach einer Viertelstunde hatte Elsa über Bläschen an den Händen geklagt. Brennnesseln! Und Björn hatte erklärt, dass er vor einem Jahr einen Bandscheibenvorfall gehabt habe, deshalb könne er diese Art der knochenharten Arbeit eh nicht machen.
Unkraut jäten, knochenharte Arbeit. Da fand Grauner das noch lustig. Als Elsa am Abend aus Versehen eine volle Milchkanne umstieß und die Milch unter dem wild muhenden Protest der Kühe über den Stallboden floss, fand er das schon deutlich weniger witzig. Als er am zweiten Tag mit den beiden eine Almwanderung unternahm und Björn nach nicht einmal einer Stunde fragte, ob man denn nicht einen Hubschrauber rufen könne, um sie zum Hof zurückzubringen, zählte er erstmals die Stunden bis zu ihrer Abfahrt. Vierunddreißig waren es da noch.
Pitschnass geregnet und viel später als geplant kamen sie zum Hof zurück, Alba wartete bereits mit den Knödeln in der Stube. Die beiden waren durchaus hungrig, ihnen schmeckte aber das Südtiroler Signature-Gericht, wie sie es nannten, nicht. Sie bestanden darauf, sich eine vegane Pizza liefern zu lassen. Und stellten entgeistert fest, dass sie sie hier im Dorf nicht über eine App bestellen konnten.
Grauner wollte keine Pizza. Warum sollte er Pizza essen, wenn Knödel auf dem Tisch standen? Er erklärte den beiden dennoch geduldig, dass sie keine App bräuchten. Dass sie einfach zur Kirche spazieren mussten, daneben, im Gasthaus zum Goldenen Lamm, arbeitete ein Koch, der Sizilianer war, der Rehrücken und Kaiserschmarrn zubereitete, aber auch Pizza buk. Björn und Elsa fühlten sich jedoch außerstande, nach der Horrorwanderung noch einen einzigen Schritt zu tun, also holte Grauner die Pizzas mit dem Panda.
Während das Pärchen aus Wien kaute, sinnierte es darüber, wie man Albas Knödelkunst verbessern könne. Warum nicht mal ein Knödel mit Papaya? Oder Halloumi? Und warum immer rund? Wie wäre es mal mit einem viereckigen Knödel?
»Out of the box thinking«, das hatte Grauner in den letzten Tagen häufig gehört. Und jetzt also das Stallbaden.
»Alba, was ist das?«, fragte der Commissario erneut.
Alba holte den Zettel hervor, die ausgedruckte E-Mail, die Sara ihnen geschickt hatte. »Mit allen Sinnen den Stall genießen, die Ruhe, die Nähe zu den vielen Tieren, die sie umgeben. Die Gäste sollten sich zwischen sie auf ein Bett aus Heu legen, die Augen schließen und im Rhythmus der Kühe atmen. Wichtig: chillige Loungemusik im Hintergrund.«
Die meisten seiner Kühe waren um diese Jahreszeit auf der Alm. Nur die vier ältesten, gebrechlichsten, waren bei ihnen im Dorf geblieben. Die Mitzi, die Josefina, die Lora, die Marianna. »Wo soll ich jetzt so viele Kühe herbekommen?«
»Vielleicht tun es auch Hühner?«, fragte Alba.
Grauner nickte. Zwölf Hühner, vier Kühe, das passte doch sicher. Was chillige Loungemusik sein sollte, wusste er nicht. Er beschloss, die alte Aufnahme von Mahlers Fünfter in den Kassettenrekorder zu legen. Lautstärke? Volle Pulle.
Als Alba sich zur Tür begab, blinkte sein Handy auf dem Stubentisch. Leise Hoffnung keimte in ihm auf. Eine Hoffnung, die er sonst nie hatte. Normalerweise war er froh über jeden Tag, den er nicht in der Questura, sondern auf dem Hof verbringen durfte.
Staatsanwalt Martino Belli rief an, das verhieß nichts Gutes. Der Commissario spürte, wie sich ein Lächeln auf seinem Gesicht ausbreitete. Im selben Moment schämte er sich dafür. Er hob ab. »Belli? Wo?«, fragte er.
»Was wo?«, antwortete der Staatsanwalt.
»Wo muss ich hin?«
»Müssen tun Sie gar nichts, Grauner. Aber Sie können zu mir ins Büro kommen, gleich heute am frühen Vormittag, wenn Sie wollen.«
Jetzt erst fiel es dem Commissario wieder ein. Schon vor Wochen hatte er Belli um einen Termin gebeten. Immer wieder hatte der ihn vertröstet, weil er angeblich so viel zu tun hätte. Obwohl er eigentlich gar nichts zu tun hatte. Es passierte ja gerade nicht viel in Südtirol. Schon über ein Jahr hatte es keinen Mord mehr gegeben. Nur ein paar kleinere Delikte. So wie letztens in Gargazon, als ein Campingplatzbesitzer einen benachbarten Bienenzüchter angezeigt hatte, weil eine seiner Bienen angeblich eine Campingplatzbesucherin in den Allerwertesten gestochen hätte. Doch die Täterin konnte nicht ausfindig gemacht werden. Der Fall musste zu den Akten gelegt werden.
Vor einigen Monaten hatte ein Wanderurlauber aus Bayern einen Wanderurlauber aus der Lombardei wegen Ruhestörung vor Gericht bringen wollen. Der Lombarde hatte auf dem Gipfel des Heiligkreuzkofel sein Kofferradio angemacht, um sich die Übertragung der Livekonferenz der Serie-A-Spiele anzuhören. Das sei unerhört, hatte der Bayer zu Protokoll gegeben, er habe sich, das müsse man in Betracht ziehen, zwei Jahre lang auf diese Wanderung vorbereitet. Und nun habe ihm dieser Mann den Moment auf dem Gipfel kaputt gemacht. Er forderte Schadensersatz, mindestens fünfstellig. Der Lombarde entgegnete, er habe den Moment auch nicht genießen können. Schließlich habe Brescia drei zu null gegen Inter verloren. Grauner hatte befunden, das sei Strafe genug – es war ihm gelungen, den Bayer abzuwimmeln.
»Alba, ich muss nach Bozen«, sagte Grauner und versuchte, betrübt zu klingen.
»Bozen? Ist etwas passiert? Ein Mord?« Ihre Stimme klang besorgt.
Der Commissario schüttelte den Kopf. »Nein, nein«, sagte er, »ich habe einen Termin bei Belli, du weißt schon.«
Sie hatten alles hundertmal durchgesprochen. Für Grauner hatte sich durch die vorerst letzte Reform des Pensionssystems, die die neue Regierung in Rom, die fünfte innerhalb von drei Jahren, beschlossen hatte, ein Schlupfloch aufgetan. Er hatte nun, mit zweiundsechzig, die Möglichkeit, in Pension zu gehen. Fünf Jahre früher als gedacht.
Er hatte genug von den Morden, von Bozen. Sie hatten beschlossen, den Hof noch ein paar Jahre weiterzuführen, bevor sie ihn Sara und Mickey überließen, die dann daraus ihr Bauernhof-Disneyland oder was auch immer machen würden.
Er verstand diese ganzen Grauners-Little-Farm-Ideen zwar nicht, aber er wollte kein Vater sein, der sich gegen die Träume der nächsten Generation stellte. Es war ihre Welt, es war ihre Zukunft.
Alba zog die Augenbrauen hoch, sie hatte natürlich sofort die Freude in seiner Stimme erkannt.
Er drückte ihr einen Kuss auf die Stirn und verließ schnellen Schrittes die Stube. Bald war das alles vorbei. Bald würden sie auf eine der Almen über dem Dorf ziehen. Im Sommer die Kühe hüten, im Winter nichts tun – einfach nichts. Zwei Wochen im Jahr mussten sie Strandurlaub machen, das hatte sie ihm abgerungen, dem Kompromiss hatte er zustimmen müssen, da hatte sie nicht lockergelassen.
Er würde jetzt nach Bozen fahren, um Belli mitzuteilen, dass er in den Ruhestand gehe, dachte er entschlossen, als er im Panda saß und den Motor startete. Ja, der Staatsanwalt sollte von dem Vorhaben als Erster erfahren. Der war zwar formal nicht sein Vorgesetzter, das war der Quästor. Aber Belli war in all den Jahren sein Ansprechpartner gewesen. Er hatte stets ihn um die Genehmigungen gebeten, die er im Rahmen seiner Ermittlungen benötigt hatte. Wenn Belli zugestimmt hatte, hatte auch der Quästor alles nur noch abgenickt.
Basta. Genug Morde. Genug Stunden in der miefigen Questura. Endlich mehr Zeit für Alba, die Kühe und Mahler haben. Mehr Zeit im Paradies.
2
Tappeiner hatte ihn in aller Früh mit ihrem Citroën abgeholt, draußen war es noch dunkel gewesen. Saltapepe hatte keine Ahnung, was das Ziel ihres Ausflugs war. Überraschung! Sie hatte ihm nur gesagt, er solle seine Wandersachen einpacken.
Der Ispettore hatte in den vergangenen Monaten viel gemeinsam mit ihr unternommen. Er wusste nicht, was das mit ihnen war. Es war schön. Basta, das reichte doch. Er spürte, dass es ihm guttat, er spürte, dass auch sie gern Zeit mit ihm verbrachte. Der Rest war einerlei.
Seit dem 4. Mai konnte ihn ohnehin nichts mehr erschüttern. Er war erst neununddreißig, aber er war sicher, ein größeres Glück würde er nie empfinden. Als er es das letzte Mal empfunden hatte, war er sechs Jahre alt gewesen. Seine Erinnerungen daran glichen den Bildern in einem Märchenbuch.
Nun war das alles, San Gennaro im Himmel, er dankte ihm dafür so sehr, noch einmal geschehen. Am 4. Mai war der SSC Neapel in Udine Meister geworden. Zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte. Er hatte sich zehn Tage Urlaub genommen. Er war in die Heimat gereist, hatte gefeiert, drei Tage und drei Nächte, wie die ganze Stadt. Er hatte sich unglaublich leicht gefühlt. Unverwundbar. Dieses Gefühl war geblieben.
Tappeiner sagte ihm, er habe sich verändert. Sie sagte ihm, dass sie das gut finde. Dass ihr der neue Saltapepe gefalle, noch besser als der alte.
Am Fenster zog Naturns vorbei, sie fuhren den Vinschgau hinauf. Er hatte in den vergangenen Jahren viele Täler und Dörfer Südtirols kennengelernt. Aber den Vinschgau? Noch nie hatte es ihn hierher verschlagen.
Die Vinschger waren wohl die friedfertigsten unter den Südtirolern, schussfolgerte er. Sie mordeten nicht. Vielleicht waren sie aber genau wie alle anderen. Nur etwas schlauer. Und mordeten, ohne sich erwischen zu lassen.
Saltapepe sah Tappeiner von der Seite an, sie musste seinen Blick gespürt haben, drehte sich kurz zu ihm hin, lächelte. Silvia hatte ihn ihren Eltern vorgestellt, er hatte sich mit ihr und seiner Mutter zu einem Videoanruf verabredet. Seine Mutter hatte sie anfangs skeptisch beäugt, sie dann gnadenlos ausgefragt. Ob sie denn kochen könne? Ob sie Kinder wolle? Ob sie bügeln könne? Silvia hatte das Spiel sofort mitgespielt, alles bejaht. Nach einer Viertelstunde hatte Mamma Saltapepe sie in ihr Herz geschlossen.
Sie fuhren weiter nach Westen, es wurde langsam hell, Saltapepe wunderte sich, wie lang dieses Tal sich dahinzog. Irgendwann erreichten sie eine breite Ebene, passierten das Städtchen Glurns, in der Ferne entdeckte der Ispettore eine Serpentinenstraße, die sich zu einem Pass emporschlängelte. Sie bogen jedoch scharf links ab. In ein schattiges Tal. Sulden stand auf einem Ortsschild.
Links und rechts der Straße drängten sich Tannen und Fichten aneinander. Saltapepe tauchte im Fußraum ab, um in seinem Rucksack nach einem Müsliriegel zu suchen. Als er sich aufrichtete, verschlug es ihm den Atem. Ein Gigant aus schwarzem Stein und blauweiß schimmerndem Eis ragte vor ihnen in den Himmel.
»Der Ortler!«, sagte Tappeiner, während sie den Citroën scharf in eine Kurve lenkte. Nein, sie sagte es nicht, sie jauchzte es heraus.
Saltapepe spürte, wie ihm die Farbe aus dem Gesicht wich. »Wow, Silvia«, sagte er, »da hoch, das ist die Überr…« Er brachte den Satz nicht zu Ende. Das war ein veritabler Gletscher. Eine Gletschertour, das hatte er bislang noch nie gewagt.
Sie erreichten ein Dorf, auf dem Platz vor einer Kirche waren Biertische, eine Leinwand und eine Bühne aufgebaut. An Laternenmasten hingen Trauben bunter Luftballons. Dutzende Menschen in Outdoorkleidung und mit Rucksäcken auf den Schultern liefen aufgeregt umher. Dabei war es gerade mal halb sieben Uhr morgens. Saltapepe entdeckte ein Plakat an einer Häuserwand, es zeigte zwei Frauen, die eine lächelte und ballte die Faust, die andere machte ein ernstes Gesicht, sie trug ein Kopftuch.
Caterina Bianchi vs. Zahra Jafari
The Ortler North Face Challenge
1. Juli
»Nein, Claudio, du bist noch nicht so weit. Für den Ortler brauchst du noch ein bisschen Bergerfahrung. In ein, zwei Jahren schaffst du die Normalroute – vielleicht. Wir beide fahren mit dem Sessellift ein Stück hoch, wandern dann bis zur Tabaretta-Hütte weiter – unser Tagesziel! Von da aus sieht man die Nordwand des Ortlers besonders gut. Diese eisige Vertikale! Die höchste Eiswand in den Westalpen. Tausendzweihundert Meter ragt sie beinahe senkrecht in die Höhe.« Sie fuhr noch langsamer, zeigte auf das Plakat. »Das sind die beiden weltbesten Fels- und Eiskletterinnen, exzellente Alpinistinnen, sie liefern sich heute einen Zweikampf. Das wollte ich unbedingt sehen. Um Punkt acht geht’s los.«
Saltapepe runzelte die Stirn. Ein leiser Ärger keimte in ihm auf. Warum traute sie ihm nicht einmal zu, die Normalroute bewältigen zu können?
»Das hier«, sagte Tappeiner und schien nun einen Parkplatz entdeckt zu haben, sie bremste und legte den Rückwärtsgang ein, »ist ein Riesenevent in der alpinen Szene. Bianchi gegen Jafari. Bei uns in Südtirol! Das ist wie, tja, Napoli gegen Real Madrid in der Champions League. Der Kampf zweier Rivalinnen, die sich nicht ausstehen können! Bianchi hat letztes Jahr den Cerro Torre in Patagonien im Alleingang bestiegen. Jafari hat den Gasherbrum 1 und den Gasherbrum 2 im Himalaja kurz nacheinander geschafft. Ebenfalls allein.«
Saltapepe nickte eilig, als wüsste er, wovon sie sprach.
Tappeiner zog die Handbremse, sie stiegen aus. Kalte, klare Bergluft schlug ihm entgegen. Saltapepe kniff die Augen zusammen. Die imposante kerzengerade Wand war verschneit und vereist, sogar jetzt im Sommer. »Da klettern die hoch? Wie um Gottes willen soll das funktionieren, Silvia?«, fragte er ungläubig.
»Hochkommen tun die locker«, sagte Tappeiner, »die Frage ist nur, wie schnell. Sie wollen einen neuen Rekord aufstellen. Den hält bislang eine Südtirolerin. Und zwar schon seit über zwanzig Jahren. Ruth Alber, eine Legende.«
»Wie viele Tage hat die denn gebraucht?« Saltapepe erinnerte sich daran, im Fernsehen mal eine Dokumentation gesehen zu haben über diese Verrückten, die ein Zelt an die Wand hängten, um darin zu übernachten.
»Eineinhalb«, antwortete Tappeiner. Sie schulterte ihren Rucksack.
»Eineinhalb Tage«, murmelte er vor sich hin, »warum machen Menschen so etwas?«
»Eine Stunde, siebenunddreißig Minuten und dreiundvierzig Sekunden, um genau zu sein«, präzisierte Tappeiner. »Bianchi und Jafari wollen jetzt die Eineinhalb-Stunden-Marke knacken. Free solo. Wer den Zweikampf gewinnt, bekommt lukrative Sponsorenverträge.«
»Free solo, was heißt das?«
»Jede auf sich alleine gestellt. Ohne Sicherungen, ohne Seil. Nur mit Steigeisen und je zwei Pickeln.«
»Ohne Seil?« Saltapepe schrie beinahe. »Warum?«
»Weil sie es können. Und weil sie so schneller sind.«
Der Ispettore verstand die Welt nicht mehr.
Saltapepe legte den Kopf in den Nacken und starrte auf die Wand. Wie all die anderen Menschen links und rechts neben ihm auf der großen Holzterrasse der Tabaretta-Hütte. Es waren Hunderte. Sie zeigten mit den Fingern nach oben, manchmal entwich ihnen ein Oh, dann ein Ahhh. Manche hielten sich Feldstecher vor die Augen, andere filmten alles mit dem Handy.
Die Ersten hatten inzwischen ihre dicken Jacken ausgezogen, die Sonne stach vom Himmel. Ziehorgel- und Gitarrenmusik dudelte zu ihm herüber. Zwei junge Buben in Lederhosen, Kuhfellhüten und karierten Hemden musizierten vor der Hütte. Was war das hier? Eine Welt, von der er bis heute nicht gewusst hatte, dass sie existierte. Dieses Südtirol, auch nach zehn Jahren hielt es noch immer Überraschungen für ihn bereit. Langweilig, nein, das musste er schon zugeben, war es hier nicht.
Er hielt eine leere Tasse in der Hand. Den Espressogeschmack hatte er noch im Mund. Er war unerwartet gut gewesen. Der Ispettore fragte sich, wie die das machten, auf rund zweitausendfünfhundert Metern über dem Meeresspiegel solch einen guten Kaffee hinzubekommen. Nicht so exzellent wie in Neapel, das nicht, das konnte auch keiner erwarten, aber doch mehr als trinkbar.
»Schau!«, sagte Tappeiner neben ihm und stupste ihn in die Rippen.
An der grauweißen Wand bewegten sich zwei Punkte, ein knallgelber und ein feuerroter, langsam, beinahe unmerklich, weiter gen Himmel.
3
»Dottore, ich wollte mit Ihnen …«
»Jetzt kommen Sie doch erst einmal herein, Commissario.«
Grauner trat näher. Er war nicht oft am Gerichtsplatz, in den Räumlichkeiten der Staatsanwaltschaft. Das war ihm ganz lieb so. Meistens kam Belli zu ihm und den Kollegen in die Questura.
Hier war alles sehr aufgeräumt, wirkte beinahe museal. Der Boden war aus venezianischem Mosaik, die Wände glänzten weiß. Hinter den massiven dunkelbraunen Türen war nichts zu hören, keine Stimmen, kein Geklapper einer Tastatur. Überhaupt herrschte hier eine gespenstische Stille. Ganz anders als in der Questura, da drang der Lärm aus allen Büros, auf den Schreibtischen stapelten sich Akten, die Computer surrten, die Kaffeemaschine in der kleinen Küche stimmte mit ein, von irgendwoher war immer Geschrei zu hören. Die Wände waren grau und um die Lichtschalter herum ganz fleckig, der Boden war mit PVC ausgelegt, das sich hier und da schon löste.
»Ich kann mir schon denken, Commissario, worüber Sie mit mir sprechen wollen. Ich habe zur Vorbereitung auf das Gespräch noch einmal Ihre Akten überprüft, mir Ihren Werdegang angeschaut.« Belli ließ sich nun hinter dem Schreibtisch auf den wackeligen Ledersessel plumpsen. Er bedeutete dem Commissario, sich auf den schlichten Holzstuhl ihm gegenüber zu setzen. Grauner kam der Bitte nach. Es wunderte ihn, dass der Staatsanwalt bereits ahnte, warum er hier war.
Er sah sich um. Es schien sich kaum etwas verändert zu haben seit seinem letzten Besuch, der nun, er dachte nach, doch schon wieder zwei Jahre zurücklag.
Auf dem Schreibtisch lag ein teuer aussehender Füllfederhalter. Kein Computer, nicht einmal Papier, da standen bloß zwei Bilderrahmen, zu Belli hingedreht. Sicher Fotos seiner Familie. Er kannte Bellis Gemahlin nur flüchtig von Konzertbesuchen, die Kinder überhaupt nicht. Er glaubte sich zu erinnern, dass es drei waren.
Hinter dem Staatsanwalt hing ein Ölporträt von ihm selbst an der Wand. Nachdenklich, eine Hand am Kinn. Daneben hatte er eine Vielzahl gerahmter Fotos aufgehängt, die ihn und wichtige Persönlichkeiten zeigten. Den Landeshauptmann, den Bischof, den Ministerpräsidenten. Auch einen Schnappschuss mit Giovanni Falcone entdeckte Grauner, dem legendären Mafiajäger, den die sizilianische Cosa Nostra 1992 vor den Toren Palermos in die Luft gejagt hatte.
»… was haben wir nicht alles zusammen erlebt.«
Der Commissario räusperte sich, er war froh, dass es Belli für gewöhnlich nicht auffiel, wenn man während seiner Monologe gedanklich abschweifte. Er fragte sich, wann das Feuer in dem Mann erloschen war, das er als junger Staatsanwalt noch gehabt haben mochte. Er fragte sich, wann er hinter diesem Tisch beschlossen hatte, die Arbeit einzustellen. Nur noch die Zeit abzusitzen. Sich ab und zu mit einer aufgeblasenen Nachricht vor die Presse zu stellen, damit nicht auffiel, wie wenig er machte.
»… den Ötzi-Mord in Schnals, den Thomas-Mann-Mord in Ulten, den Brenner-Mord, wie aufregend, erinnern Sie sich? Da hat sogar der Corriere della Sera aus Mailand ein ganzseitiges Interview mit mir angefragt, was war das für ein Highlight! Morde, Morde, Morde über Morde, Grauner, die wir beide gemeinsam gelöst haben. Ich muss schon sagen, und das tue ich ganz ohne Unbescheidenheit, die nämlich ist eine zu vernachlässigende Tugend: Ohne uns beide, Commissario, wäre Südtirol nicht ein derart sicherer Ort.«
Grauner nickte und unterdrückte ein Gähnen.
»Wer so viel erlebt hat, wird müde irgendwann, nicht? Da erinnere ich mich immer gerne, lieber Grauner, an meine Jahre als junger Staatsanwalt, als ich einmal in …«
Was war es noch gleich, was er auf dem Rückweg besorgen sollte, überlegte Grauner. Alba hatte es ihm hinterhergerufen, als er in den Panda gestiegen war. Nudeln, Salz, Geschirrtücher, es waren natürlich, wie immer, viel zu vage Angaben. Welche Nudeln, welches Salz, welche Geschirrtücher? Es würde sicher Ärger geben, egal, was er tat. Brachte er das Falsche mit, krachte es. Kaufte er vorsichtshalber von allem etwas, Spaghetti, Rigatoni, Farfalle, grobes Salz, feines Salz, große Wischtücher und kleine, würde sie ebenso schimpfen. So viel Geld für unnützes Zeug.
Auf der Alm würde alles besser werden, davon war der Commissario überzeugt. Sie würden größtenteils von dem leben, was sie selbst anbauten. Einmal pro Woche würde er hinunter ins Dorf laufen, vom Hof ein paar Eier und Milch holen, im kleinen Laden bei der Kirche ein paar Grundnahrungsmittel, beim Bäcker Brot.
»Ich verstehe, dass Sie müde sind, Grauner.«
Ja, er war müde, da hatte Belli recht. Aber es waren nicht die Morde, die ihn ermüdet hatten. Er war nie zum Zyniker geworden. Er hatte immer an den Sinn seiner Arbeit geglaubt. Daran, dass Unrecht aufgeklärt werden, das Gute die Oberhand behalten musste. Weil sonst Chaos ausbräche.
»Ja, Dottore«, sagte der Commissario. Er sprach ihn nicht oft so an. Das durfte sich nicht einschleichen, sonst war es nichts Besonderes mehr. »Ich bin müde, deshalb möchte ich den Antrag stellen. Und ich bin froh, dass Sie so viel Verständnis dafür zeigen.«
Belli nickte väterlich.
»Ich möchte zum Jahresende …« Eine dumpfe Melodie unterbrach Grauner mitten im Satz. Er verstand nicht, woher sie kam, doch er erkannte sofort, was es war.
Giuseppe Verdi. Das Intro von Va pensiero, dem Gefangenenchor aus Nabucco. Das wusste sogar er als Mahlerianer. Bellis Handy, das auf dem Schreibtisch lag, zuckte und blinkte. Der Chor begann zu singen.
Der Staatsanwalt griff nach dem Gerät. Im Eifer stieß er mit dem Arm an die Fotografien, sie fielen um. Grauner erkannte, dass es sich keineswegs um Familienporträts handelte. Das eine Foto zeigte Belli mit dem Dalai Lama, der vor einigen Jahren in Südtirol zu Besuch war. Auf dem anderen war der Staatsanwalt mit Luciano Pavarotti zu sehen, der ab und an in Meran zur Kur geweilt hatte.
»Wollen Sie nicht rangehen?«, fragte Grauner und zeigte auf das Gerät.
Belli legte den Zeigefinger auf die Lippen. Wartete, bis der Chor geendet hatte, bis alles wieder von vorne begann. »So viel Zeit muss sein«, sagte er dann und nahm den Anruf an. »Sì«, sagte er nur. Sein Gesicht verfinsterte sich umgehend. Nachdem er aufgelegt hatte, seufzte er. »Wo ist Ihr Handy?«
Der Commissario tastete seine Jackentaschen ab. Da war nichts, er musste es im Panda vergessen haben. Oder auf dem Tisch in der Stube. »Ich, äh.«
»So geht das nicht, Grauner«, sagte der Staatsanwalt streng, »auch wenn es bald vorbei sein sollte, noch sind Sie Commissario der Polizia di Stato, meiner Polizia di Stato! Und als solcher haben Sie gefälligst Ihr Handy jederzeit bei sich zu tragen, verstanden?«
Grauner nickte verschämt.
»Kommen Sie mit!« Belli ging schnellen Schrittes an ihm vorbei, die Sohlen der rahmengenähten Schuhe knallten auf das Parkett. »Wir haben einen Toten, vielleicht ist es Ihr letzter Fall. Vermasseln Sie es nicht. Nicht jetzt, auf der Zielgeraden. Wir müssen nach Sulden.«
4
Der Kaffeegeschmack im Mund war verflogen, nun schmerzte die Blase an den Zehen, die er sich auf dem Hinweg geholt hatte. Er hatte Tappeiner natürlich nichts verraten. Das wäre ihm peinlich gewesen. Vor allem, weil sie für das steilste Stück den Sessellift genommen hatten. Über der Baumgrenze waren sie durch das Geröll am Fuße der Ortler-Nordwand einen schmalen Steinweg bis zur Hütte emporgestiegen.
Saltapepe war bewusst, dass diese Hütte für wahre Bergsteiger nur eine Zwischenstation war. Dass man sich hier nicht über Blasen an den Zehen beschweren durfte. Dass man dafür mindestens bis zur Julius-von-Payer-Hütte gehen musste. Von dort aus gelangte man über einen Klettersteig und den Gletscher zum Gipfel. Die Normalroute,