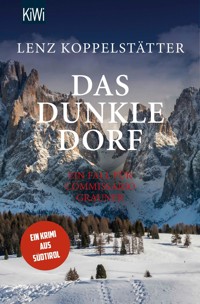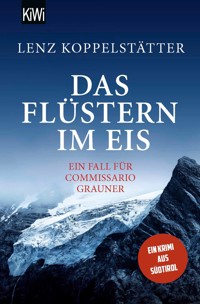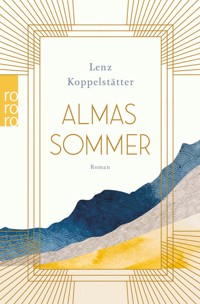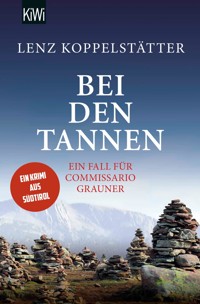9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Grauner ermittelt
- Sprache: Deutsch
Eine tote Bildhauerin, verhängnisvolle Marillen und ein gespaltenes Dorf: In seinem zehnten Fall folgt Südtirols beliebtestes Ermittlerduo den Spuren des weißen Goldes von Laas im Vinschgau bis nach New York. Die Felsen vor dem Marmorsteinbruch leuchten in den ersten Strahlen der Augustsonne. Doch Commissario Grauner hat nur Augen für die grausam zugerichtete Leiche zu seinen Füßen. Das Opfer war Bildhauerin in Laas, einem kleinen Ort im Vinschgau, in dem seit Jahrhunderten Marmor abgebaut und in die ganze Welt verschifft wird. In der Mordnacht wurden im Tal Marmorblöcke mit dem Fruchtfleisch von Marillen beschmiert, die als regionale Delikatesse gelten. Staatsanwalt Belli lässt es sich nicht nehmen, zum Tatort zu fahren, um davon zu kosten – und erleidet prompt Vergiftungserscheinungen. Wie hängen die Vorfälle zusammen? Ispettore Saltapepe und Silvia Tappeiner reisen derweil durch die USA und genießen die Zweisamkeit. Als die Spuren zu einem Architekten in New York führen, der den Südtiroler Marmor importiert haben soll, ist es vorbei mit der romantischen Ruhe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Lenz Koppelstätter
Ein Schimmern am Berg
Ein Fall für Commissario Grauner
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Lenz Koppelstätter
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Lenz Koppelstätter
Lenz Koppelstätter, Jahrgang 1982, ist in Südtirol geboren und aufgewachsen. Er arbeitet als Medienentwickler und als Reporter für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und Salon. Seit 2015 erscheint die Krimireihe um den Südtiroler Commissario Grauner, die ein großer Erfolg bei Leser:innen und Presse ist. 2024 startete mit „Was der See birgt. Ein Fall für Gianna Pitti“ eine weitere Krimireihe bei Kiepenheuer & Witsch, die am Gardasee spielt.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Eigentlich wollte Commissario Grauner in Frührente gehen. Mit seiner Frau Alba die Ruhe auf dem Hof genießen, Mahler hören, die Kühe füttern. Doch durch ein folgenreiches Missverständnis wurde daraus nichts. Im Gegenteil: Inmitten der Urlaubszeit, während Ispettore Saltapepe und Grauners Assistentin Silvia Tappeiner frisch verliebt durch die USA reisen, wird der Commissario in einen Marmorbruch im Vinschgau gerufen. In den frühen Morgenstunden wurde dort die Leiche einer Frau gefunden. Sie war Bildhauerin in dem kleinen Ort Laas, in dem das wertvolle Gestein seit Jahrhunderten abgebaut wird. In der Mordnacht wurden im Tal Marmorblöcke mit dem Fruchtfleisch von Marillen beschmiert, die als regionale Delikatesse gelten. Wie hängen die Vorfälle zusammen? Als es Hinweise gibt, dass ein New Yorker Stararchitekt in den Fall verwickelt ist, findet auch der Urlaub von Ispettore Saltapepe und Silvia Tappeiner ein jähes Ende.
Im Innern der Berge Südtirols und in den Straßen New Yorks ermitteln Commissario Grauner und sein neapolitanischer Kollege Saltapepe auf den Spuren des weißen Goldes.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2024, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Stefan Rotter/iStockimages; © Jafarxt/Depositphotos
ISBN978-3-462-31147-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:
www.kiwi-verlag.de/karten-ein-schimmern-am-berg
Inhaltsverzeichnis
Hinweis
Motto
Prolog
4. August
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5. August
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
6. August
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7. August
1
2
3
4
Epilog
Danke
Personen und Handlungen dieses Romans sind frei erfunden.
In Bezug auf Ortsbeschreibungen nimmt das Buch sich Freiheiten heraus.
Ist Gier gut? Die nach Wissen ist es. Die nach Materiellem ist es nicht. Sie frisst uns auf. Und mit uns die schöne Welt, die wir erschaffen haben.
Prolog
In so einen Berg hineinzugehen ist wie neu geboren werden. Oder sterben. Sebastian Hofer hatte das Dorf hinter sich gelassen und lenkte seine rote Vespa die kurvige Straße zum Bruch entlang. Den Jackenkragen hochgeklappt, fröstelnd. Nun fuhr er in den Schlund, stoppte vor der Felswand. Geboren werden? Sterben? Beides fühlte sich vermutlich ähnlich an, dachte sich Hofer. Wissen konnte er es nicht, an seine Geburt vor vierundvierzig Jahren konnte er sich nicht erinnern, an seinen Tod mochte er noch nicht denken, auch wenn er in seinem Leben allgegenwärtig war.
Im Marmorbruch von Laas, hoch oben am Hang, im Wald, war der Tod Tag für Tag sein Begleiter. Weil die Brucharbeiter, wie sein Vater einer gewesen war, wie auch er einer war, früher starben als die Männer und Frauen, die unten im Dorf lebten.
Weil, wie es hieß, und der Herr Doktor hatte es einmal bei einem Glas Weißwein nach dem sonntäglichen Kirchgang bestätigt, jeder Tag im Berg das Leben um einen halben Tag verkürzte.
Dreißig Jahre arbeitete der Hofer nun hier. Und wenn man die paar Samstage und Sonntage abzog, in denen er unten im Dorf geblieben war, dann musste ihn diese Arbeit rund ein Dutzend Jahre seines Lebens gekostet haben. Doch er war nicht sicher, ob es nicht mehr waren. Es hatte bei ihm mit einem Husten begonnen, so ein kehliger, der nicht mehr aufhörte.
Dann war das Kotzen dazugekommen. Zuerst nur morgens. Im Bad. Über dem Waschbecken. Blut, schnell weggewischt, runtergespült. Verdrängt.
Dann bei der Arbeit. Vor allen anderen. Rote Spritzer auf den schimmernden weißen Steinen.
Die anderen hatten schnell weggeschaut, mancher hatte sich bekreuzigt, einer hatte ihm, dem Blutkotzenden, als sie beide allein waren, auf die Schulter geklopft.
Schließlich hatte es ihn nachts ereilt. Im Schlaf. Rotes Leintuch.
Dann, aber wirklich erst dann, ging ein Brucharbeiter zum Arzt.
Die Marmorarbeiter von Laas waren stolze Männer. Was waren schon die paar verlorenen Jahre gegen das gute Geld, das sie bekamen. Der Doktor? War für die Weiber da. Wenn sie Magenschmerzen hatten. Oder Schnupfen.
Stolz, doch, stolz war der Hofer auch. Und wie.
Als er elf war, starb sein Vater am Husten und am Blut in der Lunge. Mit zwölf trieb er sich bereits hier oben herum. Weil er dort sein wollte, wo sein Vater sein Leben verbracht hatte. Im Dunkeln. Erst verscheuchten ihn die Arbeiter, dann ließen sie ihn machen. Mit dreizehn entdeckte die Frau Lehrerin in der Schule unten im Dorf das Weiß unter seinen Fingernägeln. Da wusste sie Bescheid.
Die anderen Kinder hatten schwarzen Dreck unter den Nägeln. Vom Spielen im Wald, von der Arbeit in den Gärten, in denen Marillen, Zucchini, Kürbisse und Tomaten sprossen. Der Hofer-Bub trug den Staub des weißen Goldes aus dem Berg mit sich herum. Das weiße Gold, das Laas so reich gemacht hatte. Das sich die Marmorarbeiter nie abwuschen, wenn sie nach Feierabend ins Gasthaus gingen. Zum goldenen Lamm.
Müllmänner wuschen sich, Metzger wuschen sich. Die Marmormänner nicht. Weil sie sich nicht schämten, weil es zu ihnen gehörte, das weiße Gold, das Reichtum, aber auch Zank in das Dorf gebracht hatte. Ist der Zank einmal da, in so einem Dorf, geht er nie wieder weg. Das wissen alle. Schlimmes wird passieren. Früher oder später. Das ist unvermeidlich.
Sebastian Hofer drehte sich nach rechts, zur dunklen, vom Ruß der Abgase beinahe schwarzen Steinwand, an der hier und da weißer Staub klebte. Er wusste blind, wo der Stromkasten stand. Er liebte diese Momente am frühen Morgen. Stets war er der Erste, der in den Stollen kam. Die anderen kamen erst gegen acht.
Die Neonröhren blinzelten, leuchteten grell auf. Hofer stieg wieder auf seine Vespa und fuhr tiefer in den Berg hinein. Vorbei an gestapelten und weiß glänzenden Marmorquadern, hinter denen seine Maschine stand. Sein Monster, wie viele sie nannten. Er selbst nannte sie Baby. Schon immer. Baby wirkte, als wäre sie einer Weltraumfantasie entsprungen. Halb Alien, halb Roboter stand sie auf schweren Panzerketten, an ihrem Stahlarm war eine große, runde Diamantsäge befestigt.
Mit vierzehn saß Sebastian Hofer zum ersten Mal auf dieser Maschine. Mit fünfzehn ließ ihn sein Vorgänger damit ein Stückchen fahren. Im Jahr darauf versammelten sich alle zu dessen Begräbnis unten im Dorf auf dem Friedhof. Staublunge.
Drei Tage später händigte der Hinterpichler Hans, der damals blutjunge Chef, dem Hofer den Schlüssel des Monsters aus. Der Hansi, wie der Chef von allen genannt wurde, war für ihn wie ein großer Bruder.
»Erzähl’s nicht groß rum, unten im Dorf«, hatte der Hansi gesagt und ihm die roten Backen getätschelt.
Hofer stoppte die Vespa, stieg ab. Er blickte zu Boden, entdeckte ein zerbrochenes Champagnerglas. Wie lange das Konzert gestern Abend wohl gegangen war? Diese Konzerte im Berg waren ein Irrsinn, dachte er, mit Klassik konnte er nichts anfangen. Ziehorgel und Gitarre, Tiroler Purismus, das gefiel ihm. Als er sich auf die Maschine hieven wollte, sah er weiter vorne etwas auf dem Boden liegen. Was war das? Ein Würstchen? Vom Bankett? Nein, er konnte dieses Event nicht leiden.
Der Brucharbeiter ging ein paar Schritte, bückte sich und hielt die Luft an. Das, was da auf dem Boden lag, war kein Grillwürstchen. Es war der Finger eines Menschen. Zart. Der Nagel blutrot lackiert.
Hofer rieb sich das Gesicht. Er hob den Finger hoch, die tote Haut fühlte sich kalt an. Ihm wurde übel, kurz schloss er die Augen, dann richtete er sich auf. Etwa fünfzig Meter weiter lag noch etwas auf dem Boden. Etwas Größeres. Ein Karton? Ein Müllsack? Ein Tier? Ein Hund? Er lief hin, auf halber Strecke erkannte er: Das war ein Stück eines Körpers, ein Torso. Hofer wankte, das Fleisch war zerfetzt.
Der Mann schluchzte und sah sich hastig um. Sein Blick fiel auf ein buschiges Bündel. Ein Kopf, das Gesicht nach unten. Er hustete, kehlig, er spuckte Blut. Schon wieder. Dann packte er die schwarzen, nassen Haare, hob den Kopf hoch und schrie.
»Annabel«, flüsterte Sebastian Hofer schließlich. »Was mache ich jetzt bloß?«
4. August
1
Der schimmernde weiße Streifen im dunklen Wald sah aus wie eine Skipiste, die sich im Zickzackkurs durch die Tannen und Fichten zog.
Soweit Grauner bekannt war, gab es im Vinschgau keine Piste, die bis ins Tal führte. Und überhaupt: Schnee? Jetzt, Anfang August? Der letzte Schnee war im März über Südtirol gefallen. Da hatte der Winter dem beginnenden Frühling noch einmal die Stirn geboten.
Als der Commissario den Waldrand erreicht hatte und mit dem Fiat Panda die Straße entlangfuhr, die nach oben führte, verstand er. Marmorstaub hatte sich auf die Erde, das Moos, die Steine und die Fichtenstämme gelegt. Wie Puderzucker sah er aus. Ein besseres Navigationssystem gab es nicht. Er musste nur den weißen Spuren folgen.
Zwischen den Bäumen blinkte ein blaues Licht, Grauner bremste. Die Kollegen waren bereits vor Ort.
Weiter vorne entdeckte er ein geöffnetes Tor im Maschendrahtzaun, dahinter parkten die Polizeiwagen, auch die Limousine von Staatsanwalt Belli sah er. Um eine Holzhütte stapelten sich Dutzende weiße Steinquader. Grauner schaltete den Motor aus. Klopfte seinem Panda – Automatik, Vierradantrieb – aufs Armaturenbrett.
»Brav, Panda, brav«, flüsterte er ihm zu, liebevoll, so wie er sonst nur mit seinen Kühen sprach.
Der Panda stöhnte noch ein bisschen. Dieses Stöhnen, ach, es klang so schön, es erinnerte ihn an das leise Muhen der Mitzi, der Josefina, der Mara, wenn er ihnen die Bäuche massierte.
Grauner stieg aus. Ein lauter Fluch mischte sich in das Rauschen des Waldes.
»Was ist los?«
Bellis Fahrer schimpfte mit hochrotem Kopf: »Oschtia, oschtia, oschtiamadonniga! Ich habe dem Herrn Staatsanwalt hundertmal gesagt, dass sich diese Lancia-Limousinen nicht dafür eignen, so steil bergauf zu fahren. In jeder Kurve komme ich ins Rutschen. Ab zwanzig Prozent Steigung muss ich in den ersten Gang zurückschalten. Mit einer Limousine im ersten Gang fahren! Das ist unwürdig.«
Grauner nickte.
»Hundertmal habe ich Belli gebeten, den Fuhrpark der Staatsanwaltschaft doch um so einen schönen, kleinen, kräftigen Panda zu erweitern …«, er zeigte auf Grauners Auto.
»Aber?«, fragte der Commissario.
»Dieser eingebildete Esel will nichts davon wissen. Er sagt, das könne er nicht riskieren. Wenn die Presse davon Wind bekäme! Man stelle sich das einmal vor: die Schlagzeilen! Die Staatsanwaltschaft von Südtirol fährt Panda! Im Kurier. Oder gar im Corriere. Die ganze Kollegenschaft würde sich über ihn lustig machen, von Mailand bis Palermo, sagt er.«
Grauner lehnte sich neben dem Chauffeur an die Hintertür des Lancia.
Der Mann fluchte leise weiter. Grauner stimmte mit ein.
»Porcoschtrigga, zittinziga, zoschzoschtrigga!«
Vor ihm in der Felswand klaffte ein riesiges schwarzes Loch. Polizisten und Spurensicherer in Schutzanzügen standen davor und steckten die Köpfe zusammen. Da drin lag sie wohl, die Tote, von der der Kollege am Telefon gesprochen hatte. Da drin wartete er wohl, der nächste Fall, von dem Grauner geglaubt hatte, ihn nicht mehr erleben zu müssen. Es war doch alles anders gekommen.
Grauner ließ den Chauffeur zurück, trat an den schwarzen Schlund heran. Ein Ziehen in seinem Magen ließ ihn innehalten. Er schluckte und ging schnellen Schrittes weiter, es blieb ihm nichts anderes übrig. Mit voller Kraft meldete sie sich erneut zurück, die alte Angst, wie vor zwei Jahren, nachdem er im hintersten Ridnauntal in einem Bergwerkstollen einen ersten Rückfall gehabt hatte. Es war töricht zu denken, er hätte sie für immer besiegt.
Er spürte, wie ihm die Luft wegblieb, beachtete die weißen Quader nicht, die sich links und rechts von ihm auftürmten, hastete voran, hatte bereits zweihundert Meter hinter sich gebracht. Er dachte an Alba, seine Frau, verfluchte sich selbst. Er hatte ihr nicht sagen wollen, dass diese verdammte Platzangst der Grund dafür gewesen war, dass er sie gestern Abend nicht hatte begleiten wollen. Zum alljährlichen Stollenklang, einem Konzert im Marmorbruch von Laas. Das berühmte Linzer Johannes-Brahms-Quartett war aufgetreten. Nun war sie sauer. So sauer wie noch nie.
Sie hatte bereits vor Wochen die Karten besorgt. Er hatte sich erst gefreut, dann war die Panik gekommen. Schließlich hatte er ihr gesagt, dass er nicht mitkommen wolle. Sie hatten gestritten. Das erste Mal seit … Nein, sie hatten sich auch vorgestern schon gestritten. Und am Tag davor auch. Und auch am Montag. Seit einigen Wochen stritten sie sich ständig. Dabei hatten sie sonst nie gestritten. Ihr ganzes gemeinsames schönes Leben lang nicht. Was war bloß los mit ihr? Mit ihm?
Einer der Polizisten trat an ihn heran. »Commissario?«
Grauner atmete langsam ein und aus. »Bringen Sie mich zum Fundort der Leiche.«
»Der ist gleich da vorne.« Der Mann zeigte im Schein der Neonröhren auf eine große Maschine mit einem runden Schneideblatt an einem Metallarm; das Ungetüm versperrte den Blick ins Innere des Bruchs. Neben ihr gingen ein paar der Spurensicherer eilig umher, einige knieten auf dem Boden, einer fotografierte.
Der Commissario entdeckte den Chef der Scientifica, Max Weiherer, dieser winkte ihn zu sich heran. Als Grauner ihn erreichte, zeigte der Mann auf die schwarze Plane, die neben ihm lag. Weiherer bückte sich, hob einen der Zipfel an. Der abgetrennte Kopf einer Frau kam zum Vorschein. Der Spurensicherer zog die Plane nun vollends beiseite. Da lagen der Torso der Frau, zwei abgetrennte Arme und zwei Beine.
»Was ist hier bloß geschehen?«, murmelte Grauner entgeistert.
»Das ist einfach zu beantworten«, antwortete der Spurensicherer unterkühlt. »Über die ist einer mit der Säge des Marmorschneidegeräts drübergefahren.«
Er zeigte auf die Maschine hinter ihnen.
Grauner lief ein Schauer über den Rücken, so kalt, dass er beinahe seine Platzangst vergaß. »Wo ist Belli?«, fragte er.
»Wer bin ich?«, fragte Weiherer zurück.
Der Commissario hob die Augenbrauen.
»Bin ich dein Assistent?«
»Du …« Nun verstand er.
Es kam einfach alles zusammen in diesen Wochen. Belli? Der Staatsanwalt war nach wie vor beleidigt. Alba? Sprach nicht mehr mit ihm. Und Ispettore Saltapepe? War mit Grauners Assistentin Tappeiner im Urlaub. Der Commissario hielt die Stellung. Was in Ordnung gewesen wäre, wenn es keinen Mord gegeben hätte. Aber so? Das war alles viel zu viel.
»Er ist irgendwo dahinten im Schlund«, sagte Weiherer nun doch.
»Danke«, hörte Grauner sich flüstern und bereute es sogleich. Er hatte sich doch nicht zu bedanken. Wofür denn? Für eine selbstverständliche Auskunft?
Der Commissario ließ Weiherer stehen, stampfte weiter. Vorbei an den Polizisten, vorbei an einer Vielzahl kleiner Maschinen und weißer Klötze, die vor der schwarzen Gesteinswand standen. Schon spürte er wieder, wie es ihm die Kehle zuschnürte, wie die Panik in ihm hochkroch.
Ein Schritt nach dem anderen. Schneller, noch schneller, als könnte er die Panik abhängen. Einatmen, ausatmen. Grauner biss sich auf die Lippen. Schmerz. Manchmal half das. Doch heute half es nicht. Ihm wurde schwindelig.
Der Tunnel beschrieb eine Kurve, dahinter standen Polizisten und Männer in dunkler Arbeitskleidung in einem Grüppchen zusammen. Auf dem Boden waren Holzplatten ausgelegt, hier hatte das Konzert stattgefunden. Die Stühle hatte jemand an der Seite aufeinandergestapelt. Vor einer der Wände standen Vespas. Grün, gelb, blau, orangefarben, schwarz. Fünf Stück.
Belli hatte dem Commissario den Rücken zugedreht. Der Staatsanwalt sprach mit erhobener Stimme, auf die weißen Klötze schauend, beinahe wie ein Priester in der Kirche.
»Das Schöne. Und das Hässliche. So nah beieinander. Das Böse, der Tod. Die Reinheit dieses Gesteins.«
Er drehte sich nun um, ging mit ernster Miene auf den Commissario zu. »Grauner. Gut, dass Sie da sind.«
Es war das erste Mal seit einer Ewigkeit, dass er etwas Nettes zu ihm sagte. Seit jenem verfluchten Missverständnis vor einem Jahr hatte der Staatsanwalt ihn, so gut es ging, ignoriert. Grauner hatte ihm damals beizubringen versucht, dass er in Frühpension gehen wolle. Belli hatte alles falsch verstanden, er hatte gedacht, der Commissario wolle sich nur beruflich verändern, aufsteigen, den nächsten Karriereschritt machen. So war eines zum anderen gekommen, und Grauner hatte an einem Nachmittag im letzten Herbst einem gewissen Manfredo Panebianco in Verona gegenübergesessen, dem scheidenden Leiter der Abteilung Polizia dell’immigrazione e delle frontiere, IV zona, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige. Und noch ein paar weiteren hohen Viechern, deren Namen ihm Belli eingetrichtert hatte, die er sich aber nicht hatte merken können. Sie hatten ihn gefragt, warum er denn glaube, der Richtige für diesen höchst verantwortungsvollen Job zu sein.
Das Bewerbungsgespräch hatte der Staatsanwalt ihm vermittelt, Grauner hatte nicht gewusst, wie er aus der Sache rauskommen sollte. Absagen war keine Option gewesen, also hatte er beschlossen, einen möglichst schlechten Eindruck zu hinterlassen.
Er hatte sich morgens nach der Stallarbeit nicht geduscht. Er holte während des Gesprächs einen holzigen Tiroler Akzent hervor, der ihn selbst überraschte. Eigentlich sprach er beinahe akzentfrei Italienisch, wenn er wollte. Er wollte jedoch nicht. Er wollte so hinterwäldlerisch wie möglich wirken. So hinterwäldlerisch, dass er selbst die Vorstellungen von einem Klischeesüdtiroler dieser Polizeischnösel in den Palazzi von Verona übertraf.
Er mischte ab und an ein Muhen in seine Argumentation, die mehr oder weniger darauf hinauslief, dass er Grenzen für überflüssig halte. Man stelle sich einmal vor, die Italiener hätten damals nicht nach Amerika gedurft. Enrico Fermi hätte nach dem Erhalt des Nobelpreises für Physik wohl dem faschistischen Regime in seiner Heimat dienen müssen, Rocky Marciano wäre wohl nie Schwergewichtsweltmeister im Boxen geworden, Francis Ford Coppola hätte wohl nie den Paten gedreht.
Und der Grenzschmuggel? Der internationale Drogenverkehr? Der interessiere ihn schon mal gar nicht. Das bisschen Haschisch, das er rauche, baue er selbst an. Zu Hause, auf dem Hof, hinter der Scheune, neben dem Misthaufen. Ob er denn so ein würziges Misthaufenmarihuana schon einmal probiert habe, fragte er den Mann, der in der Mitte der Kommission saß, diesen Manfredo Panebianco, der ihn daraufhin mit hochrotem Kopf hinausbat.
Aus seiner Versetzung und Beförderung nach Verona, zur Polizia dell’immigrazione e delle frontiere, wurde nichts, und Belli war beleidigt, auch weil er sich vor Panebianco – dessen Schwiegervater zudem einst Oberstaatsanwalt in Mailand war, worauf der Mann bei jeder Gelegenheit hinwies – mit Grauners Auftreten blamiert hatte.
»Das ist jetzt doch ein guter Moment, unseren Zwist zu begraben, Commissario, nicht? Auch wenn ich Ihnen das, was Sie mir in Verona angetan haben, wohl nie vollends verzeihen werde können. Diese Blamage! Diese brutta Figura! Mein Freund Panebianco, Sie hätten ihn hören sollen. Was der sich wohl dachte, mit was für, na ja, Höhlenmenschen, Steinzeitkommissaren ich es in Südtirol zu tun habe. Beinahe Mitleid hatte er mit mir. Che vergogna.«
Grauner setzte ein gequältes Lächeln auf. Er war froh, dass Belli Frieden schließen wollte. Aber ihm war auch klar, warum. Er brauchte ihn. Jetzt, da es einen Mord aufzuklären galt, ausgerechnet in der Urlaubszeit, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich mit ihm zu versöhnen.
»Wer ist die Tote?«, fragte er.
Bellis Miene verfinsterte sich. Der Staatsanwalt trat näher an den Commissario heran. »Was soll das, Grauner? Spinnen Sie?«
»W… was?«
»Bin ich etwa Ihre Assistentin?«
Grauner schluckte. Verdammt, er musste an seinem Ton arbeiten. Saltapepe und Tappeiner hatten sich daran gewöhnt, er war ihr Vorgesetzter, die störte es nicht. Mit Belli, klar, durfte er nicht so sprechen. »Ich, äh, nein, natürlich …«
»Tappeiner, wo ist die überhaupt?«
»Urlaub.«
»Und der Ispettore?«
»Auch.«
»Wie?« Der Staatsanwalt grunzte zornig. »Sie lassen beide gleichzeitig Urlaub nehmen?«
»Sie sind gemeinsam weggeflogen. In die USA, wenn ich das richtig …«
»Wie? Sind die jetzt richtig zusammen oder was?«
Grauner hob die Schultern, nickte dann leicht.
»Das geht nicht, keine Beziehungen am Arbeitsplatz. Das ist verboten, strengstens!«
Grauner schaute dem Staatsanwalt tief in die Augen. »Ich fürchte, die Liebe kann man nicht verbieten, Dottore.«
»Die Tote, das ist die Frau vom Lehrer unten im Dorf, vom Weissensteiner Norbert.«
Grauner zuckte zusammen, er hatte gar nicht bemerkt, dass zwei der Arbeiter an sie herangetreten waren. Einer mit einem roten Lockenschopf und ebenso roten Backen. Der zweite mit einem Spitzbärtchen und gletscherblauen Augen. Die anderen Männer und die Polizisten hatten mit etwas Abstand einen Halbkreis um den Commissario und den Staatsanwalt gebildet.
Grauner wiederholte murmelnd die Information. Die Tote kam wohl nicht aus dem Dorf. Ihr Mann, dieser Weissensteiner, der Lehrer, schon. In Südtirol wurde bei Personen, die zugezogen waren, zuerst der Name des Partners genannt. Man musste schließlich wissen, wem diese Person zuzuordnen war. Welcher Familie, welchem Clan. Auch wenn sie selbst schon seit Jahrzehnten im Ort wohnte.
»Das ist die Reiterer Annabel«, sprach der Mann mit den roten Locken weiter, »die kommt eigentlich aus dem hintersten Pustertal. Eine Künstlerin ist, äh, war die, eine recht bekannte. Die machte so Skulpturen aus Marmor. Engel, Heiligenfiguren, aber auch Auftragswerke. Büsten, Köpfe von Persönlichkeiten. Von Politikern, Wirtschaftsbossen, auch von unserem Chef hat sie schon eine gemacht, er schenkt ihr ab und an ein paar Marmorstücke …«
Grauner nahm den Rothaarigen und den Mann mit dem Spitzbart beiseite, ging ein paar Schritte mit ihnen, fragte sie nach ihren Namen.
»Ich bin der Sulzenbacher Josef«, sagte der Mann mit den Locken.
Der andere schwieg.
»Und das ist Olaf. Seinen Nachnamen vergesse ich immer wieder«, Sulzenbacher grinste. »Olaf ist erst seit einigen Monaten bei uns. Er kommt aus Tschechien. Oder war’s Polen? Vorher hat er jedenfalls bei den Marillenbauern als Erntehelfer gearbeitet, jetzt ist er einer von uns. Nicht wahr, Olaf?«
Olaf nickte. »Olaf Nowak«, sagte er dann mit einer tiefen, brummenden Stimme. »Vater Pole, Mutter Tschechin.«
»Gut«, sagte Grauner, dann stellte er all die Fragen, die er seit Jahren nicht mehr gestellt hatte. Weil er dafür Tappeiner hatte. Und wenn die mal nicht dabei war, dann hatte Saltapepe das übernommen.
Zehn Minuten später war der Commissario auf dem aktuellen Stand. Die Tote, Annabel Reiterer, war dreiundvierzig Jahre alt. Kinderlos. Sie und ihr Partner lebten in einem Häuschen am Dorfrand. Dort war auch ihr kleines Atelier untergebracht.
»Seit wann sind die beiden verheiratet?«
»Seit sieben Jahren, acht vielleicht. Zusammen sind sie schon etwas länger«, sagte Sulzenbacher, »bestimmt zehn. Soweit ich weiß, haben sie sich beim Wiesenfest in Schlanders kennengelernt. Kennen Sie das Schlanderser Wiesenfest, Kommissar?«
Grauner schüttelte den Kopf.
»Da wird ordentlich gebechert, wissen Sie! Da kann man sich gut kennenlernen. Weil, dass sich ein Mann und eine Frau jemals nüchtern kennengelernt hätten, das halte ich für ein Gerücht. Außer Adam und Eva vielleicht.«
Grauner antwortete nicht. Aber ja, vielleicht hatte der Mann recht. Auch er hatte sich einst ordentlich einen angetrunken vor seinem ersten missglückten Versuch, Alba zu erobern. Das war eine Geschichte, auf die er nicht besonders stolz war. Aber was soll’s. Die Alternative wäre gewesen, sie nie anzusprechen. Jemand anderem das Feld zu überlassen. Das wäre auch keine Lösung gewesen.
»War die Tote gestern Abend anwesend?«, fragte Grauner weiter, »beim Konzert?«
Sulzenbacher zuckte mit den Schultern, Nowak ebenso. »Wissen Sie, Herr Kommissar, wir verbringen fünf Tage die Woche im Berg, jeweils acht Stunden, das sind rund zweitausend Stunden im Jahr. Glauben Sie wirklich, wir Arbeiter kommen wegen so einem Geklimper abends auch noch mal hoch?«
Grauner verstand. Er überlegte kurz, ob er nach Feierabend ein klassisches Konzert im Hinterhof der Questura besuchen würde. Eher nicht. Nur wenn Mahler gespielt wurde, dann vielleicht schon.
»Wer hat die Tote gefunden? Und wann?«
»Der Hofer war’s«, sagte nun Nowak, »der Sebastian. Der ist immer als Erster im Bruch. Dem gefällt’s hier, dem Spinner! Der hat sie da liegen sehen. Also ihre Einzelteile zumindest.«
»Wer bedient normalerweise die große Schneidemaschine am Eingang vorne?«
»Auch der Hofer«, antwortete Sulzenbacher, »das ist sein Monsterbaby. Seit Ewigkeiten schneidet er damit den Marmor aus dem Felsen. Selten sitzt ein anderer darauf. Keiner kann das so gut wie er.«
Eine Weile schwiegen sie.
»Sebastian Hofer«, murmelte Grauner schließlich.
»War er’s, der Sebastian? Er war es also, oder? Er ist der Einzige, der den Schlüssel hat …« Nowak sah ihn abwartend an.
»Welchen Schlüssel?«
»Na, den für sein Monsterbaby.«
Grauner dachte an die große, alte Maschine, die bei der Leiche stand. Er fand es beinahe amüsant, dass man bei einem solchen Ungetüm einen kleinen Schlüssel brauchte, um es zum Leben zu erwecken.
»Der Schlüssel …«, begann Grauner.
»War er es also, der Sebastian?«, unterbrach ihn Nowak.
»Ich weiß es nicht«, antwortete der Commissario knapp.
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sebastian …«, ging Sulzenbacher dazwischen. »Der ist harmlos, so einer wie der Sebastian, der tut doch keinem was. Und der Annabel schon gar nicht …«
»Warum ihr schon gar nicht?« Grauner zog die Augenbrauen hoch.
»Weil … weil der … weil der ja auch ein bisschen verliebt war in die Annabel. Wissen Sie … wer liebt, der tötet doch nicht, oder?«
Grauner schwieg.
»Oder …?«
»Ich danke Ihnen für die Informationen«, sagte der Commissario schließlich. Nein, er wollte diesem Mann diesen naiven, schönen Glauben nicht nehmen.
Im Hintergrund heulte eine der Vespas auf. Die orangefarbene. Ein Arbeiter hatte sich auf sie gesetzt, ohne Helm, er wendete, dann fuhr er in Richtung Ausgang. Grauner verstand nicht viel von Motoren, aber so wie die krachte, war sie auffrisiert, hundertprozentig.
»Tausend Meter«, sagte Sulzenbacher, der Grauners fragenden Blick richtig gedeutet hatte.
»Tausend Meter?«
»Tausend Meter sind es bis zum Ende des Stollens. Da hast du keine Lust, das jeden Tag zu Fuß zu gehen.«
»Dann lieber mit mehr PS als erlaubt fahren und ohne Helm obendrein.« Grauner bereute seinen oberlehrerhaften Ton sogleich. Er lächelte schief.
»Die Verkehrsregeln, die gelten hier drin nur so halb, oder?«, fragte Nowak.
Grauner winkte ab. »Ich bin kein Verkehrspolizist.«
Nun grinsten auch die beiden Männer.
Der Commissario sah sich um, Belli war nirgends zu entdecken. Er verabschiedete sich von den Arbeitern und lief eilig zum Ausgang. Als er an den Polizisten vorbeikam, fragte er sie nach Hofer und erfuhr, dass der einem Nervenzusammenbruch nahe gewesen sei und man ihn zum Dorfarzt gebracht habe. Nun sei er zu Hause. Grauner ging weiter, an den Spurensicherern vorbei. Die Neonröhren am Stolleneingang blinzelten immer noch, von draußen schien das Tageslicht herein. Er sah Bellis Fahrer vor seinem Lancia stehen.
Bald hatte er es geschafft. Ohne Anfall. Ohne Zusammenbruch. Dann hörte er Schritte hinter sich, ein rasselndes Atmen. Noch nichts war gelöst in diesem Fall, sie standen noch ganz, ganz am Anfang, aber zumindest redete der Staatsanwalt wieder mit ihm. Auch wenn er die Zeit der Funkstille zwischen ihm und Belli zu Anfang genossen hatte, war er froh, dass sie vorbei war.
Belli erreichte ihn, wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»Ich habe Sie gestern vermisst, Commissario, Sie können Ihre schöne Gattin doch nicht alleine zu so einem unvergesslichen Abend gehen lassen! Wo waren Sie? So etwas lassen Sie sich doch normalerweise nicht entgehen.«
Grauner biss sich auf die Lippen. »Es ist wegen …«
»Ist es wegen damals, in Ridnaun?« Bellis Stimme klang ungewöhnlich sanft, beinahe kumpelhaft.
Der Commissario runzelte die Stirn. Die Stimmungsschwankungen des Staatsanwalts wurden mit den Jahren zunehmend schlimmer. Von einem Moment auf den anderen schien er seinen Groll vergessen zu haben.
Er nickte zögernd. Er hatte noch mit niemandem darüber gesprochen. Wie so oft, wenn er Probleme hatte, hatte er versucht, allein damit fertig zu werden. Da tickte er nicht anders als die meisten Polizisten. Über das, was wehtat, sprach man nicht. Das, was einen nachts in den Träumen heimsuchte, verdrängte man im Arbeitsalltag. Ein fester Handschlag am letzten Ermittlungstag, wenn der Fall abgeschlossen war, ein Blick, eine schnelle Berührung der Schulter. Diese Gesten sagten mehr als tausend Worte. Eigentlich. Und doch merkte er, dass es guttat, nun zu sprechen.
»Es ist … es lässt mich … Ich hatte das früher schon. Diese Angst in geschlossenen Räumen. Ich dachte vor Jahren, ich hätte sie überwunden.«
Die Hand des Staatsanwalts legte sich schwer auf seine Schulter. »Das mit dem Blut, Grauner, Sie wissen, dass ich …«
Natürlich wusste Grauner sofort, was er meinte. Alle wussten, dass Belli kein Blut sehen konnte.
»Falls Sie mal Hilfe brauchen, Commissario, es gibt da eine Psychologin in Haslach, Frau Dr. Dr. Frick, sie … ich … sie hat mir wirklich sehr geholfen. Sie hilft vielen. Blut, Platzangst, Drogen, Eheprobleme …«
»Eheprobleme!« Grauner trat einen Schritt zurück.
Belli schaute überrascht. »Nur als Beispiel, Commissario, nicht, dass ich dachte, dass … Ich meine, Sie und Ihre wunderbare Gattin …«
Der Commissario winkte ab. Sie gingen weiter.
»Was nun?«, wechselte Belli zu seiner Erleichterung das Thema.
»Nun sprechen wir mit dem Mann, der diese Monstermaschine bedienen kann. Der die Leiche gefunden hat. Mit Hofer.«
»Wir? Also, äh, ich, ich muss …«
Der Commissario ahnte schon, was jetzt kam. Der Staatsanwalt hatte keine Lust, sich mit dem Kleinklein der Ermittlungsarbeit zu befassen. Er suchte stets nach irgendeiner Ausrede, nach Bozen zurückzukehren, um sich erst wieder am Abend mit Grauner, Weiherer und der Gerichtsmedizinerin zu treffen, in der Hoffnung, dass sie bis dahin ein gutes Stück weiter waren.
»Ich, äh …«
»Ich weiß, Dottore, Sie müssen sicher zu einem ganz wichtigen Treffen in Bozen, aber ich bitte Sie, verschieben Sie es.« Er könnte sich durchaus Schöneres vorstellen, als den Staatsanwalt den ganzen Tag um sich zu haben. Aber er brauchte Unterstützung von oben, er konnte nicht alles alleine koordinieren, organisieren, in Auftrag geben. »Bleiben Sie mit mir in Laas. Waren Sie schon einmal in Laas?«
Der Staatsanwalt schüttelte mit überraschtem Gesichtsausdruck den Kopf. »Nur hier oben am Bruch. Gestern Abend. Unten im Dorf noch nie, nein. Südtirol hat über hundert Gemeinden, da kann ich doch nicht in jeder …«
»Laas ist besonders.«
Belli runzelte die Stirn.
»Laas ist nach Ihrem Geschmack.«
Sie hatten die Autos erreicht, blieben stehen. Der Chauffeur öffnete die hintere Tür der Limousine.
»Fahren Sie mich …« Belli sprach den Satz nicht zu Ende. Sein Magen brummte vernehmlich. »Eigentlich bin ich in Bozen zum Mittagess…«
»Sie werden staunen. Sie werden begeistert sein. Sie werden Ihren Kollegen in Verona und Mailand davon erzählen, was für prunkvolle Dörfer wir in den Bergen haben. Sie werden es nicht bereuen. Ich verspreche es Ihnen.«
»Fahren Sie mich hinunter ins Dorf. Und rufen Sie mein Büro an. Die sollen den Termin mit dem Präsidenten der Stadtpolizei verschieben. Auf nächste …, nein, übernächste Woch…, ach, auf nach dem Sommer. Der soll sich einen neuen Termin im September geben lassen, wenn ich aus Sardinien zurück bin.«
Der Chauffeur nickte.
»Stadtpolizei, braucht kein Mensch«, murmelte Belli und kletterte in den Fond des Wagens.
Grauner stieg in den Panda. Er drückte auf den Anlassknopf, folgte Bellis Limousine den weißen Zickzackweg hinab. Langsam, die Bremslichter des Lancia leuchteten unaufhörlich, der Motor jaulte.
»Auch«, flüsterte Grauner, »auch.« Er schaltete die Musikanlage an. Mahlers Zweite. Die Geigen wimmerten, die Bässe brummten. Die Auferstehungssinfonie. »Sulzenbacher, dieser rothaarige Brucharbeiter, er hat gesagt, dass Hofer auch ein bisschen verliebt war in die Annabel …«
Wer noch?
2
Nein, Claudio Saltapepe konnte sich nicht sattsehen an dem Lichtermeer von Las Vegas. Der Blick aus seinem Hotelzimmerfenster war fast so schön wie der von den Hängen des Vesuvs auf das nächtliche Neapel. Auf die Häuser, auf die gelben Lampen, die sich im schwarzen Hafenwasser spiegelten. Nur war hier alles viel bunter. Blau, rot, gelb, orangefarben. Und lauter, obwohl er nicht gedacht hätte, dass das möglich sei. Reifenquietschen, Polizeisirenen, Menschengeschrei.
Er war glücklich. Noch glücklicher als im Frühjahr 2023, als der SSC Neapel zum dritten Mal Meister geworden war. Ging das überhaupt?
Es ging. Er liebte seinen Verein, aber ja, das musste er zugeben, er liebte Silvia fast noch mehr, ihre gemeinsame wunderschöne Verrücktheit. Hatten sie es wirklich getan? Er befühlte den billigen Plastikring an seinem linken Ringfinger, sah Elvis Presleys lächelndes Gesicht wieder vor sich. In seinen Ohren hallten die Worte nach, die er beinahe gesungen hatte, mit dem typischen Elvis-Timbre: And now, Claudio, buddy, you can kiss your beautiful bride!
Die schönen gemeinsamen Tage, die sie verbracht hatten, nie würde er sie vergessen. San Francisco, Santa Barbara, Hollywood. Dann die Fahrt in die Wüste. Las Vegas, die Stadt, die wie aus dem Nichts vor ihnen aufgetaucht war. Sie waren stundenlang den Strip entlangspaziert. Sie hatten die fünfhundert Dollar, die sich noch in der Reisekasse befunden hatten, auf Rot gesetzt. Viertausend Dollar gewonnen. Noch einmal alles auf Rot. Alles verloren. Wenn du glücklich bist, ist so etwas egal. Völlig wurscht.
Sie teilten sich ein Porterhouse-Steak, vierhundert Gramm, tranken eine Flasche teuren Champagner dazu. Dann kam ihr die Idee, und er lachte nur, lauthals, nahm sie dann in den Arm, sie küssten sich und fragten den Kellner, wo man schnell heiraten könne.
Der Kellner erklärte ihnen alles, in einem Ton, der deutlich machte, dass nach dieser Auskunft täglich mehrmals verlangt wurde.
»Wollt ihr Elvis, den Papst, Batman, Spiderman oder George Bush?«
Saltapepe fragte vorsichtig, ob es denn auch ein Maradona-Double gebe, das sie trauen könne. Maradona, diesen Namen habe der Kellner noch nie gehört, ob das ein italienischer Basketballspieler sei.
Sie entschieden sich schließlich für Elvis und tranken den Champagner aus. Nun gab es kein Zurück mehr. Raus auf den Strip, etwa hundert Meter runter, dann links, neben dem Starbucks, da musste es sein. Dort, so hatte der Kellner gesagt, gebe es drei Elvis-Doubles zur Auswahl. Und einen Laden, der günstige Ringe im Angebot habe.
Silvia fragte, ob er wirklich ohne seine Mutter heiraten wolle. Es war unerträglich, an Mamma zu denken. An das, was ihr passiert war. Er hatte Silvia noch nichts erzählt. Für Mamma müssten sie eh noch einmal heiraten, sagte er ihr. In Neapel. In einer Kirche. Mit einem großen Fest.
»Wenn ich schon heirate«, sagte Silvia und blieb vor einer Drogerie stehen, »dann will ich mich vorher auch hübsch machen.«
Silvia machte sich sonst nie hübsch. Hübscher, als sie eh schon war, ging’s gar nicht, fand Saltapepe. Doch sie bestand darauf. Sie legte schwarzen Lidschatten auf, lackierte die Fingernägel pink – wenn schon, denn schon!
»Wir haben es tatsächlich getan«, flüsterte Claudio Saltapepe, Ispettore der Polizia di Stato, und schaute zu seiner Kollegin Silvia Tappeiner, die im Bett lag und schlief. Hinter den bodentiefen Fenstern schossen die Fontänen des Springbrunnens vor dem Bellagio