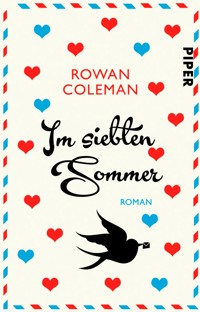9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Marissa stirbt, beschließen ihre beiden Töchter Luna und Pia nach Brooklyn, Marissas Geburtsort, zu reisen. Hier wollen sie mehr über das dunkle Geheimnis erfahren, das ihre Mutter jahrelang gehütet und sie schließlich zugrunde gerichtet hat. Doch die beiden Schwestern stoßen nur auf noch mehr Fragen, statt auf Antworten. Bis Luna eines Tages eine rätselhafte – ja, magische – Erfahrung macht: Sie begegnet ihrer Mutter als junge Frau, im Sommer 1977. Erst glaubt Luna, verrückt geworden zu sein. Doch dann wird ihr klar: Wenn sie tatsächlich die Fähigkeit besitzt, durch die Zeit zu reisen, dann kann sie auch die Vergangenheit ändern. Doch ist es möglich, das Leben ihrer Mutter zu retten, ohne ihr eigenes zu opfern?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Lily, die so klug, gütig und mutig ist,
und der das gesamte Universum zu Füßen liegt.
Übersetzung aus dem Englischen von Marieke Heimburger
ISBN 9783492977975
© Rowan Coleman 2017
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Summer of Impossible Things«, Ebury Press, London 2017
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2017
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: © serazetdinov / shutterstock.com, © lookus / shutterstock.com, © Curly Pat / shutterstock.com
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Cover & Impressum
Prolog
7. JULI 2007
1 – Wir befinden uns …
2 – Du hast jetzt keine …
3 – »Kannst du dir vorstellen, …
4 – Mir fällt auf, …
5 – Es ist derselbe …
6 – Ich sterbe. Das wird …
7 – »Bellamo hat ver-lo-ren …
8 – Die einzige Maßnahme, …
9 – »Alles in Ordnung mit …
10 – Ich hebe die Jeans …
11 – Die Halskette ist da, …
8. JULI
12 – »Das soll eine Anwaltskanzlei …
13 – Auf dem kurzen Weg …
14 – Kaum fällt die Tür …
15 – Die Zimmer im ersten …
16 – Pipi hält den Lichtkegel …
17 – »Oh Gott.« Ich schlage …
18 – »Luna. Die Leute gucken …
19 – »Manchen Leuten ist es …
9. JULI
20 – Als ich aufwache, …
21 – »Ich geh ein bisschen …
22 – Ich stehe auf der …
23 – »Du bist so …
10. JULI
24 – Pia sitzt auf der Treppe …
25 – »BROOKLYN RARITÄTEN-GALERIE« steht …
26 – »Komm, wir suchen Mums …
27 – Es ist schon dunkel, …
28 – Pipi wartet im Haus …
11. JULI
29 – Ich bin sofort eingeschlafen …
30 – Der wuchtige Bau …
31 – Gerade, als mir aufgeht, …
32 – »Was ist passiert?« Pipi sitzt …
33 – Das Licht schimmert …
34 – Als der Film fertig ist, …
35 – Es ist nicht das erste …
36 – »Da bist du ja.« Ich spüre …
37 – Auf der Tanzfläche herrscht …
12. JULI
38 – Die Morgendämmerung setzt bereits …
39 – Noch nie in meinem Leben …
40 – Lydia La Castillon straft …
41 – Wenn die Menschen an Geschichten …
42 – Watkins Gillespies Kanzlei ist …
43 – Dieses Mal gestaltet sich …
44 – Die junge Frau, die …
45 – Der Abend bricht nur langsam …
46 – Der private Teil von …
13. JULI
47 – Heute ist mein letzter Tag …
48 – Lupos Änderungsschneiderei hat …
49 – »Hallo, meine Liebe«, begrüßt …
50 – Ich bin ein bisschen früh …
51 – Plötzlich, wie aus dem Nichts, …
52 – Ich hatte nicht damit …
Epilog
Anmerkung der Autorin
Dank der Autorin
Quellenverzeichnis
»Manchmal denke ich bereits vor dem Frühstück an sechs unmögliche Dinge.«[1]
Alice hinter den Spiegeln, Lewis Carroll
Prolog
Oxfordshire, 6. Juni 2007
Zum ersten Mal, seit meine Mutter gestorben ist, sehe ich sie wieder, und plötzlich bin ich ein anderer Mensch. Mein Selbst löst sich auf, und von einer Sekunde auf die andere fühle ich mich als eine Fremde in meiner eigenen Haut.
Es gibt eine Theorie, dass man allein durch das Betrachten Einfluss auf die Umgebung nehmen kann, dass man allein durch den Akt des Hinschauens das Universum und seine Quantenfunktionen verändern kann. Die Physik nennt das den »Beobachtereffekt«. An dieses Phänomen muss ich denken, während ich das Bild meiner Mutter betrachte, wie es zitternd an die Wand projiziert wird.
Ich habe vor wenigen Sekunden erfahren, dass mein Vater – der Mann, der mich großgezogen hat und den ich liebe – nicht mein leiblicher Vater ist. Ja, durch den Akt des Hinsehens hat sich das Universum um mich herum verschoben und für immer verändert. Im Grunde hatte ich es schon immer geahnt. Ich hatte schon immer das Gefühl gehabt, nicht richtig dazuzugehören – meine Schwester so anders als ich, und meine blauen Augen einfach zu blau.
Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als weiter zuzusehen. Ich muss zusehen, ganz gleich, was kommt, obwohl dieses Zusehen alles komplett verändern wird. Das ist schlichte Physik. Aber es gibt keine Gleichung dafür, wie es mir dabei geht, das Gesicht der Frau vor mir zu sehen, die ich in den letzten acht Monaten jede einzelne Sekunde so schmerzlich vermisst habe.
Sie sitzt im Garten meines Elternhauses in Oxfordshire. Dieser Garten steht in voller, prächtiger Blüte – die von ihr beschnittenen Rosen, die von ihr gepflanzten Azaleen. Doch der Garten, in dem ich sie sitzen sehe, könnte sich genauso gut auf dem Mars befinden, so endlos weit entfernt scheint das alles. Meine Mutter ist außerhalb meiner Reichweite. Für immer. Der Wind spielt mit dem hellgrauen Baumwollkleid über ihren gebräunten Beinen, Silberfäden durchziehen ihr Haar. Ich sehe einen von den alten Küchenstühlen, seine Beine versinken leicht im weichen Rasen. Sie muss die Aufnahme im Spätsommer gemacht haben, denn die Rhododendren blühen, ihre dunklen Blätter glänzen in der Sonne. Wahrscheinlich letztes Jahr, kurz nachdem unser Vater nach mehreren Wochen des Bangens erfahren hatte, dass er doch nicht an Darmkrebs litt. Das hieß, sie wusste bereits letzten Sommer, viele Monate vor ihrem Tod, was sie tun würde. Die Erkenntnis schmerzt mich. Körperlich. Ein heißes Brennen in der Brust.
»Die Zeit vergeht wie immer …«, sagt meine im Bild festgehaltene Mutter, deren Haar im Wind weht, »aber ich stecke immer noch in der Vergangenheit fest. Oder zumindest ein Teil von mir. Wie ein Schmetterling bin ich aufgespießt von der einen Minute in der einen Stunde an jenem Tag, der mein Leben verändert hat.«
Ihre Augen schwimmen in Tränen.
»Um mich herum hatten wohl alle den Eindruck, dass ich ganz normal durchs Leben ging, wie alle anderen sechzig Sekunden pro Minute hatte, aber in Wirklichkeit stand ich still und dachte immer nur an diesen einen Moment, diese eine … Entscheidung.«
Sie verbirgt das Gesicht hinter ihren Händen, vielleicht möchte sie damit weitere Tränen zurückhalten. Als sie die Hände wieder in den Schoß sinken lässt, lächelt sie. Ich kenne dieses Lächeln gut: Es ist ihr tapferes Lächeln.
»Ich liebe euch, meine schönen Töchter.«
Diesen Satz hat sie fast jeden Tag unseres Lebens zu uns gesagt, und ihn jetzt wieder von ihr zu hören ist wie Zauberei. Ich möchte ihn am liebsten einfangen und in der Hand halten.
Sie lehnt sich auf ihrem Stuhl nach vorn, richtet den Blick direkt auf die Linse, direkt auf mich, und ich merke, wie ich zurückweiche, als glaubte ich, sie würde gleich die Hand nach mir ausstrecken und mich berühren.
»Diesen Film nehme ich auf als meinen Abschiedsgruß an euch, weil ich nicht weiß, ob und wann ich den Mut haben werde, es euch persönlich zu sagen. Das hier ist mein Abschied an euch, aber auch noch etwas anderes. Nämlich eine Botschaft für dich, Luna.«
Als sie meinen Namen ausspricht, kann ich förmlich ihren Atem an meinem Hals spüren.
»Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt will, dass du das hier siehst. Vielleicht siehst du es ja auch nie. Vielleicht ist der heutige Tag und diese Art und Weise die einzige Möglichkeit für mich, dir und Pia von meinem anderen Leben zu erzählen, von dem Leben, das ich neben dem Leben mit euch und eurem Vater führte, dem Leben in einem Paralleluniversum, in dem sich die Zeiger der Uhr nie weiterbewegen. Ja, ich glaube … Ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit. Hier und jetzt habe ich den nötigen Mut.« Sie schüttelt den Kopf, erneut glitzern Tränen in ihren Augen.
»Vor vielen Jahren ist mir nämlich etwas Schreckliches passiert, und ich habe auch etwas Schreckliches getan. Und seitdem verfolgt mich etwas, ein Geist, auf Schritt und Tritt. Ganz gleich, wohin ich gehe, er ist auch da, wie ein Schatten. Und ich weiß, ich bin mir sicher, dass ich eines Tages nicht mehr in der Lage sein werde, ihm davonzulaufen. Eines Tages wird er mich einholen. Eines Tages wird er sich rächen. Und dieser Tag ist nicht mehr fern. Wenn ihr das hier seht …«, ihre Stimme bohrt sich in mich, »… dann hat er mich bereits …«
Sie kommt so nah an die Linse heran, dass wir nur noch ein Viertel ihres Gesichts sehen können, und auch nur sehr unscharf. Sie senkt die Stimme und flüstert. »Wenn du ganz genau hinschaust, dann wirst du mich in Brooklyn finden, genau da und genau zu dem Zeitpunkt, den ich seither nie wirklich hinter mir lassen konnte. In unserem Haus, in meinem Elternhaus, da wirst du mich finden. Mich und die anderen Filme, die ich für dich gemacht habe. Luna, wenn du ganz genau hinschaust – wenn du herausfinden willst, was ich getan habe … Er wollte mich nicht loslassen. Bitte … du musst mich finden.«
7. JULI 2007
»Der Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist lediglich eine verbissen hartnäckige Illusion.«
Albert Einstein
1
Wir befinden uns in einer Art Blase, meine kleine Schwester Pia und ich. Wir sitzen im Schutz der ruhigen, kühlen Kabine eines klimatisierten Taxis und fahren durch uns unbekannte, brütend heiße Straßen in einem fremden Land. Wir kommen an Brücken und Gebäuden vorbei, die uns doch irgendwie bekannt vorkommen, weil sie immer wieder in den Erzählungen vorkamen, mit denen wir aufwuchsen. Keine von uns ist je hier gewesen, und doch ist ein Teil dieser Welt ein Teil unserer DNA.
Ich habe im Laufe meines Lebens viele in New York spielende Kinofilme gesehen, aber in der Realität sieht der Brooklyner Stadtteil Bay Ridge ganz anders aus, als ich ihn mir vorgestellt hatte: breite Straßen, maximal zwei Stockwerke hohe Häuser mit Holzfassaden – amerikanisches Kleinstadtflair gleich neben einer der größten und großartigsten Städte der Welt. Mir kommt es vor, als würde New York über den breiten Hudson hinweg nach Bay Ridge schielen und dabei gleichgültig mit den Schultern zucken.
Die Julisonne brennt vom Himmel, und es herrscht eine ruhige Atmosphäre. Die Fußgänger auf den Straßen wirken alle so gelassen, als wäre dies hier ihr ganz eigener, sicherer Ort, ein Ort, um den sich der Rest der Welt sonst nie kümmert, ein Ort, an dem Geheimnisse, wenn man sie gut versteckt, für immer unentdeckt bleiben. Hier können das Leben, die Liebe und der Tod sich leise entfalten, ohne dass es sonst irgendwo auf der Welt bemerkt wird. Fast kommt es mir vor, als würde die Zeit ein klein wenig langsamer vergehen, wenn man erst die Brooklyn Bridge hinter sich gelassen hat.
Dies ist die Welt, in der unsere Mutter aufwuchs, die Welt, aus der sie floh und in die sie nie wieder zurückkehrte. Uns war nie in den Sinn gekommen, dass ausgerechnet wir – Pia und ich – eines Tages eine Reise hierher unternehmen würden, eine Reise zurück an den Anfang des Lebens unserer Mutter. Offiziell sind wir hier, um ihren Nachlass zu regeln und den Verkauf eines heruntergekommenen, mit Brettern vernagelten Hauses in die Wege zu leiten, das ihr gemeinsam mit ihrer Schwester gehört hatte – einer Frau, mit der sie die letzten dreißig Jahre keinen Kontakt mehr hatte. Das Haus ist ihr Elternhaus und war viele Jahre ihr Lebensmittelpunkt. Inoffiziell und insgeheim sind wir hier, weil sie uns dazu aufgefordert hat. Weil sie möchte, dass wir sie suchen und etwas über meinen leiblichen Vater herausfinden. Mir kommt das immer noch alles wie ein böser Traum vor.
»Vielleicht hat sie da einfach nur was durcheinandergebracht«, hatte Pia gesagt, als der Film fertig war und aufgewirbelter Staub im Lichtstrahl des Projektors tanzte, den wir uns unbemerkt von unserem Vater geliehen hatten. »Ich meine, in ihren dunkelsten Phasen hat sie doch Wahnvorstellungen gehabt. Hat sich Sachen eingebildet. Vielleicht erzählt sie in Wirklichkeit nur von einem schrecklichen Albtraum und an der Sache ist gar nichts weiter dran.«
»Ja«, sagte ich. Langsam. Verunsichert. Ich ließ ihre Worte in mich hineinsickern. »Ja, könnte schon sein … aber …«
Ich sah meine Schwester an, und jetzt begann sie zu begreifen, was ich längst wusste. Meine strahlend blauen Augen, die einzigen blauen Augen seit Generationen.
»Aber du musst der Sache auf den Grund gehen«, beendete Pia den Satz für mich. »Die beiden haben sich so geliebt, vor allem damals, als sie aus Brooklyn weg ist und für ihn ihre Familie aufgegeben hat. Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen, dass da ein anderer Mann im Spiel gewesen sein soll … Und selbst wenn, dann ändert das ja nichts. Du bist immer noch du. Du bist immer noch unsere Luna.«
Pia konnte nicht wissen, dass ich mich zeit meines Lebens ein wenig fremd gefühlt hatte in unserer Familie. Ein klein wenig außer Takt. Und dass das, was unsere Mutter in ihrer Videobotschaft offenbart hatte, mir ein seltsamer Trost war.
Unser Vater hätte uns gerne begleitet, aber wir konnten ihn überzeugen, zu Hause zu bleiben. Selbst jetzt, Monate später, litt er immer noch enorm unter dem Verlust, und sein Blutdruck war so hoch, dass sein Arzt ihm von einer Flugreise abgeraten hatte. Von dem Video haben wir ihm nichts erzählt. Dabei hätten wir das tun können. Wir hätten ihn rundheraus nach der Wahrheit fragen und ihm dann glauben können. Aber genau das taten wir nicht. Es wäre zu grausam gewesen, ihm innerhalb weniger Monate nicht nur die Frau, sondern auch eine Tochter zu nehmen – auch wenn wir uns hinterher noch genauso lieben würden wie vorher. Ich war sicher, wenn er wüsste, dass ich es wusste, hätte ihn das zu sehr geschmerzt. Darum beknieten wir ihn, zu Hause zu bleiben bei unseren Freunden, die sich um ihn kümmern würden, während wir den Papierkram erledigten. Und vielleicht ein paar Geheimnisse entdeckten. Und einen Teil meiner selbst.
Der Teil, der meiner Mutter am meisten ähnelte, glaubte tatsächlich, sie würde irgendwo in Bay Ridge auf uns warten.
Ihre Schwester Stephanie hatte das Haus sofort verkaufen wollen, als ihr Vater, unser Großvater, 1982 starb. Ständig bekamen wir Post von irgendwelchen Anwälten, und obwohl ich nicht recht verstand, worum es dabei ging, bemerkte ich, dass meine Mutter auf jeden Luftpostumschlag mit Händezittern reagierte. Mum weigerte sich zu verkaufen, und sie gab nicht nach. Sie hatte ihre Gründe, in die sie uns nie einweihte, und vielleicht hatte sie das alles geplant, denn sie hatte ihre Hälfte des Elternhauses Pipi und mir vermacht.
Womit uns nun eine Finanzspritze beschert wäre, die wir beide sehr gut gebrauchen könnten. Einmal nach Bay Ridge fahren, das Haus zum Verkauf anbieten, und im Handumdrehen müsste genügend Geld herausspringen, um meiner Schwester wieder auf die Füße zu helfen, und zwar endgültig. Und ich finde vielleicht Antworten auf Fragen, die ich immer mit mir herumgetragen habe, ohne mir dessen bewusst zu sein.
Pipi – so nenne ich meine Schwester, seit sie geboren ist – sitzt da und verknotet nervös die Finger in ihrem Schoß. Ihre Fingernägel sind brüchig und abgekaut, ihre Knöchel gerötet und rau. Sie kämpft. Nicht im Sinne von prügeln. Aber sie kämpft. Jeden Tag. Gegen den Drang, zum Glas oder zu Tabletten zu greifen. Sie ist vierundzwanzig und seit acht Wochen trocken und clean. Letztes Mal hat sie achtzehn Monate durchgehalten, und ich dachte schon, sie hätte es geschafft – aber dann ist Mum gestorben, völlig unerwartet, ein totaler Schock. Ich habe getan, was ich konnte, um Pipi Halt zu geben inmitten der Trauer und des Chaos, die sie wegzureißen drohten. Aber ich war nicht stark genug.
Dieses Mal werde ich meine Schwester nicht hängen lassen.
Dieses Mal werde ich dafür sorgen, dass sie in Sicherheit ist. Wenn ich mich nur einfach an das halte, was wirklich zählt, an das, was wirklich wahr ist, dann werde ich sie retten können.
Ich lege die Kamera in den Schoß und nehme Pipis Hand. Sie sieht mich durch die rosafarbene, herzförmige Brille an, die sie am Flughafen gekauft hat.
»Wozu hast du eigentlich das olle Ding da mitgebracht?«, fragt sie mich und nickt Richtung Kamera. Es ist die alte Pentax meines Vaters. Die Kamera, durch die er unsere Mutter zum ersten Mal gesehen hat. »Für die würdest du bei eBay keine fünfzig Pfund mehr kriegen. Glaub mir, ich hab nämlich schon versucht, sie da zu verticken. Heutzutage ist einfach alles digital.«
»Ich weiß. Aber das hier ist mehr als eine Kamera, das hier ist ein … Relikt. Es ist ein Stück von Mums und Dads Geschichte, und abgesehen davon betrachte ich die Dinge gerne durch eine Linse. Ich dachte, ich könnte dieselben Sachen fotografieren, die Dad damals fotografiert hat, und ihm die Fotos dann zeigen. Seine Kamera ist ja zum Glück fit genug, um die Reise mitzumachen, im Gegensatz zu ihm, und ich dachte, das würde ihn freuen.«
»Wird es auch.« Pipi nickt. »Du hättest Fotografin werden sollen, nicht Wissenschaftlerin. Für eine Wissenschaftlerin bist du künstlerisch viel zu begabt.«
»Ich bin Physikerin«, erinnere ich sie. »Und ganz viel von dem, was ich tue, ist Kunst. Wie geht es dir?«
»Habe unbändigen Bock auf einen Drink. Oder ein paar Pillen. Oder beides«, sagt sie. »Aber gut, ich bin ja auch wach. Normal.«
Wir schweigen eine Weile.
»Aber wie geht es dir?«, fragt sie schließlich. »Jetzt mal ehrlich?«
Ich zögere. Die ehrliche Antwort wäre, dass ich unendlich wütend und traurig bin, eine Scheißangst habe, mich ziemlich verloren fühle und nicht sicher bin, ob ich je wieder festen Boden unter die Füße bekommen werde. Aber das behalte ich für mich. Unsere geliebte Mutter hat sich mit Tabletten das Leben genommen, und obwohl sich unser gesamtes Familienleben immer nur um ihre Depressionen gedreht hat, hatte das dann doch niemand kommen sehen. Keiner von uns konnte sie retten, und das kann ich mir nicht verzeihen. Und als wäre das nicht genug, weiß ich jetzt, dass ich zur Hälfte von einem Fremden abstamme, dass ich zur Hälfte eine Fremde bin, dass ich einen entscheidenden Teil meiner selbst nicht kenne, und das macht mich fertig.
»Ich glaube, die nächsten Tage werden eine ziemliche Herausforderung werden«, sage ich stattdessen mit Bedacht. »So ganz ohne sie. Ich hab immer gedacht, eines Tages würden wir alle zusammen herkommen – du und ich, Mum und Dad. Ich hab immer gedacht, die Geschichte würde irgendwann ein ordentliches Ende haben, alles würde sich lösen, und Mum würde es besser gehen. Ich dachte, Mum würde irgendwann glücklich werden. Ich hätte nie gedacht, dass sie …«
»Sich umbringt«, beendet Pipi meinen Satz.
»Oh Gott.« Ich senke den Kopf, die Schuldgefühle schnüren mir fast die Kehle zu – warum habe ich das nicht kommen sehen? »Wie kann das sein? Wie kann das wirklich und wahrhaftig passiert sein? Ich habe es nicht kommen sehen. Aber ich hätte es kommen sehen müssen. Ich hätte … Aber ihr schien es doch besser zu gehen. Sie wirkte so froh. Gelöst. Da habe ich mich entspannt, und das hätte ich nicht tun sollen.«
»Vielleicht ist es besser so«, sagt Pipi. »Dass wir alle es nicht kommen sahen.«
»Wie kannst du so was sagen?«
»Luna. Mum war völlig alle. Ständig hat sie sich angestrengt, glücklich zu sein. Unsere ganze Kindheit hindurch hat sie uns und Dad zuliebe tapfer gelächelt. Das hat sie fertiggemacht, aber sie hat durchgehalten, weil sie uns liebte. Ich war über ein Jahr lang trocken, du hattest deinen Doktor in der Tasche und wolltest mit Brian zusammenziehen. Dads Krebsverdacht hat sich in Luft aufgelöst. Meinst du nicht, dass sie vielleicht dachte, jetzt, wo bei uns allen alles läuft, kann sie endlich Schluss machen? Schluss machen mit dem Schmerz und gehen? Meinst du nicht, dass sie vielleicht deshalb glücklicher wirkte? Weil ein Ende in Sicht war?«
Ich weiß nicht, was ich darauf entgegnen soll, und sage nichts.
»Hast du Brian mal gesehen?« Pipi wechselt völlig unbeschwert das Thema – von einer für mich unerträglichen Angelegenheit zur nächsten.
»Nein.« Ich schüttele den Kopf. »Zum Glück nicht. Er ist einfach nicht der Typ Mensch, den man gerne sehen möchte, wenn das Leben … problematisch ist.«
Pipi schnaubt. »Das Leben ist problematisch. Ist klar. Unsere Mutter bringt sich um, und unser ›Leben ist problematisch‹. Ich nehm’s zurück, du bist die perfekte Wissenschaftlerin – durch und durch analytisch.« Ihre Worte treffen mich, was sie mir offenbar ansieht, denn jetzt nimmt sie endlich die alberne Sonnenbrille ab und neigt sich mir zu. »Du weißt, dass ich das nicht so meine«, sagt sie. »Und in Wirklichkeit kannst du von Glück reden, dass du Brian von dieser unerfreulichen Seite kennengelernt hast, sonst hättest du ihn womöglich noch geheiratet. Ist immer gut zu wissen, wer in einer echten Krisensituation zu einem hält. Und er … na ja, weißt schon.«
In der Tat. Ich war dahintergekommen, dass Brian am Tag von Mums Beerdigung einen kleinen Kurzurlaub am Lake District eingelegt hatte – mit einer anderen Frau. Vielleicht hätte es mich mehr schmerzen sollen, schließlich waren wir zwei Jahre ein Paar gewesen und hatten bereits übers Heiraten gesprochen, aber irgendwie machte mir dieser Seitensprung nichts aus. Als ich Brian verließ, wurde mir bewusst, dass ich ihn zwar aufrichtig mochte und respektierte, ihn aber nie wirklich geliebt hatte. Und er wusste das. Wenn ich zurückdenke, bezweifle ich auch, dass er mich je richtig geliebt hat. Ich glaube, er war mehr fasziniert von mir, weil ich so anders war, eine Anomalie – und genau das gefiel ihm als Neurowissenschaftler. Ich war eine Frau, die sich der rationalsten aller Wissenschaften verschrieben hatte, fest entschlossen, sich nicht von ihrem Geschlecht zurückhalten zu lassen – das tat die Welt der Physik, in der ich mich bewegte, bereits zur Genüge.
Im Rückblick wurde mir klar, dass ich mich zu Brian hingezogen fühlte, weil ich dachte, er würde mich verstehen. Ich dachte, er wäre wie ich, aber da hatte ich mich geirrt. Ihm gefielen nicht unsere Gemeinsamkeiten – er interessierte sich für unsere Gegensätze.
Vermutlich war es auch nicht gerade hilfreich, ihm von meinem Geheimnis zu erzählen. Das hätte ich besser bleiben lassen. Aber kurz nach Mums Tod sind mir wieder Dinge passiert, die ich zuletzt als kleines Mädchen erlebt hatte. Und in letzter Zeit passieren sie immer häufiger. Ich sehe Sachen. Menschen … Orte …
Die ich überhaupt nicht sehen kann. Die gar nicht da sind.
2
Du hast jetzt keine Zeit, verrückt zu werden, ermahne ich mich immer wieder. Viel zu viele Leute brauchen dich jetzt. Also reiß dich zusammen. Was anderes bleibt mir ohnehin nicht übrig. Professionelle Hilfe kann ich nicht in Anspruch nehmen. Binnen weniger Stunden würde es in der Forschungsgemeinschaft die Runde machen, dass ich ein psychisches Problem habe, und es ist für mich als Frau unter dreißig ohnehin schon schwer genug, als Forscherin ernst genommen zu werden. Da wäre ich ganz schnell nur noch »die Verrückte«. Und wenn eine Psychose oder Ähnliches festgestellt würde, dann würde diese mit Medikamenten behandelt werden, deren Nebenwirkungen Brian mir bereits sehr anschaulich geschildert hatte. Ich würde nicht mehr richtig denken können.
Und wenn es sich nicht um eine psychische Erkrankung handelt, wenn es die Symptome einer somatischen Erkrankung sind, dann … Egal, ich habe auch keine Zeit, krank zu sein. Das Beste ist, gar nicht dran zu denken und die Sache zu ignorieren.
So schlimm ist es ja auch gar nicht. Diese Episoden treten ganz plötzlich auf und sind genauso schnell wieder vorbei. Wie das Aufblitzen der Sonne, wenn sie auf Glas trifft. Falls es schlimmer werden sollte, kann ich es mir ja immer noch anders überlegen, aber im Moment ist alles gut. Ich meine, ich höre ja keine Stimmen oder so. Brian tippt auf eine Form von Epilepsie, aber ich wollte kein EEG machen lassen, weil ich keine Ergebnisse möchte, die mich zum Handeln zwingen würden. Brian hat mir von einem jungen Franzosen erzählt, der so viele winzige, aber nie nachlassende Anfälle hatte, dass er ständig ein Gefühl von Déjà-vu hatte, so, als hätte er alles schon einmal erlebt. Das Universum in unseren Köpfen birgt mehr Geheimnisse und Rätsel als das Universum, das uns umgibt und das ich schon mein ganzes Leben zu verstehen versuche. Dennoch bin ich sicher, dass die beiden im Grunde dasselbe Phänomen sind. Kein Medikament der Welt wird mich von dem trennen, was wirklich zählt.
Konzentration. Ich muss mich konzentrieren. Auf jede einzelne Sekunde. Auf alles, was wahr ist. Ich muss mich auf Pipi konzentrieren, auf Bay Ridge, auf alles, was wir hier zu erledigen haben. Ich werde versuchen, so oft es irgend geht durch Dads Kameralinse zu gucken, weil – keine Ahnung, wie sich das erklärt – diese … Episoden … offenbar nicht auftreten, wenn ich durch die Kamera sehe. Als wäre die Linse ein Filter.
Also los jetzt. Konzentration.
Ich habe nämlich wirklich absolut keine Zeit, verrückt zu werden. Wir sind da.
Das Taxi bremst ab und bleibt vor unserer Unterkunft stehen – der einzigen Unterkunft, die für diese Reise infrage kam, weil sie nämlich einer der Schauplätze der Liebesgeschichte unserer Eltern ist. Hier hat mein Vater gewohnt, als er für seinen ersten größeren Auftrag als freiberuflicher Fotograf nach Bay Ridge kam: Er sollte sich unter die Filmcrew mischen und hinter den Kulissen des ersten Kinofilms seiner Karriere fotografieren: Saturday Night Fever. Meine kleine Schwester und ich haben den Streifen bestimmt tausendmal gesehen – schon als Kinder, als wir eigentlich noch viel zu jung dafür waren.
»Das sind also die Straßen, durch die Mum und Dad so oft gezogen sind«, sagt Pipi, als wir aus dem Taxi steigen und unsere müden, von der langen Reise steifen Glieder strecken. »Wer weiß, vielleicht haben sie sich genau hier auf dem Bürgersteig geküsst. Oder da, unter dem Baum. Hey, ist das der Baum?«
»Nein, falsche Straße«, sage ich. Ich weiß ganz genau, wo der berühmte Baum sich befindet oder befand. Er steht auf der Liste der Orte, die ich aufsuchen möchte, ganz oben. Ich will sehen, ob es ihn noch gibt, und wenn ja, dann mache ich ein Foto von Mums und Dads in die Rinde geritzten Namen.
Während Pipi den Fahrer bezahlt, halte ich mir die Kamera vors Auge und suche nach demselben Bildausschnitt eines ganz bestimmten Fotos, das ich so oft in Dads Alben gesehen habe. Damals war dieses etwas heruntergekommene Haus hübsch und gepflegt gewesen, es strahlte Stolz und Akkuratesse aus – wie auch an den sorgfältig gepflegten Geranien in den Fensterkästen abzulesen war. Jetzt wirkt Mrs Finkles kleine Pension müde und farblos. Der ehemals makellose blau-weiße Anstrich blättert an vielen Stellen ab, das Blau ist grau geworden, das Weiß gelb wie Raucherzähne. Und doch gibt es immer noch jemanden, der dieses Haus liebt, das spürt man sofort. Ich lasse die Kamera sinken, als ich etwas entdecke, das nicht auf dem alten Foto von Dad war: Auf der Fensterbank gleich bei der Tür steht wie zur Begrüßung eine gut einen halben Meter große Figur der Jungfrau Maria. Sie steht ziemlich schief und neigt sich gefährlich dem Abgrund zu. Sie muss schon lange so riskant dastehen, ihre Farben sind verblasst, ihre gütigen Hände angeschlagen, ihre Augen weiß und blind. Ich sehe noch einmal durch die Linse und schaue dann ohne Kamera hin – ja, sie steht da wirklich.
»Luna und Pia, richtig?« Eine Frau, die nur Mrs Finkle sein kann, steht auf der obersten Stufe in der offenen Tür. Ich hatte ein Hauskleid und Lockenwickler erwartet, doch weit gefehlt. Mrs Finkle ist regelrecht elegant. Das einst vermutlich blonde, jetzt silbergrau glänzende Haar hat sie sich auf der einen Seite hinters Ohr gestrichen. In ihrer schicken weißen Hemdbluse und der hellblauen Jeans-Caprihose sieht sie eher aus wie Lauren Bacall und nicht wie Mrs Finkle. Ich muss lächeln. Ich mag es, wenn ich mich irre, denn sich zu irren ist viel spannender, als immer recht zu haben.
»Ja, genau, hallo!«, begrüße ich sie. »Wir sind Luna und Pia Sinclair.«
»Endlich!« Entzückt klatscht sie auf dem Weg die Stufen hinunter in die Hände, dann nimmt sie mich so fest in den Arm, dass sich mir die Pentax in die Brust drückt. »Lass dich anschauen!« Sie tritt einen Schritt zurück, die Hände auf meinen Schultern, und richtet ihre haselnussbraunen Augen auf mein Gesicht.
»O ja. Ganz klar. Die Ähnlichkeit ist da. Die Nase, die Ohren – und die Haare. Damals, als deine Mutter von hier wegging, da dachte ich, ich würde sie nie wiedersehen. Aber da ist sie: in dir! Ach, und auch in dir!« Sie wendet sich Pipi zu und nimmt sie genauso herzlich in den Arm wie mich. Ich liebe diese Frau schon jetzt. Ich liebe sie dafür, dass sie nichts zu meinen blauen Augen sagt und sich nicht laut fragt, wem ich wohl am ähnlichsten sehe – aber vor allem dafür, dass sie findet, dass ich meiner wunderschönen Mutter ähnele.
»Du hast die verrückten Haare von deinem Vater«, sagt Mrs Finkle und betrachtet lächelnd Pipis wirren Lockenschopf, der eigentlich genauso dunkel ist wie meiner, den sie aber bei jeder sich bietenden Gelegenheit bleicht. »Aber du hast auch was von deiner Mutter. Marissa Lupo trug das Kinn immer ein klein wenig höher als alle anderen. Du auch, wie mir scheint.«
»Echt?« Pipi fasst sich ans Kinn, dann lächelt auch sie. »Cool.«
»Na los, was steht ihr hier draußen rum? Ist doch viel zu heiß. Kommt rein.« Pipi schnappt sich ihre Tasche und folgt Mrs Finkle die sauber gefegten Stufen hinauf, vorbei an der Jungfrau Maria. »Ist wirklich unerträglich dieses Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wann wir zuletzt so eine Hitze hatten … Obwohl, doch, ich glaube damals, als euer Vater und die anderen Typen von der Filmcrew bei mir gewohnt haben. Die Hitzewelle von 1977 … Das war vielleicht ein Jahr!«
Ich habe ein Gefühl wie von einem winzigen Stromstoß in meinem Kopf, und das ist immer das erste Zeichen dafür, dass etwas passieren wird. Dann kommt es mir vor, als würde mich jemand beobachten, jeden Quadratzentimeter meiner Haut mit seinem Blick abtasten. Ich könnte versuchen, dieses Summen in meinem Kopf zu ignorieren und einfach ins Haus verschwinden – aber es würde nicht funktionieren. Diese Anfälle hören nur wieder auf, wenn ich mich ihnen stelle.
Während Pipi und Mrs Finkle bereits reingehen, bleibe ich draußen und sehe mich sehr aufmerksam um. Lasse den Blick bis zum Ende der nicht ganz unbelebten Straße wandern. Da steht, wie in goldenes Sonnenlicht getaucht, eine junge Frau und beobachtet mich. Das Licht tänzelt und schimmert, die Gestalt wirkt unscharf. Ich sehe sie nur eine Sekunde, dann ist sie weg und hinterlässt nichts als einen kühlen blauen Schatten. Mir ist schwindelig, ich schließe die Augen. Meine Knie werden weich. Mich schaudert. Ich halte mir die Kamera vors Gesicht und gucke noch einmal. Die Straße ist leer.
Konzentration. Auf das Hier. Und Jetzt.
»Was machst du da, Luna?«, fragt Pipi ungeduldig von der Tür aus und meint damit: »Bitte komm jetzt rein und hilf mir, mit dieser Frau Small Talk zu betreiben«. Ich werfe einen letzten Blick den Gehsteig hinunter und folge meiner Schwester dann ins Haus.
Unsere Gästewohnung ist ganz oben, unterm Dach. Wo die Grenze zwischen Mrs Finkles Territorium und dem ihrer Gäste verläuft, ist deutlich dadurch markiert, dass ihre Galerie gerahmter Fotografien einfach abbricht und eine saubere, weiß gestrichene Treppe beginnt. Die Wohnung ist schön hell und verfügt über ein kleines Schlafzimmer, ein Badezimmer, ein Wohnzimmer mit Schlafsofa und eine Küchenzeile.
»Euer Vater hat euch sicher erzählt, dass ich früher Zimmer vermietet habe«, sagt Mrs Finkle. »Alle Gäste mussten sich ein Bad teilen. Das waren lustige Zeiten.« Sie lächelt. »Aber heutzutage wollen die Leute mehr. Touristen habe ich nur selten zu Gast, die verirren sich kaum je nach Bay Ridge. Normalerweise mieten sich junge Leute hier ein, die eine günstige Bleibe wollen, damit sie es nicht so weit zur Arbeit haben. Ich habe mich so gefreut, als ihr angerufen habt. Meine letzte Mieterin ist mit ihrem Freund zusammengezogen und ich wollte gerade eine Annonce aufgeben. Kommt mir ein bisschen wie Schicksal vor, dass Marissas und Henrys Töchter jetzt bei mir unterkommen. Ich habe die beiden wirklich sehr gemocht.«
»Unser Vater spricht auch in den höchsten Tönen von Ihnen«, sagt Pipi, und das meint sie ganz ernst. Allerdings erwähnt sie nicht, dass Dad uns auch in epischer Breite erzählt hat, wie Mrs Finkle sich in einen der jüngeren Pensionsgäste verguckte und ihn nach allen Regeln der Kunst verführte. »Es tut ihm so leid, dass er nicht mitkommen und Sie wiedersehen konnte. Ich glaube, nachdem er sein ganzes Leben durch die Welt gegondelt ist und alles fotografiert hat, was schön und reich ist, genießt er es einfach nur, zu Hause in seinem Garten zu sitzen und die Hummeln zu beobachten.«
»Das tut mir so leid, das mit eurer Mutter. Und ich finde es auch schade, dass Henry nicht mitgekommen ist«, sagt Mrs Finkle und lächelt dabei etwas geheimnisvoll. »Das waren wirklich tolle Zeiten. Die Crew, die Schauspieler, die Aufnahmen. Ja, in dem Jahr hat es wirklich etwas Sternenstaub über Bay Ridge gerieselt! Und ich habe es in vollen Zügen genossen, dabei eine kleine Nebenrolle zu spielen. Wusstet ihr, dass Travolta fast mal mit zu mir nach Hause gekommen ist?«
»Echt?« Pipi grinst von einem Ohr zum anderen – ihre Hingabe und Bewunderung für Dads ersten größeren Auftrag als Fotograf ist grenzenlos. Sie hatte sich mal alle seine Fotos vom Set von Saturday Night Fever rahmen lassen und in ihrer Wohnung aufgehängt. Als wir jünger waren, hat sie sich den Film mindestens einmal pro Woche angesehen. »Hat er denn hier gewohnt?«
»Nein, nein. Und das war wohl auch besser so.« Mrs Finkle legt sich beide Hände ans Herz. »Sonst hätte ich wirklich für nichts garantieren können. Gott, sah der gut aus! Wie ein Michelangelo in Jeans. Aber jetzt richtet euch erst mal ein. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, immer gerne, und wenn nicht, ist es auch okay. Ihr habt sicher viel vor. Wollt ihr jetzt endlich das Haus verkaufen?«
»Ja, das haben wir vor«, antworte ich. »Ist jetzt wohl endlich der richtige Zeitpunkt.«
»Ja, das glaube ich auch.« Mrs Finkle nickt. »Es verfällt nun schon so lange vor sich hin, alle Fenster sind mit Brettern zugenagelt … Manchmal kommt es mir so vor, als wäre an der Straßenecke die Zeit stehen geblieben, seit eure Mutter von hier fortging. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, dann hat euer Großvater danach ja auch noch ein paar Jahre drin gewohnt. Aber in den letzten dreißig Jahren hatte ich immer, wenn ich daran hochsah, das Gefühl, eure Mutter dort sehen zu können, wie sie an der Feuerleiter lehnte, rauchte und wartete. Wartete und rauchte. Ich bin froh, dass ihr Warten jetzt ein Ende hat.«
3
»Kannst du dir vorstellen, wie Mum durch diese Straßen hier gegangen ist?«, fragt Pipi nach einem späten Abendessen in einer Burger-und-Pommes-Bar auf dem Weg zurück über die 4th Avenue. »Jung und sexy, wie auf den Fotos, die Dad von ihr gemacht hat. In Hotpants und mit Keilabsätzen. Ganz schön heißer Feger, damals.«
»Ja, kann ich mir vorstellen.« Ich denke dabei an ein ganz bestimmtes Foto, das erste Foto überhaupt, das Dad von ihr gemacht hat, das Foto, das ich in der Gesäßtasche meiner Jeans mit mir herumtrage.
Mum ist darauf zwanzig Jahre alt, ihre gebräunte Haut schimmert im Licht der Brooklyner Frühlingssonne, die sie blenden würde, wenn sie nicht schützend ihre schlanken Arme gehoben hätte. Ihr Gesicht liegt halb im Schatten, man sieht ihre leicht offen stehenden, mit Gloss geschminkten Lippen. Sie trägt ein gestreiftes Top, darunter keinen BH, und strahlt insgesamt eine so ungezwungene Sinnlichkeit aus, wie sie mir nie im Leben möglich wäre. Ich sah das Foto zum ersten Mal, als ich zwölf Jahre alt, ungelenk und etwas pummelig war. Die selbstbewusste Gelassenheit, die meine Mutter auf diesem Bild ausstrahlte, faszinierte mich damals so sehr, dass ich das Foto aus dem ohnehin nur selten betrachteten Album stibitzte. Nach Mums Tod fiel es mir plötzlich wieder ein, und ich hatte zunächst Angst, nicht gut genug auf dieses kostbare Bild von ihr aufgepasst, es womöglich verloren zu haben. Aber ich fand es wieder, ganz unten in einem Schuhkarton voller Fotos und Zeichnungen, die ich im Laufe der Jahre gesammelt hatte. Und seitdem trage ich es stets bei mir. Und heute Abend, wenn ich im Bett liege, werde ich es mir ansehen, bis ich einschlafe, und hoffen, von ihr zu träumen. Hier an diesem Flecken Erde, wo das Foto gemacht wurde.
»Sie hat sich immer so schön angezogen«, sage ich. »Hat jede Menge Blicke auf sich gezogen.«
»Das würdest du auch, wenn du mal aufhören würdest, dich wie ein sechzehnjähriger Junge anzuziehen.« Pipi zupft an meiner täglichen Uniform: weißes T-Shirt, verwaschene Jeans und Converse. »Und wie einer auszusehen. Ist echt gruselig, dass meine große Schwester jünger aussieht als ich. Kannst du nicht mal anfangen zu rauchen und zu trinken oder sonst was, damit du so alt aussiehst, wie du wirklich bist?«
»Ich ziehe mich so an, weil es in meinem Job von Vorteil ist, von den Männern so wenig wie irgend möglich als Frau wahrgenommen zu werden. Ich kann auch nichts dafür, dass ich jünger aussehe, meinst du etwa, das ist lustig, mit neunundzwanzig immer noch nach einem Ausweis gefragt zu werden?«
Unvermittelt bleibt Pipi stehen.
»Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot ist, Luna. Wie konnte sie uns einfach so verlassen? Ich fasse das nicht. Wie kann es sein, dass sie sterben wollte und keiner von uns was gemerkt hat?
Weißt du, wovor ich am meisten Schiss habe? Davor, dass mir eines Tages dasselbe passieren wird. Dass ich keine Kraft mehr haben werde für dieses Leben, dass alles einfach nur noch wehtut, so sehr wehtut, dass Sterben leichter ist, als am Leben und an den Menschen, die mich lieben, festzuhalten. Du bist da eher wie Dad, das sagt jeder – und jetzt komm mir nicht damit, dass er nicht dein leiblicher Vater ist, denn er hat dich großgezogen, und du bist genau wie er. Aber ich, ich bin wie Mum. Was, wenn eines Tages ich dran bin, Luna?«
»Das wird nicht passieren«, versichere ich ihr. »Ich werde nicht zulassen, auch noch dich zu verlieren, klar? Ich werde alles tun, um dir zu helfen.« Was ich nicht sage: Ich habe Angst, dass ich vielleicht eines Tages nicht mehr die Kraft haben werde zu kämpfen.
Da spurtet Pipi plötzlich die Stufen zu Mrs Finkles Haustür hoch und wieder runter – so schnell ist ihr Anfall von Schwermut verflogen.
»Komm, wir gehen da jetzt hin.«
»Wohin?« Ich kann ihr nicht ganz folgen, sie braust mit Lichtgeschwindigkeit von einem Gedanken zum nächsten.
»Na, zu dem Haus, in dem Mum aufgewachsen ist. Ist doch ganz in der Nähe, oder? Wir gehen da jetzt hin und gucken es uns gründlich an. Jetzt komm schon, ich kann eh noch nicht schlafen, ich muss irgendwas machen, da können wir doch genauso gut einfach hingehen und mal ein Auge darauf werfen.«
Da ist es wieder, dieses Summen in mir, es fängt in den Füßen an und kriecht immer höher. Ich wende mich von Pipi ab und schaffe es auf wundersame Weise, die Füße auf dem Boden zu behalten.
»Ich möchte da jetzt aber nicht hin«, sage ich.
»Warum denn nicht? Ist doch bloß ein kleiner Spaziergang.«
»Weil …« Selbst wenn ich ihr von dem Gefühl erzählen wollte, das mich gerade gepackt hat – ich könnte es nicht. Es ist eine Mischung aus Angst und der Überzeugung, dass irgendetwas Schreckliches passieren wird. Ich weiß nicht, warum, aber das Haus flößt mir Furcht ein.
Ich stelle es mir trostlos vor, seit Jahrzehnten verlassen und total heruntergekommen. Und ich komme nicht von diesem einen Gedanken los. Diesem einen schrecklichen, hirnrissigen Gedanken. Nämlich, dass Mum immer noch da ist. Dass sie in dem Haus gefangen ist, an Fenstern und Türen rüttelt und keinen Ausgang findet. Und ich habe Angst, dass ich sie, wenn ich jetzt dahin gehe, sehen werde, wie sie zwischen den Brettern, mit denen die Fenster vernagelt sind, hinausspäht.
Ich hole tief Luft und drücke die Fersen fest gegen den Asphalt. Konzentration.
»Soll ich euch einen Tee machen?« Plötzlich steht Mrs Finkle in der offenen Tür, und ich bin sehr dankbar, mich jetzt auf sie konzentrieren zu können, auf ihr langes Seidennegligé und ihre gepflegten Hände mit den im Licht der Straßenlaterne glänzenden Ringen.
»Mrs Finkle!« Pipi grinst mich an und zieht die Augenbrauen hoch.
»Ich schnüffele euch nicht hinterher«, beteuert Mrs Finkle. »Ich konnte nicht schlafen und habe euch hier draußen reden gehört. Ich habe bestimmt noch irgendwo etwas Kamille. Kommt rein, ich mache euch einen Tee und langweile euch mit alten Geschichten von eurer Mutter, bis ihr mich anfleht, endlich schlafen zu dürfen.«
»Klasse! Komm, Luna. Tee!« Pipi greift mit beiden Händen nach der Rettungsleine und springt die Stufen hoch.
»Ich muss nur eben …« Ich weiß nicht, was ich sagen soll. »Ich brauche einen Moment für mich.«
»Alles klar, ich lege den Schlüssel unter die Jungfrau«, sagt Pipi, und Mrs Finkle tritt einen Schritt zurück, um sie ins Haus zu lassen.
»Deine Schwester ist bei mir in guten Händen«, versichert sie mir. »Lass dir Zeit, Liebes.«
In der Stadt ist es endlich ruhig, ich bin alleine mit dem Halbmond, demselben Mond, unter dem Dad Mum immer nach Hause begleitet hat. Demselben Mond, der Zeuge so vieler Ereignisse ist.
Ich dachte, das elektrische Summen in meinem Kopf hätte nachgelassen, aber auf einmal verstärkt es sich wieder, flammt regelrecht in mir auf, und ich weiß, dass da irgendwas ist. Irgendetwas ganz Kleines, am äußersten Rand meines Blickfeldes. So klein, dass ich normalerweise überhaupt nicht darauf achten und einfach nur hoffen würde, dass es wieder verschwindet. Aber dieses Mal kann ich es nicht ignorieren. Ich kann es nicht ignorieren, weil es mich ruft.
Ein Ding der Unmöglichkeit, ich weiß. Und doch passiert es.
4
Mir fällt auf, wie die Straßenlaternen aufflackern, begleitet von einem unschönen Geräusch wie von etwas, das reißt, und als ich aufsehe, drehen sich die Sterne um mich herum und strahlen viel heller als die Stadt unter ihnen.
Ich bin in Bewegung, ich werde weggerissen. Keine Ahnung, wie das vor sich geht, aber so ist es. Ich will mich an dem Treppengeländer festhalten, doch meine Finger greifen ins Leere, und ich weiß nicht mehr, was echt ist und was nur eingebildet. Ich bin in Bewegung, aber ich weiß weder warum noch wie. Dann sehe – nein, spüre – ich, wohin. Es fühlt sich an wie ein Schlag in die Magengrube.
Mums Elternhaus. Das Zuhause meiner Mutter. Seine Silhouette ragt in den Nachthimmel, die Fenster sind blind und ausdruckslos, mit Brettern vernagelt, ein Maschendrahtzaun mit Warnschildern umgibt es. Es ist überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es ist keine düstere Spukschlossruine. Es ist ein Zufluchtsort.
Das Gebäude wird durch eine schmale Gasse von den Nachbargebäuden getrennt und steht dadurch ein klein wenig abseits – wie ein einsamer Wachposten auf der Ecke. Ich konzentriere mich mit aller Macht darauf, zwinge mich, in Bewegung zu bleiben, und stelle fest, dass ich den Geschmack von Ziegelsteinen und Mörtel im Mund habe. Binnen weniger Sekunden bin ich da, aber mir kommt es vor, als würde ich mit jeder Sekunde langsam weiter auseinandergezogen, als würden kleine Brocken meines Bewusstseins eine Spur hinterlassen.
Die Maschen des Sicherheitszauns tanzen um mich herum, und plötzlich falle ich dagegen, so schwer, dass ich das Gefühl habe, hindurchbrechen zu können durch den Zaun, durch den Asphalt und in den darunterliegenden Schlamm und Lehm. Ich hoffe inständig, der Zaun möge nachgeben, und kaum denke ich den Gedanken, passiert genau das. Ich falle auf die andere Seite des Zauns, stolpere die schmale Gasse hinunter, kollidiere immer wieder mit den Hauswänden, ramme mit Schultern und Ellbogen dagegen. Der Boden unter meinen Füßen verschwindet, ich taumele in den schmalen Spalt zwischen den Häusern, bis ich eine winzige Betonplatte vor einer Seitentür entdecke. Kurz darauf – oder auch eine Million Jahre später – knicken meine Beine unter mir weg, und ich lande unsanft auf dem Boden. Über mir zwischen den Häusern sehe ich einen schmalen Streifen Himmel. Ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich beobachte, echt ist oder Einbildung, aber der Himmel öffnet sich nach innen, nach oben und Flammen schlagen aus ihm hervor. Ich schmecke Asche, dann verschlingen sie mich.
5
Es ist derselbe Mond. Das ist mein erster Gedanke, noch bevor ich die Augen wieder öffne.
Ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos war oder was passiert ist, aber ich bin froh, dass ich nicht tot bin. Ich lege mir die Hand auf die Brust – mein Herz schlägt schnell und unregelmäßig, aber es schlägt.
Ich bleibe noch ein bisschen liegen, nehme den kühlen Beton unter Schulterblättern und Po wahr. Ich muss eine ganze Weile weggetreten gewesen sein. Während der Nebel sich langsam lichtet, spüre ich die schmerzhafte Überdehnung der Sehnen in meinem Hals. Auch die Wirbel tun weh, als ich den Rücken strecke, aber was bleibt mir anderes übrig. Pipi wird sich fragen, wo ich bin. Auch ich frage mich, wo ich bin.
Ist das jetzt der entscheidende Zwischenfall? Der, nach dem ich wirklich endlich einen Arzt aufsuchen sollte?
Vorsichtig öffne ich die Augen. Was mich einige Anstrengung kostet, weil meine Lider bleischwer sind. Ich erwarte, wieder den schmalen Streifen Nachthimmel zu sehen, nein, ich erwarte, in ihm verschwunden zu sein und auf die Straßen von Brooklyn hinabzublicken. Doch der Himmel ist immer noch da, wo er hingehört, und ich atme erleichtert auf.
Ich setze mich auf, lehne mich an die Seitentür und warte, bis mir das Blut nicht mehr in den Ohren und Schläfen rauscht. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich so einen Zusammenbruch befürchtet, seit ich von Mums Tod erfuhr. Seit jenem schrecklichen Anruf von Dad, der mit erstickter Stimme das aussprach, was einfach nicht sein konnte. Dieser Augenblick wurde zu einer Art Achse, zu einem Hebel, auf dem seither mein ganzes Leben balanciert. Der Tod meiner Mutter hat mich über alle Maßen bedrückt. Jetzt, nachdem ich ihren Film gesehen habe, zerbreche ich vielleicht daran.
»Wir entschuldigen uns für die Sendestörung, in Kürze geht es weiter mit der normalen Luna«, flüstere ich, und der Klang meiner eigenen Stimme ist mir ein Trost. Es gibt mich also noch.
Ich ruhe mich ein wenig aus. Ich höre die Stimmen von Jugendlichen irgendwo auf der Straße. Sie sprechen mit so ausgeprägtem Akzent, dass ich kein Wort verstehe. Oder ist das Spanisch? Ganz langsam beginnen meine Augen wieder scharf zu sehen, und mir fallen kleine, aber feine Unterschiede auf zu dem, was ich sah, bevor ich … Ja, keine Ahnung, was da eigentlich gerade passiert ist. Die riesigen Müllcontainer, in die ich gerade gekracht war – oder etwa nicht? –, sind weg. Stattdessen stehen links von mir einige altmodische Metallmülltonnen, randvoll mit vergammelndem und stinkendem Abfall. Da hat wohl jemand vergessen, den Müll zu trennen. Ich wende den Kopf ab, weg von dem beißenden Gestank, und begreife, dass das Dröhnen in meinem Kopf gar nicht aus meinem Kopf kommt, sondern aus dem Haus.
Ja, genau, durch die grasgrüne Tür dringt ein langsamer, rhythmischer Bass. Mein Schwindel legt sich, und ich bemerke, dass der Zaun, der doch gerade noch das Grundstück umgab, weg ist und die schmale und bedrückend finstere Gasse plötzlich offen und weit. Ich lasse den Blick Richtung Straße schweifen, auf der ein Auto vorbeirollt. Sieht ziemlich alt aus. Ein typischer Amischlitten. Könnte glatt aus einer Folge von Starsky & Hutch stammen. Das lose Auspuffrohr schleift lärmend über die Straße, aus den offenen Fenstern hängen junge Männer und rufen und pfeifen irgendeiner Frau hinterher, die ich nicht sehen kann.
Ich drehe mich wieder um und versuche herauszuhören, wo genau die Musik herkommt. Obergeschoss. Ich spüre Wut in mir. Was fällt denen ein? Das ist Mums Haus, da haben die nichts verloren!
Mir bleibt nichts anderes übrig, ich muss da rein. Ich bin immer noch etwas wacklig auf den Beinen, als ich auf die Tür zugehe. Ich staune über den bizarren Messingtürklopfer in Form eines Löwenkopfes und die Klinke, die eigentlich aussieht wie die einer Zimmertür. Ich drücke sie herunter, es ist nicht abgeschlossen. Wie viel auch immer Tante Stephanie dieser Sicherheitsfirma dafür zahlt, auf das Haus aufzupassen – sie zahlt zu viel.
Zwei Neonröhren erleuchten das, was wohl mal die Nähstube gewesen war. Erstaunlich, dass die Eindringlinge es geschafft haben, für Strom zu sorgen. Ich sehe mich in dem Raum um und werde richtig sentimental – ich habe das Gefühl, ihn zu kennen. Mum hat uns so oft von ihrer Kindheit und Jugend in diesem Haus erzählt. Zum Beispiel davon, wie ihre Mutter ihr beigebracht hat, mit einer Nähmaschine umzugehen, sie war damals ungefähr im gleichen Alter wie ich später, als sie es mir beibrachte.
Ich sehe mich um. Erstaunlich. In den Regalen befinden sich immer noch Stoffballen – orange, lila, gemustert, gestreift. Auf einem langen, im Neonlicht glänzenden Tisch stehen zwei Nähmaschinen, die so gut und neu aussehen, dass ich mich frage, ob sie wohl noch funktionieren. Tante Stephanie muss alles genau so gelassen haben, wie es immer war, als sie Anfang der 1980er hier auszog. Ich komme mir vor wie in einer Zeitblase. Wollte sie ein Denkmal hinterlassen? Oder gar eine Gedenkstätte?
Ich gehe weiter. Am Fuß der Treppe wird Hotel California deutlich lauter.
Von einem Adrenalinschub angetrieben laufe ich die Treppe hoch und reiße die Tür zu dem Zimmer auf, aus dem die Musik kommt. Ungefähr sechs Leute drehen sich um und gucken mich an. Und da fällt der Groschen. Erleichtert lache ich auf. Das sind keine fiesen Drogenhändler mit einer Schwäche für Prog-Rock, das sind junge Leute, jünger als ich, Studenten vielleicht, und das hier ist eine 70er-Party. Alle haben sich perfekt verkleidet. Alles strahlt in Knallfarben, als würde ich durch die Linse meiner Pentax gucken.
»Hoppla. Wer bist du denn?«, begrüßt mich ein eher stämmiger, blonder Typ mit einem süffisanten Grinsen.
Zuerst weiß ich nicht, was ich antworten soll, schließlich habe ich gerade ziemlich wütend die Tür aufgerissen, aber jetzt … Das hier sieht doch eigentlich richtig nett aus.
»Ach, ich kam hier grad so vorbei und hab die Musik gehört.« Ich betone meinen britischen Akzent und lächele. »Die Tür war offen, darum bin ich einfach reingegangen.«
Die jungen Leute beäugen mich neugierig und nicht die Spur so, als hätte ich sie bei etwas Unerlaubtem erwischt. Es sind sieben. Die Jungs trinken Bier aus Flaschen, die Mädchen nippen an weißen Pappbechern. Geschlechtertrennung. Die nehmen ihr Hobby ja ganz schön ernst. Ich sehe mich um. Eine Ablage voller Schmuck, eine Stehlampe, die warmes, oranges Licht verbreitet, ein Sofa mit knallgelben Kissen, und in der Ecke sehr prominent ein Fernseher mit Holzverkleidung und einer Bildröhre, in deren Rundung sich das Zimmer spiegelt. An der Wand darüber hängt ein Elvis-Kalender, aufgeschlagen ist Juli 1977, der mit Klunkern behangene King schwitzt und singt in ein Mikrofon. Auf dem Couchtisch liegt zusammengefaltet eine aktuelle Ausgabe der Daily News, auf der das Fahndungsfoto von einem »Son of Sam« zu sehen ist.
Hier stimmt wirklich jedes Detail. Im Kalender ist sogar ein Kreis um das heutige Datum, und jemand hat mit Hand »Pops weg« hineingeschrieben.
»Mann, wie redest du denn?« Ein hochgewachsener Bursche mit dunklem, gewellten Haar und breiten Schultern kommt lächelnd auf mich zu. »Bist wohl nicht von hier, was?«
»Nein, ich komme aus London«, antworte ich, und seine grünen Augen und dichten Wimpern entwaffnen mich ein wenig. Ich mache zwei Schritte rückwärts, um seinem neugierigen Blick auszuweichen, der sich von meinem weiten weißen T-Shirt offenbar nicht abschrecken lässt. Ich kann sehr gut mit Männern reden – wenn sie Wissenschaftler sind. Die präzise Sprache, die sie so gut verstehen, spreche ich fließend, und wenn sie mich dann plötzlich anziehend finden, dann ist das ihre ganz normale Reaktion darauf, dass ich weiß, wovon ich rede und einen Busen habe. Mit Männern oder Jungs, die einfach nur hammergut aussehen, kann ich gar nicht gut reden. Mit Brian hat es nur deshalb funktioniert, weil mir lange Zeit überhaupt nicht aufging, dass er auch gut aussah. Aber der hier, der ist ganz klar zum Anbeißen. Und darum gerate ich aus dem Konzept.
»Äh, ja, also, ich geh dann mal wieder«, stammele ich und erröte. »Es ist nur … also, das Haus hier, das gehört meiner Familie, und darum … Also, wenn ihr geht, dann seid doch so nett …«
»Was redest du denn für einen Blödsinn?« Ein Mädchen mit Kurzhaarfrisur – im Nacken ganz kurz, oben etwas länger und gelockt – kommt auf mich zu und baut sich vor mir auf. »Das Haus gehört ganz bestimmt nicht deiner Familie. Es gehört nämlich uns. Meinem Vater. Jeder einzelne Stein.«
»Wie man nie müde wird, uns zu erzählen.« Der blonde Typ knufft den Grünäugigen in die Rippen.
Das Mädchen mit den kurzen Haaren steht direkt vor mir und sieht mich aus ihren braunen Augen durchdringend an.
»Ich wollte wirklich nicht stören«, erkläre ich ihr, während ich mich gleichzeitig frage, woher ich diese Stupsnase kenne, die in ihrem eher kantigen Gesicht so deplatziert wirkt. »Ich sehe schon, dass ihr euch echt Mühe gegeben und ziemlichen Aufwand betrieben habt. Ich wäre euch nur wirklich dankbar, wenn ihr nachher alles so hinterlasst, wie ihr es vorgefunden habt.«
»Hat die sie noch alle?«, fragt das Mädchen, den Daumen auf mich gerichtet, die anderen.
Dann spüre ich es plötzlich wieder, diesen Lockruf, diesen Sirenengesang, wie er mich durchdringt. Und schließlich fällt mein Blick auf das Mädchen hinter der Stupsnasigen. Es sitzt auf der Rücklehne eines braunen Sofas und hat die Füße unter die Sitzkissen geschoben.
Mein Herz stockt. Ich habe das Gefühl, als würde sämtliche Atemluft binnen einer Sekunde aus mir herausgesaugt. Ich starre die junge Frau an. Sie hat die schlanken Beine übereinandergeschlagen, ihr langes, dunkles Haar fällt ihr über die Schultern.
Tränen schießen mir in die Augen und ich versuche, sie wegzublinzeln.
Die Frau ist meine Mutter. Nicht so, wie ich sie zuletzt gekannt habe, sondern viel jünger, als ich sie je gekannt haben kann. Das hier ist die Frau, die mein Vater 1977 fotografierte.
Da fällt mir die Kamera um meinen Hals wieder ein. Ich halte sie mir vors Gesicht und gucke durch den Sucher. Mum ist immer noch da.
Und sie sieht mich.