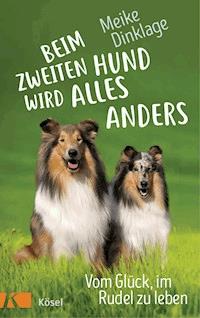
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
»Ich will einen zweiten Hund. Und mit dem mache ich dann alles richtig«, denkt sich Meike Dinklage. Mittlerweile lebt sie mit den beiden Collies Sam und Fee und beschreibt den mal haarsträubenden, mal sehr berührenden, aber immer äußerst amüsant zu lesenden Weg zum Rudelglück. Sie schildert die Höhen und Tiefen der Hundeerziehung, Erlebnisse mit Hundetrainern und anderen Hundehaltern; ihre Erfahrungen im Hundesport, vor allem aber ihren nicht immer ganz gelingenden Versuch, im Rudelzusammenleben alles richtig zu machen. Ein unterhaltsamer Erfahrungsbericht, der alle Tipps enthält, die man braucht, um glücklich mit zwei und mehr Hunden zu leben.
- Das erste Buch über den zweiten Hund
- Der unterhaltsame Bericht einer Hundeliebhaberin, die nicht genug bekommen kann
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
»Ich will einen zweiten Hund. Und mit dem mache ich dann alles richtig«, denkt sich Meike Dinklage. Mittlerweile lebt sie mit den beiden Collies Sam und Fee und beschreibt den mal haarsträubenden, mal sehr berührenden, aber immer äußerst amüsant zu lesenden Weg zum Rudelglück. Sie schildert die Höhen und Tiefen der Hundeerziehung, Erlebnisse mit Hundetrainern und anderen Hundehaltern; ihre Erfahrungen im Hundesport, vor allem aber ihren nicht immer ganz gelingenden Versuch, im Rudelzusammenleben alles richtig zu machen. Ein unterhaltsamer Erfahrungsbericht, der alle Tipps enthält, die man braucht, um glücklich mit zwei und mehr Hunden zu leben.
Meike Dinklage, geboren 1965, studierte Germanistik und Anglistik. Als Politikredakteurin arbeitete sie bei der Hamburger Morgenpost, seit 1998 ist sie bei der Brigitte tätig, wo sie seit 2005 Ressortleiterin der Bereiche Reportage/Gesellschaft/Kultur ist, seit 2008 zudem Chefreporterin. 2006 trat Collie Sam in ihr Leben, 2011 vervollständigte Colliehündin Fee ihr Rudel.
Meike Dinklage
BEIM ZWEITEN HUND WIRD ALLES ANDERS
Vom Glück, im Rudel zu leben
Kösel
Für Sven
INHALT
WARUM IM RUDEL LEBEN?
1. DER HUND MACHT NICHT PLATZ
2. LASSIE-FAIRE
3. SAM VERWILDERT
4. DER SCHEIN-COLLIE
5. IM BOOTCAMP
6. DER MACKER
7. EIN HALBER SAM?
8. BEI DEN SCHÄFERHUNDEN
9. SAM MACHT DIE BEGLEITHUNDEPRÜFUNG
10. NOCH EIN HUND?
11. FEE IST DA
12. FEE HAT ANGST
13. WAS SIEHT DER HUND?
14. FRÄULEIN FEE
15. RUDELHARMONIE
16. DIE JAGD
17. SCHLEPPIS FLUCH
18. DIE HUNDE ZIEHEN UM
19. SCHÖNER WOHNEN MIT SCHLAUCHBOOT
20. NOCH EIN HUND?
ANHANG
FÜNF MYTHEN ÜBER DAS LEBEN MIT ZWEI HUNDEN – UND WORAUF ES WIRKLICH ANKOMMT
WELCHER ZWEITHUND PASST ZU MIR?
DAS RUDEL
WARUM IM RUDEL LEBEN?
Drei Wochen, nachdem unser zweiter Hund Fee zu uns ins Haus gekommen war, lag ich meinem Mann heulend in den Armen. Ich war sicher, dass ich einen furchtbaren Fehler gemacht hatte: einen zweiten Hund anzuschaffen und völlig ohne Not unser unkompliziertes Leben aufzugeben, das wir mit Ersthund Sam geführt hatten. Jetzt lag Sam, fünf Jahre alt, traurig auf seiner Decke und beobachtete mit waidwundem Lassie-Blick das kleine, seltsame Ding, das einfach nicht mehr aus seinem Leben verschwinden wollte. Und Fee, elf Wochen alt und so ängstlich, dass sie nicht eine Pfote vor die Haustür setzen mochte, pinkelte, weil sie auch noch eine Blasenentzündung hatte, aufs Parkett und verkroch sich ansonsten in ihrer Box.
Das war nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich wollte zwei gut gelaunte Collies, die unbeschwert über den Hamburger Elbstrand tollten; herrliche, zufriedene Hunde, die in einem von meinem Mann und mir geordneten Rudel ihren Platz und ihr Glück fanden. Ja, das ist Zweithund-Romantik. Und ich war ihr erlegen. Ich dachte, dass sich beim zweiten Hund das Glück automatisch verdoppelt.
Deshalb hatte ich meinem Mann das Ja zum zweiten Hund abgerungen, er war zögerlich gewesen, weil er deutlich weniger zu Verklärung neigt als ich. Aber ich wollte unbedingt. Ich hatte mir gesagt, dass ich beim ersten Hund so viel über Verhalten und Erziehung gelernt hatte, dass beim zweiten eigentlich nichts mehr schiefgehen konnte.
In Wahrheit ist es so: Beim zweiten Hund ist wirklich alles anders, auf eine unvorhersehbare, tendenziell chaotische Weise. Das hat mit Rudeldynamik zu tun und damit, dass der zweite Hund seinen eigenen Charakter und seine eigenen Macken mitbringt und einen vor ganz neue Herausforderungen stellt, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Außerdem verdoppeln sich die Arbeit und all die Dinge, über die man sich als Hundehalter Gedanken machen muss – Zeit, Geld, Pflege –, während sich die eigenen Freiheiten halbieren. Einen Hund kann man im Urlaub noch wegorganisieren oder mit ins Ferienhaus schmuggeln – aber zwei? Ein Hund liegt im Restaurant unauffällig unterm Tisch, zwei dagegen liegen irgendwie immer im Weg. Kein Vermieter klatscht vor Freude in die Hände, wenn man im Hundepulk zur Besichtigung erscheint, und so trendig auch das Mitbringen seines Hundes zur Arbeit ist: ein Hund ist der süße Bürohund, den alle zauberhaft finden, zwei jedoch sind eine Meute, die für Kollegen wie Vorgesetzte die Frage aufwerfen, ob man mit ihnen im Schlepptau überhaupt noch zum Arbeiten kommt.
Aber das blendet man aus. Man blickt sich in der Wohnung um, denkt, »hier ist doch noch Platz«, denkt: »Hunde sind Rudeltiere, der Ersthund freut sich sicher«, denkt: »Spazierengehen muss ich ja sowieso«, und ruft den Züchter an oder verliebt sich beim Durchklicken der Tierschutzseiten in ein Augenpaar aus Spanien und kann nicht anders.
Vielen Hundehaltern geht es so, ich kenne kaum einen Menschen mit Hund, der nicht wenigstens zeitweilig schon einmal mit dem Gedanken gespielt hat, sich noch einen zweiten Hund anzuschaffen. In den Parks, auf den Freilaufwiesen, in den Hundeschulen scheinen die Besitzer von mehreren Hunden inzwischen schon in der Überzahl.
Es gibt dafür gute Gründe. Hunde sind Sozialpartner, Familienmitglieder, und weil es den Menschen glücklich macht, in Gesellschaft zu leben, aber viele nicht die Zeit oder die Lebensumstände oder auch das Interesse daran haben, sich ständig mit Freunden und Großfamilie zu umgeben, sind es eben die Hunde, die das Dasein komplett machen und vor der Einsamkeit bewahren. Und je mehr Hunde, desto reicher fühlt sich das Leben an. Hunde machen es ihren Leuten leicht, sich mit ihnen wohlzufühlen, nach 30 000 Jahren Anpassung an den Menschen haben sie sehr feine Sensoren für dessen Bedürfnisse entwickelt, und das Bedürfnis der Menschen heute, in dieser auseinanderfallenden, digitalisierten, komplizierten Welt lautet: Frag nicht, bewerte nicht, sei einfach mein Freund.
Dazu kommt der Trend zum reduzierten, natürlichen Leben. Hunde repräsentieren ein Stück Ursprünglichkeit, das viele Menschen im Alltag vermissen. Lässt man die Hunde mit ihresgleichen leben, dann, so hoffen viele Hundehalter, erlebt man noch mehr von dieser rohen, archaischen, wölfischen Urkraft.
Und dann gibt es noch die Moden. Es ist zurzeit einfach schick, zwei Hunde an der Leine zu führen. Entweder zwei derselben Rasse, weil das das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt, nach innen, weil sich Hunde derselben Rasse einfach leichter verstehen, und nach außen, weil es signalisiert: Mensch und Rasse passen einfach zusammen. Oder zwei und mehr aus dem Tierschutz, was zwar optisch heterogen ist, aber erkennen lässt, dass hier ein kleines Team zueinandergefunden hat, das sich umeinander sorgt und zusammenhält.
Daneben gibt es eine ganze Reihe individueller Gründe; manche so banal oder irrational wie etwa der meinige. Ich hatte einfach das Gefühl, ich sei innerlich an meinem ersten Hund so gereift, dass ich nun einen zweiten mühelos und zur Freude aller Beteiligten in unser Leben integrieren könnte.
Beim zweiten Hund wird alles anders, und meine Collies Sam und Fee sind dafür ein gutes Beispiel. Nichts, gar nichts ist glatt gelaufen, nichts war, wie ich es vorher geplant oder mir ausgemalt hatte. Ich habe nicht nur einmal geheult, aus Überforderung, Frust, Ratlosigkeit.
Inzwischen sind wir natürlich dickste Freunde, und Sam und Fee sind die besten Lehrer, die ich mir hätte wünschen können, mein Familienrudel, meine besten Hundekumpel: ein sanfter, selbstbewusster Beau und eine kleine, empfindsame Amazone.
Dieses ist die Geschichte unserer Rudelwerdung, und sie beginnt da, wo Menschen, die ihren Hund vergöttern, aber keine Ahnung von Hundeerziehung haben, ihre eigene Unfähigkeit am schmerzlichsten vor Augen geführt wird: auf dem Hundeplatz.
1. DER HUND MACHT NICHT PLATZ
Der Tag, an dem wir aus der Hundeschule flogen, war ein nasser Mittwoch im November. Sam war sechs Monate alt, gerade der welpischen Unschuld entwachsen und nun auf dem besten Weg in die Pubertät. Seit ein paar Wochen gingen wir in eine Erziehungsgruppe, lauter sexuell erwachende Junghunde, die wie Sam dringend Nachhilfe im kleinen Alltagskommando-Einmaleins brauchten: »Sitz«, »Platz«, »Hier«, »Bleib« und vor allem – »Nein«.
Die Hunde saßen in einer Reihe, wir Besitzer standen daneben, und Geli, die Trainerin, wies uns an, sie mit einem entschlossenen »Platz!« und sanfter Körperhilfe zum Hinlegen zu bewegen. Nach und nach wechselten alle Hunde die Position. Einer blieb sitzen. Sam. Eigentlich saß er nicht, er thronte, mit gerader Brust und einem Blick, in dem eine tiefe Verachtung für all die Anpasser lag, die sich auf den regennassen Boden geworfen hatten, nur weil ihr Mensch das von ihnen verlangt hatte.
Ich sah meinen Hund an. Er saß da wie ein unbeugsamer Wilder, stolz und selbstgewiss.
Ich sagte: »Platz!«. Sam lachte. Ich deutete mit der flachen Hand auf den Boden, ging in die Hocke. Nichts. Ich lockte, ich flehte. Sam wandte mir nicht mal den Kopf zu. Er sah in die Weite, auf die Felder und Wiesen, die, sobald er diese lästige Hundeschul-Störung erfolgreich ausgesessen hätte, ihm gehören würden, zur Jagd, zum Vergnügen.
Geli, die Trainerin sagte: »Schmeiß ihn um.« Nur wusste ich nicht wie. Ich wollte nicht körperlich werden, ich tat mich schwer mit Gewalt, schon aus ethischen Gründen. Außerdem saß Sam da wie festgetackert, ich hätte keine Chance gehabt. Geli, eine Mitvierzigerin mit lauter Stimme und großer Bestimmtheit, die Hunde schon durch ihre bloße Präsenz zum Gehorsam brachte, verdrehte die Augen. Sie ging auf Sam zu. Sam grinste. Sie stupste ihn an. Sam saß. Am Ende rang sie regelrecht mit ihm. Dann rutschte sie aus und fiel in den Matsch. Sam lüpfte ein Pfötchen, um den Dreckspritzern auszuweichen.
Vermutlich hatte Geli einfach einen schlechten Tag, wer steht schon gern bei Schneeregen und Kälte stundenlang auf einer Wiese und hämmert einer Horde Jungspunde Benehmen ein. Dazu die Besitzer, Leute wie ich, denen das Herz noch voll zärtlicher Liebe übergeht angesichts der eben erst zu Ende gegangenen Welpenzeit und die noch lange nicht im Durchgreif-Modus sind, den ein heranwachsender Hund gelegentlich braucht. Ich war eine der schlimmsten. Sam war für mich der Hundegott. König Sam, Gebieter über Herrchen und Frauchen.
Jedenfalls: Etwas an diesem Collie, seinem lässigen Selbstbewusstsein und meiner hilflos-defensiven Art brachte Geli an diesem Tag aus der Fassung. Sie lag im Dreck und wollte nicht mehr. Sie sagte Dinge, die sich sicher schon eine ganze Weile in ihr angestaut hatten, aber nun sagte sie sie sehr, sehr deutlich: »Such dir einen anderen Trainer. Einzelstunden, irgendwas. Dein Hund macht, was er will, du bist ihm völlig egal. Ihr müsst noch mal völlig bei null anfangen. Aber in dieser Gruppe ist für euch Schluss.«
Ich stand da, leinte den Hundegott an und schlich mich nass und gedemütigt davon.
Ich wollte mein Leben lang einen Collie. Es ist wegen Lassie, ich beginne noch heute auf der Stelle bei der Titelmelodie von Lassie kehrt zurück zu weinen, und ich weine mich konsequent durch den gesamten Film, sogar durch das Remake. Collies waren für mich als Kind wunderschöne, fast überirdische Wesen. Ich wollte schon damals einen Kumpel, einen besten Freund, die Lassie-Timmy-Sache: bedingungslose Liebe, gemeinsames Abenteuer, Spaß, Vertrauen, Kinderarme in weißem Colliekragen.
Stattdessen hatte ich Hühner, Katzen und Kaninchen, die ich zwar auch sehr liebte, aber es war nicht dasselbe. Wir wohnten auf dem Land, wir hatten einen Obsthof und jede Menge Platz, aber meine Mutter mochte keine Tiere im Haus, schon gar keine Hunde. Heute, wenn meine Hunde zeitgleich im Fellwechsel sind oder einfach nur nach jedem Spaziergang den Herbstschlamm im frisch gestrichenen Flur abschütteln, verstehe ich sie ein bisschen besser.
Aber damals gab es für mich nur eins: Ich wollte unbedingt einen Hund. Ich vergötterte die Hunde in der Nachbarschaft, Bobbie, den dicken Dackel der alten Dame gegenüber, Senta, den drahtigen Malinois-Mix vom Hof nebenan. Ich ging in den Pausen mit Ares, dem Collie eines älteren Herren, der neben meiner Schule wohnte, Gassi. Und ich schaute jeden Tag auf die Anzeigenseite des Stader Tageblatts, schnitt aus der Rubrik »Zu verkaufen« alle Annoncen aus, in denen Collies angeboten wurden, und klebte sie in ein kleines Ringbuch. Es war ein gutes Gefühl zu wissen, dass ich sofort eine Reihe Züchter an der Hand hätte, sollten meine Eltern ihre Meinung ändern.
Sie änderten sie nicht. Ich brachte meinen Hühnern Kunststücke bei (Hühner sind kluge Wesen, meine drei Hennen hörten auf ihre Namen und warteten jeden Tag an der Straße, bis ich von der Schule kam) und verzärtelte meine Katzen. Natürlich ließ ich sie, wenn meine Eltern nicht da waren, ins Haus und auf meinem Bett schlafen. Dann zog ich aus, studierte, zog um, arbeitete, heiratete. Ich wurde 38, wir kauften ein Haus. Und plötzlich – mit Haus, Garten, meinem Mann, der viel von zu Hause aus arbeitet – passte alles. Nach einem halben Leben war endlich der richtige Zeitpunkt da. Wir konnten einen Hund haben.
Ich musste mich nicht anstrengen, um meinen Mann zu überzeugen. Ein Hund war zwar nicht sein dringlichster Wunsch, aber er war einverstanden. Wäre es nach ihm gegangen, hätte es auch ein Golden Retriever sein können oder ein Husky. Aber da ich in all unseren Gesprächen zum Thema das Wort Collie synonym für Hund verwendet hatte, ahnte er, dass es da keinen Spielraum gab.
Wir googelten »Collie«. Es war ein Schock. Ich hatte in den vielen Jahren, in denen ein Leben mit Hund aufgrund der Umstände nicht infrage kam, aufgehört, mich intensiv mit der Rasse zu beschäftigen. In meinem Kopf retteten immer noch Timmy und Lassie das kleine Rehkitz. Ich dachte nach wie vor, Collies wären große, stattliche Tiere mit klaren, klugen Augen und einer imposanten Statur.
Was ich auf den Züchterseiten fand, war in etwa das Gegenteil. Kleine, plüschige Hunde, die Haare auf dem Kopf hochtoupiert wie zu einem Mob, die Augen schmale, mandelförmige Schlitze, die ihnen einen grimmigen Ausdruck verliehen. Diese Hunde bestanden aus wenig Körper und sehr viel Fell, als wäre Lassie erst geschrumpft und dann in ein Flauschkissen eingenäht worden. Wo war der Stolz hin, die Erhabenheit?
Ganz offensichtlich hatte eine Art Transformation stattgefunden, hervorgerufen durch den jahrelangen Lassie-Hype. Alle Welt hatte damals einen Collie wie den berühmten Fernsehhund haben wollen, was dazu führte, dass man die Rasse überzüchtet hatte. Weil sich Krankheiten eingeschlichen hatten und der Boom schließlich abgeebbt war, hatten die Züchter dann auf einen anderen Typus gesetzt. Die amerikanische Linie – große, wesensfeste Hunde mit klarer Körperlinie und mäßig viel Fell – wurde in Deutschland kaum mehr gezüchtet. Stattdessen gab es vor allem englische Collies, die einen völlig anderen Rassestandard haben.
Wir waren verunsichert. Wir überdachten unseren Plan. Ich befragte mein Herz. Golden Retriever? Husky? Wir blätterten durch »Das große Hunderassen ABC« und kamen bis C. Es ging nicht anders: Collie.
Irgendwann fand ich im Netz eine Zucht, die mir gefiel. Die Züchterfamilie wohnte nur achtzig Kilometer entfernt, ich rief an, sagte, wir planten die Anschaffung eines Welpen und würden uns gern Zuchtstätten ansehen, die Züchterin lud uns ein und wir fuhren hin.
Die Familie lebte in einem rot geklinkerten Einzelhaus auf dem Land. Auf der Fußmatte: Collies. Das Türschild: in Collie-Form. Die Klingel: Collie-Sound. Das Bellen nach dem Klingeln: Collies. Ich war im Glück. Über Geschmack lässt sich streiten, aber dieser hier war aus purer Begeisterung entgleist, was alles entschuldigte. Die Leute waren Collie-Maniacs. Für mich war es wie nach Hause zu kommen, als hätte ich endlich die geheime Pforte gefunden in das Leben, das ich mir als Kind gewünscht hatte.
Wir traten ein. Sieben aufgeregte Hunde wuselten um uns herum, teils bellend, teils uns neugierig beschnuppernd. Die Züchterin griff nicht ein, sie beobachtete uns, als wollte sie herausfinden, wie wir mit der Situation klarkämen. Ich glaube, ich bin in eine Art andächtige Starre verfallen, angesichts so vieler riesiger, unfassbar schöner Hunde.
Wir sahen uns um. Das gesamte Untergeschoss bestand mehr oder weniger aus einer Freifläche, ein Esstisch stand mitten im Raum, sonst kaum Möbel, es gab keine Teppiche, nur blanke Fliesen und Hundedecken. Alles funktional, ganz auf die Hunde abgestimmt. Der Lebensraum glich dem eines Rudels, in dem die Hundebedürfnisse die ästhetischen Maßstäbe setzten. Wahrscheinlich müsste man Hund sein, um darin eine Art Gemütlichkeit zu erkennen.
In einem abgedunkelten Nebenraum hatte eine Hündin ein paar Tage zuvor Welpen bekommen, die Züchterin öffnete die Tür, alle Hunde durften hinein, sie beschnupperten die Wurfkiste, interessierten sich aber nicht besonders für die Kleinen. Die Hündin blieb geduldig bei ihren Welpen, die glücklich saugend gegen ihre Zitzen traten.
Möglichst dezent schielten wir in die Kiste. Wir hatten mit der Züchterin nicht darüber gesprochen, ob und wann wir einen Hund von ihr bekommen könnten; es sollte erst mal nur ein Kennenlernen-Besuch sein, und außerdem war unsere Ehrfurcht vor ihr zu groß. Sie war zum Zeitpunkt unseres Besuchs eine der renommiertesten Collie-Züchterinnen, eine, die ihre Hündinnen aus Amerika holte und deren Deckrüden halb Deutschland besamten. Wir hatten gehofft, dass sie uns von sich aus einen Hund anbieten würde, aber für uns selbst offen gelassen, wie konkret wir nachfragen wollten. Doch nun, die Welpen vor Augen, das Glück zum Greifen nah, hätte ich mich am liebsten danebengekniet und mir auf der Stelle einen Hund ausgesucht.
Ich nahm also meinen Mut zusammen und fragte, ob schon alle Hunde des Wurfes vergeben seien. Die Züchterin lachte herzlich. »Alle, und auch die des nächsten Wurfs«, sagte sie. »Sie müssen bis Mitte nächsten Jahres warten, so lang ist die Warteliste.« Dann setzten wir uns an den Esstisch, und sie begann zu meiner Überraschung, uns nach unserem Privatleben zu befragen, offensichtlich, um unsere persönliche Eignung als Hundebesitzer zu prüfen: Wo wohnten wir? Gab es einen Garten? Könnten wir ihr bitte Fotos von Haus und Garten schicken? Und hatten wir genug Zeit für einen Hund? Was machten wir beruflich? Hatten wir Hundeerfahrung? Wie sah unser Tagesablauf aus? Würden wir wirklich jeden Tag stundenlang mit dem Hund spazieren gehen können? Wären wir finanziell in der Lage, die Tierarztrechnungen zu bezahlen? Hatten wir uns das alles genau überlegt?
Hatten wir? Auf dem Rückweg waren wir beide sehr still.
Im Rückblick würde ich sagen, die Frau hat alles richtig gemacht. Sie gehörte eindeutig zu den Züchtern, die ihre Hunde nicht des schnellen Geldes wegen weggaben, sie wollte jeden in die bestmöglichen Hände vermitteln. Die Welt wäre ein besserer Ort, würden sich alle Züchter so viele Gedanken machen. Und es war richtig, uns all die Fragen zu stellen, die man selbst schnell ausblendet, wenn man unbedingt etwas will. War ich die Art Mensch, die wirklich jeden Tag lustvoll durch Wald und Wiesen streift? Hatte ich Spaziergänge nicht bislang stets als sinnloses Herumgerenne betrachtet und lieber eine DVD in den Player geschoben? Würde ich wirklich völlig neue Gewohnheiten entwickeln, mir eine Art Hundehalter-Ich zulegen und Gefallen an Regen, Hundedurchfall und dem Druck entwickeln, nie länger als vier Stunden aus dem Haus sein zu können, weil sonst der Hund zu lange allein wäre?
Die Frau hatte unseren Wunsch mit der Wirklichkeit konfrontiert. Das war gut so. Und quälend.
Damals war ich vor allem brutal ernüchtert. Ich stellte fest, dass die Collie-Welt nicht in dem Maße auf mich wartete wie ich auf einen Collie. Und dass mich Schwärmerei nicht automatisch zu einer Wunschkandidatin für den Welpenkauf machte. Außerdem sollte ich eineinhalb Jahre warten, bis wir die Chance auf einen Welpen aus dieser Zucht hatten. Und ich sollte mir Fragen stellen, die ich nicht in der Theorie beantworten konnte. Ich brauchte einen Hund, um mein Hunde-Ich kennenzulernen.
Wir wussten, es würde etwas auf uns zukommen. Es gab Restrisiken. Aber wir waren entschlossen, es zu wagen.
Die Züchterin hatte uns eine Kollegin empfohlen, deren Hündin von einem ihrer Importrüden gedeckt worden war. Es war ihr erster Wurf, sie vermutete, als Newcomerin sei ihre Vormerkliste noch nicht allzu lang.
Ich rief an. Es war ein langes, freundliches Gespräch. Ulla, die Züchterin, erzählte von ihrem Werdegang, von ihren Gründen, Hunde zu züchten, von ihrer alten Hündin, die früh gestorben war, und von ihrer Zuchthündin. Sie hatte nur eine Hündin und es war deren erster Wurf. Wir teilten unsere Aufregung, Ulla über die baldige Niederkunft ihrer Hündin, ich über die baldige Hundemutterwerdung meiner selbst.
Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was auf uns zukam.
2. LASSIE-FAIRE
Erst mal gingen wir shoppen. Hat der Mensch Angst und muss sie kompensieren, geht er einkaufen, das ist ein gut trainierter Reflex.
Außerdem sollte alles bereitstehen, wenn der kleine Hund ins Haus kam. Wir überlegten: Als Erstausstattung brauchte er ein Bett, einen Trink- und einen Futternapf, eine Leine, ein Halsband, ein paar Kauknochen und Spielzeug. Angesichts unserer Nervosität, die die bevorstehende Veränderung unseres Lebens in uns auslöste, war es ein beruhigender Akt, ganz pragmatisch ein paar materielle Vorbereitungen zu treffen.
Zum ersten Mal in meinem Leben betrat ich einen »Fressnapf«, der eventuell auch ein »Futterhaus« war, ich weiß es nicht, bis heute kann ich diese Läden nicht auseinanderhalten. Ein großer gelber Plastikhund stand am Eingang; es war wie das Entree in eine neue, ganz dem Tier geweihte Welt. Dutzende Regale voller verschiedenster Futtersorten in Dosen und Beuteln, eine Wand nur mit Spielzeug, Quietschebällen, Gummiknochen, Ballschleudern, eine andere mit Hunderten von Leinen. Kübelweise Hundesnacks, die man sich wie in der Obstabteilung selbst in Plastiktüten abfüllen und abwiegen konnte. Mit Herz, Blättermagen und grünem Pansen gefüllte Tiefkühlboxen.
Für Hunde sind diese Läden Boutique, Gourmettempel und Abenteuerspielplatz in einem, für mich waren sie eine einzige Überforderung. Ich hatte den Laden mit dem Gefühl betreten, endlich dazuzugehören, ich wollte souverän eine kleine Einkaufstour starten und das Gefühl genießen, als echte Hundefrau zu gelten. Und nun stand ich verloren in dieser neuen bunten Shoppingwelt und überlegte, was noch mal Blättermagen ist.
»Geschirr oder Halsband«, fragte die freundliche Mitarbeiterin, »Elchleder oder Nylon? Oder lieber eine Flexileine? Oder eine Retrieverleine, nur zum Überstülpen? Oder doch ein klassisches Halsband: Würger, Halbwürger oder geschlossen? Mit Schnalle oder mit Klickverschluss? Oder Klett? Und die Farbe? Lieber aufs Fell abgestimmt oder als schöner Kontrast? Der Hund ist rotweiß? Also ein klassisches Schwarz oder ein elegantes Beige?«
Ich kaufte einen Trinknapf, weil ich dachte, damit am wenigsten falsch machen zu können. (Als Doppelgedeck mit integriertem Futternapf? Im Ständer, in Stehhöhe des Hundes? Mit breitem wasserauffangendem Rand, um den Bodenbelag zu schonen, oder ein leichteres Modell aus Keramik?) Wir kauften den für 3,99 Euro, Alu, am Rand gummiert, damit, wenn es der falsche wäre, sich die Investition im Rahmen hielte.
Danach suchten wir im Internet weiter, wir wollten lieber gar keine Beratung als die totale Überforderung, und außerdem mussten wir uns erst mal ins Thema einarbeiten. Wir brauchten noch ein Hundebett oder eine Matte, auf jeden Fall ein weiches Refugium für den Hund, das optisch keine Beleidigung darstellte. Uns gefielen die Produkte eines bei Google weit oben gelisteten Versandhändlers (»Hundebetten mit Wohlfühlgarantie!«), aber dann stellten wir uns vor, mit welchem Gefühl wir dem DHL-Mann eine Warensendung der Firma »Knuffelwuff« quittieren müssten, und verwarfen die Idee wieder. Wir wollten ein Hundebett, aber nicht unsere Würde verlieren.
Wir kauften schließlich ein abwischbares Kunstlederbett mit festem, erhöhtem Rand in Eierschalengelb und der Ausführung »Luxury«. Wir wählten es in der Größe XL, um nach Lieferung festzustellen, dass diese Raum für zwei ausgewachsene Ridgebacks bot. Das Hundebett erinnerte in Form und Umfang an ein Schlauchboot, eigentlich fehlte nur das Paddel.
»Schlauchi«, wie wir das Bett bald nannten, haben wir noch heute, wenn es zerschlissen ist, bestellen wir ein neues. Die Hunde lieben es und wir lieben es auch, schon aus hygienischen Gründen, ich möchte, wenn im Hundepark ein Virus umgeht, reproduzierte Magenreste nicht aus feiner Mikrofaser rubbeln.
Der Anruf kam Mitte Mai. Ich saß im Büro, es war Freitagnachmittag, draußen – mein Büro liegt am Hamburger Hafen – begann die Einlaufparade, es war Hafengeburtstag. Ich nahm den Hörer ab, Ulla war dran. Sie sagte leise und mit ein wenig Dramatik in der Stimme: »Die Babys sind da.« Dann schwieg sie, und ich sagte: »Oh mein Gott«, und dann noch mal und noch mal. Es waren drei Rüden und zwei Hündinnen im Wurf, vier Welpen sable-white, also rotweiß, eine Hündin tricolor – schwarz, weiß, rot. Ulla erzählte von der Geburt, vom Gewicht und den Gesundheitsdaten der Hunde. Ich hörte nur: »Ich habe einen Hund!«
Wir dürften kommen und aussuchen, sagte sie, aber erst müssten die Hunde stabil genug sein, weil jeder Besuch Keime ins Haus und an die Wurfkiste bringe. Außerdem habe einer der Hunde das erste Entwurmungsmittel nicht vertragen, er sei geschwächt, habe an Gewicht verloren und müsse sich erst wieder erholen.
Abends machten wir eine Flasche Sekt auf, hockten uns auf Schlauchis feste, seetüchtige Kante und malten uns aus, was für ein herrlicher Sommer vor uns läge. Wir sahen uns zu dritt an der Nordsee spazieren, den kleinen Hund drollig watschelnd neben uns. Glück würde auf kurzen, tapsigen Collie-Beinen einfach in unser Leben gelaufen kommen.
Jetzt, da es konkret wurde, brauchte der Hund einen Namen. Wir wollten einen Rüden, weil ich gelesen hatte, dass Rüden weniger häufig abhaaren, womöglich steckte da ein Rest mütterlicherseits geprägter Sauberkeitsfimmel in mir. Also riefen wir im Internet die gängigen Hundenamen-Listen auf. Arthur? Rocky? Elvis? John Boy? Meier? Einstein? Snoopy? Ghandi? Chef? Wir schalteten die Rechner aus. Ich sagte: »Sam.« Mein Mann nickte. Mein Mann heißt Sven. Ich weiß nicht, was uns geritten hat, einen so ähnlichen Namen auszusuchen, noch heute denken Menschen, wenn ich Sam im Wald rufe, ich würde nach meinem Mann rufen, und wundern sich. Damals schien es uns der freundlichste Name auf der Welt. Dass das außer uns Millionen anderer Hundebesitzer weltweit so sehen, wussten wir nicht. »Sam« hält seit Jahren Platz eins im Ranking der beliebtesten Hundenamen. Auf Platz zwei folgt dann »Sammy«.
Wir fuhren zur Züchterin, sobald die Hunde die Augen geöffnet hatten. Sie lebte mit ihrer Familie in einer Kleinstadt an der Ostsee und zog die Welpen im Wohnzimmer auf, mit direktem Familienanschluss und allen Alltagsgeräuschen, an die sich die Hunde auf diese Weise früh gewöhnen konnten: Staubsauger, Telefon und, weil gerade WM war, sehr viel Fernseh-Fußballlärm. Wir knieten neben der Wurfkiste, und ich war bereit für den großen, magischen Moment: Würde mein Hund mich erkennen? Würde er mir freudig entgegentapsen auf seinen Stummelbeinen, mit der winzigen Schnauze an meine Hand stupsen und glücklich meinen Geruch aufnehmen?
Ulla hatte vom zweiten Tag an Bilder des Wurfes ins Internet gestellt, als noch keiner der Hunde größer als eine Maus war. Auf den Fotos war ein unsortierter, schwarz-rot-weißer Haufen zu sehen, Welpen-Mikado. Die Bilder waren nichtssagend, aber trotzdem hatten wir an jedem neuen Tag, bei jedem neuen Bild gebannt davor gesessen, die Positionen interpretiert, die die kleinen Kerle beim Trinken an den Zitzen einnahmen, und die Haltung, in der sie schliefen. Wir hatten täglich diskutiert, wer am meisten Charakter erkennen ließ und, natürlich, welcher der hübscheste war.
Klar ist es Unsinn, bei Welpen so früh schon Ausstrahlung und Wesen festmachen zu wollen, die Zwerge interessieren sich für nicht viel mehr, als ihre Basis-Bedürfnisse zu befriedigen, die etwa so ausdifferenziert sind wie das Feierabendverhalten eines Bierkutschers: trinken, verdauen, schlafen. Jetzt, an der Wurfkiste, hatte ich dennoch nicht nur die Hoffnung, dass mein Hund mich erkennen würde, sondern dass dieses Erkennen gegenseitig wäre. Ich hoffte, intuitiv zu wissen, welcher unserer wäre, ich erwartete irgendetwas Metaphysisches, ein Fingerzeig des Universums, ein tiefes, warmes Gefühl. Immerhin war ich dabei, mich für die nächsten zehn, 15 Jahre zu binden, und es sollte aus Liebe sein.
Inzwischen glaube ich, dass eine Züchterin gut daran tut, ihre Welpen den späteren Besitzern zuzuteilen, weil sie ihre Hunde am besten kennt und mit ihrer Erfahrung einschätzen kann, welcher Charakter zu welchen Bedürfnissen passt. Einem Hundeneuling den umtriebigsten Burschen zu überlassen, führt absehbar ins Unglück, und wer jeden Tag mit seinem Hund vier Stunden Fahrradfahren möchte, sollte nicht unbedingt den gemütlichen Kuschler bekommen. Damals aber waren wir froh, dass wir freie Auswahl hatten, und da ich sowieso noch nie einen Hund gehabt hatte, machte ich mir keine Gedanken über Wesen oder Trieb. Ich wollte den schönsten.
Der magische Moment stellte sich nicht ein. Wahrscheinlich war ich viel zu aufgeregt, um überhaupt etwas zu spüren. Ich fand alle Welpen in einem Ausmaß entzückend, dass ich nur noch sinnreduzierte Halbsätze von mir geben konnte und eigentlich am liebsten nur laut gejauchzt hätte. Nacheinander durften mein Mann und ich die Welpen auf den Arm nehmen, sie schliefen dabei einfach weiter. Uns gefiel vor allem ein kräftiger Rüde, aber auch ein etwas kleinerer, der sehr charmant wirkte und ausgesprochen munter war.
Irgendwann, bei einem späteren Besuch, die Hunde waren sechs, sieben Wochen alt, erzählte Ulla, wie der Muntere sich mit dem Apfelbaum im Garten vergnügt habe. Er habe Anlauf genommen, sich einen Zweig geschnappt und so lange daran herumgezerrt, bis die halb reifen Äpfel heruntergekullert seien, und dann habe er sie vergnügt über den Rasen gerollt. Sie sagte, er sei der Clown der Truppe, er könne jeden auf der Stelle zum Lachen bringen. Aber er habe auch absolut seinen eigenen Kopf, »was der nicht will, das will er nicht, basta«. Wir hörten nur: »Clown«. Das gab den Ausschlag. Wir wollten einen lustigen Hund, einen mit sonnigem Gemüt. Sam Sonnenschein. Die Sache mit dem eigenen Kopf hatten wir irgendwie überhört.
Ich nahm zwei Drittel meines Jahresurlaubs, die Kollegen schenkten mir beim Abschied einen riesigen Kauknochen mit roter Schleife und eine Rolle Designer-Gassibeutel mit Picasso-Tierzeichnungen, die ich selbstverständlich nie benutzt habe. Dann fuhren wir zur Züchterin, um unseren Neuzuwachs zu holen. Wir setzten Sam, der jetzt elf Wochen alt war, auf eine Decke auf die Rückbank, ich setzte mich daneben. Ulla hatte Tränen in den Augen beim Abschied – Sam war ihr Erstgeborener –, und ich genoss das berauschende Gefühl, dass sich mein Leben gerade in aufregender Weise substanziell veränderte.
Wenn ich heute, elf Jahre und zwei Hunde später, daran denke, wie wenig Gedanken ich mir damals über die Erziehung gemacht habe, dann verblüfft es mich, dass Sam überhaupt ohne nennenswerte Schäden groß geworden ist. Wir hatten ein Gottvertrauen, dass alles gut wird, woher auch immer es rührte. Vielleicht ist das die Grundvoraussetzung dafür, den Mut aufzubringen, etwas so Unkalkulierbares wie einen jungen Hund in sein Leben zu lassen.
Jedenfalls gingen wir davon aus, dass Erziehung irgendwie nebenbei passieren würde, während wir und der Hund zu einem tollen Team zusammenwüchsen. Wir wollten in eine Hundeschule gehen, aber nur, um ein paar Grundlagen zu lernen, und damit der Hund Kontakt mit anderen Hunden hatte. Das war uns das Allerwichtigste: dass unser Hund ein Hunde- und Menschenfreund würde, der jedem und allem aufgeschlossen gegenüberstand. Schon das Wort »Grundgehorsam« klang für mich nach Kaserne und Strammstehen. Das wollte ich auf keinen Fall. Wir wollten eine natürliche, partnerschaftliche Beziehung zum Hund. Wenn wir nett zu ihm wären, dachte ich, wäre er es auch zu uns. Unser Erziehungsideal war, kurz gesagt, Lassie-faire. In Wahrheit hatten wir einfach überhaupt keine Ahnung.
Noch vor Sams Ankunft hatten wir, auf den Rat hundekundiger Freunde hin, eine Probestunde in einer Welpengruppe verbracht und uns hinterher ausgiebig darüber lustig gemacht, mit welchem albernen, hohen »Kiiiira-hiiiier«-Singsang die Halterinnen ihre tapsigen Kleinen lockten. Es waren nur Frauen dort, was uns ebenfalls belustigte, als sei Hundeerziehung ein Biotop voremanzipatorischer Rollenmodelle. Alle Grundregeln des normalen, erwachsenen Frauenverhaltens schienen abgestreift wie drückende Pumps nach einem Bürotag. War das so in der Hundehalterwelt? Die Frauen übernahmen die Hundeerziehung, während die Männer ihre Vollzeitjobs erledigten und abends einem wohlerzogenen Labradoodle steif ein Gutenacht-Küsschen auf die kalte Schnauze drückten?
Mein Mann und ich wollten den Hund selbstverständlich gemeinschaftlich erziehen. Damals dachten wir noch, das sei normal. Aber als Mann, das merkte mein Mann bald, ist man in der Hundeschulwelt entweder Pensionär, Sonderling oder einsam. Auf jeden Fall einer für die psychosoziale Schublade. Ich erinnere mich an einen Vormittag in unseren ersten Wochen mit Sam: Mein Mann hatte von einem Hundetraining im Park in der Nähe gelesen, er wollte es sich ansehen, fuhr hin und kam wenig später unverrichteter Dinge zurück. »Da waren nur Frauen«, sagte er erschüttert. Er hatte sich weggeschlichen.
Ich kann nicht mehr sagen, wann genau wir begannen, Fehler zu machen. Ich vermute, es war an Tag eins. Sam war da, und das Lebensgefühl mit Hund war so großartig, dass wir ihn zum Mittelpunkt unseres Lebens machten. Wir konnten ihm stundenlang zusehen, wie er über den Rasen tobte, an Ästen nagte, mit schräg gestellter Rute durch die Büsche fegte, und nur einschlief, wenn es gar nicht mehr anders ging, indem er genau da, wo er gerade stand, einfach umfiel. Morgens machten wir ihm Haferflocken mit Honig, mittags schnitten wir ihm den grünen Pansen klein, nachts trugen wir ihn zum Pinkeln in den Garten und saßen an seinem Schlauchboot, bis er wieder eingeschlafen war, und Sam leckte uns dabei verschlafen und zärtlich die Hand.
Ich hatte mir ein Buch gekauft, eine Art Erziehungsleitfaden für die ersten zwei Monate, geschrieben von einer bekannten Hundetrainerin. Für jeden Tag waren darin Übungen erklärt, der Hund sollte Kommandos erlernen und zugleich mit seinen Menschen die Welt erkunden.





























