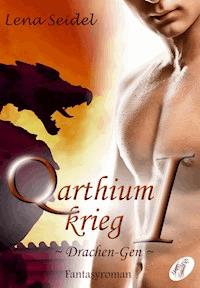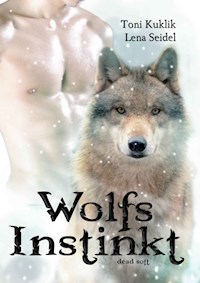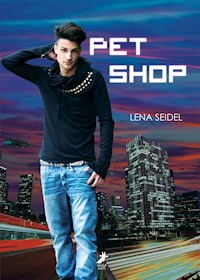Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dead soft verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Vor den Augen seiner Mutter wird der telepathisch begabte Ben entführt, um von einer staatlichen Geheimorganisation zum perfekten Söldner ausgebildet zu werden. In dem unmenschlichen System findet er in dem Telekineten Vincent einen Vertrauten und Freund. Als Vincent entlassen wird, verwandelt sich die Ausbildung für Ben in seine ganz persönliche Hölle - und es dauert lange, bis Vincent sein Versprechen einlöst und sie sich wiedersehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lena Seidel
Ben Dover
Band 1
Impressum:
© dead soft verlag, Mettingen 2015
http://www.deadsoft.de
© the author
Cover: Joshua Bailey
Bildrechte:
© Sergey Nivens – fotolia.com
© Fotomicar – fotolia.com
Quelle wissenschaftlicher Text: wikipedia
1. Auflage
ISBN 978-3-945934-12-8
ISBN 978-3-945934-13-5 (epub)
Klappentext
Vor den Augen seiner Mutter wird der telepathisch begabte Ben entführt, um von einer staatlichen Geheimorganisation zum perfekten Söldner ausgebildet zu werden. In dem unmenschlichen System findet er in dem Telekineten Vincent einen Vertrauten und Freund. Als Vincent entlassen wird, verwandelt sich die Ausbildung für Ben in seine ganz persönliche Hölle – und es dauert lange, bis Vincent sein Versprechen einlöst und sie sich wiedersehen.
I.
1.
Ein kräftiger Schlag hallte wie Donner in der undurchdringlichen Finsternis und riss ihn aus dem Dämmerschlaf, in den er nach endloser Zeit endlich gefallen war. Das war der Riegel der Tür gewesen! Nicht nur die Klappe, durch die ihm hin und wieder ein Tablett mit einem Becher Wasser und etwas Brot geschoben wurde, sondern der Riegel! Schon wieder! Oh nein, bitte, nein!
Ben versuchte, sich möglichst weit weg von der Tür in eine Ecke zu drücken, doch nach den ewigen Stunden in der gleichen zusammengekauerten Haltung waren seine Gelenke eingerostet und die Muskeln zu verspannt. In der nächsten Sekunde fiel gleißendes Licht in die Kerkerkammer. Ben kniff die Augen zu, das grelle Licht blendete ihn nach der Zeit in absoluter Dunkelheit. So sah er die Hand nicht, die sich um sein Sprunggelenk legte, er fühlte nur den harten Griff. Mit einem Ruck wurde er nach draußen gezogen, die Helligkeit der Deckenstrahler stach trotz fest zusammengekniffener Lider schmerzhaft in seine Pupillen und brannte sich rot in seinen Sehnerv. Er konnte nicht verhindern, dass sein Körper mit ungewollten Tränen gegen diese Malträtierung ankämpfte. Auslöser war nicht nur die plötzliche Helligkeit, sondern auch der Zug an seinem Bein; sein nackter Rücken schleifte über den rauen Steinboden und schickte Tausende Signale wie Nadelstiche an sein Gehirn.
Die Hand an seinem Knöchel verschwand, dafür schlossen sich Finger wie Stahlklammern um seinen Oberarm und zerrten ihn erbarmungslos in die Höhe. Seine Beine waren die Belastung nicht mehr gewöhnt, die Achillessehnen brannten wie Feuer, nachdem sie weiß Gott wie lange nicht mehr benutzt und damit gedehnt worden waren.
Ben hatte keine Ahnung, wie lange er diesmal eingesperrt gewesen war, und eigentlich war es auch egal – Zeit spielte hier unten in dieser Hölle keine Bedeutung.
Ein harter Stoß in den Rücken trieb ihn voran, immer noch blind und unsicher, sich kaum auf den Beinen halten könnend. Matt beschäftigten sich seine Gedanken mit der Frage, welche Tortur jetzt wohl auf ihn zukäme, andererseits entschied er, dass es gleichgültig wäre, solange sie ihre Arbeit richtig machten und ihn endlich umbrachten. Die Kopfschmerzen, die er seit seiner letzten Begegnung mit seinem persönlichen Dämon Doktor Everett Style ständig hatte, machten ihn ohnehin beinahe wahnsinnig. Eine Sekunde lang spielte er mit dem Gedanken, den Wächter einfach zu killen – seine Wut auf das Personal, das ohne Skrupel selbst die widerlichsten Befehle ausführte und einen Teenager folterte, ließ sich kaum zügeln. Doch was hätte ihm das gebracht? Nein, für eine Flucht fehlten ihm zwei entscheidende Dinge: die Kraft und der Plan.
„Dusch dich und zieh dich um. Dr. Dumont erwartet dich in einer Viertelstunde in seinem Büro!“
Was? Er wurde nicht ins Labor geschleppt? Das konnte doch nur eine Falle sein, ein weiterer Versuch, seinen Willen endgültig zu brechen. Viel fehlte ohnehin nicht mehr. Hoffnung keimte in ihm auf, er kämpfte sie nieder, so gut er konnte. Nein, es gab kein Entkommen aus diesem Wahnsinn. Diese Erkenntnis, die ihm bei Weitem nicht zum ersten Mal durch den Kopf schoss, tötete den letzten verbliebenen Rest Hoffnung gnadenlos ab und löste dafür einen Panikanfall aus. Die Kehle wurde ihm eng, er schnappte hilflos nach Luft, und trotz der Kälte brach ihm der Schweiß am gesamten Körper aus. Längst war ihm klar, dass Doc Style ihn eines Tages umbringen würde – das hatte der ihm schließlich auch angedroht. Eigentlich hatte er gedacht, sich damit abgefunden zu haben, doch jetzt überkam ihn eine so gewaltige Furcht, dass es sich nur um Todesangst handeln konnte. Dann meldete sich sein Verstand zu Wort. Doc Style würde ihn nicht in eine Falle laufen lassen – dafür machte es dem Mistkerl viel zu viel Spaß, ihn wissen zu lassen, dass er als Wissenschaftler das Leben seiner Versuchskaninchen in der Hand hatte. Nein, so ein Verhalten war nicht Styles Stil. Tief durchatmend beruhigte er sich allmählich, das unkontrollierbare Beben in seinen Muskeln ließ nach, bis er hinter sich die Wache fluchen und näherkommen hörte. Weg, er musste weg hier!
Ben stolperte vorwärts, tastete sich zittrig an der Wand entlang und wusste dabei nicht einmal, ob er überhaupt in die richtige Richtung lief. Erst als seine Fingerspitzen nach einer gefühlten Ewigkeit unter dem höhnischen Lachen des Wärters auf glattes Metall statt schroffen Stein stießen, stellte sich Erleichterung bei ihm ein. Keine Ahnung wie, aber er hatte es bis zum Aufzug geschafft. Allein.
Immer noch fast blind und mit tränenden Augen strich er mit den Fingerspitzen über die Etagenknöpfe des Aufzugs und zählte leise mit, bis er – hoffentlich – den Knopf für sein Stockwerk gefunden hatte. Erst als sich die Türen vor ihm schlossen und ihn so der Sicht der Aufpasser entzogen, atmete er auf. Jetzt konnte er nur hoffen, keinem der anderen Schüler oder gar einem Ausbilder über den Weg zu laufen. Niemand sollte ihn in diesem Zustand sehen – ein klein wenig Schamgefühl war ihm trotz der Zeit in der Einzelzelle geblieben, auch wenn es nicht mehr viel war.
Trotz des Vorschlaghammers, der erbarmungslos in seinem Kopf wütete, konzentrierte er sich auf eventuell entgegenkommende fremde Gedanken, als der Aufzug mit einem sanften Ruck stehen blieb und die Türen sich öffneten. Soweit er es spüren konnte, war der Gang leer.
Langsam und schwerfällig schlurfte er über den glatten Felsboden, sich dabei immer an der Wand haltend. Holz wechselte sich mit Stein ab: Der erste Eingang zu einem Privatzimmer. Dann der zweite, der dritte ... Es fühlte sich wie Stunden an, bis er endlich bei seinem eigenen Zimmer angekommen war. Und das, ohne gesehen zu werden. Glanzleistung!
Nachdem die Tür hinter ihm zu gefallen war, wagte er es, die Augen einen kleinen Spalt zu öffnen. Sofort rannen ihm ungewollte Tränen über die Wangen. Das Licht tat nach wie vor weh, allerdings nicht mehr ganz so arg wie zuvor. Vermutlich würde es diesmal lange dauern, bis er ohne Schmerzen sehen konnte.
Er nutzte die verschwommene Optik, um einen frischen Overall, ein raues Handtuch und die Duschgelflasche aus seinem Spind zu holen und sich einen Bademantel überzuwerfen. Jetzt war er wenigstens nicht mehr nackt, sondern stank nur noch zum Himmel. Wenn er niemanden zu nah an sich heran ließ, konnte er einen halbwegs anständigen Eindruck auf dem Weg zum Waschraum machen - das musste reichen.
Das warme Wasser, obwohl nur zwei Striche auf dem Wählhebel von eiskalt entfernt, biss sich wie gereizte Ameisen in seine Haut und stellte seine Nerven auf die Zerreißprobe. Nachdem er sich zum dritten Mal mit dem duftenden Gel eingerieben hatte und immer noch dreckig zu sein glaubte, griff er nach dem Wärmeregler und drehte das Wasser auf heiß. Sein schmerzerfüllter Schrei wurde von den gefliesten, kahlen Wänden zurückgeworfen und hallte ohrenbetäubend. Ben zwang sich, unter dem Strahl stehen zu bleiben, bis seine Haut leuchtend rot wurde, zusätzlich traktierte er mit den Fingernägeln die Stellen, die in Kontakt mit dem verdreckten Zellenboden gekommen waren. Als er endlich das Wasser abschaltete, waberte eine Nebelwand aus Dunst durch den Raum und hüllte ihn ein. Der Dampf hatte sich auch auf dem Handtuch abgesetzt, weshalb es nicht sonderlich viel brachte, dass er sich mit harten Strichen abrubbelte. Wenigstens stellte sich allmählich das Gefühl ein, sauber zu sein. Nicht mehr tropfnass, aber auf keinen Fall wirklich trocken, quälte er sich in den ebenfalls feuchten Overall. Der Stoff klebte an seiner Haut und machte jede Bewegung zu einer unangenehmen Sache. Egal, er würde schon irgendwann trocknen.
Kurz überlegte er, vor seinem Termin bei Dumont noch einen Abstecher in die Krankenstation zu unternehmen – seine Kopfschmerzen ließen einfach nicht nach. Doch damit würde er den Chef des Instituts unnötig verärgern und er hatte bei Gott keine Lust, deswegen gleich wieder ins Loch zu wandern. Äußerst unmotiviert machte er sich auf den Weg; Bademantel, Handtuch und Duschgel ließ er auf dem Boden des Waschraums liegen. Mit jedem Schritt wuchs Übelkeit wie ein heißer Ballon in seinem Magen an. Ob sie jedoch von seinem hämmernden Schädel herrührte oder eher von dem Gedanken, gleich einem der beiden Männer gegenübertreten zu müssen, die er hasste wie nichts anderes, konnte er nicht entscheiden. Der Weg hinauf ins Haupthaus weckte Erinnerungen, auf die er lieber verzichtet hätte, genau wie der Anblick des dunklen Eingangsportals. Wut, Verzweiflung und abgrundtiefer Hass flammten in ihm auf. Bevor er einem dieser Gefühle nachgeben konnte, klopfte er an die dunkle Holztür und vernahm beinahe im gleichen Moment ein gedämpftes „Komm rein!“. Unwillkürlich zitterte seine Hand, als er die Klinke nach unten drückte. Das Zittern wuchs sich zu einem regelrechten Beben aus, während er das Büro betrat und Dr. Dumont gegenüberstand.
„Setz dich, Ben.“ Die Aufforderung drang schwer durch das Hämmern in seinen Ohren, das von rasendem Herzschlag stammte. Mit aller Beherrschung, die er aufbringen konnte, machte er die wenigen Schritte auf den Schreibtisch zu und setzte sich auf den Stuhl davor.
Dumont blätterte geschäftig und schweigend in einem dünnen Ordner, und Ben widerstand der Versuchung, entweder dem Kerl jetzt und hier eigenhändig den Hals zu brechen oder einen Blick auf die Papiere zu werfen. Die Zeit schien sich ins Unendliche zu dehnen. Endlich klappte Dumont die Mappe zu, musterte Ben herablassend und sagte: „Du scheinst dich recht gut von deiner letzten Erziehungsmaßnahme erholt zu haben. Deine Nase ist fast nicht mehr geschwollen und die Schrammen im Gesicht sind verheilt.“
Ben klammerte sich am Stuhl fest, um sich selbst davon abzuhalten, aufzuspringen und doch noch eine Dummheit zu begehen. „Haben Sie mich nur rufen lassen, um meinen Gesundheitszustand zu prüfen?“
Dunkles Lachen. „Nein, denn das ist mir herzlich egal, wie du weißt. Eigentlich war geplant, dass du da unten bleibst und den Tests von Dr. Style zur Verfügung stehst, bis Ostern auf Weihnachten fällt.“
Ben biss die Zähne zusammen. Erneut wallte Wut in ihm auf, diesmal über Dumonts selbstgefälligen Ton. Nur nichts anmerken lassen, Dumont roch Angst oder Zorn wie ein Jagdhund – und diese Genugtuung wollte er ihm nicht geben. Immerhin hatte ihm Style ja angedroht, ihn zu Tode testen zu wollen.
„Was hat sich geändert? Ich lebe schließlich noch.“
„Die Chefs stellen ein neues Team auf. Du wurdest angefordert.“
Es dauerte, bis Ben den Sinn der Worte begriff, doch als er verstand, was Dumont ihm damit mitteilte, riss er die Augen auf.
„Was? Ernsthaft? Wann?“
„Jetzt.“
Dr. Dumont warf ihm einen großen braunen Umschlag über den Tisch zu, fast so, wie man einem Hund einen Knochen hinwirft. Ben schnappte sich das Kuvert, öffnete es und schüttelte den Inhalt heraus. Ausweis, Führerschein, Geburtsurkunde und Reisepass rutschten über die blank polierte Platte.
Er konnte es nicht glauben. Glückshormone überschwemmten seinen Körper, bis ihm schwindlig wurde. Er kam hier raus! Nach beinahe elf Jahren konnte er das MorningStar Institut verlassen! Dabei hatte er bereits die Hoffnung aufgegeben, dass das jemals passieren würde!
Er schnappte sich den Ausweis und starrte fassungslos auf das Bild eines hübschen jungen Mannes. Tatsächlich, sein Gesicht. Wann war das Foto aufgenommen worden? Egal. Seine Augen huschten über das Dokument, bis sie am Namen hängen blieben. War das Dumonts Ernst? Ben ... Dover?
„Zieh dich um, pack deine Sachen und melde dich anschließend an der Pforte.“ Die kalte Stimme riss ihn aus seinen Überlegungen. Wie in Trance nickte er, erhob sich und verließ das Büro. Schlagartig war jede Müdigkeit von ihm abgefallen, er rannte den Weg durch die kahlen Gänge zurück zu seinem Zimmer. Er kam sich vor wie in einem Traum und zwickte sich, um sicherzugehen, dass er wirklich wach war. Unmöglich, das war schlicht und ergreifend unmöglich! Noch während er rannte, zog er den Ausweis aus dem Umschlag und warf einen raschen Blick darauf. Das Ding sah tatsächlich echt aus – und es fühlte sich auch echt in seiner Hand an. War das in einem Traum möglich?
Ben erreichte sein Zimmer völlig außer Atem. Die lange Zeit in der Einzelzelle zeigte ihre Spuren ... Dennoch gönnte er sich keine Pause und lachte immer wieder auf, während er die wenigen Sachen, die er besaß, hastig in einen Rucksack warf.
Viel gab es nicht mitzunehmen. Die Einheitsklamotten ließ er im Schrank hängen, seine einzige Jeans zog er an. Ebenso ein T-Shirt, die anderen beiden wanderten in die Tasche. Unterwäsche, Socken, vier Bücher, Waschzeug, dann zog er den Reißverschluss zu und hängte sich einen der Riemen über die Schulter. Barfuß stieg er in die Sneaker, die ihm fast schon zu klein waren, und öffnete die Tür. Vom Gang aus warf er einen Blick zurück in das Zimmer, in dem er die letzten paar Jahre gelebt hatte. Das Bett, ein minimalistischer Schrank, das Waschbecken mit Spiegel, eine Leuchtstoffröhre, deren kaltes Licht ihn immer halb wahnsinnig gemacht hatte, und das Regal, auf dem seine Bücher gestanden hatten. Mehr gab es nicht. Nichts von alledem würde er vermissen. Im Gegenteil: Wohin ihn sein Weg von nun an auch führen mochte, es würde überall besser sein als hier. Das Institut war die Hölle auf Erden und Style der Teufel persönlich, zusammen mit Dumont. Solange er diese beiden Männer nicht mehr um sich zu haben brauchte, konnte es nur bergauf gehen. Mit entschlossenem Schwung knallte er die Tür zu, drehte sich um und lief los.
Ein junger Typ saß in dem verglasten Pfortenhäuschen. Ben kannte ihn vom Sehen her, früher war er ebenfalls Schüler in diesem Institut gewesen. Nachdem er allerdings hier zum Wachdienst eingesetzt wurde, konnte er nicht sonderlich gut gewesen sein. Kein Wunder also, dass Ben sich nicht an den Namen erinnern konnte.
Er steuerte auf den Wachmann zu, als ihm Dumont den Weg versperrte. Ben blieb wie angewurzelt stehen und starrte ihn entgeistert an. Der Kerl war sein persönlicher Albtraum. Wieder schlug ihm das Herz bis zum Hals, Angst schnürte ihm die Kehle zu. Wollte Dumont ihm jetzt ins Gesicht lachen und ihm erklären, dass das alles nur ein Scherz gewesen war und er sich gefälligst wieder bei Doc E. Style melden sollte? Zuzutrauen war es ihm ... Ben hatte keine Ahnung, wie er in einem solchen Fall reagieren würde. Wahrscheinlich würde er den alten Mann schlichtweg umbringen.
„Ich möchte mich von dir verabschieden“, erklärte Dumont, und Ben atmete auf. „Mach uns keine Schande, Puppeteer. Wenn du deinem Teamleader nicht gehorchst, bist du schneller wieder hier, als du es für möglich hältst.“
Na, das würde er zu verhindern wissen!
Auf Dumonts Nicken hin schwangen beide Flügel des schweren Portals auf. Das Licht der untergehenden Sonne flutete die Halle. Ben schloss die Augen, sog tief die frische Luft ein, die nach Freiheit roch, und machte einen großen Schritt hinaus. Die drei steinernen Stufen, die zum Haus führten, hatte er zuletzt vor etwa elf Jahren gesehen, wenn er auch oft von ihnen geträumt hatte. Er blinzelte ins Abendrot, bis er einen schwarzen Wagen auf dem Parkplatz erkannte. Das war dann wohl sein Transport fort vom Schlund der Hölle ... In seinem Magen kribbelte es aufgeregt, als er die Treppe nach unten stieg und auf das Auto zu ging.
Die Fahrertür ging auf, der Fahrer stieg aus. Und Ben glaubte, seinen Augen nicht zu trauen.
„Vincent?“
Fassungsloses Auflachen löste sich aus seiner Brust, er rannte auf den Mann zu und sprang ihm förmlich in die Arme.
„Du bist es wirklich!“
„Ich habe dir doch versprochen, dich rauszuholen. Es hat nur ein bisschen gedauert.“
Ben lachte und schüttelte gleichzeitig den Kopf.
„Du bist unglaublich, weißt du das? Ich bin verdammt froh, dich zu sehen!“
„Steig ein, ich will nicht länger hier bleiben, als unbedingt nötig. Alles Weitere erzähle ich dir auf der Fahrt.“
„Wohin fahren wir?“
Erst als sie beide im Wagen saßen und der Motor aufbrummte, antwortete Vincent.
„Wir fahren erst mal in meine Wohnung. Ich habe von den Oberen die Anweisung, meinen Partner, also dich, auszustaffieren und ihm den letzten Feinschliff zu verpassen.“
„Da wird es nicht mehr viel zu Schleifen geben.“
Ein skeptischer Blick aus tiefdunklen Augen streifte ihn.
„Deine Selbstüberschätzung hat dich früher schon in Schwierigkeiten gebracht.“
Ben grinste, machte es sich in seinem Sitz bequem und schloss die Augen. Es hatte lange gedauert und er hatte fast schon aufgegeben, doch nun, mit siebzehn Jahren, begann sein Leben wirklich.
*
Es wurde schon wieder hell, als Vincent den Motor abstellte und Ben damit aufweckte.
„Komm, du Schlafmütze, wir sind da.“
Ben gähnte und rieb sich die Augen, ehe er sich umschaute. Sie parkten vor einem lang gestreckten Gebäudekomplex mit kleinen, aber gepflegten Vorgärten vor jeder Tür. Auf dem Gehweg drehten einige Jogger in knallbunten Trainingsanzügen ihre Runden.
Vincent stieg aus und wedelte mit ungeduldiger Handbewegung zu Ben.
Jetzt mach endlich! Bist du immer so lahm?
Ben grinste über die Hektik.
Ich komme ja schon ...
Seine Beine waren steif vom Sitzen, die Knie knackten, als er sich aus dem Auto wuchtete. Rasch griff er seinen Rucksack, schlug die Autotür zu und hastete hinter Vincent her. Der öffnete gerade eines der niedrigen, einheitlichen Türchen, die in regelmäßigen Abständen den durchgehenden, weißen Zaun unterbrachen, und gab damit den Zutritt zu dem kurzen, gepflegten Pflasterweg frei.
Einmal mehr grollte sein Pulsschlag wie Donnerhall durch seine Gehörgänge und übertönte sämtliche Umgebungsgeräusche. Ben beobachtete, wie Vincent die Lippen bewegte, doch was sein Leader, Partner ... Freund sagte, drang nicht durch den Aufruhr in seinem Inneren.
Du siehst aus wie ein geschlagener Welpe.
Die warme Stimme in seinem Kopf milderte seine Nervosität, minimal zwar nur, aber besser als nichts. Er spürte, wie sich seine Lippen zu einem schwachen Lächeln verzogen.
Geschlagener Welpe. Allein dieser Terminus weckte Erinnerungen, schöne wie schreckliche. Früher oder später würde er sich ihnen stellen müssen, aber jetzt war nicht die Zeit dafür.
Er folgte Vincent, blieb einen Moment vor der Wohneinheit stehen und betrat entschlossen sein neues Domizil. Die Tür klappte hinter ihm zu – zum ersten Mal hatte er nicht das Gefühl, als würde dieses Geräusch ihn seiner Freiheit berauben – und ehe er es sich versah, umfingen ihn kräftige Arme und drückten ihn gegen Vincent. Er erwiderte die Umarmung und schmiegte sich an die muskulöse Brust, lehnte den Kopf an die Schulter und schloss die Augen.
„Ich habe dich so vermisst!“
Weiche Lippen streiften sein Ohr, warmer Atem strich über seine Haut. Und Vincent sprach genau die Worte aus, nach denen Ben sich endlose Jahre gesehnt hatte. Ein Finger unter seinem Kinn hob zärtlich seinen Kopf an, das lang entbehrte Gefühl eines Kusses prickelte auf seinen Lippen. Genießend schlang er die Arme um Vincents Hals und konterte das leidenschaftliche Zungenspiel. Vertraute Nähe, vertraute Wärme, vertrauter Geschmack. Vertraute Empfindungen, an die sein Körper sich prompt erinnerte.
Langsam klang der Kuss ab, Vincent zog den Kopf zurück, gab ihn aus seinem Griff frei und grinste.
„Später gibt’s mehr. Ich zeige dir die Wohnung und dann organisiere ich uns was zum Essen. Ich bin am Verhungern.“
Die Führung durch die wenigen Räume war rasch erledigt. Den größten Teil des Hauses bildete das Wohnzimmer, von dem aus man in zwei Schlafzimmer, das Bad, die halb offene Küche und ein kleines Zimmer gelangte, das als Arbeitszimmer fungierte. Die Einrichtung war modern und geschmackvoll, genau so, wie er es von Vincent erwartet hatte. Kein Palast, aber geräumiger und luxuriöser als alles, in dem er bisher dahinvegetiert hatte.
Erschlagen von den ganzen Eindrücken ließ er sich auf die Couch fallen und beobachtete Vincent über den Küchentresen hinweg. Es dauerte nicht lange, bis der neben ihm saß und zwei Tassen mit dampfendem Kaffee auf dem Tisch vor ihnen standen. Ben lehnte sich vor, nippte an seinem Getränk und sah anschließend seinen Partner an.
„Warum zwei Schlafzimmer?“
„Weil du garantiert eine Rückzugsmöglichkeit brauchen wirst, in der du allein sein kannst.“
„Ich war die letzten zwei Jahre allein.“
Vincent streckte die Hand aus und fuhr ihm sanft durch die Haare. „Vertrau mir einfach.“
„Das habe ich schon immer getan.“
„Und habe ich dich je enttäuscht?“
Für den Bruchteil einer Sekunde biss Ben die Zähne aufeinander. Nein, er würde Vincent jetzt nicht erzählen, wie enttäuscht er gewesen war, als er feststellen musste, dass sein Freund das Institut verlassen hatte – ohne ihm zuvor auch nur einen winzigen Hinweis auf die bevorstehende Trennung zu geben oder sich gar zu verabschieden. Stattdessen schüttelte er schwach den Kopf und ließ sich an Vincent ziehen. Wenn er ehrlich war, hatte er ihm diesen Verrat gerne verziehen, nachdem er eine gewisse Phase des Beleidigtseins hinter sich gebracht hatte. An Vincents Stelle hätte er bestimmt ebenso gehandelt, wenn er die Chance dazu gehabt hätte. Er mochte vielleicht nachtragend sein, jedoch wäre ihm das nie seinem Partner gegenüber eingefallen.
Vernehmliches Magenknurren unterbrach sowohl seine Gedanken als auch das sanfte Streicheln über seinen Rücken. Passend dazu piepte irgendein Gerät in der Küche. Vincent richtete sich auf.
„Unser Essen ist fertig. Hotdogs sind doch okay, oder?“
„Klar.“ Alles war besser als das geschmacklose Einheitsfutter, von dem er sich zwei Drittel seines Lebens hatte ernähren müssen.
Vincent erhob sich und kehrte mit zwei Tellern zurück, wobei Ben sich die Frage verkniff, warum er dazu aufstand. Allerdings wollte er nicht zu neugierig erscheinen, Vincent hatte sicher seine Gründe. Eventuell kam hier auch die Erziehung des MorningStar zum Tragen – wer zu viel fragte, machte sich sehr schnell extrem unbeliebt.
Nachdem sich Vincent wieder neben ihn gesetzt hatte, zeigte sich jedoch, dass er in Ben anscheinend immer noch lesen konnte wie in einem offenen Buch.
„Man kann nie wissen, wer ...“
„... einen beobachtet. Lektion eins, schon klar“, fiel Ben ihm ins Wort und grinste, schnappte sich einen der Hotdogs und biss herzhaft hinein, ohne darauf gefasst zu sein, dass das Brötchen samt Wurst und Soße kochend heiß war. Noch während er den Brocken in seinem Mund hektisch herumwälzte, um sich die Zunge nicht noch mehr zu verbrennen, öffnete sich in der Küche eines der Schränkchen wie von Zauberhand, ein Glas schwebte heraus. Kurz hörte er Wasser rauschen, dann kam das Glas auf ihn zu geflogen. Dankbar pflückte er es aus der Luft und stürzte den Inhalt in einem Zug hinunter.
„Du hättest mich vorwarnen können!“ Die Beschwerde an Vincent war ein undeutlicher Vorwurf, weil Ben dabei seine Zunge herausstreckte, um sie weiter zu kühlen.
„Tut mir leid, ich hatte vergessen, dass du nur das lauwarme Schul-Essen gewöhnt bist. Kommt nicht mehr vor.“
Ben zog die Zunge wieder ein, warf seinem Freund einen „Ich-glaube-dir-kein-Wort“-Blick zu und griff nach dem Hotdog, den er zuvor einfach auf den Teller zurückfallen lassen hatte. Diesmal pustete er die Stelle an, in die er beißen wollte.
„So viel zu ‚Du weißt nicht, wer dich beobachtet‘ ...“, monierte er ironisch und erntete dafür ein lässiges Schulterzucken.
Kaum hatte Vincent den letzten Krümel verputzt, gähnte er und streckte sich mit einem tiefen Ausatmen.
„Ich gehe schlafen. Die Fahrt war anstrengend.“
„Soll ich mitkommen?“ Das klang hoffnungsvoller, als Ben es beabsichtigt hatte, und dafür ärgerte er sich insgeheim. Vincent musste ja nicht auch noch auf dem Silbertablett serviert bekommen, wie sehr er sich nach ihm gesehnt hatte.
„Jetzt nicht. Ich will wirklich schlafen.“
„Was soll ich in der Zwischenzeit machen?“
„Was immer du willst. Du kannst fernsehen oder lesen, du kannst dich auch hinlegen oder du ziehst dich um und erkundest die Gegend. Wenn du magst, kannst du dir ja schon mal überlegen, was du noch alles für dich brauchst. Du bist nicht mehr im Institut, Ben. Solange du die Arbeit, die ich dir gebe, gut erledigst, hast du niemandem Rechenschaft über deine Freizeit abzulegen.“
Diese Worte jagten einen wilden Schauer über Bens Rücken. Damit war er das erste Mal in seinem Leben frei. Oder etwas, das Freiheit mächtig nahe kam, denn im Grunde gehörte er nach wie vor MorningStar. Nicht mehr dem Institut, der Schule, stattdessen der Organisation, die dahinter stand. Augenblicklich verdrängte er diesen Gedanken in den letzten Winkel seines Denkens; er wollte sich von derartigen Tatsachen nicht die Laune verderben lassen.
Vincent verschwand in seinem Schlafzimmer und Ben blieb alleine zurück. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis ihm einerseits langweilig wurde und ihn die ganze Situation andererseits schier erdrückte. In den vergangenen dreizehn Jahren war jede Minute eines jeden Tages für ihn verplant worden – jetzt auf einmal selbst für seine Zeit verantwortlich zu sein, war reichlich viel verlangt, fand er.
Er schlenderte ans Fenster, verschränkte die Arme vor der Brust und sah hinaus, über den Vorgarten auf die Straße. Die Jogger waren mit ihren Runden anscheinend fertig, keiner von ihnen war mehr zu sehen. Auch der wenige Verkehr hatte sich weiter beruhigt. Eine junge Frau schob einen Kinderwagen am Grundstück vorbei. Ben war bei ihrem Anblick drauf und dran, seine Fühler auszufahren, riss sich dann aber kopfschüttelnd zusammen. Nein. Das war unter seine Würde. Abrupt wandte er sich ab und ließ den Blick durch die Wohnung schweifen. Ungewolltes Grinsen zog seine Mundwinkel auseinander. Er konnte es einfach nicht glauben. Ein gepflegtes Haus, bequeme Möbel, lichtdurchflutete Räume anstatt winziger dunkler Zellen, gehauen in Fels tief unter dem Erdboden, und einer kargen Holzpritsche als Bettersatz.
Apropos Bett: Er konnte doch austesten, wie komfortabel das Bett in seinem Zimmer tatsächlich war ... Zeit dazu hatte er, solange Vincent schlief.
Vorsorglich behielt er die Zimmertür einen Spalt offen, um zu vermeiden, dass sie ins Schloss fiel und sich die Klinke als hinterhältige Fälschung erwies. Auch wenn er sich sagte, wie dumm solche Vermutungen waren, konnte er nicht aus seiner Haut. Die Angst, erneut eingesperrt und auf das Wohlwollen anderer Menschen angewiesen zu sein, ließ sich beim besten Willen nicht abschütteln.
Einen Moment blieb er vor dem Bett stehen, dann stieß er einen Jauchzer aus und sprang übermütig auf die für seine Verhältnisse fast dekadent große Matratze. Sie federte nach, war aber nicht so weich, um das Gefühl zu vermitteln, darin zu versinken. Optimal! Mit einem wohligen Seufzen streckte er sich aus, das Gesicht zur weißen Decke gerichtet, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, und er spürte, wie langsam aber sicher ein merkwürdig diffuser Druck von ihm abfiel. Seine Gedanken, die er sonst so streng kontrollierte, machten sich selbstständig und begannen zu schweifen. Ben starrte an die Decke ohne sie wahrzunehmen, seine gesamte Aufmerksamkeit war von den Bildern gefesselt, die seine Erinnerungen in seinem Kopf abspielten ...
2.
„Mama, gehen wir auf den Spielplatz?“
Die junge Frau zögerte, doch dem bittenden Blick ihres Sohnes konnte sie nicht widerstehen.