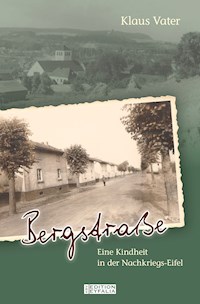
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Eyfalia in der KBV Verlags- und Medien-GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Edition Eyfalia
- Sprache: Deutsch
Die Bergstraße in Mechernich mit ihren über 600 Metern Länge ist ein Mythos geworden; also eine Mischung aus tatsächlich Geschehenem und später durch Hörensagen Hinzugefügtem. Als die gleichförmigen Häuserreihen in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts entstanden, wollte man verhindern, dass Elendsquartiere entstehen. 4500 Menschen arbeiteten im und für das Blei. Die Männer glitten in die Erde, um den Rohstoff hervorzuholen oder schufteten an den Hochöfen. Die Frauen arbeiteten ebenso hart. Sie hielten das zusammen, was Familie hieß, oft unter sehr schweren Bedingungen. Die Kinder brachten Leben auf die Straßen. Ein Idyll war das zwar nicht, aber einigermaßen leben konnte man. Da mitten hinein führen die Erinnerungen von Klaus Vater: Die Bergstraße und das Leben in und auf der Straße aus der Sicht eines Kindes. Es ist keine alltägliche Geschichte. Was sie hier lesen werden, ist Teil der Aufarbeitung eines Mythos'.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Vater, geboren 1946 in Mechernich, machte das Abitur in Euskirchen. Das Geld zum Studieren der Politikwissenschaften verdiente er sich großen Teils bei Dörries in Vussem, einem Ortsteil Mechernichs. Er arbeitete ab 1971 als Nachrichtenredakteur in verschiedenen Redaktionen. Von 1990 bis 1999 war er wissenschaftlicher Referent der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, zuletzt Büroleiter des SPD-Politikers Rudolf Dreßler. Anschließend war er von 2000 bis 2009 Sprecher des Bundesarbeitsministeriums und des Bundesgesundheitsministeriums und zuletzt Stellvertretender Regierungssprecher. Er veröffentlichte Sachbücher (»Arbeitslosigkeit ist kein Schicksal«, »Produktivkraft Solidarität«) und Kriminalromane (»Sohn eines Dealers«, »Am Abgrund«, »Brandt-Gefahr«). Zudem betätigt er sich als Blogger für den BLOG DER REPUBLIK und als Redenschreiber.
Klaus Vater
Bergstraße
Eine Kindheit in der Nachkriegs-Eifel
Die abgedruckten Fotografien stammen zum Teil aus dem Privatbesitz der Familien Schwer/Vater. Außerdem steuerte die Agentur Profipress/Manfred Lang etliche Bilder bei. Freundlicherweise wurden auch vom Archiv der Stadt Mechernich weitere Fotos zur Verfügung gestellt.
Für die Erlaubnis, die Bilder abzudrucken, bedanken wir uns sehr herzlich.
Originalausgabe
© 2019 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Fax: 0 65 93 - 998 96-20
Umschlaggestaltung: Sabine Hockertz
Druck: CPI books Ebner & Spiegel GmbH, Ulm
Printed in Germany
Print-ISBN 978-3-95441-509-0
E-Book-ISBN 978-3-95441-511-3
Inhaltsverzeichnis
Heimat
Die Bergstraße
Mein »magisches Viereck«
Das Dorf um die Bergstraße
Kinder auf der Straße
Der unerwähnte Krieg
Die tägliche Arbeit
Die tägliche Familie
Unser täglich’ Brot
Was es in der Woche zu essen gab
Mittelpunkt für die Familie: Die Küche
Großvaters Garten
Orte der Kinder
Arnika half gegen alles
Trümmer jeglicher Art
Wegwerfen – Ein unbekanntes Wort
Samstags kam der Prinz
Was man sich erzählte
Was ich werden wollte
Die Augen Christi
Die dunkle Zeit
René Carol und die Sehnsucht
Technik
Die große Stadt
Auf der Schule in der Stadt
Großvater weint
Ende aus – und doch nicht vorbei
Heimat
Niemand beschäftigt sich ständig mit der eigenen Kindheit. Es gibt aber Gelegenheiten, da fällt die Kindheit über Menschen her. Im Sommer 2009 war mein Elternhaus in der Mechernicher Bergstraße an die Stadt verkauft. Sie hatte im Sanierungsgebiet Bergstraße das Vorkaufsrecht. Sie plante, mein Elternhaus abzureißen. Anfang August mailte ein Cousin mehrere Fotos, die eine Beschäftigte der Mechernicher Stadtverwaltung geschossen hatte. Das erste Foto zeigt frontal und von der Straße aus geschossen mein Elternhaus. Komplett in grauer Farbe gestrichen. Wie der Blick auf ein verschlossenes Gesicht. Menschenleer. Blickfang ist ein Weinstock auf der rechten Seite des Hauses, 1904 von Joseph Dederichs aus Salt Lake City gepflanzt. Von einem Onkel meiner Großmutter, der die weite Reise nach Mechernich unter-nommen hatte, um die goldene Hochzeit der Eltern mitzufeiern, der aber zu spät kam, weil sein Vater zuvor verstorben war.
Auf dem zweiten Foto schwingt ein Raupenbagger seine eiserne Faust, um den Fachwerkgiebel dieses Hauses einzureißen. Als ich auf dieses Foto blickte, am späten Nachmittag eines Augustsonntags, stockte mein Atem. Da, genau da, wo die Eisenfaust hinschwang, da hatte ich während meiner Kinderjahre Nacht für Nacht geschlafen, nach dem Wachwerden dem Rauschen der Blätter des Kirschbaums vor dem Fenster gelauscht. Das ist eine Art Musik, die mich mein Leben lang begleitet hat, die mich stehen bleiben und lauschen lässt, sobald ich dieses Rauschen höre. Auf weiteren Fotos hatte der Bagger sein Werk getan: Das Haus war verschwunden. Stattdessen lag da, wo es gestanden hatte, ein wirrer Holz- und Steinbrockenhaufen auf dem Bruchstein-Fundament. Arbeiter hielten Wasserschläuche auf die Reste dieses Hauses, damit der Abbruch-Staub am Boden kleben blieb.
Heute erinnert nichts mehr an dieses Haus. Es ist, als habe es dort nie gestanden. Wo es stand, steht nun eine Polizeistation. Außer mir gibt es niemanden mehr, der in diesem Haus gelebt hat. Es war ein Sechs-Generationen-Haus. Angefangen hatte es mit der Großmutter meiner Großmutter. Und es endete mit den Urenkeln meiner Großmutter, die an Wochenenden oder in den Ferien in diesem Haus wohnten. Sechs Generationen. Ich besitze Briefe, Fotos, Urkunden, eine Aussteuertruhe meiner Urgroßmutter aus Stoitzheim mit Hakenverschluss, einen Teil der Hobelbank des Großvaters als Untersatz meines Schreibtisches, eine wunderbare Suppenschüssel aus dem 19. Jahrhundert, eine Uhr, mehrere Tonkrüge, einige Bücher, Fotografien. Im Besitz meiner Kinder sind ein Larres-Bild, das im Zimmer meiner Mutter hing, ein eichenes Vertiko, ein Eichentisch furniert, die Tabak-Dose des Großvaters. Mehr ist nicht, wie man heute sagt.
Ich habe mich an einen Abschnitt meiner Kindheit so gut es geht erinnert; angestoßen durch einen wiederholten Blick auf die Bilder der Zerstörung. Es ist der Abschnitt meiner Kindheit bis zur Beendigung des Bergbaus in Mechernich 1957. Das Ende des Bergbaus war ein tiefer Schnitt in meine Lebenswelt. Über die eigene Kindheit nachdenken und schreiben, das ist ja nicht einfach. Es ist wie in einem Boot langsam auf einem See zu treiben. Du schaust über den Bootsrand hinab in den See. Die Sonne spiegelt sich auf der Oberfläche, erzeugt Reflexe, die dich blinzeln lassen. Du glaubst den Grund des Sees zu erkennen, Gewissheit hast du freilich nicht. Während dein Boot langsam voranfährt, treiben unter dir Dinge in die entgegengesetzte Richtung. Du meinst, Helles und Dunkles unterscheiden, Gegenstände erkennen zu können. Du strengst dich an. Du schaust auf eine verborgene Welt.
Für Erinnerung hatte ich eine Leitschnur: Zwei Jahre vor dem Verschwinden meines Elternhauses hörte ich auf dem Evangelischen Kirchentag in Köln dem früheren Politiker Erhard Eppler zu. Er hielt eine bewegende Rede. Denn er beschwor das Glück, in dem Haus aufgewachsen zu sein und leben zu dürfen, in welchem bereits Eltern und Großeltern gelebt, gearbeitet, sich gestritten und sich geliebt hatten. Für Eppler war dies einfach gesagt: die Heimat.
Die Bergstraße
Meine Heimat war die Bergstraße, die uns Kindern unendlich lang erschien. Stand ich auf der Straße vor unserem Haus, war die Bergstraße so lang, dass sich ihr Ende an der Peterheide in einem blau-braunen Dunst auflöste. Im oberen Teil liefen Figürchen über die Straße, so unendlich lang war die Straße. Manchmal flog eine Schar Tauben vom Dach eines Hauses der Straße ab. Ein Handkarren ratterte leer die Bergstraße hinab, um sich bei Schröders mit Briketts, mit »Klütten« füllen zu lassen. Aus der Parallelstraße, der Bahnhofstraße, klang Lärm herüber: Im Betrieb von Klaus Schmitz hämmerte jemand auf Metall. Hin und wieder fuhr ein Auto die Straße entlang. Seltener Besuch für eine der Familien in der Straße oder Warenlieferung für eines der wenigen Geschäfte.
Genau genommen waren das sieben Geschäfte in der ganzen, langen Straße. Hinzu kamen ein Kino und eine Gaststätte (Für diejenigen, die es gerne genau haben: Metternichs Johannes, Schröders für Käse und Wurst, Schröders Hubert für Briketts und Eierkohlen, eine Schneiderei, Fellens – eigentlich Weierstraße, aber für mich Bergstraße; Schwer’s und die Metzgerei Holzheim).
Im oberen Teil der Straße wohnten ausschließlich Bergarbeiterfamilien Wenn’s um etwas gehe, sagte meine Mutter, dann hielten die zusammen wie Pech und Schwefel. Das war merkwürdig. Was sollte das sein, Pech und Schwefel? Da keiner widersprach, wollte ich nicht fragen, zumal das Gespräch nach meiner Erinnerung angeregt weiterging.
Im unteren Teil war’s gemischt: Dort wohnten sowohl Familien, deren Männer ihr Geld auf Spandau unter Tage verdienten, so wurde das Bergwerk genannt, als auch Angestellte des Bergwerks sowie kleine Geschäftsleute. Mein Großvater hatte viele Jahre auf dem Bergwerk gearbeitet (er ging 1949 mit 243 Mark in Rente). Die Großmutter hatte den Frauen dort Kleider genäht; die Tante hatte ihren Laden mit allerlei Haushaltswaren für den täglichen Gebrauch geführt. Schließlich gab es noch die »hintere Bergstraße«, eine Abzweigung für wenige Häuser. Das Interessanteste im hinteren Teil der Straße war für mich ein Mann, der in meiner Erinnerung stets rauchte und der Ferdi hieß. Hin und wieder sah ich ihn, wenn ich meine Großmutter begleitete, weil sie dort Hemden meines Großvaters ablieferte, deren Kragen wegen Verschleißes gewendet werden mussten. Ferdi saß da im Unterhemd, rauchte, schaute uns zu. Er soll Jahre in der französischen Fremdenlegion zugebracht haben.
Am südlichen Ende der Straße warteten Fellens auf Kundschaft. Bei Fellens kaufte eine Tante donnerstags Heringe, die freitags in der Pfanne gebraten wurden und dabei einen solchen Gestank verbreiteten, dass mir übel wurde. Besorgte Frage einer Tante: »Ist dir nicht gut?« Antwort: »N… nein … doch.« Misstrauischer Blick der Tante, dann der Rat: »Geh an die frische Luft. Lauf aber nicht weit weg, denn wir essen gleich.«
Eine Straßenbreite entfernt vom Fischgeschäft der Polizeiposten. Den dort stationierten Polizisten, Herrn Marko, habe ich nie in Aktion gesehen. In den Erzählungen meiner Leute schimmerte durch, dass der Polizist am liebsten in Ruhe gelassen wurde.
Das andere Ende der Straße mündete in die Peterheide, ein sandiges mit Büschen und Kiefern bewachsenes Gebiet. Auf die Peterheide trugen manche Frauen den Essensbehälter ihrer Männer. Denn dort wartete der sogenannte »Mittenzug«: Eine Werksbahn, die das Essen für die Arbeiter mitnahm. Mitte: Der Essensbehälter aus Metall mit einem Spannbügel auf dem Deckel hieß so bei uns.
Rechts um die Ecke des Endes an der Peterheide wohnte der Hauptmann der Feuerwehr, von dem mein Großvater stets mit Achtung sprach (er war früher selber Brandmeister gewesen); links existierte eine Kneipe, die für mich mit den unverständlichen Worten »Café Hemd hoch« bezeichnet wurde. In der sogenannten zweiten Querstraße von uns aus gesehen, in der Arenbergstraße bestand damals ein Milchgeschäft. Milch wurde mit der Kanne in der Hand besorgt. Eine Schwengelpumpe wurde bedient, so dass die Milch in die Kanne schoss. Deckel drauf und vorsichtig nach Hause.
Großes Allotria war nicht auf der Straße. Die »Menschenströme« in der Bergstraße und deren Richtungen waren überschaubar: Die Männer gingen aus der Straße hinaus zur Arbeit und den umgekehrten Weg in die untere Bergstraße, wenn sie einen trinken wollten – und sonntags in die Kirche. Frauen gingen ebenfalls in Richtung unterer Bergstraßenteil, weil da eingekauft werden konnte. Die Kinder der Straße trafen sich etwa auf der Mitte über den Daumen gesehen: Da ging die Straße Im Sande ab, da lagen Kindergarten und eine Schule. Andere Kinder gingen bis ans Ende der Straße, weil dort die große Volksschule auf sie wartete.
In meiner Straße wohnte eine Familie, deren Oma auf der Außentreppe saß, um Kartoffeln zu schälen. Währenddessen saß ihr die Katze auf dem Kopf. Wir lachten uns rund, wenn das erzählt wurde. Rechts neben unserem Haus stand ein unverputztes Haus aus schmutzig braunen Ziegelsteinen. Aus den Zwischenräumen der Ziegel ließ sich bei Langeweile wunderbar der Mörtel puhlen. Ein dunkel gebeiztes Tor verschloss die Hofeinfahrt. Im ersten Stock wohnte eine alte Frau, die zum Meckern neigte, im Parterre eine Familie mit einem brummigen Familienvorstand, der ärgerlich in den ersten Stock rief: »Kommen Sie runter, Sie altes Suppenhuhn, wenn Sie was wollen.« Ende der Auseinandersetzung. Ich hatte gespannt zugehört, mein Opa Tränen gelacht. Die alten Frauen wurden daheim gebraucht, weil Essen vorbereitet, geputzt und gewaschen werden musste. Die alten Männer trafen sich stattdessen an der Ecke Bahnhof-/Weierstraße, am sogenannten »Consums«-Eck, um sich zu unterhalten und eine zu rauchen.
Die Bewohner unterhielten sich von Haustür zu Haustür: Über die Großmutter, die krank im Bett lag, über die Kinder und den kommenden Sonntag. Wer vorbeiging, wurde beäugt und gegebenenfalls angesprochen. Feindselig war man selten zueinander. Gewiss gab es Familien, die sich nicht grün waren. Aber in der Regel war die Von-Tür-zu-Tür-Unterhaltung friedlich.
Wir Kinder spielten hierbei kaum eine Rolle. Wir hörten zu, schnappten auf. Kinder auf der Straße waren eben alltäglich. Als Kinder dieser Straße hielten wir uns für etwas Besonderes. So wie die Männer in unseren Augen Besondere waren, weil sie unter Tage arbeiteten, einfuhren. Die Frauen waren Besondere, weil sie, wenn es Streit gab, ihren Männern die Partie standen und, in meinen Augen, alles konnten. Aufgeschlagene Knie behandeln, wissen, wann man Durst hatte, mit gradem Rücken einkaufen gehen, rauchen, sagen: Lass ja den Jungen in Ruhe! Und vieles andere mehr. Warum hätten wir nicht besonders sein sollen?
Die Häuser waren aneinandergebaut. Häuser für zwei Familien mit dem Eingang um die Ecke von der Straße her betrachtet. Mit einer angebauten Waschküche. Dahinter lag die Sickergrube, verdeckt durch Bretter. Daran schloss sich der Garten an. Familien und Häuser ohne Gärten? Das gab es nicht. Es gab Häuserreihen mit an der Straßenfront liegenden Eingängen, zu denen eine steinerne Treppe mit einigen Stufen führte. Die Haut mancher Häuser bestand aus dunkel gewordenen Backsteinen; andere trugen verblassende Pastellfarben, wie verklingende Musik. Wieder andere Häuser mussten mit braunem Putz auskommen. In Abständen waren Lindenbäume vor die Häuser gepflanzt. Wir Kinder fühlten uns wohl in der Straße. Wir kannten uns. Fragte jemand: »Wer is dat, kennste den«, antwortete todsicher jemand anderes: »Dat ist der Sohn von Maria.«
Samstags wurde in einer großen Wanne gebadet. Badezimmer gab es nicht. Jahre später ging der Satz die Straße rauf und runter: Wir bauen uns ein »Bades«, ein Badezimmer. Praktisch besaß niemand ein Auto, aber alle hatten Handwagen. Viele fütterten im Hinterhof Karnickel, alle hatten eine Schütte im Keller, um Kartoffel zu lagern. Die eine Familie half der anderen bei Krankheit oder wenn jemand gestorben war. Das war so selbstverständlich wie Sonne, Mond und Sterne.
Mein »magisches Viereck«
Unser Haus in der unteren Bergstraße war 1876 erbaut worden. Es bestand nicht aus Beton oder pur aus Backsteinen, sondern es war ein Fachwerkhaus. Es hatte ein hölzernes Gerüst, einen hölzernen Knochenbau. Als es gebaut wurde, soll die Familie in Geld geschwommen sein. Sagte die Großmutter. Denn die Fuhrleute der Familie, die Sand und Steine zum Bau der Werkswohnungen und Häuser heranschafften, verdienten gut, sie verdienten »Goldfüchse«, Goldgeld. Das Fundament unseres Hauses bestand daher aus wohlgesetzten Bruchsteinen. Wie für eine Ewigkeit aufeinander gesetzt. Darauf erhob sich ein durch verfugte Eichenbalken dauerhaft stabiles Erdgeschoss. Da die Fuhrleute aber auf ihren Wegen viel Durst entwickelten, fehlte es später beim Bau des ersten Stockwerks am Geld für teure Eichenbalken. Im ersten Stock und für den sich darüber erhebenden Dachboden musste Fichte reichen.





























