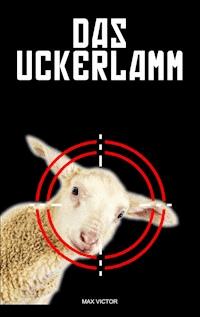3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hybrid Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nach der nuklearen Apokalypse gelang nur wenigen Menschen die Flucht in die Berliner U-Bahn Schächte. Seit zehn Jahren kämpfen sie dort ums Überleben, friedlich oder plündernd und mordend. Als Toms Schwester entführt wird, beginnt für ihn eine Odyssee durch das Tunnelsystem, die ihn bis in die unterirdische Stadt Cor führt. Auch Elvira hat überlebt. Im Auftrag von Cor fährt sie an die Oberfläche, um Material und Vorräte für die prosperierende Stadt zu sammeln. Während sie mit den Gefahren an der Oberfläche kämpft wird Cor von innen heraus bedroht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
HYBRID VERLAG
Vollständige elektronische Ausgabe
05/2024
Berlin Untergrund
© by Max Victor
© by Hybrid Verlag
Westring 1
66424 Homburg
Umschlaggestaltung: © 2024 by Magical Cover Design, Giuseppa Lo Coco
Lektorat: Tina Dutge, Matthias Schlicke
Korrektorat:Rudolph Stromeyer
Buchsatz: Mascha Fekete
Coverbild ›Zone 9 – Caput Leonis‹
© 2023 by Mascha Fekete
Coverbild ›Zone 9 – Die Verschollenen‹
© 2024 by Mascha Fekete
ISBN 978-3-96741-259-8
www.hybridverlag.de
www.hybridverlagshop.de
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
Printed in Polen
Max Victor
Berlin Untergrund
Dystopie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
1.
Tom, im Tunnel
Tom sah nichts. Er zog die Brauen hoch und öffnete die Augen so weit wie möglich. Doch ihn umgab reine, vollkommene Schwärze. In gleichmäßigem Tempo schritt er über den holprigen Untergrund und spürte die spitzen Steine, die sich durch die weichen Schuhsohlen hindurch in seine Füße bohrten. Die trockene Luft roch nach altem Beton und strich ihm angenehm kühl übers Gesicht. Sein Atem ging ruhig. Das Laufen war jetzt nicht mehr so anstrengend wie auf dem Hinweg und der große Dreißig-Liter-Kanister auf seinem Rücken leer. Abgeliefert hatten sie das Wasser an der Klinik und sich im Anschluss rasch auf den Rückweg begeben. Nun trotteten sie schon eine ganze Weile schweigend zwischen den alten U-Bahn-Gleisen entlang, wobei sie wie immer auf die Lampen verzichteten, um die Akkus zu schonen. Diesen Tunnel hatten sie schon unzählige Male durchquert, vier Märsche lagen allein seit dem Morgen hinter ihnen. Und für heute zum Glück kein weiterer vor ihnen, dachte Tom. Er konnte sich eigentlich auf seine Ausdauer verlassen, doch die kräftezehrenden Wasserlieferungen brachten ihn immer wieder an seine Grenzen. Zu Hause angekommen würde er sich direkt zum Schlafen hinlegen.
Er wandte sich im Gehen um und drehte den Kopf nach hinten. »Bist du noch da?«, fragte er in die Dunkelheit hinein.
»Natürlich«, antwortete Armin und an der Lautstärke seiner Stimme schätzte Tom die Entfernung zwischen ihnen auf etwa zehn Meter. »Du hörst doch meine Schritte hinter dir, also weißt du, dass ich noch da bin, oder?«
»Manchmal kann man nicht mehr unterscheiden, ob es bloß die eigenen Schritte sind, die von den Wänden widerhallen oder ob es fremde sind, die man hört.«
»Mensch Tom, jetzt mach dir mal nicht ins Hemd! Wir sind diese Strecke doch schon so oft gelaufen und noch nie haben wir uns verloren.«
»Ja, zum Glück!«
Im Gegensatz zu Armin hatte Tom diesen Tunnel noch nie allein durchquert. Überhaupt war er noch nie allein außerhalb seiner Heimat, der alten U-Bahn-Station Wittenau, unterwegs gewesen. Armin hingegen verließ die Station hin und wieder, ganz ohne Begleitung und für mehrere Wochen. Die allermeisten Bewohner zogen es jedoch vor, in kleinen Gruppen loszuziehen, denn man konnte nie wissen, was Reisende in den Tunneln erwartete. Auf dieser Strecke gab es aber seit Langem keine Zwischenfälle mehr und der Abschnitt zwischen Wittenau und der Klinik galt als sicher.
»Hast du etwa Angst vor den Tunnelstreichern?«, fragte Armin und Tom meinte, einen spöttischen Unterton aus seiner Stimme herauszuhören.
»Natürlich nicht«, erwiderte er, »das sind doch alles nur Ammenmärchen.« Trotzdem verspürte er mit einem Mal ein unangenehmes Prickeln im Nacken. Geschichten von beängstigenden und schlimmen Ereignissen, die sich zutrugen, bekam man ständig zu Ohren. Häufig berichteten Leute von wilden Hunden, die hier unten in Rudeln lebten und gelegentlich Reisende anfielen. Auch wurde von plündernden und mordenden Banden erzählt, die umherzogen und sich gewaltsam alles nahmen, was sie in die Finger bekamen. Toms Heimatstation war von solchem Unheil bisher glücklicherweise verschont geblieben. Vermutlich lag sie einfach zu abgeschieden.
Was nun die Tunnelstreicher anbelangte, so kursierten etliche Gerüchte über sie, doch was sie genau waren und woher sie kamen, das wusste niemand. Angeblich zogen die Tunnelstreicher als Einzelgänger durch den Untergrund und jagten Menschen, um sie anschließend zu fressen. Dabei schnappten sie sich ausschließlich Alleinreisende und mieden Gruppen sowie bewohnte Stationen. Eigentlich schenkte Tom den Geschichten keinen Glauben, aber bei der Vorstellung, dass diese Wesen doch existierten und verborgen in der Finsternis auf Beute warteten, spürte er leise Angst in sich aufsteigen. Besonders wenn er sich gerade ohne Licht mitten in einem stockdunklen Tunnel befand.
»Die Tunnelstreicher können überall lauern«, erklärte Armin. »Ich habe gehört, dass sie in der Lage sind, sich im Dunkeln perfekt zu bewegen und das auch noch lautlos.«
»Aber wir sind zu zweit und die Tunnelstreicher machen nur auf einzelne Personen Jagd«, entgegnete Tom. In diesem Tunnel ist noch nie etwas passiert, sagte er zu sich selbst und versuchte, sein aufkeimendes Unbehagen zu ignorieren. Musste Armin jetzt damit anfangen? Er machte sich wohl einen Spaß daraus.
»Wer weiß«, raunte Armin, »vielleicht sind sie so hungrig, dass sie jetzt auch zwei Leute auf einmal angreifen.«
Plötzlich kam es Tom vor, als würde sich in der Schwärze vor ihm etwas bewegen. Schemenhafte Umrisse tanzten vor seinen Augen. Kein Grund zur Beunruhigung. Er kannte dieses Phänomen. Wenn man längere Zeit durch die Finsternis lief, begann die Wahrnehmung Streiche zu spielen. Tatsache war, dass er nichts sah, aber sein Gehirn ihm vorgaukelte, bizarre Formen oder gar Gegenstände in der Dunkelheit auszumachen.
Ohne stehen zu bleiben, schloss er die Augen, fuhr sich mit Daumen und Zeigefinger über die Lider und vergewisserte sich, dass sie tatsächlich zu waren. Die tanzenden Umrisse verschwanden. Erleichtert atmete er auf. Doch als er die Augen wieder aufschlug und geradeaus ins Nichts starrte, überkam ihn das Gefühl, als könne er jeden Moment mit der Stirn gegen etwas Hartes prallen. Instinktiv zog er den Kopf ein und kam sich sogleich albern vor. Er lief schließlich genau in der Mitte zwischen den Gleisen und wusste, dass es in diesem Tunnel keine Hindernisse gab, schon gar nicht auf Kopfhöhe. Doch das Gefühl hielt an und je mehr er versuchte, es abzuschütteln, desto stärker wurde es. Kurze Zeit später wurde der Drang übermächtig, stehen zu bleiben, und er musste sich zwingen weiterzulaufen. Sein Puls beschleunigte und er atmete etwas zu schnell. Panik drohte, sich in ihm auszubreiten. Er holte langsam und gleichmäßig Luft und versuchte, sich zu beruhigen. Es gab nichts, mit dem er zusammenstoßen konnte.
»Ist alles in Ordnung? Du sprichst ja gar nicht mehr mit mir«, hörte er Armin sagen.
Tom streckte die Arme aus und tastete mit den Händen in der Luft vor seinem Gesicht herum. Sein Tempo verlangsamte sich. Im selben Moment stieß er mit dem linken Fuß gegen etwas Weiches. Augenblicklich erstarrte er. Mitangehaltenem Atem und nicht fähig, sich zu rühren, stand er da. Etwas lag direkt vor ihm auf den Gleisen und er konnte absolut nichts sehen. Er wusste nur, dass es auf dem Hinweg noch nicht dagelegen hatte.
»Schnell, mach die Lampe an, hier ist irgendwas!«, rief er mit zitternder Stimme. Er wollte gerade einen vorsichtigen Schritt zurück machen, als Armin von hinten gegen ihn prallte. Tom stolperte über das, was dort am Boden lag und schlug schreiend auf den harten Holzschwellen auf. Heftiger Schmerz zuckte durch seine Unterarme, doch er nahm ihn kaum wahr. Vielmehr spürte er das weiche Ding unter seinen Beinen liegen. Hastig robbte er ein Stück nach vorne, um von ihm wegzukommen.
»Verdammt, was ist denn los?«, fragte Armin mit erregter Stimme. »Warum bleibst du einfach stehen?«
»Da liegt irgendetwas. Mach doch endlich Licht an. Ich bin gestürzt!«
»Hast du dich verletzt?«
»Ich glaube nicht. Aber meine Arme tun weh.« Ein heller Lichtkegel durchschnitt die Dunkelheit und Tom kniff die Augen zusammen, als Armin ihn mit der Taschenlampe anleuchtete. Dann glitt das Licht von ihm weg und über die rostigen Schienen. Etwa einen Meter von ihm entfernt lag ein menschlicher Körper, bäuchlings, das Gesicht nicht zu sehen.
Armin kniete sich hin. »Der ist tot«, stellte er fest. »Anscheinend erschossen worden.«
»Von wem? Banditen?«
»Möglich. Aber unwahrscheinlich. Schießende Banditen sind selten.«
Das stimmte. Tom wusste, dass die umherziehenden Diebe und Plünderer für gewöhnlich nicht über Schusswaffen verfügten. Stattdessen gehörten primitive Schläger oder Messer zu ihrer Ausrüstung und nicht selten kämpften sie auch einfach nur mit Händen und Füßen. Schusswaffen und besonders die Munition dafür waren rar und schwer zu beschaffen. An Toms Heimatstation gab es genau zwei Gewehre, die von den Wachen am Eingang getragen wurden. Nur im äußersten Notfall durfte geschossen, keine Kugel verschwendet werden.
Armin kam zu Tom herüber und half ihm auf die Beine. »Wirklich alles okay mit dir?«
Tom schob die Ärmel hoch und sah ein paar Abschürfungen. »Ja, alles in Ordnung. Nichts Ernstes.«
»Halt mal die Lampe,« sagte Armin, dann bückte er sich hinunter und drehte die Leiche auf den Rücken. Ein alter Mann, vermutlich um die achtzig. Neben dem fast kahlen Schädel lag ein Basecap mit verblasstem Logo. Der gestutzte schneeweiße Bart war mit Blut bespritzt, die Augen geschlossen.
Tom keuchte auf. »Das ist Kuba!«, rief er und starrte schockiert auf die blutgetränkten Kleider. Sein Herz begann wild zu schlagen.
»War Maya nicht heute mit Kuba unterwegs?«, fragte Armin vorsichtig.
»Ja«, stieß Tom hervor und sein Magen krampfte sich heiß zusammen. Maya war seine kleine Schwester und erst dreizehn. »Sie wollten zusammen eine Ladung Kartoffeln besorgen, zum Schnapsbrennen.« Stockend atmete er ein und fragte mit vibrierender Stimme: »Was machen wir denn jetzt?«
2.
Tom, Station Wittenau
Karla, die Leiterin der Station Wittenau, hatte ihr von grauen Strähnen durchsetztes Haar zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden und sich in eine wärmende Strickjacke gehüllt. Neben ihr stand Olaf, ihr Stellvertreter, ein Mann mittleren Alters mit dünnem Haar und fast einen Kopf kleiner. Seine Brille mit den zerkratzten Gläsern saß schief auf der Nase, das rote Halstuch und die Mütze, die er sonst zu tragen pflegte, fehlten. Zusammen mit Tom, seiner Mutter Ariane und Armin hatten sie sich auf dem kleinen Platz versammelt, um den sich die Hütten ringsherum dicht an dicht drängten.
Tom blickte zur großen Uhr am Pfosten. Es war fast Mitternacht und die Beleuchtung daher in der gesamten Station auf ein Minimum reduziert. Doch auch am Tage brannten meist nur wenige Lampen, denn Treibstoff, um den altersschwachen Generator anzutreiben, war knapp und teuer.
Unruhig huschten Olafs Augen über die Anwesenden.
Karlas Miene hingegen war ernst und angespannt. »Habe ich das richtig verstanden?«, begann sie. »Ihr habt Kuba tot im Verbindungstunnel zu unserer Nachbarstation aufgefunden. Dorthin ist er heute Nachmittag mit Maya, der Tochter von Ariane, aufgebrochen. Und Maya ist seitdem verschwunden. Sie ist hier nicht aufgetaucht und es wurden keinerlei Hinweise auf ihren Verbleib gefunden?«
Tom und Armin nickten. Sie hatten den Fundort der Leiche genauestens untersucht, aber nichts entdeckt. Auch auf dem weiteren Rückweg hatten sie alles gründlich abgeleuchtet, jede Nische, jede Ritze, jedoch keine Spuren gefunden.
»Wer kann etwas so Abscheuliches getan haben?«, fragte Olaf. »Und weshalb?«
»Genau das müssen wir herausfinden«, sagte Karla. »Dieses Verbrechen muss aufgeklärt werden. Der Tunnel zu unseren Nachbarn war bis jetzt immer sicher. Ich kann mich nicht erinnern, dass sich je ein solcher Vorfall ereignet hätte.«
»Sind die beiden vielleicht von Banditen überfallen worden?«
»Unwahrscheinlich«, warf Armin ein. »Kuba ist erschossen worden. Mehrere Kugeln stecken in seinem Oberkörper.«
Olaf nickte. »Aber wer sollte so etwas tun? Unsere Freunde von der Nachbarstation kommen doch wohl nicht in Frage.«
»Das kann ich mir auch nicht vorstellen«, bestätigte Karla. »Seit ich denken kann, leben wir in gegenseitiger Achtung und helfen uns, wo wir können.«
»Wer war es dann?«
Schweigen.
Niemand sagte etwas und erst nach einer Weile ergriff Olaf wieder das Wort. »Vielleicht«, sagte er langsam, »vielleicht waren es die Tunnelstreicher.«
Karla verdrehte die Augen. »Blanker Unsinn!«, fuhr sie ihn an. »Dass du überhaupt an dieses Zeug glaubst.«
»Wir alle kennen die Gerüchte über die Tunnelstreicher!«, rief Olaf, nun seinerseits empört. »Niemand kann sagen, ob es sie tatsächlich gibt oder nicht. Stellt euch vor, sie existieren doch. Sie lauern den Leuten auf, fangen sie und fressen sie!«
Bei diesen Worten entrang sich Arianes Kehle ein kummervoller Laut.
Karla stellte sich neben sie, legte ihr einen Arm um die Schultern und warf Olaf einen bösen Blick zu. »Und warum wurde Kuba dann nicht gefressen? Und was ist mit der Tatsache, dass er erschossen wurde? Hast du das auch in deine Überlegungen mit einbezogen?« Sie wandte sich an Ariane. »Wir werden herausfinden, was passiert ist.«
»Ich will nur wissen, wo meine Tochter ist«, sagte Ariane mit bebender Stimme. »Jemand muss sie suchen!«
»Sehr richtig«, bestätigte Karla.
»Und wer soll das machen?«, fragte Olaf und blickte herausfordernd in die Runde. »Die meisten verlassen die Station doch so gut wie nie. Und die, die es tun, wagen sich maximal bis zur Nachbarstation oder eine darüber hinaus. Niemand hat Erfahrungen mit dem weitläufigen Tunnelsystem, das sich jenseits erstreckt, und das Mädchen könnte überall sein.«
Tom stand die ganze Zeit stumm da. Er überlegte fieberhaft. Auch er hatte keine Ahnung von der Welt da draußen, die aus Hunderten oder gar Tausenden von düsteren Tunneln, Gängen und Schächten bestehen musste. Auch er blieb, wenn möglich, hier in Wittenau und viel weiter als bis zu ihren nächsten und übernächsten Nachbarn war er nie gekommen. Doch wenn sich nun niemand bereit erklärte, nach Maya zu suchen, so blieb als einzige Möglichkeit, dass er selbst es tat. Aber wie bereitete man sich auf eine solche Expedition vor? Er brauchte einen Rucksack. Den besaß er. Und Vorräte. Eine starke Lampe mit guten Akkus. Robuste Kleidung. Was noch? Er konnte sich nicht vorstellen, was ihn jenseits der ihm bekannten U-Bahn-Stationen erwartete. Pläne und Karten gab es zwar, doch was sagten die schon aus. Mehr als den Weg konnte man auf ihnen nicht ablesen.
Sein ganzes Leben hier unten hatte sich im Schutz dieser Station abgespielt. Würde er sie verlassen, um sich auf die Suche nach Mördern zu machen, begab er sich zweifellos in große Gefahr. In Lebensgefahr. Kaltblütig hatten sie einen alten Mann erschossen. Nein, er konnte nicht gehen. Aber was wurde dann aus Maya? Er würde sie im Stich lassen. Er würde sie nie wiedersehen. Bei diesem Gedanken fuhr ihm ein unangenehmes Kribbeln über die Haut und plötzlich durchzog Eiseskälte seine Brust.
Unzählige Erinnerungen stiegen in ihm empor. Maya, die ihm erst vor kurzem das schon wieder zu lang gewordene schwarze Haar geschnitten hatte. Maya lachend, zusammen mit Kuba, der sie wie eine geliebte Enkelin behandelte. Das kleine dreijährige Mädchen, das sie einst gewesen war, als sie aufgrund des großen Krieges in den Untergrund flüchten mussten. Später brachte Tom ihr Lesen und Schreiben bei und verschlang etliche Bücher mit ihr zusammen. Große Bildbände hatten sie durchgeblättert und er erzählte ihr alles über die ehemalige Oberwelt. Auch sonst kümmerte er sich viel um sie, denn Ariane war oft zu beschäftigt und überließ ihm, ohne es je direkt ausgesprochen zu haben, diese verantwortungsvolle Aufgabe. Ariane, die einzige Person an der Station, die über eine medizinische Ausbildung verfügte und vor dem Krieg viele Jahre in einem Krankenhaus als Ärztin tätig gewesen war, kümmerte sich hier um kranke Bewohner und Verletzungen aller Art. Wenngleich nur etwa sechzig Menschen in Wittenau lebten, füllte sie diese Aufgabe vollständig aus. Oft kamen auch Bewohner der Klinik, um sich von ihr behandeln zu lassen, denn ironischerweise gab es dort nichts, was auch nur im Entferntesten an eine echte Klinik erinnerte. Klinik lautete lediglich die Kurzform des zu langen Namens U-Bahn-Station Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik. Einen Arzt gab es da nicht, ja nicht einmal eine Person mit einfachen medizinischen Grundkenntnissen. Wegen dieser Umstände kam es oft vor, dass Ariane heillos überlastet war.
Tom blickte zu ihr hinüber. Nie hatte er seine Mutter so müde und erschöpft gesehen wie in diesem Moment. Tiefe Sorgenfalten durchschnitten ihr Gesicht und das dunkelblonde Haar wirkte matt und kraftlos. Selbst die Klamotten schienen ungewöhnlich schlaff an ihr herab zu hängen und das Silber ihrer filigranen Armbanduhr und ihrer Ohrringe schimmerte schwach und leblos. Er konnte ihren Kummer förmlich spüren. Und plötzlich wurde ihm klar: Es war seine Pflicht, Maya zu suchen. Es war seine Aufgabe, sie zurück nach Hause zu holen. Niemand sonst kam dafür in Frage.
Er öffnete den Mund, um zu sprechen, als Armin vortrat und verkündete: »Ich gehe!« Er stemmte die Fäuste in die Hüfte. »Ich mache es.«
Tom hörte seine Mutter aufatmen.
»Ich war ja schon ein paar Mal da draußen unterwegs. Ich werde nach Maya und den Mördern von Kuba suchen.«
»Ich komme mit!«
Armin sah überrascht zu Tom herüber und auch die anderen drehten die Köpfe und blickten ihn an.
»Tom …«, sagte er ruhig. »Das ist zu gefährlich.«
»Nein!« Tom schüttelte den Kopf. »Ich begleite dich.«
»Es ist besser, wenn du hier bleibst. Glaub mir.«
»Ich werde dir bei der Suche helfen!«
»Aber du hast so gut wie keine Erfahrung in den Tunneln. Es ist wirklich besser für dich, wenn du hier bleibst.«
»Warum sollte er nicht mitkommen?«, mischte sich nun Karla ein. »Es ist seine Schwester und er will sie zurückhaben. Ihr geht beide. Zu zweit ist es ohnehin sicherer!«
Armin sah abwechselnd zwischen Karla und Tom hin und her. »Also gut«, sagte er schließlich.
»Und wo wollt ihr anfangen?«, erkundigte sich Olaf.
»Wir fragen zunächst an der Klinik nach, ob jemand etwas beobachtet hat oder ob dort irgendwelche Fremden gesichtetwurden. Allerdings …«, Armin machte eine Pause und überlegte kurz. »Allerdings habe ich auch schon eine ganz konkrete Idee, wo wir Ausschau halten können.«
»Wirklich?«, fragte Tom verblüfft. »Wo denn?«
»In Richtung Süden kommt nach sieben oder acht Stationen der Bahnhof Pankstraße. Ich habe mitbekommen, dass sich dort vor einiger Zeit eine größere Gruppe von Banditen niedergelassen hat. Sie überfallen angeblich regelmäßig Stationen in der Nähe und sollen auch einige der Bewohner entführt haben.«
»Woher weißt du das?«
»Vor ein paar Wochen war ich in der Gegend unterwegs. Da wurde es mir von mehreren Leuten berichtet. Es besteht die Möglichkeit, dass diese Bande etwas mit Mayas Verschwinden und Kubas Tod zu tun hat.«
Tom spürte, wie seine Mutter ihn an der Hand fasste. Sie sah ihn an. »Ich will nicht, dass du gehst!«
»Wir werden gut aufpassen«, sagte Armin. »Es wird zwar sicher nicht ungefährlich, aber wir gehen die Sache ruhig und wohlüberlegt an und keine unnötigen Risiken ein. Zur Not können wir die Suche jederzeit abbrechen, sollte etwas schief gehen.«
Das schien Ariane nicht zu beruhigen, denn sie umklammerte Toms Hand nur noch fester und er bemerkte, dass sich ihre Augen mit Tränen füllten.
»Wir rüsten uns aus und brechen dann sofort auf«, erklärte Armin. »Je länger wir warten, desto schlechter!«
*
Die Station Wittenau besaß als Endstation nur einen Zugang zum Tunnel. Dort wollten sich Tom und Armin in einer halben Stunde treffen. Bis dahin musste Tom noch einiges erledigen. Er lief an der kleinen offenen Werkstatt, dann an der Gemeinschaftsküche vorbei. Jetzt, zu dieser späten Stunde, arbeitete hier niemand mehr und alles lag verlassen da. Die Feuer in den beiden alten Küchenöfen aus Gusseisen waren erloschen und der große steinerne Spültrog dahinter verschwamm im spärlichen Licht zu einem bloßen Schatten. Direkt an die Küche schloss sich der kleine Platz mit den Tischgruppen an. Tom dachte an die vielen Abende mit Brett- und Kartenspielen, an denen er oft teilnahm. Witze wurden gemacht und es wurde gelacht. Manchmal erzählte jemand Geschichten oder las vor. Stundenlang konnte man zuhören. Zwischen den Tischen ragte der krumme Weihnachtsbaum empor, bei dem es sich, obgleich er tatsächlich aus Holz bestand, nicht um einen echten Baum handelte. Das Gebilde aus alten Latten und Stöcken, in Aufbau und Form einer Tanne nachempfunden, war mit Sternen aus gebogenem Draht geschmückt. Bald würde der Baum in den Öfen die Flammen nähren, denn das Weihnachtsfest lag schon eine Weile zurück und das neue Jahr hatte begonnen.
Tom kam am Brunnen vorbei, einem Schacht von etwas mehr als einem Meter im Durchmesser, der vor einigen Jahren unter gewaltiger Anstrengung senkrecht in die Tiefe gegraben worden war. Eine niedrige Mauer aus behauenem Betonbruch und Natursteinen umsäumte das Loch. Darüber befand sich ein stabiles Holzgestell mit Flaschenzügen. Zerbeulte Blecheimer mit langen Seilen daran standen ordentlich aufgereiht in der Nähe. Zusammen mit einigen anderen war Tom für das Trinkwasser zuständig. Jeden Morgen schöpften sie die für den täglichen Bedarf benötigte Menge und füllten es anschließend in die Kunststoffkanister, die sie zu ihren festen Plätzen auf der gesamten Station brachten. Dort konnte sich jeder bedienen. Mitunter kam es vor, dass sie nachmittags noch einmal nachschöpften. Zur Sicherheit ließen sie das klare Grundwasser durch einen Kiesfilter laufen, damit es sich in den Kanistern oder beim Abkochen aufgrund des hohen Eisengehalts nicht rostrot verfärbte.
Wassermangel hatte es nie gegeben, im Gegenteil, sie konnten es sich sogar erlauben, erhebliche Mengen davon an die Klinik zu liefern, an der es zwar auch einen Brunnen gab, der aber vor einiger Zeit eingestürzt und noch nicht wieder instand gesetzt worden war.
Tom erreichte den Schlafsaal im hinteren Teil der Station, einen mit alten Blechen und Brettern abgetrennten Bereich. Etwa ein Dutzend Menschen hatten hier ihr bescheidenes Heim. Auf Zehenspitzen schlich er durch die Reihen der Schlafenden, die auf alten Matratzen, in Schlafsäcken und unter löchrigen Decken lagen. Vor zwei Jahren hatte er hier einen freien Platz übernommen. Sicher, das war nicht ganz so gemütlich wie in der Hütte, in der seine Mutter und seine Schwester wohnten, aber irgendwann war es ihm dort doch zu eng geworden. Außerdem lebte auch sein guter Freund Claudio im Saal. Zwanzig Jahre alt, genau wie Tom. Claudio verließ die Station so gut wie nie, denn in der Vergangenheit hatte er sich bei einem Sturz das Bein gebrochen und es war etwas schief wieder zusammengewachsen. Zwar konnte er sich gut bewegen, doch längere Märsche ließ die alte Verletzung nicht zu.
Tom rüttelte vorsichtig an Claudios Schulter. Dieser öffnete die Augen einen Spalt breit und sah ihn verschlafen an. Leise berichtete Tom von den Ereignissen. Als er endete, saß Claudio kerzengerade auf seiner Matratze. Unruhe spiegelte sich in seinem Blick und er fuhr sich besorgt mit der Hand durch den irokesenhaft gestutzten, rabenschwarzen Haarschopf.
»Mensch, das ist ja ungeheuerlich, was du da erzählst!«
»Ich werde mit Armin losziehen und nach Maya suchen.«
»Wann wollt ihr aufbrechen?«
»Jetzt gleich, ich packe noch ein paar Sachen ein und dann geht’s los.«
»Tom, du warst doch noch nie weiter als zwei oder drei Stationen von hier entfernt. Bist du sicher, dass du das machen willst?«
»Ich habe keine Wahl. Ich muss nach ihr suchen, sie ist meine kleine Schwester. Auf keinen Fall kann ich hier bleiben und untätig abwarten.«
»Aber du weißt doch, dass schon so mancher aufbrach und nie mehr zurückkehrte, einfach verschwunden ist.«
Tom spürte ein unangenehmes Ziehen in der Magengegend. »Ich weiß. Und ehrlich gesagt habe ich ziemlichen Bammel vor der ganzen Sache. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was auf mich zukommt.«
»Gut, dass Armin dabei ist. Er hat immerhin etwas Erfahrung in den Tunneln.«
»Ja, da bin ich auch heilfroh!«
»Ich hoffe, er wird gut auf dich aufpassen. Und ich hoffe, auch du passt gut auf dich auf, Tom!«
»Ja, das hoffe ich auch.«
Claudio wandte sich um und öffnete die selbst gebaute Holzkiste neben seiner Matratze. Mit einem Feuerzeug leuchtete er hinein, dann zog er etwas Großes heraus. Die Armbrust. Diese Waffe hatte Claudio vor Jahren, als sein Bein noch heil gewesen war, auf einem Markt an einer Station in der Nähe bekommen. Ein riesiger Glücksfall. Es handelte sich um eine Compound-Armbrust von herausragender Qualität, gefertigt aus einem leichten, aber stabilen Material, einfach zu spannen und mit enormer Präzision und Durchschlagskraft. Schon unzählige Male waren Tom und Claudio zusammen ein kleines Stück in den Tunnel gegangen und hatten dort Ratten gejagt. Die kleinen Biester zu treffen, verlangte viel Geduld und eine ruhige Hand, doch mit der Zeit entwickelte sich Tom zu einem passablen Schützen. Dennoch bereitete es große Schwierigkeiten, die Population der Tiere unter Kontrolle zu halten. Immer wieder passierte es, dass eine ganze Schar in die Station eindrang und sich über die Vorräte hermachte. Die Schäden konnten verheerend sein.
»Hier, nimm sie«, sagte Claudio und hielt ihm die Waffe hin. »Vielleicht wird sie dir nützlich sein.«
Tom zögerte. »Ich weiß nicht …« Die Vorstellung, mit der Armbrust auf etwas anderes zu schießen als Ratten oder leere Blechdosen, löste ein starkes Unbehagen in ihm aus.
»Nun nimm sie schon. Hier in der Kiste liegt sie nur nutzlos herum.«
Tom schwieg.
Claudio sah ihn eindringlich an. »Besser dabei haben und nicht brauchen als anders herum«, sagte er mit Nachdruck.
»Also gut.« Tom nahm die Armbrust entgegen, an der sich - neben einem Tragegurt - vorn auch eine leistungsstarke Taschenlampe befand. Er hängte die Waffe über die Schulter. »Danke!«
Claudio überreichte ihm zwei Handvoll Bolzen. »Du weißt ja, wie man mit dem Teil umgeht. Schießt inzwischen besser als ich.«
»Du wirst sie auf jeden Fall zurückbekommen!«
»Am wichtigsten ist, dass du heil zurückkommst. Zusammen mit Maya.«
Kurze Zeit später verließ Tom den Schlafsaal und schritt durch eine schmale Gasse zwischen den ohne große Kenntnis oder Sorgfalt errichteten Hütten entlang. Eigentlich nicht mehr als bloße Verschläge, zusammengefügt aus Brettern, Planen und lose gestapelten Steinen. Er schob einen Vorhang zur Seite und betrat eine der kleinen Behausungen. Seine Mutter saß seitlich auf einem niedrigen Schemel und lehnte mit einer Schulter an der Wand. Sie sah furchtbar mitgenommen aus und ihre Augen waren rot gerändert. Neben ihr auf dem Boden stand eine kleine Öllampe, die träge vor sich hin flackerte.
Tom stellte seinen Rucksack ab, legte die Armbrust daneben und bemerkte, wie der Blick seiner Mutter voller Besorgnis darüber glitt. »Es gefällt mir nicht, dich damit aufbrechen zu sehen«, sagte sie leise und sah zu ihm auf. Tom erwiderte nichts. Er wusste, dass diese Waffe in ihren Augen nur ein unnötiges und gefährliches Spielzeug war. Ihn damit hantieren zu sehen, hatte ihr nie recht gefallen.
»Ich werde sie bestimmt gar nicht brauchen«, versuchte er sie zu beruhigen. »Claudio bestand darauf, dass ich sie mitnehme.«
»Deinem Vater …«, begann Ariane und plötzlich lag ein Anflug von Lächeln auf ihrem Gesicht, »… hätte es wohl nicht so viel ausgemacht wie mir.«
Unwillkürlich musste auch Tom lächeln. Alte Zeiten riefen sich wie von selbst in Erinnerung. Zeiten aus einem anderen Leben, vor dem großen Krieg, der jetzt zehn Jahre zurücklag. Bruchstücke von Szenen begannen sich vor seinem inneren Auge abzuspielen. Undeutlich sah er Hosenbeine aus grobem Kord und karierte Hausschuhe. Sein Vater Torger stand mitten im Wohnzimmer. Tom hob den Kopf und schaute direkt in die schwarzen Augen, die warm und freundlich zurückblickten. Unter dem ebenso schwarzen Bart war ein Lächeln zu erkennen.
»Alles in Ordnung, mein Junge«, sprach Torger. »Mach dir keine Sorgen!«
Ariane stand im Durchgang zur Küche und redete auf seinen Vater ein. Sie stritten selten. Doch ab und zu passierte es, dass sie aneinander gerieten. Torger nahm Tom oft mit in den Wald. Dort gab er ihm sein Taschenmesser und erlaubte ihm, sich im Schnitzen zu üben. Ariane hatte es herausgefunden. Ihre Einstellung war eine ganz andere. Sie ließ Tom nicht einmal eines der stumpfen Küchenmesser benutzen und versuchte so gut es ging, alle möglichen Gefahrenquellen zu beseitigen. Sein Vater hingegen sah es nicht ein, weshalb ein Sechsjähriger kein Messer benutzen oder ein Streichholz entzünden sollte. Statt die Dinge fernzuhalten, erklärte er lieber, wie man richtig mit ihnen umging und worauf man achten sollte.
»Ich bin froh, dass Armin dabei ist«, sagte Ariane und holte Tom aus seinen Erinnerungen zurück.
»Ich auch«, erwiderte Tom. »Ich treffe mich gleich mit ihm und dann brechen wir auf.« Er wusste nicht, was er noch sagen sollte, also stand er einfach nur da.
Seine Mutter erhob sich. Sie war mehr als einen Kopf kleiner als er, trat auf ihn zu und drückte ihn, ohne etwas zu sagen, an sich. Tom legte die Arme um ihre schmalen Schultern und als er den vertrauten Geruch ihres Haars einatmete, schossen ihm schlagartig glühende Tränen in die Augen.
»Pass bitte gut auf dich auf!«
Er nickte stumm. Nach einer Weile lösten sie sich voneinander. Er sah sie ein letztes Mal an, nahm dann seine Sachen und verließ die Hütte.
Am Lager, das lediglich aus ein paar gestapelten Kisten und wackeligen Holzregalen bestand, machte er Halt. Er nahm etwas Trockenfleisch und einige Konservendosen und legte sie in seinen Rucksack. Das würde hoffentlich reichen. In einem Regal mit Klamotten fand er eine Hose in gutem Zustand, zog sie rasch an und befestigte auch sein Taschenmesser am Gürtel. Seine alte zerschlissene Jeans schmiss er achtlos davon. Dann warf er eine dicke Jacke über, griff nach einer warmen Mütze und beförderte sie mit einer schnellen Bewegung in den Rucksack. Geeignete Schuhe fand er nicht. Also würde er seine abgenutzten Treter anbehalten müssen. Sie waren bereits ziemlich zerfleddert und die Sohlen im Begriff, sich allmählich abzulösen. Nicht gerade beste Voraussetzungen für das, was ihm bevorstand, doch so war es nun. Er prüfte den Inhalt seines Rucksacks: Taschenlampe, Akkus, Streichhölzer, Essen, Wasser. Alles da.
Als er am Eingang der Station ankam, stand Armin noch nicht dort. Der Tunnel war hier bis auf einen schmalen Durchgang von einer hohen Wand aus Steinen und Holzbalken versperrt. Anders als auf der restlichen Station brannten die Lampen in diesem Bereich rund um die Uhr und mit voller Leuchtkraft.
Tom grüßte die beiden Wachen, die auf einem erhöhten Holzsteg standen und über die Mauer hinweg in den Tunnel blickten. Dann schlüpfte er durch die Öffnung nach draußen. Das Licht der Scheinwerfer reichte nur wenige Meter in den Tunnel hinein, bevor es sich in der Finsternis auflöste. Er war schon so oft von hier zur Klinik aufgebrochen und fand nichts Besonderes dabei. Furcht hatte er nie verspürt. Doch nun war alles anders. Wie gebannt starrte Tom geradeaus in die Schwärze, die wie ein düsterer Atem langsam auf ihn zu waberte. Ein kalter Luftzug streifte sein Gesicht, ließ ihn erschauern und einen Augenblick lang rechnete er damit, dass etwas aus der Dunkelheit heran sausen und auf ihn zuspringen würde. Er erschrak, als Armin wie aus dem Nichts hinter ihm auftauchte und plötzlich neben ihm stand.
»Alles in Ordnung? Du bist ja total weiß im Gesicht.«
»Ja, alles in Ordnung«, stammelte Tom und versuchte, sich seine Anspannung nicht anmerken zu lassen.
Armin zog eine Zigarette hervor und entzündete sie. Er trug einen grünen Wollpullover, eine schwarze Hose mit vielen Taschen und massige Wanderstiefel in bemerkenswert gutem Zustand. Eine Wollmütze bedeckte seine blonden Stoppelhaare und wie bei Tom hing ein großer Rucksack über seiner Schulter. Als er die Armbrust bemerkte, nickte er anerkennend. Dann fiel sein Blick auf das Messer an Toms Gürtel.
»Zeig mal her«, sagte er und Tom händigte ihm das Messer aus.
Armin fuhr die Schneide mit dem Daumen entlang und schüttelte den Kopf. Er nahm seinen Rucksack ab und holte einen kleinen Schleifstein hervor. Er zog das Messer einige Male darüber, wobei die Zigarette in seinem Mundwinkel gefährlich auf und ab wippte.
»Woher hast du den?«, fragte Tom und deutete auf den Schleifstein.
»Gefunden. In einem verlassenen Stollen hinter der Klinik.« Er gab Tom das geschärfte Messer zurück und packte den Schleifstein wieder weg. »Gehen wir?«
Tom atmete tief ein. »Gehen wir!«
3.
Tom, Station Rathaus
Reinickendorf
Tom drückte auf den seitlichen Knopf seiner Armbanduhr. Es war ein klobiges Teil mit Kunststoffarmband und Digitalanzeige, nicht gerade schön, aber zweifellos ein wertvoller Gegenstand, den er wie einen Schatz hütete. Die angezeigte Uhrzeit auf dem grün leuchtenden Display verriet, dass sie in Kürze die Station Rathaus Reinickendorf erreichen sollten, die letzte vor der Klinik. Sie war nicht bewohnt und es auch nie gewesen. Tom schaltete seine Taschenlampe ein und richtete den Lichtkegel nach vorne. Und tatsächlich, sie waren bereits aus dem rechten Tunnel hinaus gekommen und einige Meter in die Station vorgedrungen.
Er legte die Lampe auf den Vorsprung des von Staub und Schutt bedeckten Bahnsteigs und stemmte sich hinauf. Teile der Decke waren hier vor langer Zeit herunter gekommen und auch manche der großen runden Deckenlampen lagen zerbrochen am Boden, dazwischen allerhand Müll und Schrott. Zu beiden Seiten des langgestreckten Bahnsteigs verliefen die Gleise, eines für jede Richtung. In der Mitte des Bahnsteigs wurde die Decke auf ganzer Länge von zwei Reihen rechteckiger Säulen gestützt, die im Abstand von wenigen Metern aufeinander folgten.
»Lass uns einen Blick auf den Plan werfen«, sagte Armin und so schritten sie an den Säulen entlang, bis sie zu einem alten zugeschütteten Aufzugschacht aus Stahl und Glas kamen, an dem mehrere flache Kästen befestigt waren.
Tom beleuchtete den ausgeblichenen, wellig gewordenen Plan im mittleren Kasten, der das gesamte U-Bahn-Netz abbildete. Diese alten Pläne fand man an vielen Stationen. Daneben existierten ebenso zahlreiche, nachträglich angefertigte Pläne, die auch Veränderungen, wie zum Beispiel Tunneleinstürze, berücksichtigten und Informationen über einzelne Stationen enthielten. Zusätzlich waren Seitentunnel, kleine Verbindungsgänge und andere Strukturen auf manchen dieser Pläne verzeichnet.
»Ist das hier die unterirdische Stadt Cor?«, fragte Tom und zeigte auf einen kleinen Kreis, neben den jemand den Buchstaben C gemalt hatte.
»Ja, das muss sie sein«, erwiderte Armin.
»Die ist ja ganz schön weit weg! Hast du jemals jemanden getroffen, der schon mal dort gewesen ist?«
»Nein, noch nie. Aber jetzt lass uns unsere Route suchen.«
»In Ordnung. Wo werden wir langgehen?«
»Schau«, sagte Armin und deutete mit dem Finger auf eine Stelle. »Dort oben ist unsere Station. Wir sind jetzt hier eine Station weiter. Die nächste Station ist die Klinik. Die Station danach ist wieder unbewohnt und dann kommt Paracelsus-Bad.«
An der Station Paracelsus-Bad war Tom ein Paar Mal gewesen. Die weiteste Entfernung, die je zwischen ihm und seiner Heimatstation gelegen hatte.
»Bei Paracelsus-Bad machen wir Halt«, erklärte Armin. »Ich möchte dort einen bestimmten Händler aufsuchen.«
»Was willst du von ihm?«
»Ich will sehen, ob wir Schusswaffen bekommen.«
»Gewehre?«
»Ja, zum Beispiel. Oder wenigstens eine Pistole.«
»Eine Pistole?« Tom war nicht sicher, ob ihm dieser Gedanke gefiel. »Du hast doch neulich erst gesagt, wer auf andere schießt, auf den wird auch geschossen.«
»Und warum hast du dann die Armbrust dabei?« Armin sah ihn fordernd an.
»Claudio hat sie mir mitgegeben.« Mehr fiel Tom nicht ein.
»Vernünftig von ihm. Du kannst doch ausgezeichnet mit ihr umgehen. Es ist sicher keine schlechte Idee, sie dabei zu haben.«
»Hm …«, machte Tom zögernd. Es stimmte. Er konnte gut mit der Armbrust umgehen. Und auch darüber hinaus kannte er sich ein bisschen aus. Simon, nach Kubas Tod nun der Älteste an der Station, hatte in der Zeit vor dem Krieg im Spezialeinsatzkommando des Landeskriminalamtes Berlin gedient. Seinen aufregenden Erzählungen hatte Tom oft gelauscht und dadurch einiges erfahren. Simon war es auch, der die Wachposten in Wittenau und der Klinik geschult hatte. Selber Wache stehen konnte er nicht mehr, dafür war er inzwischen zu alt. Der Umgang mit der Armbrust gefiel Tom von Anfang an. Die Präzision, mit der man zu Werke gehen musste, die Geduld und die viele Übung, die es brauchte, bis man sie beherrschte. Das ruhige und kontrollierte Vorgehen, wenn man versuchte, sich lautlos an die Ratten heranzupirschen. In einen beinahe meditativen Zustand konnte man dabei fallen. Doch ebenso starben Menschen durch Waffen. Es waren gefährliche Werkzeuge. In den falschen Händen, richteten sie nichts als Unheil und Leid an.
»Ich denke nicht, dass ich ein echter Freund von Waffen bin«, erklärte Tom.
»Freund oder nicht: Hast du vergessen, wo wir hin wollen? Wir werden der Linie folgen bis zur Pankstraße, wo sich vermutlich eine Horde von Banditen versteckt hält. Kerle, die von Raub und Mord leben. Sie schrecken vor nichts zurück. Darauf müssen wir vorbereitet sein!«
»Ich dachte, Banditen besitzen gar keine Gewehre, sondern nur irgendwelche Knüppel und Schläger.«
»In der Regel stimmt das auch. Aber Kuba ist erschossen worden, vergiss das nicht. Egal, wie sie ausgerüstet sind, mit der Armbrust alleine werden wir jedenfalls nichts gegen sie ausrichten können. Auch wenn es ein wirklich ordentliches Teil ist.«
Tom nickte. Armin hatte ihn und Claudio einige Male begleitet, wenn sie auf Rattenjagd gegangen waren. Dann fragte er: »Was genau weißt du über diese Bande?«
»Ich war, wie schon gesagt, neulich in der Gegend dort unterwegs. Die Station Pankstraße war, wie du vielleicht weißt, einmal bewohnt, doch das ist schon eine ganze Weile her. Und nun haben sich eben die Banditen dort ihren Unterschlupf eingerichtet. Von da starten sie ihre Raubzüge. Die Station Oslo befindet sich in unmittelbarer Nähe. Die haben sie auch überfallen und Vorräte gestohlen, als ich mich dort gerade aufhielt.« Armin machte eine kurze Pause. Dann sprach er weiter. »Obwohl die Bewohner sich bereits ergeben hatten, schreckten diese Teufel nicht davor zurück, einige umzubringen. Sie haben auch Menschen verschleppt. Deshalb bin ich ja darauf gekommen, dass sie mit Kubas Tod und Mayas Verschwinden etwas zu tun haben könnten.«
Bei dem Gedanken, Maya könne sich in den Händen dieser furchtbaren Verbrecher befinden, wurde Tom ganz anders. Er wagte nicht, weiter darüber nachzudenken.
»Jedenfalls hatten diese Kerle angekündigt, Oslo erneut heimzusuchen«, fuhr Armin fort. »Ich bin dann schleunigst abgehauen.«
»Wie sollen wir eigentlich zu zweit etwas gegen die unternehmen? Da haben wir doch gar keine Chance.«
»Ehrlich gesagt, weiß ich das auch noch nicht. Aber möglicherweise finden wir an der Station Oslo Leute, die uns unterstützen. Wir werden sehen. Uns wird schon was einfallen.«
»Wie lange werden wir bis Pankstraße brauchen?«
»Es sind ein paar Kilometer, aber nicht allzu viele. Es kommt auch darauf an, wie lange wir uns bei Paracelsus-Bad aufhalten. Lass uns jetzt weiter gehen.«
Wenig später hatten sie die Station Rathaus Reinickendorf hinter sich gelassen und waren wieder im Tunnel unterwegs. Wie gewohnt liefen sie ohne Licht und die Dunkelheit umhüllte sie dicht. Tom atmete gleichmäßig und lauschte den Geräuschen der Steine, die unter seinen Schuhsohlen leise aneinander rieben. Ein Stück voraus vernahm er Armins Schritte, ansonsten herrschte Totenstille.
Ihm war klar geworden, dass er einerseits viel und andererseits fast nichts über Armin wusste. Kaum mehr, als dass er mit vollem Namen Armin Lenk hieß und ein gutes Stück älter war als er. Wann sie sich zum ersten Mal begegnet waren, hatte er vergessen. Es lag zu weit zurück. Er erinnerte sich jedoch, dass Armin einst am Eingang zur Station Wittenau Wache geschoben hatte. Dann war er eine Zeit lang wie Tom für das Trinkwasser der Station verantwortlich gewesen. Zuvor hatte er beim Bau des Brunnens mitgewirkt. Auch an der Klinik hatte er beim Brunnenbau geholfen. Zu Tom verhielt er sich stets loyal, genauso wie zu allen anderen Bewohnern und seine Hilfsbereitschaft wurde allgemein geschätzt. Über Armins Vergangenheit und wo er gelebt hatte, bevor er nach Wittenau gekommen war, wusste Tom hingegen nichts. Auch was Armin tat, wenn er die Station gelegentlich für eine Weile verließ, entzog sich seiner Kenntnis.
»Kann ich dich was fragen?«, sprach Tom in die Stille hinein.
»Sicher.«
»Was machst du, wenn du manchmal eine Zeit lang von zu Hause weg bist?«
»Ach … so dies und das. Ich kenne eine Menge Leute, manchmal besuche ich sie, oder erledige einen Job für jemanden.«
»Was denn für Jobs?«
»Naja, alles Mögliche.« Armin zögerte einen Moment. »Du kannst dir gar nicht vorstellen, was man alles für Aufträge bekommt.« Er lachte auf. »Aber lass uns jetzt nicht darüber reden, auf manches bin ich nicht unbedingt stolz.«
Tom interessierte es brennend, was für Jobs es waren, die Armin erledigte, aber er traute sich nicht weiter zu fragen und ließ es gut sein. Nachdem sie eine Weile schweigend weitergegangen waren, schaltete Tom die Lampe ein. Gleich würden sie zu der schaurigen Stelle kommen, an der noch immer der Körper Kubas lag und er wollte nicht noch einmal über den Leichnam stolpern.
»Da ist es«, sagte Armin und deutete nach vorn.
Der Tote lag zwischen den Schienen im Gleisbett und als Tom beim Näherkommen den Lichtkegel auf ihn richtete, sah er einige fette Leiber mit dünnen langen Schwänzen, die laut piepsend aufschreckten und davonrasten. Die Ratten hatten bereits angefangen, an den Gliedmaßen zu knabbern. Eigentlich hatte Tom es vermeiden wollen, den Leichnam anzuschauen, aber als sein Blick erst einmal an ihm haftete, konnte er ihn nicht mehr lösen. Erschüttert starrte er auf den Körper unten am Boden, der irgendwie viel zu klein für einen kompletten Menschen aussah. Die Haut über Wangen und Stirn war unnatürlich entspannt und hing schlaff herunter. Als er den Lichtstrahl direkt aufs Gesicht richtete, konnte er durch die dünnen, von violetten Äderchen durchzogenen Lider hindurch die schwarzen Pupillen der dahinterliegenden Augen erkennen. Der Tote starrte zurück! Plötzlich wurde der Boden unter Toms Füßen ganz weich und er drohte, in die Tiefe hinabzustürzen.
»Hey Tom,« rief Armin laut und rüttelte an seiner Schulter. Er nahm ihm die Lampe weg und schob ihn beiseite. »Besser, wenn man nicht zu lange hinsieht!«
»Ja, das war dumm«, stotterte Tom. Auf seinem Gesicht hatten sich winzige Schweißperlen gebildet, trotz der kühlen Luft. Er wischte sie mit dem Jackenärmel davon.
»Komm, lass uns verschwinden«, sagte Armin, »gleich sind wir an der Klinik.«
4.
Tom, Station Klinik
Tom und Armin näherten sich dem quer durch den Tunnel verlaufenden Wall aus aufgeschütteten Steinen, hinter dem sich der Bahnsteig erstreckte. An der Klinik lebten etwa so viele Menschen wie in Wittenau, ebenfalls in winzigen Hütten und Häuschen, so viele und so dicht, dass sie Gleise und Bahnsteig nahezu vollständig unter sich verbargen.
Als sie auf den Wall zukamen, sahen sie im schwachen Licht, dass nur eine einzelne Person Wache hielt. Tom, der alle Angehörigen des Wachpersonals von seinen zahlreichen Besuchen her kannte, wusste längst, um wen es sich bei der Frau handelte. Es war Babette. Unschwer zu erkennen an ihrem grünen Mantel. Unter einer wärmenden Mütze lugten Büschel ihres dunkelroten Haares hervor. Tom vermutete, dass es irgendwie gefärbt war, denn es war ein unnatürlich intensiver und kühler Ton.
Als Babette die beiden erblickte, rief sie: »Halt! Sofort stehen bleiben!« Sie richtete den Strahl einer starken Taschenlampe auf sie. »Auf die Knie! Ich will eure Hände sehen!«
»Sehr einfallsreich, Babette!«, rief Armin zurück.
Sie senkte die Lampe und lachte schallend. Mit einer Hand hielt sie den Kolben des Gewehrs, das lässig auf ihrer Schulter ruhte. »Ihr seid’s«, sagte sie, als Tom und Armin am Fuß des Walls stehen blieben und zu ihr hinauf sahen. »Seit wann liefert ihr uns denn auch nachts Wasser?«
»Tun wir nicht«, antwortete Armin, »wir sind in anderer Angelegenheit hier.«
»Klingt ja spannend. Nebenbei, ihr seht erbärmlich aus! Total übermüdet.« Sie grinste spöttisch und kam den Wall herunter.
»Wir haben wenig Zeit und müssen gleich weiter«, sagte Armin. »Und wir bringen unangenehme Nachrichten.«
»Unangenehm für wen?«
Babettes Grinsen verflog rasch, als Armin berichtete, was sich ereignet hatte.
»Ein Mord?«, fragte sie erregt. »In unserem Tunnel? Hier ist doch seit Ewigkeiten nichts passiert. Das arme Mädchen!« Sie schüttelte den Kopf. »Und der alte Kuba. Er hat den besten Schnaps in der ganzen Gegend gebrannt.«
»Weißt du, ob irgendjemand von den Wachleuten etwas Ungewöhnliches bemerkt hat?«, fragte Armin. »Waren vielleicht kürzlich Fremde an der Station? Der oder die Täter müssen doch hier durchgekommen sein.«
»Ich selbst habe nichts gesehen und auch nicht gehört, dass jemand anderes etwas beobachtet hat. Fremde waren, so weit ich weiß, nicht hier. Nur ein paar Händler, aber die sind allseits bekannt.«
»Wir vermuten, dass das Verbrechen von den Mitgliedern einer Bande verübt wurde.«
»Aha«, sagte Babette und machte ein nachdenkliches Gesicht. »Nun, falls das zutrifft, müssen sie die Klinik aber nicht zwangsläufig passiert haben. Sie könnten auch durch einen der kleinen Seitengänge gekommen sein. Das halte ich sogar für viel wahrscheinlicher. Dort kann man sich doch hervorragend vorbeischleichen.«
»Aber diese Gänge sind nicht zugänglich. Sie sind alle verschlossen.«
»Wie sind sie denn verschlossen?«, fragte Babette und zog die Brauen hoch. »Nicht alle sind zugemauert. Manche Durchgänge sind nur mit Geröll zugeschüttet. Mit ein bisschen Anstrengung kriegt man die bestimmt wieder auf.«
»Du meinst die Banditen haben sich da durch gegraben, um in den Tunnel zu gelangen?«, fragte Tom. Er wusste, dass sich jenseits des alten U-Bahn-Netzes ein weiteres Netz erstreckte, bestehend aus einer ungeheuren Anzahl von Stollen, Verbindungsgängen, Schächten und anderen unterirdischen Gebilden. Ein regelrechtes Labyrinth musste es sein, das Karten höchstens teilweise und wenn, dann auch nur sehr skizzenhaft abbilden konnten. Sämtliche Zugänge zu diesem Netz zwischen Wittenau und der Klinik waren versiegelt, seit Tom denken konnte. Eine Sicherheitsmaßnahme. Niemand sollte unkontrolliert in den Haupttunnel herein- oder hinauskommen.
Babette stellte das Gewehr auf den Boden, hielt es mit Daumen und Zeigefinger an der Mündung fest und wischte mit der anderen Hand eine rote Haarsträhne zur Seite.
»Mir fällt da gerade etwas ein. Neulich erzählte mir ein Bekannter, dass er an der verlassenen Station Rathaus Reinickendorf einen Hund herumstreunen sah. Einen von diesen verwahrlosten Wildkötern. Als er sich näherte, ist das Tier angeblich sofort abgehauen und war dann auch nicht mehr auffindbar. Das Problem: Dieser Typ erzählt oft die haarsträubendsten Geschichten und man weiß nicht, was man ihm glauben kann. Wenn es aber wahr ist, dann muss das Tier irgendwie an der Klinik vorbeigekommen sein, denn dass so ein Vieh über unsere Station spaziert, ist ausgeschlossen, da geben wir schon acht.«
»Das heißt, der Hund muss aus einem der Seitengänge in das Tunnelstück zwischen unseren Stationen gelangt sein«, folgerte Tom. »Also könnten auch die Täter auf diesem Weg gekommen sein. Sicher gibt es eine Verbindung bis zur Pankstraße.« Seine Stimme klang jetzt ganz aufgeregt. »Wir müssen nachsehen!«
»Tom, jetzt mach mal halblang«, sagte Armin mit beschwichtigender Stimme. »Wir wissen nicht, ob diese Hundegeschichte überhaupt wahr ist. Und selbst, wenn wir einen offenen Durchgang finden, hinein begeben wir uns auf keinen Fall. Das ist viel zu gefährlich. Da drin verirrt man sich in Windeseile und findet nie wieder hinaus. Selbst ich habe nie einen Fuß hinein gesetzt.«
»Was machen wir dann?«
»Wir gehen zur Pankstraße, wie geplant. Aber durch den Haupttunnel.«
*
Wenig später liefen Armin und Tom über die in fahlem Licht liegende Station, entlang an den kargen Behausungen, zum gegenüberliegenden Ausgang. Nichts rührte sich und kein Mensch begegnete ihnen. Die Bewohner der Klinik schliefen tief und fest. Tom hoffte inständig, dass es wirklich die Banditen von der Pankstraße waren, die seine Schwester entführt hatten. Denn dann befanden sich diese, egal auf welchem Wege sie gekommen waren, aller Voraussicht nach wieder in ihrem Unterschlupf. In diesem Fall bestand eine Chance, dass sie Maya dort aufspürten. Es war eine winzige Hoffnung und er klammerte sich daran, wie er sich in seinem Leben noch nie an etwas geklammert hatte.
5.
Tom, Station Paracelsus-Bad
In den frühen Morgenstunden schlenderten Tom und Armin über die still daliegende Station Paracelsus-Bad, die sich zu dieser Uhrzeit noch in tiefem Schlummer befand. Von den Bewohnern zeigte sich niemand im gedimmten Licht. Es war so leise, dass Tom unwillkürlich flüsterte, als er Armin fragte: »Werden wir hier jemanden finden, der mit Schusswaffen handelt?«
»Hoffentlich. Allerdings ist es nicht gerade leicht, an das Zeug heranzukommen. Und teuer ist es auch. Man muss schon die richtigen Leute kennen.«
»Und du kennst sie?«
»Ich habe da jemanden im Sinn. Er schuldet mir noch einen Gefallen.« Armin zwinkerte Tom zu. »Es dauert allerdings noch eine Weile bis zum Marktbeginn. Solange suchen wir uns ein ruhiges Plätzchen. Eine kleine Pause wird uns gut tun.«
Sie fanden eine abgelegene Ecke in unmittelbarer Nähe zu einer Ansammlung ärmlicher Zelte. Jedes einzelne bestand lediglich aus einer Plane, über ein waagerecht gespanntes Seil geworfen und mit schweren Steinen am Boden gehalten. Aus den Zelten drangen laute Schnarchgeräusche. Tom legte Rucksack und Armbrust ab und streckte die Gliedmaßen. Er war hundemüde. Seine Schultern schmerzten, genauso wie sein Rücken. Vom ewigen Stapfen über den groben Gleisschotter kribbelten und piksten seine Füße. Armin hingegen zeigte kaum Anzeichen der Erschöpfung. Obwohl sie den ganzen gestrigen Tag lang Wasser zur Nachbarstation geschleppt hatten, spät abends wieder aufgebrochen und die ganze Nacht unterwegs gewesen waren, schien er noch immer über Kraftreserven zu verfügen. Tom war froh, ihn an seiner Seite zu haben. Er legte sich auf den Boden, bettete den Kopf auf den Rucksack und schloss die Augen.
Als er sie wieder öffnete, war das Licht auf der Station deutlich heller und verriet, dass einige Stunden vergangen sein mussten. Geschäftige Geräusche drangen an sein Ohr und feine Geruchsfäden durchzogen die Luft: Seife, gekochtes Essen, ein Hauch von Holzfeuer. Armin konnte er nirgends entdecken. Er setzte sich auf und massierte Arme und Beine, die vom Liegen auf dem harten Boden etwas steif geworden waren. Er nahm die Wasserflasche aus seinem Rucksack und trank ein paar große Schlucke, dann schob er sich ein Stück Trockenfleisch zwischen die Zähne und stand auf.
Der Markt befand sich am anderen Ende der Station. Tom lief einen breiten Weg entlang, den Behausungen und weitere Zeltlager säumten. Es waren bereits viele Bewohner auf den Beinen. Sie kamen ihm entgegen, überholten ihn eilig oder standen einfach nur herum und plauderten. Er kam an der Endstation vorbei, der örtlichen Lokalität und dem zentralen Treffpunkt. Die Endstation bestand aus uralten Tischen und Stühlen sowie einem langen wackligen Tresen mit abgewetzten Barhockern davor. Viel los war an diesem Morgen noch nicht, lediglich zwei einsame Gestalten hockten da, mit glasigem Blick, jeweils einen Becher vor sich, und starrten in die Leere. Es war der Schnaps, hergestellt an seiner Heimatstation, der hier unter anderem ausgeschenkt wurde. Tom wusste um den hohen Tauschwert dieser Flüssigkeit. Ein paar Mal hatte er die Gelegenheit gehabt, selbst zu probieren und die anschließende Wirkung nicht unangenehm gefunden.
Er ließ die Endstation hinter sich und näherte sich nun dem Markt. Zu diesem Markt kamen die Menschen aller umliegenden Stationen. Die Händler, die hier ihre Waren anboten, reisten durch den gesamten Untergrund und brachten die verschiedensten Dinge mit, die sie in riesigen Rucksäcken und mit Hilfe ihrer Esel transportierten. Da sie Dieben und Plünderern ein lohnendes Ziel boten und es immer wieder vorkam, dass allein reisende Händler ausgeraubt oder gar getötet wurden, schlossen sie sich für gewöhnlich zu Karawanen zusammen, bevor sie sich in die Tunnel wagten. Die Anzahl der Händler, die sich in Paracelsus-Bad aufhielten, schwankte stets, und manchmal, wenn auch sehr selten, kam es sogar vor, dass kein einziger anwesend war und somit auch kein Markt stattfinden konnte. Dann blieb einem nur übrig, zu warten und auf ihre baldige Ankunft zu hoffen. Heute hatten etwa ein Dutzend ihr Angebot auf den Tischen ausgebreitet. Dazwischen wuselten die Leute umher und prüften die Waren mit kritischen Blicken, während diese von den Händlern eifrig und lobend angepriesen wurden. Untermalt wurde das lautstarke Feilschen und Rufen zeitweise vom Geschrei der Esel, die zwischen den Verkaufstischen herumstanden.
Tom bahnte sich einen Weg durch das Getümmel und sah im Vorbeigehen Geschirr, Bücher, Stifte und weitere Gebrauchsgegenstände sowie Berge von Klamotten. Auf anderen Tischen wartete Werkzeug aller Art auf Käufer, Schnaps in PET-Flaschen und Zigaretten wurden zu Wucherpreisen feilgeboten. An einem Stand mit gut erhaltenen Schuhen machte er Halt und schaute sich um. Gerne hätte er seine eigenen gegen eines der hier angebotenen Paare eingetauscht. Als er jedoch die Preise erfuhr, wurde ihm klar, dass er sich das keinesfalls würde leisten können. Also ging er weiter und kam kurz darauf an ausgebreiteten Konservendosen und geräuchertem Fleisch vorbei. Der zahnlosen alten Frau mit Haarnetz, die hier hinter dem Tisch stand, bereitete es nicht die geringste Mühe, die Stimmen der Händler an den Nebentischen mit ihrer eigenen zu übertönen.
»Frisches Gemüse aus Cor!«, rief sie eindringlich. »Gereift unter künstlicher Sonne!« Mit der Bezeichnung frisch übertrieb sie allerdings, denn die paar Kartoffeln und Möhren, die zwischen den Konservendosen lagen, waren schon ziemlich verschrumpelt und die Tomaten klein und blass.
Trotzdem stritten sich die Leute um das Wenige, das es noch gab, stießen sich gegenseitig zur Seite und nahmen, was sie nur kriegen konnten.
Bezahlt wurde mit Salz, dem allgemein akzeptierten Zahlungsmittel. Ebenso waren Tabak, Kerzen, Medikamente und Vitaminpräparate beliebte Tauschmittel. Der Vorteil von Salz jedoch war, dass es sich gut transportieren und portionieren ließ. Auch Tom hatte einen winzigen Beutel dabei, alles was er besaß, doch es waren nur wenige Gramm.
Er steuerte nun auf den einzigen Waffenhändler zu, über dessen riesigem Tisch sich quer ein Transparent mit der Aufschrift Waldemars Waffen spannte. Pistolen oder Gewehre sah er nicht, dafür aber eine große Anzahl Messer, die ordentlich nebeneinander aufgereiht lagen und dazu verschiedene Schlagringe, Äxte, Knüppel und Schläger. Tom betrachtete die Auslage, bis sein Blick an einem dicken gebogenen Ast hängen blieb, entrindet und glatt geschliffen. An einem Ende war ein Griff herausgearbeitet und eine Schlaufe aus Leder befestigt, am anderen schauten große Nägel aus dem Holz heraus und standen chaotisch in alle Richtungen ab. Die blank polierten Nägel glänzten metallisch, und auch das Holz war sauber, doch direkt an den Stellen, wo die Nägel aus dem Holz heraustraten, hafteten noch schwarzrote Rückstände. Tom schauderte. Dann sah er auf und blickte zu dem Mann hinüber, der hinter dem Tisch stand. Der Waffenhändler grinste ihn an und entblößte dabei eine Zahnlücke. In seinem Gesicht prangte eine beachtliche Hakennase, sein langes schwarzes Haar war nach hinten gekämmt. Er trug einen nagelneuen und offenbar handgefertigten Mantel aus braunem Leder.
»Ein solides Teil«, erklärte der Händler. »Liegt gut in der Hand.« Er beugte sich über den Tisch, langte nach dem Knüppel mit den Nägeln und hielt Tom die Griffseite hin. »Überzeuge dich selbst!«
Tom zögerte, doch dann nahm er ihn entgegen und hielt ihn so fest in der Hand, als fürchtete er, der Knüppel könne jeden Augenblick von selbst auf seinen Schädel niedersausen. Dabei inspizierte er die Reste des getrockneten Blutes, die jetzt noch deutlicher zu erkennen waren.
»Wie du siehst, hat er schon mal einem Menschen das Leben gerettet!«, erläuterte der Händler.
»Falsch«, entgegnete Tom, »er hat schon mal einem Menschen das Leben genommen.«
Gespielte Empörung machte sich auf dem Gesicht des Händlers breit und er stemmte die Hände demonstrativ in die Seiten. Dann grinste er noch breiter. »Auslegungssache«, sagte er und hob den ausgestreckten Zeigefinger in die Höhe. »Welches Leben würdest du verschonen, wenn es darauf ankäme? Das eines anderen oder dein eigenes?«
»Wo soll das hinführen, wenn sich die Menschen immerzu gegenseitig umbringen?«
»Nun, wahrscheinlich sterben sie irgendwann einfach aus. Aber was können wir schon daran ändern? So sind sie eben.« Der Händler zog die Schultern nach oben.
»Sie könnten auf den Verkauf von Waffen verzichten. Weniger Waffen, weniger Tod.«
»Aha«, machte der Händler, zog die Augenbrauen nach oben und kratze sich am Kinn. »Ein kluger Gedanke. Doch meine Waffen sind harmlos. Sie töten nicht. Die Menschen töten.«
»Auslegungssache«, sagte Tom.
»Haha!« Der Händler lachte laut auf schob die Unterlippe anerkennend nach vorne. »Du gefällst mir Junge!«
Tom legte den Knüppel behutsam zurück auf den Tisch.
Der Händler rückte ihn wieder zurecht und hob dann ein Messer in die Höhe. »Hier, ein Allzweckwerkzeug, frisch geschliffen. Zu schneiden gibt es doch immer etwas. Für dich mache ich es besonders günstig. Wenn du dreißig Gramm Salz dabei hast, gehört es dir! Was meinst du?«
»Nein danke«, entgegnete Tom. Er hatte nicht vor, irgendetwas an diesem Stand zu kaufen.
Der Händler machte ein übertrieben enttäuschtes Gesicht und legte das Messer zurück. Dann beugte er sich, so weit es ging, zu Tom herüber und sagte im vertrauensvollen Ton: »Hör mal, die Armbrust, die du da auf dem Rücken hast, die gefällt mir. Ich meine, sie ist ganz gut, natürlich nicht das Beste, aber schon in Ordnung. Ich biete dir zweihundert dafür.«
»Tut mir leid, die Armbrust ist unverkäuflich.«
»Okay, ich verstehe.« Der Händler strich sich übers Haar. »Sagen wir vierhundert? Plus fünf Schachteln Zigaretten.«
»Diese Waffe ist mindestens tausend Gramm wert, klar?«, raunzte es da plötzlich hinter Tom. »Du willst den Burschen wohl übers Ohr hauen.«
»Armin!«, rief der Händler und klatschte in die Hände. »Wie ich mich freue, dich zu sehen. Unsere letzte Begegnung ist schon so lange her.«
»Lass den Quatsch! Sag mir lieber, ob du uns helfen kannst.« Armin kam näher heran und dämpfte die Stimme. »Wir suchen nach etwas Exklusivem.«
Die Augen des Händlers blitzten auf. »Etwas Exklusives? Ich höre.«
»Etwas zum Schießen.«
»Hm«, machte der Händler und zog eine nachdenkliche Miene. »Setzt euch da hin und wartet einen Moment.« Dann drehte er sich um und begann, in den großen Körben aus geflochtenen Zweigen zu wühlen, die am Packsattel seines Esels festgeschnallt waren und zu beiden Seiten des Tiers herunterhingen.
Tom und Armin ließen sich auf Holzkisten nieder, die etwas abseits in einer Nische standen, und warteten. Tom betrachtete den Esel. Der schaute mit seinen großen schwarzen Augen zurück, dann senkte er den Kopf und tunkte die Schnauze in einen Eimer, gefüllt mit einer unappetitlich aussehenden grauen Pampe. Einmal hatte Tom erlebt, dass jemand mit einem Esel an seiner Heimatstation gewesen war. Eine Sensation! Jeder wollte den Esel anfassen und ihn füttern und das Tier hatte alles geduldig über sich ergehen lassen. Tom durfte sogar aufsitzen und ein Stück durch die Station reiten. Seither übten Esel eine große Faszination auf ihn aus und er bewunderte diese genügsamen und treuen Tiere. Wenn die Menschen das Gemüt eines Esels besäßen, so überlegte er manchmal, dann ginge es ihnen sicher wesentlich besser.
Der Händler ging um sein Tier herum und durchsuchte jetzt den Korb auf der anderen Seite.
Tom bemerkte, wie Armin damit begann, auf seiner Kiste unruhig hin und her zu rutschen. »Also was ist jetzt?«, rief er hinüber.
Kurze Zeit später richtete sich der Händler auf und kam zu ihnen. »Ich habe da tatsächlich etwas«, sagte er diskret.
Armin schaute ihn fragend an. »Geht es auch etwas genauer?«
»SIG Sauer P225. Guter Zustand. Inklusive dreißig Patronen.«
»Eine Pistole?«, fragte Tom.
Der Händler nickte. »Es ist die einzige Waffe, die ich im Moment anbieten kann. Ich habe natürlich noch meine eigene Knarre, aber die ist absolut unverkäuflich. Ohne die würde ich längst nicht mehr leben.« Er lachte kurz auf.
»Hört sich schon mal gut an«, sagte Armin. »Aber nur dreißig Patronen? Das ist wenig.«
»Du weißt doch, wie schwierig es ist, diese Dinge aufzutreiben.«
»Okay. Wie viel?«
»Für euch mache ich einen Sonderpreis!« Der Händler breitete die Arme aus. »Nur 3500.«
Tom schielte zu Armin, der aussah, als hätte man ihm soeben eine saftige Ohrfeige verpasst. Er hatte sich zwar gleich wieder im Griff, doch seine Gesichtsmuskeln blieben angespannt.
»3500 Gramm?«, zischte er. »Das ist nicht dein Scheißernst!«
»Hey, tut mir leid, Armin, aber billiger kann ich es wirklich nicht machen. Vor allem an Munition ist zurzeit unglaublich schwer heranzukommen. Und du weißt, dass Kugeln mit jedem Schuss seltener werden und damit auch teurer. Die Waffe allein würde ich dir für 1000 überlassen.«
»Mit der Waffe allein kann ich aber nichts anfangen!«, entgegnete Armin ungehalten und erhob sich. Unauffällig ballten sich seine Hände zu Fäusten, sodass die Knöchel weiß wurden.
»Du musst sie ja nicht nehmen«, sagte der Händler und zuckte mit den Schultern. »Ich werde sicher einen anderen Käufer finden.«
»Du weißt genau, dass du mir noch einen Gefallen schuldest! Entweder, du nennst mir jetzt einen vernünftigen Preis oder …«
»Oder was?«, entgegnete der Händler schroff und mit einer Stimme, aus der die anfängliche Freundlichkeit mit einem Schlag gewichen war. »Immer noch der alte Hitzkopf, wie?«
Feindselig starrten sich die beiden an. Langsam und scheinbar zufällig wanderte Armins Hand in Richtung des Messers an seinem Gürtel.
Tom beobachtete die Szene mit wachsendem Unbehagen. Armins Reizbarkeit war ihm nicht unbekannt und er wusste, dass dieser gelegentlich zu vorschnellen Reaktionen neigte. »Wenn die Munition so teuer ist, können wir wohl nichts dagegen machen«, versuchte er die Situation zu entspannen. »Vielleicht sollten wir es woanders versuchen.«
Verwundert blickten sie zu ihm herüber, so als hätten sie ihn ganz vergessen.
»Da hörst du’s«, sagte der Händler. »Der Junge ist vernünftig!«
»Dieser Betrüger will uns nur über den Tisch ziehen, Tom. Es wäre nicht der erste Versuch. Vor ein paar Monaten hätte man für den Kram nicht mal die Hälfte bezahlt.« Armin hielt jetzt den Griff seines Messers fest umschlossen.