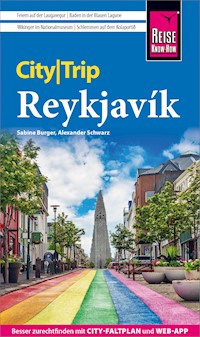15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Eine große Liebe, eine bahnbrechende Erfindung und eine Frau, die die Welt verändert Alexander Schwarz' historischer Roman »Bertha Benz und die Straße der Träume« ist die erste Roman-Biografie über die Frau, die dem Automobil zum Durchbruch verholfen hat. Mannheim, 1888: Bertha Benz hat genug! Sie liebt ihren Mann Carl, bewundert den brillanten Ingenieur und glaubt fest an seine Vision einer pferdelosen Kutsche. Schließlich verbringt sie selbst genug Zeit in der Werkstatt und lässt sich alle Motoren und Maschinen erklären, die Carl sich ausdenkt. Und sie hat sich ihre Mitgift und einen Teil ihres Erbes noch vor der Ehe auszahlen lassen, um die Werkstatt zu finanzieren – gegen den entschiedenen Willen ihrer Eltern. Doch nach einem Konkurs hatten Bertha und Carl lange Zeit ständig die Schuldner im Nacken und mussten mit ihren Kindern in bitterer Armut leben. Jetzt ist es an der Zeit, dass sich endlich etwas ändert! Aber Carl mit seinem Perfektionismus zögert und zögert. Also beschließt Bertha, das Steuer selbst in die Hand zu nehmen – im wahrsten Sinne des Wortes … Atmosphärisch, gefühlvoll und hochspannend erzählt Alexander Schwarz in seinem biografischen Roman von einer starken Frau, die Geschichte geschrieben hat: mit einer Liebe, die sich gegen alle Widerstände behauptet, und dem Mut, zur richtigen Zeit etwas Großes zu wagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Ähnliche
Alexander Schwarz
Bertha Benz und die Straße der Träume
Roman
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Mannheim, 1888: Bertha Benz hat genug! Sie liebt ihren Mann Carl, bewundert den brillanten Ingenieur und glaubt fest an seine Vision einer pferdelosen Kutsche. Schließlich verbringt sie selbst genug Zeit in der Werkstatt und lässt sich alle Motoren und Maschinen erklären, die Carl sich ausdenkt. Und sie hat sich ihre Mitgift und einen Teil ihres Erbes noch vor der Ehe auszahlen lassen, um die Werkstatt zu finanzieren – gegen den entschiedenen Willen ihrer Eltern.
Doch nach einem Konkurs hatten Bertha und Carl lange Zeit ständig die Schuldner im Nacken und mussten mit ihren Kindern in bitterer Armut leben. Jetzt ist es an der Zeit, dass sich endlich etwas ändert! Aber Carl mit seinem Perfektionismus zögert und zögert.
Also beschließt Bertha, das Steuer selbst in die Hand zu nehmen – im wahrsten Sinne des Wortes …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Teil I
1863
1. Kapitel
2. Kapitel
1869
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
1870
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
1871
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
1872
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Teil II
1872
1. Kapitel
2. Kapitel
1873
3. Kapitel
4. Kapitel
1875
5. Kapitel
1876
6. Kapitel
7. Kapitel
1877
8. Kapitel
1879
9. Kapitel
1883
10. Kapitel
11. Kapitel
1887
12. Kapitel
1888
13. Kapitel
Teil III
1888
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Nachwort
Dankeswort
für meinen Vater
Ulrich Anton Schwarz
1938–2023
Teil I
Pforzheim
1863
Mai
1
Das darf ja wohl nicht wahr sein?! Steht das da wirklich? Bertha schaute noch einmal auf den handgeschriebenen Eintrag mit dem Datum 3. Mai 1849. Ihre gute Laune verzog sich schlagartig und machte einer vulkanartigen Wut Platz. Sie schaute noch einmal auf die Seite am Anfang der in hellbraunes Leder gebundenen, großformatigen Familienbibel. Eigentlich war sie nur auf der Suche nach einer dieser modernen und praktischen Hutnadeln, um ihren Florentinerhut am Kopf feststecken zu können. Ihre Mutter legte die Nadeln für gewöhnlich in die oberste Schublade der Kommode in der guten Stube, wo sie sie immer zur Hand hatte, wenn sie aus dem Haus gehen wollte. Zufällig sah Bertha das alte Buch dort liegen, und wie aus einer Anwandlung heraus griff sie danach, legte es auf die Kommode und blätterte darin. Sie mochte die reich verzierten Illustrationen darin schon von klein auf. Ihr Blick fiel auf eine der ersten Seiten, die das Buch mit seinem Vorspann und den Einträgen der Familienmitglieder erst zur Familienbibel machte. Sie las erneut diesen Satz, um sich auch wirklich sicher zu sein, dass dort auch wirklich stand, was gerade in ihrem Kopf zu explodieren schien. Er stand da tatsächlich, unter »Cäcilie Bertha«, in der Handschrift ihrer Mutter, in der sie die Geburten der Familie Ringer eintrug: »Leider wieder ein Mädchen.« Damit war sie gemeint. Das war der erste Satz, der je über sie geschrieben wurde, kurz nach ihrer Geburt vor vierzehn Jahren. Was für eine Begrüßung zu ihrem Eintritt in diese Welt. Wie konnte ihre Mutter nur so etwas schreiben?!
Bertha zog ihre Stirn weiter zusammen. »So weit kommt es noch. Bin ich etwa weniger wert, weil ich ein Mädchen und kein Junge geworden bin?«, sagte sie, und ihre Stimme wurde mit jedem Wort erboster und lauter. Sie schrie ihren Ärger richtiggehend heraus. Ihr Unterkiefer schob sich nach vorne, sie holte tief Luft und stieß dann einen Laut aus, der sich tief in ihrem Kehlkopf formte und irgendwo zwischen einem wütenden Schnauben und einem Grummeln angesiedelt war.
»Was ist denn, Bertha?«, rief ihre fünf Jahre jüngere Schwester besorgt und stürmte ins Wohnzimmer.
Bertha schluckte ihren Ärger hinunter, richtete sich auf und drückte ihren Rücken durch. Sie stand noch immer vor der Kommode, drehte sich um und legte ihrer kleinen Schwester fürsorglich einen Arm auf deren Schulter.
Ihr wurde klar, dass sie sich für einen Moment hatte gehen lassen, und das schickte sich nicht, dessen war sie sich wohl bewusst. Nur mit Mühe konnte sie ihren Ärger unterdrücken.
»Es ist gut, Marie Louise«, sprach sie beruhigend auf sie ein, »bitte entschuldige, mach dir keine Sorgen.«
»Sollen wir etwas spielen?« Die Kleine hatte den kurzen Schrecken zu Berthas Erleichterung schon wieder vergessen.
»Das würde ich ja gerne.« Sie kitzelte sie ein wenig, und Marie Louise lachte vergnügt. »Aber ich muss leider auf den Markt, die Einkäufe erledigen. Warum spielst du nicht mit Thekla?«
»Na gut«, sagte die Kleine mit einem Schmollmund, »nie hast du Zeit.« Sie zog ab und rief noch vom Wohnzimmer aus, »Thekla, kommst du mit zum Spielen nach draußen?«
2
Mit zwei großen Einkaufskörben in den Händen stapfte Bertha wenig später durch die Ispringer Straße in der Brötzinger Vorstadt hinunter Richtung Marktplatz in der Pforzheimer Innenstadt.
Dieser Mittwoch Ende Mai fühlte sich eigentlich wie ein wunderschöner Frühsommertag an, mit blauem Himmel, einer angenehmen Wärme und einem lauen Lüftchen. Noch war es nicht zu heiß, aber schon warm genug, um sich in Sommerkleidung auf die Straße zu wagen. Deshalb hatte sie sich ihren Florentinerhut zusammen mit einem einfachen Krinolinenkleid aus dunklem Stoff und darunter einer weißen Chemisette mit einem kleinen Spitzenkragen für ihren heutigen Marktgang ausgesucht. Bertha hatte sich, wie jede Woche, darauf gefreut. Aber jetzt wurde sie mit jedem Schritt wütender.
Sie bemühte sich, ihre Emotionen zu zügeln, wie es einer Frau geziemte, die sie ja bald wäre, so fand sie, aber es fiel ihr schwer. Sie kniff die Augenbrauen zusammen, hielt ihren Kopf gesenkt und schaute aus trotzigen Augen nach vorn. Zusammen mit dem Stapfen ihrer Füße entfuhr ihr ab und an ein Schnauben.
Was um alles in der Welt hatte ihre Mutter nur bewogen, diesen Satz nach ihrer Geburt zu schreiben? Bertha fühlte sich tief in ihrem Inneren verletzt. Sie konnte sich keinen Reim darauf machen, es widersprach allem, was sie über sich, über ihre Eltern und auch ihre Geschwister wusste. Nie hatte sie sich zurückgestellt gefühlt. Ohne Frage gab es Unterschiede zwischen den Jungen und ihr und ihren Schwestern. Von den Töchtern wurde erwartet, dass sie sich um das Haus und die Familie kümmerten, sauber machten, Essen kochten, Kleider nähten, Strümpfe stopften, die Wäsche wuschen – und das waren bei dem großen Haushalt wahrlich Berge, die mühsam eingeseift, auf dem Waschbrett gerieben und danach gestärkt werden wollten –, und alles, was sonst noch dazugehörte. So wie eben auch das Einkaufen auf dem Markt. Alles, während die Jungen draußen rumtoben durften.
Aber immerhin durfte sie bis ins Jahr ihrer Konfirmation auf die Höhere Töchterschule gehen und das vierte Jahr dort turnusgemäß mit den Osterferien abschließen. Das bedeutete doch, dass die Eltern ihr eine gute Bildung zukommen lassen wollten, dass sie sie wertschätzten, oder nicht?
Bertha fühlte, wie ihre Gedanken umherwirbelten wie in einem großen Karussell, das sich immer schneller drehte und die an langen Ketten befestigten Sitze immer weiter nach außen trieb, bis sie gegen ihre Schädeldecke schlugen. Ihr wurde schwindelig. Bertha konzentrierte ihren Blick auf die Häuserfassaden, an denen sie vorbeikam, und so schaffte sie es, wenn auch langsam, weiterzulaufen.
Sie dachte daran, wie zu Beginn eines jeden Schuljahres nach den Osterferien immer wieder weniger Klassenkameradinnen in die Schulbänke zurückkehrten. Deren Väter fanden wohl, dass sie jetzt besser anfingen, Geld zu verdienen. Bis zu einem gewissen Grad sahen diese Familienoberhäupter Bildung noch als nützlich an, aber irgendwann überwog der Gedanke an eine gute Partie für ihre Töchter. Die zu finden schien wesentlich wichtiger, als Geld für irgendwelche »Wissensfratzen«, wie sie einen der Väter einmal sagen hörte, zum Fenster hinauszuschmeißen.
Nicht selten aber bemerkte Bertha, wenn sie bei Klassenkameradinnen zu Besuch war, dass dort einfach nicht genügend Geld da war. Dessen war sie sich sehr wohl bewusst. So manche Eltern hatten schon alle ihre Möglichkeiten ausgeschöpft, um ihre Tochter zur Schule gehen zu lassen.
Das sah bei ihr zu Hause anders aus. Sie lebten zwar nicht im Reichtum, aber Geld war nie ein Problem. Bertha war froh, dass ihren Eltern Bildung, auch für sie und ihre Schwestern, wichtig war. Es wäre ein Leichtes für sie gewesen, das Schuldgeld für andere Zwecke auszugeben.
Aber so waren meine Eltern doch nie. Bertha verstand die Welt nicht mehr. Ihre Wut wich nur langsam aus ihrem Körper. Mit jedem Schritt spürte sie sich selbst wieder ein bisschen mehr, anstatt dieses überwältigende Gefühl der Ohnmacht. Aber die Verwirrung in ihrem Kopf blieb, kreiste weiter darin herum und kam einfach nicht zum Stillstand.
Der Weg zum Markt in Pforzheim war zum Großteil derselbe wie zu ihrer früheren Schule. Komisch, warum mir das jetzt gerade auffällt, dachte Bertha. Als sie anfing, zur Schule zu gehen, standen in der Straße nur vier Häuser. Mittlerweile waren es zehn, und es machte den Anschein, dass bald neue hinzukommen würden.
Auf der gegenüberliegenden Seite gab es noch keine Bebauung. Der Park des Bohnenberger Schlösschens war recht weitläufig und reichte bis zur Straße. So reich konnte man als Papier- und Schmuckfabrikant werden, staunte Bertha jedes Mal, wenn sie an dem prächtig gestalteten Bau und dem dazugehörigen Park vorbeiging. Am Ende der Ispringer Straße angekommen, lief sie entlang einer Neusilber- und einer Bijouteriefabrik. In Pforzheim schienen die Schmuckfabriken wie Unkraut aus dem Boden zu schießen. Die Stadt am Rand des Nordschwarzwalds entwickelte sich zu einem wahren Zentrum der Schmuckindustrie und galt als erste Fabrikstadt Badens. Sie wirkte wie ein Magnet, der mehr und mehr Leute in die Stadt lockte. Vor allem Bauern und Frauen aus dem näheren, aber auch aus dem weiteren Umland kamen, um sich in den Manufakturen als Arbeiter zu verdingen. Wenn sie daran dachte, war sie doppelt froh, dass ihre Eltern so lange Schulgeld für sie bezahlt hatten und dass sie nun zu Hause mit anpacken konnte. Das war ihr allemal lieber, als in einer dieser lauten, stinkenden, dunklen Fabrikhallen zu arbeiten. Immerhin wurde der Ort von Schwerindustrien verschont und daher nicht von stinkenden Schloten verpestet, wie es in anderen Städten der Fall war. Trotzdem, schon alleine bei dem Gedanken an den Lärm und die Gerüche innerhalb der Fabriken für die Schmuck- und Goldfertigung musste sich Bertha schütteln. Sie wusste, dass einigen ihrer Klassenkameradinnen dieses Los beschert war. Die Mädchen mussten für den Unterhalt der Familie mitverdienen. Bertha taten ihre früheren Klassenkameradinnen leid, aber es lag nicht in ihrer Macht, daran etwas ändern zu können.
»Leider wieder ein Mädchen.« Das konnte ihre Mutter doch nicht wirklich so gemeint haben. Aber wieso schreibt sie denn dann so was? Ob sie wollte oder nicht, allein bei dem Gedanken stieg die Wut wieder in ihr hoch. Sie fühlte sich so machtlos und ausgeliefert wie das Neugeborene, über das damals dieser Satz geschrieben wurde. Vor allem aber konnte sie einfach nicht begreifen, wie ihre Mutter so etwas überhaupt hatte denken können.
Bertha bog an der südwestlichen Ecke des Bohnenberger Schlösschens in die Westliche Karl-Friedrich-Straße ab. Ihre Eltern sagten, wie so viele, noch immer Brötzinger Gasse, wie die schmale Verbindung zwischen der Vorstadt und Pforzheim bis vor Kurzem noch hieß. Die Stadt bemühte sich seit einiger Zeit, durch den Abriss mehrerer Häuser die schmale Gasse in eine breite Straße zu verwandeln. Man hatte entschieden, dass mit der wachsenden Einwohnerzahl und aufkommenden Industrie eine entsprechende Ost-West-Verbindung nötig wurde, die dem täglichen Ansturm an Fußgängern, vor allem aber an Pferdefuhrwerken gewachsen war. Dazu gehörte eben auch ein entsprechender Name, befand der Stadtrat, und so hieß die Brötzinger Gasse nun offiziell Karl-Friedrich-Straße, nach dem badischen Großherzog und Landesfürsten. Sowieso war es anscheinend bei der Stadtverwaltung gerade Mode, den Gassen und Straßen festgelegte Namen zu geben. Bisher hatte das ganz einfach der Volksmund erledigt.
Als sie aus der Gasse auf die breitere Straße trat, fühlte es sich gleich lebendiger an, ratterten Fuhrwerke über das Kopfsteinpflaster, hörte sie Leute miteinander sprechen und Mütter nach ihren Kindern rufen. Kein Wunder, denn hier mündete nicht nur die Ispringer, sondern auch die Friedrichs- und Brötzingerstraße in die zentrale Straße Richtung Stadtzentrum.
Eigentlich konnte es wohl nur einen Grund geben, warum ihre Mutter jene Worte geschrieben hatte, und das lag nicht an ihr, sondern an ihrem Vater. Er hatte sich wahrscheinlich einen Stammhalter gewünscht. Vielleicht hatte ihre Mutter gedacht, dass dieses Kind, Bertha, unter Umständen das letzte gewesen sein könnte, das sie zusammen bekamen. Schließlich war ihr Mann zweiundzwanzig Jahre älter als sie und zählte zu dem Zeitpunkt stattliche achtundvierzig Lenze. Obwohl er noch immer recht rüstig daherkam, so zählte er damals so langsam schon zu den alten Herrschaften. Es war also an der Zeit für ihn gewesen, endlich einen Stammhalter vorweisen zu können. Schließlich hatte es der Zimmermann mit fleißiger und guter Arbeit bis zum Handwerksmeister und – auch dank der guten Partie mit seiner Frau – zu gewissem Wohlstand gebracht. Beides, Firma und Wohlstand, wollte in die nächste Generation vererbt werden, der Familienstamm sollte in der Zukunft weiter prosperieren. Aber das Fehlen eines Stammhalters konnten sie doch nicht ihrer Tochter ankreiden.
Bertha atmete die sonnig-frische Luft des Frühsommers ein. Daher wehte also der Wind. Die Gedanken in ihrem Kopf drehten sich wieder etwas langsamer. Auf der einen Seite beruhigte sie die Vorstellung, dass das »Leider« sich wohl nur hierauf beziehen konnte. Auf der anderen Seite fand sie es noch immer ungehörig. Sollten sich Eltern nicht über jedes Kind, das sie bekämen, gleichermaßen freuen? Nun ja, sie musste sich eingestehen, dass sie in der Schule Texte lasen, in denen das auch nicht der Fall war. Schon traurig, dachte sich Bertha. Nur weil wir mit Puppen spielen und nicht mit diesen handwerklichen Geräten hantieren, die die Jungs benutzen dürfen. Obwohl ihr Vater, als er den Auftrag bekam, die Familiengruft des badischen Fürstenhofs anlässlich des Dahinscheidens der Großherzoginnenwitwe Stéphanie zu restaurieren, nicht nur Karl, ihren zwei Jahre jüngeren Bruder, sondern auch Bertha mitgenommen hatte, und er sich gefreut hatte, dass sie ihm für ihr Alter so gut zur Hand ging. Anders als ihre zwei älteren Schwestern schien sie handwerklich durchaus begabt zu sein und begriff schnell. Bertha mochte es schon von Kindesbeinen an, ihrem Vater bei seiner Arbeit über die Schulter zu schauen und ihm so viel wie möglich zu helfen. Mit Puppen zu spielen, fand sie schon immer langweilig. Vielmehr interessierte es sie, mit ihrem Vater zusammen etwas Sichtbares und Bleibendes zu schaffen, etwas, das man anfassen konnte. Die Aufgaben, die sie im Haushalt erledigen musste, waren allesamt schnurstracks wieder dahin. Die Kleider wurden schnell wieder dreckig, das Geschirr wieder gebraucht, der gebohnerte Fußboden wieder stumpf und das gekochte Essen im Nu vertilgt. Ihre Brüder dagegen durften Dinge machen, die blieben. Kleine Möbelstücke bauen oder Reparaturen am Haus ausführen. Manchmal wäre sie schon gern ein Junge oder würde zumindest gerne die Dinge tun dürfen, die ihre Brüder so ganz selbstverständlich durften. Dabei hatte sie mit ihrem Vater noch Glück, fand Bertha. Der fand seit einigen Jahren Gefallen daran, ihr etwas beizubringen. Seit er ihr handwerkliches Talent erkannt hatte, bereitete es ihm wohl auch Spaß, dieses weiterzuentwickeln.
Bertha hatte nie das Gefühl, dass ihr Vater enttäuscht darüber war, dass sie »nur« ein Mädchen war. Sie fühlte sich bei ihm geborgen und wusste, dass er sie sehr mochte. Ihre Mutter hatte mehr als einmal behauptet, dass sie ein wahres Papakind sein, wenn sie ihm mal wieder um seinen Hals hing oder mit ihm herumtollte und dabei vor Freude juchzte. Sobald sich ihr Vater mit Werkzeugen ans Schaffen machte, war sie neugierig und wollte dabei sein, wollte wissen, warum er dies oder das tat, und es selbst ausprobieren.
»Warum, warum«, sagte ihr Vater manchmal, wenn sie ihm mit ihrer Fragerei auf die Nerven ging. Aber eigentlich glaubte Bertha, dass ihm ihre unerschrockene und ausdauernde Art gefiel. »Du bist nicht ungeschickt, meine Kleine«, sagte er dann. Dabei schaute er sie glücklich und traurig zugleich an. Nachdem sie den Eintrag in der Familienbibel gelesen hatte, glaubte sie auch zu verstehen, warum. So handwerklich begabt sie auch war, würde sie ihm in seinem Beruf niemals nachfolgen können. Armer Papa, dachte Bertha, aber ich glaube, er ist auch so stolz auf mich.
Sie wurde aus ihren Gedanken gerissen, als ihr ein großes Gespann mit schweren Fässern beladen entgegenkam. Ein Bauer vor ihr mahnte sein Pferd lautstark, schneller zu gehen. Die Schimpfworte, die er verwendete, überhörte Bertha geflissentlich. Als er sie sah, entschuldigte er sich bei ihr.
»Bitte entschuldigt, junge Dame«, er nickte ihr zu, »aber mein Pferd lahmt, ich bin spät dran und muss auf dem Markt doch noch mein Gemüse verkaufen.« Er wandte sich wieder seinem Pferd zu, unterdrückte aber einen weiteren Fluch.
Bertha hörte nicht wirklich zu. Nachdenklich wich sie dem Bauern sowie dem mit Fässern beladenen Wagen aus.
Wenn ihre Eltern sich zum Zeitpunkt von Berthas Geburt gesorgt hatten, keine weiteren Kinder mehr zu bekommen, oder zumindest keinen Sohn, so hatte sich diese Sorge als unnötig erwiesen. Nach den drei Töchtern folgten sechs weitere Kinder, und schon das erste nach Bertha war ein Junge, der nach seinem Vater Karl Friedrich benannt wurde.
Plötzlich hörte sie von hinten ein seltsames Rattern.
»Ohhh«, rief jemand, und der panische lang gezogene Laut kam genauso schnell näher wie das Rattern. Unwillkürlich machte Bertha einen Satz zur Seite, und im selben Moment passierte sie in schnellem Tempo ein junger Mann, der auf einem hölzernen Apparat saß, mit zwei Rädern, eines vorne und eines hinten. Die Holzräder machten auf dem Kopfsteinpflaster einen Höllenlärm und schüttelten den Fahrer kräftig durch. So etwas Komisches hatte sie ja noch nie gesehen. Der verwegene Kerl saß ziemlich ungelenk, wie ihr schien, zwischen dem größeren Vorder- und dem etwas kleineren Hinterrad und strampelte mit seinen Beinen auf so etwas wie einer Kurbel, was wohl bewirkte, dass sich das Vorderrad immer schneller drehte. Mit den Händen hielt er eine Gabel fest, die aus zwei Stangen bestand, die mittig über dem Vorderrad angebracht waren, und versuchte so zu lenken, was angesichts der holprigen Pflastersteine ein schwieriges Unterfangen war.
»Danke … Entschuldigung«, rief ihr der junge Mann fröhlich zu, ohne sich umzudrehen. Offenbar benötigte seine Art und Weise, sich fortzubewegen, seine ganze Aufmerksamkeit. Er schwankte noch immer etwas hin und her, schien sich aber immer wieder zu fangen. Bertha konnte nicht anders, als leise zu lachen. Was war denn das jetzt? Und vor allem, was war das für ein lustiger Kerl? Ihre Stimmung hellte sich zunehmend auf, und sie war dankbar, dass sie wieder lachen konnte.
Sie war nur ein paar Schritte weitergegangen, als sie wieder dieses lang gezogene »Oooh«, hörte, in dem zum einen die Befürchtung mitschwang, einen Sturz oder gar einen Unfall zu verursachen, und zum anderen die Hoffnung, dies gerade noch vermeiden zu können. Der junge Mann versuchte, gleichzeitig einer Gruppe von Frauen, die wohl wie Bertha auf dem Weg zum Markt waren, sowie einem Karren auszuweichen, was ihm wunderlicherweise sogar gelang. Bertha hielt sich eine Hand vor den Mund und musste erneut ungläubig lachen.
Sie war erleichtert, ihr frohes Gemüt wiedergefunden zu haben. Außerdem fand sie, dass sich ihre Eltern bisher nicht über sie beklagen konnten. Immerhin war sie eine folgsame Schülerin gewesen und hatte bis zuletzt gute Noten heimgebracht. Sie war gerne zur Schule gegangen, aber mit ihrer Konfirmation begann ein neuer Lebensabschnitt. Seitdem wurde sie von ihrer Mutter im Haushalt unter die Fittiche genommen, um in den kommenden zwei bis drei Jahren alles von ihr zu lernen, was im weiteren Leben als Ehefrau wichtig war und ihr zupasskommen würde. Auch wenn sie sich viel lieber mit dem Werkzeug ihres Vaters beschäftigte, war ihr klar, dass ihr nichts anderes übrig blieb, als sich dem Wunsch ihrer Eltern zu fügen. An Heirat mochte sie noch überhaupt nicht denken. Bertha hatte mit ihren vierzehn Jahren beim besten Willen kein Interesse an Jungs, außer dass sie mit ihnen herumtoben und mit ihren Spielsachen spielen wollte. Schon bei dem Gedanken an irgendetwas, was darüber hinausging, musste sie sich unwillkürlich schütteln. Wenn Emilie oder Elise, ihre beiden älteren Schwestern, sie kichernd ins Vertrauen nahmen, auf welche Jungen sie ein Auge geworfen hatten und wie sie es am besten anstellen konnten, sie wenigstens aus Versehen und heimlich einmal kurz zu berühren, lief Bertha jedes Mal rot an. Sie fand es abscheulich. Obwohl, so ganz im Geheimen, musste sich Bertha zugestehen, fand sie es – irgendwo tief drinnen – auch ein kleines bisschen spannend, als kitzle sie der Gedanke ein wenig. Als gäbe es auf einmal eine kleine Stimme in ihr, die sie immer wieder in diese Richtung schubste. Ihr Interesse am anderen Geschlecht mochte vielleicht geweckt sein. Richtig wach war es bestimmt noch nicht. Bertha war sich nicht sicher, ob sie sich diese Gefühle überhaupt zugestehen, geschweige denn sie haben durfte. Sie fühlte sich unwohl in ihrer Haut, wenn sie daran dachte, einen Jungen überhaupt nur zu küssen. Ach, es war zum Aus-der-Haut-Fahren. Sie dachte noch nicht im Traum daran, auf die Avancen junger Männer einzugehen. Dafür verlor sie sich manchmal in Fantasien über eine romantische Liebe. Das war ja etwas ganz anderes, als tatsächlich so einen mehr oder weniger ungehobelten Kerl zu küssen, der noch nicht einmal richtigen Bartwuchs hatte. Bertha schauderte es schon bei dem Gedanken daran. Sie musste unwillkürlich ihren Kopf schütteln. Nein, bis sie das täte, würde es wohl noch etwas dauern, wenn es überhaupt jemals so weit kommen würde.
Sie wusste ziemlich genau, was sie wollte, und auch, wie sie dies erreichen konnte. Irgendetwas sagte ihr jedoch, dass diese leise Stimme in ihrem Inneren irgendwann dazu führen würde, dass dieser feste Wille unter Druck geraten würde. Sie brauchte ja nur auf Emilie und Elise zu schauen.
Da sie nun ein Backfisch war, zogen ihre Schwestern sie ab und zu auf, machten Scherze mit ihr. Über ihren Körper, der sich in den letzten Jahren verändert hatte, wie sie es zuvor bei Emilie und dann bei Elise hatte sehen können. Es bei sich selbst zu erleben, war schon noch mal etwas anderes, fand Bertha. Da halfen die blöden Bemerkungen ihrer Schwestern nicht wirklich. Dennoch war sie froh, dass sie die beiden hatte. Wenn sie nicht gerade in einer ihrer überschwänglichen Stimmungen waren, hatten sie für Bertha immer ein offenes Ohr. Über alles, was ihr peinlich erschien, fiel es Bertha leichter, mit ihren Schwestern zu sprechen als mit ihrer Mutter. Außerdem war diese schon wieder schwanger. Nachdem nach fünfeinhalbjähriger Pause letztes Jahr ihr Bruder Hermann August als achter Spross der Familie auf die Welt gekommen war, dachten sie alle noch, er wäre der Nachzügler. Jetzt war deutlich, dass es noch einen zweiten dieser Sorte geben würde.
Für Bertha bedeutete dies nach dem Ende der Schulzeit einen großen Umschwung. Vor allem, weil sie mehr denn je im Haushalt benötigt wurde. Emilie und Elise waren immer öfter auf Brautschau außer Haus. Und wenn sie mal zu Hause waren, mühten sie sich mit dem Nähen ihrer Aussteuer ab. Zu allem Überfluss kränkelte ihre Mutter, seit sie schwanger war, und konnte nicht mehr so, wie sie wollte. An Bertha blieben so fast von einem Tag auf den anderen viel mehr Arbeit und Verantwortung hängen. Sie war fest entschlossen, diese Aufgabe zu meistern. Ihre Eltern konnten von Glück sagen, dass sie ein Mädchen war. Ein Junge würde diese Aufgaben sicher nicht übernehmen, dachte Bertha trotzig. Zum einen hätte der keine Ahnung, und zum anderen würde er vor dem Berg an Arbeit, der sich jeden Tag aufs Neue anhäufte, schlicht zusammenbrechen. So, nun ist es aber gut, ermahnte Bertha sich selbst. Sie wollte sich ihren Ausflug zum Markt, den sie vor allem im Sommer so genoss, nicht von dunklen Gedanken vermiesen lassen.
Die lautesten Marktschreier, die mit ihren kräftigen Stimmen ihre Ware anpriesen, waren bereits in Hörweite. Bertha war heute spät dran, es war bereits um die Mittagspause, wenn der Marktplatz gewöhnlich aus allen Nähten platzte. Nicht nur erledigten die Hausfrauen und Dienstmägde ihre Besorgungen. Aus den umliegenden Fabriken kamen die Bijoutiers und Polisseusen herbeigeströmt, um ihre Mittagszeit an der frischen Luft zu verbringen und sich im Marktgetümmel ein wenig treiben zu lassen oder vielleicht einen Apfel zu kaufen, bevor sie wieder in die Schmuckfabriken zurück- und ihrer Arbeit nachgingen. Zwischendurch sah Bertha in der Menge auch immer wieder adrett herausgeputzte Männer mit gezwirbelten oder äußerst penibel geschnittenen Bärten, in dunklen Anzügen und gewienerten Schuhen. Sie trugen alle diese praktisch gleich großen Koffer fest in der Hand, als müssten sie sehr auf sie achtgeben. Die Tiger sind wieder los, dachte Bertha. Diesen Anblick war sie schon gewohnt. Die »Tiger«, wie sie tatsächlich genannt wurden, gehörten in Pforzheim zum Stadtbild wie die Uhr auf dem Leopoldplatz im Zentrum der Stadt. Es waren die Vertreter der ansässigen Schmuckwarenfabriken, die sich wie die Raubtiere auf die zum Teil von weit her angereisten Ankäufer stürzten, in den besseren Wirtshäusern und Hotels der Innenstadt, wo sie die Aufträge gleich am Tisch schrieben. Diese Bezeichnung hatte sich schon so weit eingebürgert, dass die Fabriken sogar in ihren Stellenanzeigen einfach »Tiger« schrieben, wenn sie auf der Suche nach einem Vertreter für ihre Gold- und Schmuckwaren waren.
Vorher schon hatte Bertha den Ersten dieser Spezies vor dem Hotel Post auf dem Leopoldplatz ausgemacht. Sie mochte dieses neue, imposante Gebäude, das ganze dreizehn Fensterfronten breit war. Dazu waren die Fenster im Erdgeschoss und ersten Stock von beachtlicher Höhe, was das Gebäude noch beeindruckender wirken ließ. In der Mitte gab es einen breiten Durchgang für Pferdekutschen und darüber einen kleinen Balkon. Außer dem Hotel war hier auch die Großherzogliche Postverwaltung untergebracht. Die Gebäude links und rechts davon wirkten etwas bescheidener, obwohl sie genauso hoch waren. Aber sowohl die Fenster als auch die Kutscheneinfahrten fielen hier kleiner aus und die Verzierungen an den Giebeln wesentlich zurückhaltender.
Beides waren Gasthäuser, eines davon war der Goldne Adler, dort war Bertha mit ihren Eltern schon ein paarmal zu besonderen Anlässen zum Essen gewesen.
Bertha mochte es, wenn es zum Markt hin auf der Straße voller wurde, die Geräuschkulisse immer mehr anschwoll und sie sich schließlich in den Trubel des Marktes stürzen konnte. Sie war gern hier, mitten im Zentrum. Der Markt war Dreh- und Angelpunkt der Stadt. Der Platz war breit und einladend, das Rathaus mit seinem Türmchen und der großen Uhr gefiel ihr.
Der Laufbrunnen neben dem Rathaus, der als Viehtränke diente, war achteckig angelegt, und in der Mitte stand auf einer Säule ein früherer Markgraf, an dessen Namen sich Bertha gerade nicht entsinnen konnte. Die Häuser dem Rathaus gegenüber waren höher als die auf dem Leopoldplatz. Die Dächer über den drei Stockwerken waren hoch ausgebaut und mit Erkern versehen und ragten dadurch scheinbar weit in den Himmel. Am besten gefiel ihr das riesige Haus des Steckels-Kayser, wie jeder den als Sonderling geltenden reichen Kaufmann nannte. Breit und selbstbewusst ragte das Gebäude an der kürzeren Südseite des Platzes empor.
Von der Architektur abgesehen, genoss Bertha die Gerüche der feilgebotenen Gemüse und anderen Waren, das fleißige Treiben, das Feilschen, und wenn sie ehrlich war, auch die mitunter derben Sprüche der Marktschreier. Wenigstens, wenn sie nicht zu weit gingen und nicht an sie adressiert waren. Sie kramte aus ihrer Rocktasche den Einkaufszettel hervor. Elf Münder wollten gefüttert werden, da galt es, nichts zu vergessen und beim Preis auf jeden Kreuzer zu achten, auf den Gulden ganz zu schweigen.
Die meisten Bauern kannten sie schon und waren freundlich zu ihr. Schließlich war sie eine gute Kundin. Trotzdem passte sie jedes Mal genau auf, ob die Ware, die sie in ihre Körbe schütteten, auch nicht verdorben war und ob sie die Waage richtig eingestellt hatten. Im Kopfrechnen war sie in der Schule immer gut gewesen, da konnte ihr kein noch so gewiefter Händler etwas vormachen. Übers Ohr hauen ließ sie sich jedenfalls nicht, und das flößte den Verkäufern Respekt ein. Vielleicht schickte ihre Mutter sie auch deshalb immer öfter auf den Markt. Auf sie war eben Verlass. Sie ließ sich nicht aus dem Feld schlagen, auch nicht von grobschlächtigen Marktschreiern. Früher, als sie noch als kleines Mädchen an der Hand ihrer Mutter gelaufen war, waren die Händler immer lieb zu ihr gewesen, hatten ihr einen Apfel zugesteckt oder sie gelobt, wie brav sie mit ihrer Mutter die Einkäufe erledigte. In der Zwischenzeit erlaubten sie sich ab und zu anzügliche Bemerkungen und Witze auf ihre Kosten. Normalerweise ließ sie die an sich abperlen, sagte nichts dazu und verzog nicht mal ihr Gesicht. Und wenn es ihr gar zu dumm wurde, schnauzte sie schon mal ordentlich zurück. Danach war meist Ruhe.
Peinlich berührt war sie vor allem, wenn sich die Marktschreier darüber lustig machten, dass sie noch ein Backfisch war. Dann errötete sie und senkte ihren Kopf. Was nur dazu führte, dass diese oft noch einen draufsetzten.
»Diese Äpfel sind genauso rotbackig und süß wie deine Wangen, damit verführst du garantiert jeden Adam, den du nur haben willst.« Ein dickbäuchiger Obsthändler streckte ihr eine verdreckte Hand über den Stand hin, in der er einen großen Apfel hielt. »Greif nur eifrig zu, du sollst ja nicht immer ein Backfisch bleiben. Und weil ich so gut aufgelegt bin, mache ich dir heute auch einen ganz besonderen Preis nur für dich. Aber dann will ich auch einen ordentlichen Schmatzer von dir.«
Sein röchelndes Lachen machte sein Geschwätz für Bertha umso ekliger, und seine halb verfaulten Zähne bekräftigten ihre Abscheu nur noch.
Das Obst würde sie heute jedenfalls bei einem anderen Händler kaufen.
1869
Juni
3
»Ich vermisse meine älteren Schwestern manchmal schon sehr«, sagte Bertha zu ihren besten Freundinnen Hedwig und Louise, als sie an einem sommerlichen Sonntag Anfang Juni auf der Terrasse ihres Lieblingscafés saßen. Eigentlich war Bertha eine wahre Frohnatur, erledigte ihre Arbeiten im Haushalt gerne und flugs, war immer offen und gerecht zu ihren jüngeren Geschwistern und half ihnen, wenn die mal nicht weiterwussten oder Ärger mit den Eltern hatten. Bertha war immer für sie da. An diesem Nachmittag aber brauchte sie Hedwig und Louise, die ein offenes Ohr für ihre Sorgen hatten.
»Dass Emilie und Elise auch ausgerechnet beide Männer finden mussten, die nach Amerika auswandern wollen, damit kann man ja auch nicht rechnen«, sagte Louise.
»Aber zum Glück hast du ja uns«, sagte Hedwig und lächelte Bertha an.
»Ja, da hast du auch wieder recht. Zum Glück habe ich euch.«
»Schließlich kennen wir uns jetzt auch schon Ewigkeiten und haben keine Geheimnisse voreinander«, bestätigte Louise.
Bertha hakte sich bei den beiden ein.
Hatten sie früher vor allem darüber gesprochen, was mal wieder in der Schule vorgefallen war oder welchen Ärger sie mit ihren Eltern oder Geschwister hatten, so tratschten sie in der Zwischenzeit am liebsten über Männer. Das heißt, vor allem Hedwig und Louise. Bertha hörte meist nur zu und fand die Kommentare der beiden über die ihren Weg kreuzenden Jünglinge durchaus lustig.
»Schaut mal, wie arrogant der daherkommt in seinem Konfirmandenanzug, der bekommt den Rock ja fast nicht mehr zu«, sagte Hedwig genau so laut, dass der Vorbeigehende es hören musste.
Louise und Bertha hielten sich die Hand vor den Mund und hatten alle Mühe, nicht loszuprusten. Vor allem weil der Jüngling sich plötzlich überhaupt keine Haltung mehr zu geben wusste und dadurch noch staksiger wirkte. Die drei Freundinnen lächelten ihm spöttisch hinterher, so wie allen ihren Opfern, die ihrem prüfenden Blick nicht standhielten. Vor allem Hedwig machte sich einen Spaß daraus, die jungen Burschen aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Bertha liebte diese Nachmittage und Abende, die sie alles vergessen ließen. Wann immer es ihre Verpflichtungen zuließen, traf sie sich mit ihren beiden Herzensfreundinnen in Cafés, oder sie besuchten Tanzbälle, lauschten Platzkonzerten oder gingen entlang der Enz oder durch das Nagoldtal spazieren. Hedwig und Louise erzählten von ihren heimlichen Abenteuern, die sie mit jungen Männern hatten, von Blicken und manchmal sogar von verstohlenen Berührungen. Dabei kicherten sie oft wie kleine Mädchen, fand Bertha. Früher ging ihr das Gekichere nur auf die Nerven. Aber in letzter Zeit merkte sie, wie diese Geschichten sie mehr und mehr interessierten, und genoss insgeheim den Nervenkitzel, der sie beim Zuhören befiel. Sich selbst in ein solches Abenteuer zu wagen, dazu war sie jedoch nicht bereit, auch wenn die beiden sie schon mal scherzhaft als alte Jungfer bezeichneten, weil sie sich so gar nicht für Männer zu interessieren schien. »Aber was nicht ist, kann ja noch werden«, scherzten Hedwig und Louise gern und kicherten wieder albern im Chor.
»Hahaha«, sagte Bertha zugleich beleidigt als auch trotzig.
Es erinnerte sie an ihre beiden älteren Schwestern, die ihr beide immer recht offenherzig erzählt hatten, wenn sie mal wieder verliebt waren und wie sie es anstellten, dass der Angebetete auf sie aufmerksam wurde. Damals hatten sie zu dritt miteinander gekichert und sich hochheilig versprochen, dass sie ihre gemeinsamen Geheimnisse niemand anderem weitererzählen würden. Bertha fand das alles unheimlich spannend, auch wenn sie diese Gefühle und Aufgeregtheiten noch nicht so richtig verstanden hatte. Wie gern würde sie Emilie und Elise davon erzählen, wenn sie wieder einmal von einem romantischen Tête-à-Tête geträumt hatte, oder sie um ihre Meinung fragen, was sie von diesem oder jenem jungen Mann hielten, dem sie auf einem Spaziergang begegnet war und der den Mut aufgebracht hatte, sie anzusprechen. Nur leider waren die beiden in der Zwischenzeit verlobt und weit weg in Amerika. Sie waren ihren Bräutigamen auf einem Schiff gefolgt, und Bertha konnte nicht mehr einfach so in ihr Zimmer platzen und sie um Rat fragen. So schade sie es fand, so sehr gönnte sie Emilie und Elise ihr großes Glück und hoffte, dass sie es dort auf diesem fernen, neuen Kontinent gut hatten. Als erst Emilie und später auch Elise ihr eröffneten, dass sie so unbeschreiblich weit wegziehen und sie sich deshalb vielleicht nie mehr wiedersehen würden, wurde Bertha erst unheimlich böse. Tagelang wusste sie nicht, wohin mit sich, und sprach kein Wort mit den beiden. Erst als sich ihre Wut löste, kam die Trauer. Natürlich verstand sie, dass ihre Schwestern ihr eigenes Leben beginnen wollten. Sie verstand sogar ihre Schwäger, die sich auf dem fernen Kontinent eine bessere Zukunft für sich und ihre jungen Familien erhofften. Aber es machte sie auch unendlich traurig. Bertha verlor ihre engsten Vertrauten und fühlte sich auf sich selbst zurückgeworfen. Es dauerte eine Zeit, bis sie damit ihren Frieden gemacht hatte und Emilie und Elise schließlich wirklich von ganzem Herzen alles Gute wünschen konnte. Die drei versprachen sich, so oft wie möglich zu schreiben.
In ihren Briefen hielt sich Bertha aber, wenigstens was die Sache mit Jungen anging, bedeckt. Zum einen brauchte es viel zu lange, bis sie Antwort bekam. Zum anderen wusste man ja nie, wer die Briefe noch so alles las. Sie wollte es sich gar nicht ausmalen. Im Boden wäre sie versunken, tief, von einem Moment auf den anderen, wenn jemand lesen würde, was Bertha sich niemandem zu erzählen traute. Schon der Gedanke trieb ihr die Schamesröte ins Gesicht.
Emilie war schon zwei Jahre weg, und Elise war vor knapp einem Jahr an Bord eines Ozeandampfers gegangen. Berthas Leben ging hier weiter. Mit Hedwig und Louise hatte sie zwei sehr gute, wenn auch sehr unterschiedliche Freundinnen, die sie beide schon seit ihrer Schulzeit kannte. Nach und nach vertraute sie den beiden wie zuvor nur ihren Schwestern. Das tat ihr gut. Bertha fühlte sich frei, wenn sie mit ihnen unterwegs war. Zu dritt, da waren sie sich einig, waren sie unschlagbar.
Auf der Terrasse des Cafés sitzend, tuschelten sie hinter vorgehaltener Hand miteinander. Hedwigs Kommentare über Männer waren oft enorm freizügig und ließen Bertha erröten, was Hedwig nur noch mehr anstachelte. Louise war dies ebenfalls peinlich. Sie war noch zurückhaltender als Bertha. Wenn Hedwig die beiden so betreten dasitzen sah, begann sie so herzhaft zu lachen, dass sie sich fast nicht mehr einkriegte.
Auch wenn Bertha mit dieser Ungezügeltheit nicht so viel anfangen konnte, faszinierte sie es in letzter Zeit immer mehr. War sie doch selbst, in anderer Hinsicht als Hedwig, ein Wildfang, wie ihr Vater sie ab und an nannte, schließlich probierte sie alles aus, zeigte keine Angst, wenn andere sagten, das wäre nichts für Mädchen, und interessierte sich eifrig für das Zimmererhandwerk ihres Vaters. Wenn er seinen Stolz auch nicht zeigen konnte, sah sie an seinen Augenwinkeln, dass er staunte, wie schnell sie die Dinge lernte. Wenn er sie mitarbeiten ließ, war sie ihm immer eine ausgesprochen gute Hilfe. Aber Bertha wusste durchaus ihre Contenance zu bewahren, sie wusste, wie weit sie gehen konnte, ohne anzuecken. Insgeheim bewunderte sie Hedwig dafür, dass sie so frei war, dass es sie wenig scherte, was andere von ihr dachten.
Bertha verdrehte die Augen, als Hedwig gerade einem feschen jungen Kerl hinterherpfiff. Louise wusste offenbar vor Scham für ihre Freundin nicht, ob sie im Boden versinken oder schnell auf die Toilette verschwinden sollte. Der junge Kerl aber drehte sich im Gehen halb zu Hedwig um, schaute verdutzt, lächelte dann und berührte mit dem Zeigefinger kurz seinen Hutrand.
Ein paar ältere Herrschaften, die den Pfiff ebenfalls gehört hatten, regten sich mächtig auf. »So eine Frechheit!« Ein Herr stampfte mit seinem Spazierstock auf den Boden. »Wo kämen wir denn da hin …?«
»Du sollst doch auf dein Herz achten, mein Lieber«, sagte die an seinem Arm gehende Frau und hinderte ihn daran, den Satz zu vollenden.
So peinlich berührt sie von Hedwigs Aktion auch war, so sehr musste sie sich jetzt zusammennehmen, um nicht laut loszulachen.
»Was für ein unverfrorenes Weibsbild«, echauffierte sich ein dickbäuchiger Herr in etwas zu enger Weste unter seinem Gehrock, und ein anderer Herr in Begleitung zweier Damen rief den Ober. »Ich erwarte von Ihnen, dass Sie diese unflätigen Gören hier auf der Stelle hinauswerfen«, beschwerte er sich, »sonst werde ich dafür sorgen, dass man Ihnen auf der Stelle kündigen wird.«
»Und wieso bitte, soll ich jetzt gehen? Können Sie mir das bitte mal erklären?« Hedwig regte sich mächtig auf, als der Kellner der Aufforderung des sich so empörenden Mannes nachkam.
Dem Ober stand der Schweiß auf der Stirn.
»Ich bitte Sie, verstehen Sie doch, die anderen Gäste …«
»Uns pfeifen die Männer doch auch andauernd hinterher. Dürfen wir das dann nicht auch?«, ließ sich Hedwig nicht so einfach abwimmeln.
»Ich muss doch sehr bitten, meine Damen«, versuchte der Ober sie hinauszukomplimentieren. Die Augen aller im Café Anwesenden waren auf sie gerichtet, und der Kellner schien in Verlegenheit zu kommen.
»Ist unser Geld denn weniger wert als das der anderen Gäste?«
»Nein, natürlich nicht, gnädige Frau, aber …«
»Na also«, unterbrach Hedwig ihn.
»Aber die anderen Gäste …«
»Wir verstehen schon«, drängte Louise zum Aufbruch.
Bertha fand es mutig von Hedwig, dass sie sich so zur Wehr setzte. Zu Recht, fand sie. Selbst hatte sie aber keinerlei Bedürfnis, diese männliche Untugend mit vertauschten Rollen einfach nachzuahmen. Was wäre damit denn gewonnen? Sie fragte sich, ob es nicht einen anderen Weg gäbe, sich als Frau durchzusetzen.
Louise war schon aufgestanden, und Hedwig hatte erreicht, was sie wollte. Um den Ober noch mehr zu beschämen, gab sie ihm ein äußerst großzügig bemessenes Trinkgeld, worauf dieser ihnen beflissen die Tür aufhielt und mit einem tiefen Diener »noch einen besonders guten Tag« wünschte.
»So«, sagte Hedwig und atmete durch, als sie draußen standen, »das hat sich ja wieder mal gelohnt. Dann lasst uns noch einen Spaziergang machen.«
Schnell ließen sie die Aufregung im Café hinter sich und genossen es, den schönen Sommertag draußen zu verbringen.
»Ich glaube, wir sollten mal ein gescheites Mannsbild für Bertha aussuchen, meinst du nicht auch, Louise?«
Oh nein, dachte Bertha, nicht schon wieder. In letzter Zeit machten sich Hedwig und Louise immer mehr einen Spaß daraus, Bertha mit ihren Neckereien um einen passenden Mann zu ärgern. Es dauerte nicht lange, da hatte Hedwig auch schon einen Kandidaten erspäht.
»Was meinst du denn zu dem hier, Bertha? Schau mal, der Großgewachsene, der uns gleich entgegenkommt. Der hat immerhin schon einen richtigen Bart.«
»Oh ja, der wirkt schon richtig männlich. Oder ist dir das etwa zu viel Männlichkeit, Bertha?«
Die beiden musterten den jungen Mann schamlos, als er sie passierte, und kicherten, während Bertha nicht wusste, wohin mit sich, und errötete. Noch schlimmer war es, wenn sie solche Kommentare zu Hause fallen ließen und ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Karl spitzkriegte, worüber sie redeten. Mit seinen achtzehn Jahren blieb ihm der Grund für die Sticheleien zwischen den Freundinnen nicht verborgen.
»Na, Bertha, bist wohl verliebt«, mischte er sich dann ein und grinste.
»Lass mich in Ruhe!«, konterte Bertha und lief knallrot an.
»Ihr blöden Kühe«, sagte sie an Hedwig und Louise gerichtet, die daraufhin kicherten.
Gerade zwanzig geworden, waren Bertha diese Anspielungen immer noch peinlich, genauso wie fast jede Begegnung mit einem jungen Mann ihres Alters. Sie wusste nie so recht, wie sie sich verhalten sollte. Wie einfach war es früher gewesen, wenn sie mit Jungs gespielt hatte. Dann war sie zwar immer das einzige Mädchen gewesen, aber sie hatte sich immer durchgeboxt, gezeigt, was sie konnte, dass sie den Jungs ebenbürtig war. Seit sich ihr Körper vor einigen Jahren sichtbar verändert hatte, schien alles irgendwie komplizierter. Die Jungs hatten sie nicht mehr in ihr Spiel integrieren wollen, und irgendwann war das Bertha auch ganz recht gewesen. Sie grenzten sie aus und lachten über Dinge, die sie überhaupt nicht lustig fand. Manche, so bemerkte sie, schauten sie mit der Zeit auch mit anderen Augen an. Ihr war das unangenehm. Eine Weile hatte sie nicht gewusst, wie sich verhalten sollte. Doch diese Unsicherheit und Scham hatte sie schnell wieder abgelegt. Sollten sie doch denken, was sie wollten, diese Kerle. Solange die Holzköpfe ihr nur hinterherpfiffen oder -riefen und sie sonst in Ruhe ließen, war ihr das egal. Sollten sie doch. Irgendwann begriff Bertha, dass die Jungs mindestens so unsicher waren wie sie. Und als junge Frau hatte sie auf einmal andere Mittel und Wege, um an ihr Ziel zu kommen.
4
»Jetzt beeilt euch, wir müssen gleich los«, ermahnte Berthas Mutter, die streng darüber wachte, dass ihre Kinder tadellos aus dem Haus gingen. »Wie siehst du denn wieder aus, Karl?«, ermahnte sie ihren Sohn. »Deine Haare stehen in alle Richtungen ab, und dein Hemd hängt aus der Hose. Ab ins Bad, und kämm dich gefälligst ordentlich.« Sie hob verzweifelt ihre Hände.
»Es ist doch jedes Mal das Gleiche … Bertha«, sprach sie ihre Tochter an, »sorg bitte dafür, dass der Rest der Bagage abreisefertig ist, ich kümmere mich um den Jüngsten. Julius? Wo ist er denn jetzt schon wieder?«
»Wir müssen gehen, wir verpassen sonst den Zug«, sagte ihr Vater, noch mehr Unruhe in das quirlige Geschehen bringend.
Bertha wusste, dass sich ihr Vater vor seinen Freunden aus dem Geselligkeitsverein Zur Eintracht nicht mit Unpünktlichkeit blamieren wollte, und schaute zu, dass ihre Geschwister so schnell wie möglich abreisebereit waren.
Bertha mochte es, mit der Eisenbahn zu fahren. Die meisten ihrer Freundinnen sahen darin eher ein eisernes Ungetüm, in das sie sich, Gott bewahre, sowieso nie begeben würden. »Das ist doch nur wieder so eine Männererfindung, um zu zeigen, wie toll sie sind und was sie alles können, Hauptsache, das Ding zischt und raucht und macht Lärm und stinkt«, wie Louise sich gern ausdrückte. Aber genau das interessierte Bertha. Es faszinierte sie immer wieder, wie dieses große, schwere Gefährt unter klagendem Geächze langsam in Bewegung kam. Wenn beim Einheizen der gesamte Bahnhof fast im Rauch erstickte, das Stampfen der Maschine, die Räder, die sich auf den glatten Schienen um Griff mühten, das Geruckel, wenn sich der mächtige Koloss erst langsam und dann immer schneller und schneller in Bewegung setzte und sie in Windeseile in eine andere Welt brachte.
»Schnell, hol deine Mütze, Gustav, du kannst doch nicht ohne sie aus dem Haus«, spornte Bertha den Fünfzehnjährigen an.
Berthas Vater trug seinen schönen Ausgehanzug, der ihm gut passte und ihn stattlich erscheinen ließ. Er genoss die sommerlichen Ausflüge mit der Eintracht. Dieser hatte sich erst vor wenigen Jahren als Geselligkeitsverein des gehobenen Bürgertums von aufstrebenden Kaufleuten und Handwerksmeistern aus Pforzheim gegründet. Man traf sich regelmäßig jede Woche im Wirtshaus, spielte Billard, lauschte Vorträgen oder freute sich einfach am Zusammensein mit Gleichgesinnten. Zu plaudern gab es genug, wie ihr Vater immer berichtete. Die Wirtschaft florierte, die Auftragsbücher waren in diesen Zeiten meist gut gefüllt, wenn da nur nicht all die lästigen Regularien wären, die sich wie Ungeziefer zu vermehren schienen, oder die wachsenden Ansprüche der Kunden. Noch mehr zu schimpfen und zu diskutieren gab es über die Politik. Und da den gestandenen Mannsbildern vom vielen Reden die Kehle darüber gar zu trocken wurde, floss auch so manches Bier durch durstige Kehlen, was dafür sorgte, dass die Abende eben doch immer vor allem eines waren: feucht und fröhlich.
Die Eintracht war gleichzeitig ein Männergesangsverein, und Bertha freute sich immer, wenn ihr Vater von den Gesangsproben nach Hause kam. Laut trällernd lief er dann durch das Haus und hatte besonders gute Laune, und sie lernte auf diese Weise immer wieder neue Lieder kennen.
Ein paarmal im Jahr wurden Ausflüge mit den Familien organisiert. Berthas Vater hatte die ganze Familie angemeldet. Die Subskription für das Mittagessen hatte er gleich mit unterschrieben. Dieses Mal sollte sie der Ausflug zu den mittelalterlichen Klosteranlagen von Maulbronn bringen, und wie er gehört hatte, war die Wirtschaft neben dem Kloster recht gut angeschrieben. Das wollte er sich nicht entgehen lassen.
Bis auf eine hatten alle begeistert im Chor »Ja« gerufen, als Karl Friedrich und Auguste ihren Kindern den Vorschlag unterbreiteten. Alle außer Bertha, die sich schon so darauf gefreut hatte, wie an jedem Wochenende mit Hedwig und Louise im Stadtpark zu flanieren, anschließend in der Stadt auf der Terrasse eines Cafés Kaffee und Kuchen zu genießen und die Passanten zu beobachten. Und natürlich wollten sie sich die Münder fusselig reden, darüber, wie furchtbar dieser Schal doch aussah oder welch altmodisches Kleid jene Frau doch trug.
Alles Bitten half nichts. Bertha musste klein beigeben. Was sich letztendlich als gar nicht so schlimm erwies. Denn auch Hedwigs und Louises Väter, beide Mitglieder der Eintracht, hatten darauf bestanden, mit der gesamten Familie am Sommerausflug des Geselligkeitsvereins teilzunehmen. Ganz ohne ihre Busenfreundinnen musste sie den Sonntag also doch nicht verbringen.
»Also los jetzt, wir müssen wirklich aufbrechen!«, wiederholte ihr Vater und lief nervös hin und her.
»Jaja, wir kommen ja schon.« Seine Frau kam mit Julius aus dem Bad geeilt und scheuchte ihre Kinder Richtung Tür.
»Unser Backfisch hat sich aber herausgeputzt heute«, stichelte Karl Friedrich junior. »Ob sie sich vielleicht schon einen ausgesucht hat? Na, Bertha, was verheimlichst du uns denn?« Er kicherte, und die anderen Geschwister, ob sie nun begriffen, was er sagte oder nicht, lachten mit. Berthas Wangen erröteten gegen ihren Willen. »Ihr seid so doof!«, brachte sie noch heraus, wandte sich ab und schnaubte vor Wut. Normalerweise konnte sie sich gut wehren, hatte immer schnell Antworten parat, egal wer ihr gerade krumm kam. Aber bei diesem Thema traf es sie irgendwie, wenn sie aufgezogen wurde, und sie fühlte sich einfach wehrlos. Zumal sie sich mit Karl eigentlich gut verstand. Seit Emilie und Elise aus dem Haus und weit weg in Amerika waren, gingen sie beide mehr und vertrauter miteinander um. Bertha war froh, dass Karl sie für voll nahm, wenn sie gemeinsam Handwerkszeugs für Vater reparierten oder zu Hause einfache Arbeiten für ihn ausführen durften. Und dass sie sich mit ihm raufen konnte. Das gehörte sich zwar absolut nicht, aber manchmal hatte Bertha einfach Lust dazu, und ihrem Bruder schien das zu gefallen. Sie waren vertraut miteinander, wussten, dass sie sich aufeinander verlassen konnten. Das schloss nicht aus, dass sie sich manchmal auch in die Haare kriegten oder den jeweils anderen auch mal so richtig ärgern konnten. So wie jetzt.
»Hört auf mit dem Getue und macht, dass ihr aus der Tür kommt!«, forderte ihre Mutter sie auf. »Warum das doch jedes Mal so ein furchtbares Chaos sein muss, wenn wir alle zusammen aus dem Haus gehen?«
5
Schon als sie durch die kurze, enge Gasse unter dem Torbogen entlang der Apotheke und dem Buchladen liefen, offenbarte sich der Reisegruppe die enorme Größe der Klosteranlage Maulbronn. Um den enormen Wirtschaftshof, auf den sie zuliefen, reihten sich auf allen Seiten eindrucksvolle Gebäudeensembles. Bertha blieb mit offenem Mund stehen, als sie auf den Platz trat. Sie ließ die großen, auf Steinsockeln stehenden Fachwerkhäuser auf sich wirken. Rechter Hand befand sich ein riesiges Gebäude aus Stein, der Fruchtkasten, wie der Klosterspeicher genannt wurde. Das erzählte ihnen der Bruder, der auf dem Platz schon auf sie gewartet hatte. Sein Habit bestand, wie für Zisterzienser üblich, aus einer weißen Tunika mit Kapuze, über der er ein schwarzes Skapulier trug. Dieser breite schwarze Stoffgürtel verhinderte, dass der Überwurf bei Wind weggeweht werden konnte.
Hier, nur ein paar Meter hinter dem Torbogen, war der erste Halt seiner Führung. Sie erfuhren, dass das Kloster bereits im 12. Jahrhundert gegründet worden war und mit der Reformation im 16. Jahrhundert, als das Herzogtum Württemberg sich schon bald für den Protestantismus entschied, das Klosterleben, mit einer kurzen Ausnahme von 1630 bis 1649, ein Ende fand.
Bertha wusste, dass es in der Eintracht sowohl katholische als auch evangelische Mitglieder gab. Aber niemand schien auf die Ausführungen des Bruders eingehen oder eine Bemerkung machen zu wollen.
Wie selbstverständlich hatten sich Hedwig, Louise und Bertha für die Führung zueinandergesellt. Bertha schaute sich um.
Die meisten Frauen trugen ihre besseren Sommerkleider. Auch wenn es ein geselliger Ausflug war, so wollte doch keine einen schlechten Eindruck hinterlassen. Auch bei ihren Hüten hatten sie ihr Bestes gegeben, so schien es. Sogar welche mit richtig großen Krempen und verspielten Bändern mit Blumenmotiven auf den Hüten konnte sie bewundern. Das taten ihr Hedwig und Louise offenbar gleich, denn die beiden begannen gerade leise über die ausgefallensten Hüte zu lästern.
»Der stünde ja noch ein Kochtopf besser«, flüsterte Louise mit Blick auf eine schon etwas in die Tage gekommenen Dame, die schräg vor ihnen stand.
Bertha versuchte, nicht laut zu lachen.
»Dann mal schauen, wie es heute hier so mit dem Angebot an Männern steht.« Hedwig ließ ihre Augen über die Reisegruppe schweifen.
»Also, was die Kleidung betrifft, hätte der Herrgott ja keine langweiligeren Geschöpfe erschaffen können als Männer«, beklagte sich Louise, »alle im schwarzen Anzug, weißen Hemd und schwarzen Schuhen.«
»Dann müssen wir uns halt an den inneren Werten orientieren, obwohl es sich um Männer handelt«, witzelte Hedwig.
»Vielleicht finden wir ja jemanden für unsere Bertha, was meinst du, Louise?«
»Also wirklich«, Bertha wurde heiß und kalt, »ihr werdet doch nicht jetzt hier vor dem versammelten Verein …«
»Aber sicher, warum denn nicht?«
»Da schau her«, deutete Hedwig auf einmal vorsichtig zu einem Mann ein paar Meter weiter, »der wäre doch was, was meinst du, Bertha?«
»Ich meine gar nichts. Und außerdem steht mir da jemand vor der Nase, ich kann ihn also gar nicht sehen. Und jetzt hört sofort auf damit. Ihr blamiert mich ja vollkommen.«
Sie drehte sich demonstrativ dem Bruder zu, um seinen Ausführungen weiter zuzuhören.
Dieser fuhr unbeirrt mit seinen Erklärungen fort. Bertha tat, als wäre sie interessiert zu hören, dass schon 1556 der Grundstein für eine Klosterschule gelegt wurde, um evangelische Pfarrer heranzuziehen und auszubilden. Seit 1806 habe König Friedrich I. von Württemberg das Kloster schließlich säkularisiert. Immerhin sei er froh, dass er als Mitglied des Zisterzienserordens weiterhin Führungen durch die alten Klosteranlagen seines Ordens geben durfte.
»Da habt ihr euch ja mit dem Dicken Friedrich gleich den Richtigen ausgesucht«, witzelte einer aus der Gruppe, aber leise genug, dass der Bruder ihn nicht hören konnte. Die Leute um ihn herum grinsten. Der erste König Württembergs galt als besonders streng. Eine Strenge, die er sich selbst, wenn es ans Essen ging, offensichtlich nicht auferlegte.
Auch Bertha musste schmunzeln. Wenigstens lockerte das den trockenen, mit allen möglichen Jahreszahlen von anno dazumal gespickten Vortrag auf.
Im Laufe der weiteren Führung erfuhr sie, dass unter anderem Johannes Kepler hier Schüler gewesen war. Richtig wach wurde sie aber erst, als der Bruder erzählte, dass keine Frau den Ort, an dem sie jetzt standen, betreten durfte, als dies noch ein Kloster war. Die Gottesdienste durften auch von Frauen besucht werden. Auf die Klosteranlage kamen sie aber nicht. Dies war strenge Regel, während alle Männer als Gäste angesehen und hereingelassen wurden.
Bertha verstand nicht, warum schon ab diesem Punkt keine Frauen mehr zugelassen waren, schließlich standen das eigentliche Kloster und die Hauptkirche an der gegenüberliegenden Längsseite des Platzes, der mindestens zwei Häuserblocks lang war.
»Na, wenn sie damit glücklich wurden.« Louise zuckte mit den Schultern.
»Für mich gäbe es dort ja eh nichts zu suchen«, sagte Hedwig schnippisch, »die dürfen subzingulär ja nicht aktiv werden.«
»Sub was?«, fragte Bertha.
»Na unterhalb ihres Zingulums, des Gürtels, verstehst du?«
»Oje, Hedwig!« Bertha verdrehte die Augen.
Der Bruder lud die Gruppe ein, über den großen Platz an den prächtigen Fachwerkhäusern und einem großen, alten Magnolienbaum vorbei auf die riesige Kirche zuzulaufen. Anders, als es Bertha kannte, schien sich der Eingang nicht an der kurzen, sondern an der breiten Seite der Kirche zu befinden.
»Der Eingang wirkt ja fast wie der in unserer Schlosskirche«, wunderte sie sich, als sie sich schließlich im Paradies befanden, der überdachten Vorhalle zum Eingang.
»Da haben Sie vollkommen recht, junge Frau.« Der Bruder hatte ihre Bemerkung gehört und ging freudig darauf ein. »Tatsächlich wurden die Klosterkirche und Ihre Schlosskirche in Pforzheim praktisch zur selben Zeit erbaut und ähneln deshalb einander mit ihren Rundbögen und davor versetzten Säulen.« Er schien froh, eine Verbindung zwischen Maulbronn und seiner Pforzheimer Gästegruppe gefunden zu haben.
Bertha dagegen war es peinlich. Sie senkte ihre Augen und spürte die Wärme in ihren Wangen.
Zum Glück wandte sich der Bruder gleich den Türen zu, die noch aus dem Jahr 1178 stammten und damit die ältesten noch erhaltenen in allen deutschen Landen waren.
Berthas Vater machte ein paar Schritte nach vorne, um das zweiflügelige Hauptportal näher inspizieren zu können. Als Zimmermann war er besonders an den Holzarbeiten interessiert.
»Na, Karl Friedrich, werden deine Türen auch so lange halten?«, witzelte einer seiner Eintrachtbrüder.
»Auf jeden Fall so lange, dass wir beide es nicht mehr nacherzählen können«, konterte Berthas Vater fröhlich.
Ja, ihr Vater war schlagfertig und nicht so leicht unterzukriegen, genau wie ihre Mutter. Diesen Wesenszug hatten sie Bertha wohl vererbt, worauf sie stolz war. Sie schaute grinsend in die Runde und sah, wie auch die anderen lächelten.
Viele Teilnehmer hatte sie schon bei früheren Gelegenheiten kennengelernt und erkannte ihre Gesichter wieder. Der eine oder andere, der gerade zu ihr herschaute, erwiderte ihren Blick mit einem freundlichen Nicken.
Die Gesellschaft kam in eine immer bessere Stimmung, und der Bruder bemühte sich um einen angemessenen Ton, schließlich waren sie drauf und dran, die heiligen Hallen zu betreten.
Berthas Aufmerksamkeit war dahin, als sie plötzlich ein ungemein attraktives Mannsbild in der Gruppe entdeckte. Da konnte dieser Bruder viel über die Klosterkirche, den Kreuzganz, Kapitelsaal und das Herren- und Laienrefektorium erzählen, in ihr tobten auf einmal alle möglichen Gefühle, die sie überhaupt nicht von sich kannte. Es war, als hätte sie Schmetterlinge im Bauch, und ein klarer Gedanke war nicht zu fassen.
Wer konnte das nur sein?, wunderte sie sich. Sie konnte sich nicht erinnern, ihn bei früheren Ausflügen der Eintracht gesehen zu haben. Er wirkte nur wenig älter als sie und somit jünger als die meisten anwesenden Männer, die schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel und in den meisten Fällen eine Familie hatten. Nein, er war irgendwie anders. Er sah lebenslustig aus, seine braunen Augen flackerten geradezu vor Neugier und Lebensfreude. Er machte eine stattliche aufrechte und schlanke Figur. Auch das gefiel ihr. Er hatte keinen Bierbauch wie die meisten hier, und kam nicht so gesetzt daher. Seine Bewegungen waren spielerisch, Bertha gefiel das. Bei aller Bestimmtheit strahlten seine Augen auch etwas Freundliches, ja fast Liebevolles aus. Bertha musste sich geradezu zwingen, ihren Blick von ihm abzuwenden – vor allem, wenn es den Anschein hatte, dass er gleich in ihre Richtung schauen würde.
Schließlich kam die Gesellschaft zum Brunnenhaus am nördlichen Kreuzgang gegenüber dem Herrenrefektorium.
»Dies ist die letzte Station unserer Führung«, sagte der Bruder und faltete seine Hände vor seinem Bauch. »Dieser dreischalige Brunnen ist, im Gegensatz zu praktisch allem anderen, was Sie im Kloster gesehen haben, wohl eher neueren Datums und in Anlehnung an Architekturstile früherer Jahrhunderte gebaut.«
Der Brunnen befand sich in einer Art halbrundem Erker, der in den Innengarten des Klosters hineinragte, und war wirklich eindrucksvoll und hübsch, fand Bertha. Das half ihr, so interessiert wie möglich dreinzuschauen.
Gleichzeitig merkte sie, wie es ihr im Kopf immer leichter und in ihrer Magengegend schummriger zu werden schien. Wenn die anderen nur nichts merken, hoffte Bertha und gab sich Mühe, sich nicht auffällig zu verhalten. Auf hämische Kommentare ihrer Freundinnen oder Geschwister konnte sie gut verzichten. Wie konnte sie nur herausfinden, wer dieses adrette Mannsbild war? Und vor allem, wie könnte sie eine Möglichkeit bekommen, wenigstens kurz seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und vielleicht sogar mit ihm zu sprechen?
Alle standen um den Brunnen herum und hörten den Ausführungen des Klosterbruders zu.
Plötzlich fühlte sie einen Knuff in ihrer Seite. Sie erschrak und schaute verwundert zu Hedwig, die ihr den sanften Ellbogenstoß verpasst hatte.
»Den habe ich vorhin gemeint«, flüsterte sie schnell und fast unhörbar, schaute Bertha kurz an, wandte dann ihren Kopf wieder nach vorn, die Augen auf den Bruder gerichtet, und schob demonstrativ die Schultern nach hinten.
Bertha fühlte sich ertappt und errötete, was die Situation nur noch schlimmer machte. Sie tat es ihrer Freundin nach und wandte ihren Blick konzentriert nach vorn. Nach ein paar Sekunden wagte sie, wieder Hedwig anzusehen, die ihren Blick für einen Moment erwiderte. Es schien Bertha, als wäre ihr Mund zu einem Anflug eines spöttischen Lächelns verzogen. Zwinkerte sie ihr etwa mit einem Auge zu? Bertha wollte am liebsten im Boden versinken. Waren schon ihre schieren Gedanken so laut vernehmbar, dass Hedwig etwas bemerkt hatte? Ihr wurde noch schummriger. Fokussiere dich, Bertha, sagte sie im Stillen zu sich selbst, es gehört sich nicht, sich so gehen zu lassen. Sie atmete, so tief es eben mit diesem seltsamen Kribbeln im Bauch ging, und auf wundersame Weise gelang es ihr, ihre Gefühle beiseitezuschieben und den Ausführungen des Vortragenden wieder folgen zu können. Na ja, dachte sie, immerhin habe ich das schon mein ganzes Leben eingetrichtert bekommen, mich zu Hause und in der Schule zu jeder Zeit zu beherrschen und die Contenance nicht zu verlieren.
So bekam sie gerade noch mit, dass die zwei oberen Brunnenschalen erst in späterer Zeit ergänzt wurden, dass sich hier die Mönche vor dem Essen die Hände wuschen und sich hier auch die Tonsur scheren lassen konnten. Vor ihrem inneren Auge sah Bertha, wie die Mönche, bevor sie ins Refugium gingen, die Hände in der Brunnenschale wuschen und dann die ganzen Haare, die an ihren Händen hängen geblieben waren, an ihrem Habit versuchten abzustreifen. Sie musste sich auf die Lippen beißen, um nicht loszulachen. Ganz so leicht konnte sie ihre Gefühle wohl doch nicht wegstecken.
»Ich möchte diese Führung gerne mit den ersten beiden Strophen eines Gedichts eines ehemaligen Schülers von hier beenden«, sagte der Bruder. »Er ist vielleicht nicht so bekannt, aber wir sind stolz, ihn bei uns gehabt zu haben. Und wer weiß, vielleicht kommt er ja noch zu einigem Ruhm. Das Gedicht heißt ›An die Natur‹ und der Verfasser Friedrich Hölderlin:
›Da ich noch um deinen Schleier spielte,
Noch an dir wie eine Blüte hing,
Noch dein Herz in jedem Laute fühlte,
Der mein zärtlichbebend Herz umfing …‹«