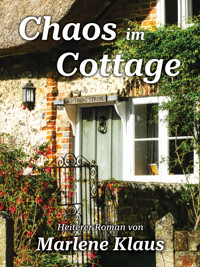Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Kurpfalz 1593. Im Dorf Hockenheim findet man am Morgen des St. Georgstages den Lehrer bewusstlos im Straßengraben. Unfall oder Überfall? Das fragt sich schnell das ganze Dorf. Da in vielen Orten rund um die Kurpfalz Frauen wegen Hexerei verurteilt werden, vermutet man auch hier eine übernatürliche Macht hinter dem Ereignis. Doch Hockenheim untersteht Heidelbergs Gerichtsbarkeit, und diese besagt, dass Hexerei nicht existiert. Trotzdem wird die Heilerin Barbara gefangengesetzt. Da sie sich seit dem Tod von Mann und Tochter aus dem Dorfleben zurückzog, häufen sich die Gerüchte um sie. Mit ihrer offenen Art machte sie sich nicht viele Freunde und so greifen ihre Widersacher die Beschuldigungen bereitwillig auf, schüren den Verdacht. Doch sie erhält Hilfe von Winfried, einem Gefolgsmann des Königs aus dem Nachbardorf. Durch ihn muss sie sich den Schatten ihrer Vergangenheit stellen. Die korrigierte Neuausgabe ist im acabus Verlag erschienen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 685
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marlene Klaus
Beschützerin des Hauses
Historischer Roman
Klaus, Marlene : Beschützerin des Hauses. Hamburg, acabus Verlag 2019
überarbeitete Neuauflage
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-756-5
PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-755-8
Print: ISBN 978-3-86282-754-1
Lektorat: Mariel Radlwimmer
Satz: Laura Künstler, acabus Verlag
Cover: © Annelie Lamers, acabus Verlag
Covermotiv: © ADDICTIVE STOCK / adobe.stock.com
Hintergrundstruktur: © pixabay.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Bedey Media GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© Dryas Verlag, Hamburg 2011
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
Für dich, Mama
Vorbemerkung
Wie wir Geburt, Krankheit, Tod erleben, wie wir miteinander umgehen, wie wir essen, wohnen, arbeiten und feiern, kurz, in welchen individuellen und kollektiven Formen wir unser Leben verbringen und uns in der Welt zurechtzufinden versuchen – dies alles verbindet uns in vielen Einzelheiten mit der Welt des alten Reiches. Es gehört zum fast vergessenen Vermächtnis der Vormoderne, das es zu entdecken gilt. Wer den verkürzenden, ausschließlich an der Gegenwart orientierten Blick überwindet, dem eröffnet die Zeit zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert überraschende Perspektiven. Dabei geht es nicht um eine Flucht aus der »bösen« Gegenwart der technischen Zivilisation zurück in die vorgeblich idyllische Welt der »guten alten Zeit«, sondern lediglich darum, zu erkennen, wer wir sind, warum wir so sind, wie wir geworden sind.
Nicht zufällig entdeckt man im ausgehenden 20. Jahrhundert die Historie neu, versucht man, in der Geschichte verlässliche Fundamente einer brüchig gewordenen Identität zu finden. Lang bewährte Formen des Zusammenlebens erfahren tiefgreifende Veränderungen, Traditionen lösen sich auf. Der gesamte Kosmos menschlicher Verhaltensweisen befindet sich im Umbruch, in einem Stadium der Neuorientierung. Vieles, was gestern galt, ist heute in Frage gestellt. Die Erfahrungen und Schwierigkeiten mit der eigenen komplexen Gegenwart erzeugen eine erhöhte Sensibilität für historische Phänomene. Geschichte erscheint heute weniger festgelegt als früher, eher als offener, unberechenbarer Prozess denn als sinnvolle, auf ein bestimmtes Ziel notwendig zulaufende Bewegung. Der rasche Wandel zeigt, dass Denk- und Verhaltensweisen, die als anthropologische Konstanten galten, der Veränderung ebenso unterliegen wie die sich schneller wandelnden Ereignisse. Die Krise öffnet den Blick für die Voraussetzungen und Bedingungen, unter denen sich die Lebensformen der Moderne gebildet haben.
Paul Münch, Lebensformen in der Frühen Neuzeit 1500 bis 1800, Propyläen 1992
Georgi 1593
1
Ein Dämon!
Oswin Gäßler stand wie vom Donner gerührt und starrte hinüber zur Weide. Ihm stockte der Atem. Äste, die in der Finsternis aussahen wie ein Haupt voll in Unordnung geratener Zöpfe. Die Fratze darin schnitt ihm Gesichter.
Gebannt starrte er auf die Schreckgestalt. Welch unheimliches Pfeifen, zum Henker!
Gäßler stemmte sich gegen den Wind, die Beine fest auf dem Grund gespreizt, drückte den Wanst nach vorn, kippte den gesamten Leib mit großer Gebärde nach hinten, als befestige er ihn an einem unsichtbaren Pflock. Die Hellebarde umklammerte er, als könne sie ihm Halt geben. Er setzte die Laterne ab und fasste nach dem Augspross des Rothirschs, den er als schützendes Amulett bei sich trug. Pfannenstiels Weib hatte ihm eigens ein Leinensäckchen in den Umhang genäht, damit er ihn darin verwahren konnte. Er berührte den rauen, gekrümmten Talisman, der ihm zudem helfen sollte, des nachts besser zu sehen. Aber gerade war er alles andere als scharf darauf, das Fratzengesicht so deutlich zu sehen. Schweiß brach ihm aus. Wind heulte. Und das Pfeifen. Sollte er nicht etwas unternehmen? Es war seine Aufgabe, die Dorfbewohner zu schützen. Doch die Gebärden der hässlichen Missgestalt lähmten ihn. Er rührte sich nicht. Hielt den Atem an. Setzte auf die Wirkkraft des Augsprosses.
Da verschwand die Wirrsal, begann, sich aufzulösen. Schwer atmete er aus.
»Zum Henker«, presste er hervor. »Ein Zerrbild.« Er nahm die Laterne wieder auf. Murmelte: »Nur die Weide, nur die Weide! Steht dort seit Menschengedenken.«
Erleichterung mischte sich unter die Angst. Aber seine Knie fühlten sich weich an. Er wandte sich der Schwopschen Mühle zu. Der Kraichbach plätscherte in der Dunkelheit. In der Mühle war noch alles still. Ein Luftstoß fuhr ihm in den Bart und lupfte ihn. Gäßler neigte den Kopf und strich das spinnwebflusige Gekitzel aus dem Gesicht. Er hob dadurch die Laterne mit an, die Kerze in ihrem Glasgehäuse flackerte, er selbst kam aus dem Gleichgewicht. Er umklammerte die Hellebarde mit Entschlossenheit, schwankte, brachte sich umständlich wieder ins Lot. Er spürte auch die Kälte wieder. Als hielte der Januar das Land noch immer in eisigen Klauen. Als sei’s nicht April. Das ging gewiss nicht mit rechten Dingen zu. Was man so hörte, waren’s Unholde, die für dieses widernatürliche Wetter verantwortlich waren. Sicher hatten die ihm auch den Dämon geschickt.
Gäßler langte vor der Mühle an. Er rammte die Hellebarde mit Wucht ins Erdreich neben sich, schluckte den Biergeschmack hinunter, spreizte die Beine fest auf dem Grund und blies schließlich fünfmal ins Horn. Mit dunklem Knurren hob er an:
»Hört ihr Leut und lasst euch sagen,
unsere Uhr hat fünf geschlagen.
Müller steh auf, bring’s Mühlrad zum Lauf!«
Gäßler wartete, bis aus dem steinernen Wohnhaus neben der Mühle schwächliches Flackern drang. Dann machte er kehrt und stapfte zurück zur Holzbrücke, über die er gekommen war. Noch einmal sah er zurück zu den Gärten. Schemen von Weide und Gestrüpp. Nichts sonst. Die Schimäre war verblasst, die Erinnerung an die Schmach nicht. Er setzte über die Brücke, folgte der Mühlgass, die leicht anstieg und sich gabelte. Der linke Arm führte in einem Schlenker zum Rathaus, von wo er seinen Rundgang begonnen hatte. Die Häuser, die sich dort Seite an Seite schmiegten, lagen noch im Dunkel. Gäßler wankte weiter, aber am liebsten hätte er sich wieder zurück in die warme Stube im Rathaus verfügt. Stattdessen folgte er dem rechten Zweig der Mühlgass hinauf zur Dorfstraß nach Reilingen. Es war der Weg, den er immer nahm, in Schlangenlinien torkelte er die Gasse hinauf.
Gäßler meinte von sich, dass er trotz Leibesfülle behutsam zu gehen vermochte wie eine Katze. Er folgte seiner Pflicht lautlos. Lärm machte er nur vorschriftsmäßig zur vollen Stunde. Hätte er gewusst, dass man seine Anmut eher mit jener von Offenlochs Ochse verglich, er hätte dem Verleumder einen Krug an den Kopf geworfen. Einen leeren, versteht sich. Bier zu verschwenden kam einer Sünde gleich.
So erreichte er die eng beieinander stehenden Holz- und Lehmfachwerkhäuser auf der Dorfstraß nach Reilingen, ging bis zum Ortsausgang. Alles ruhig. Um sich von dem Schrecken abzulenken, der ihm noch immer in den Knochen saß, stellte sich Gäßler die Betriebsamkeit vor, die am heutigen Georgstag herrschen würde. Die Hirten bezogen die Sommerweiden; möglich, es kam die ein oder andere Magd durch den Ort, wenn sie ihren Herrn wechselte. Auch sonst war allerhand Volk unterwegs. Hockenheims Grenzlage nahe des Rheins hinüber ins altgläubige Speyer sorgte für regen Verkehr. Der alte Ost-West Handelsweg von Heidelberg nach Speyer machte es zur wichtigen Zollstation. Durchreisende Händler und Kaufleute belebten der Wirte Geschäfte, sogar papistische Pilger zogen durch.
Gäßler machte kehrt. Nach einigen Schritten bog er rechts zum Dorfgrabenweg ab. Auch diese Gasse machte eine Biegung. Hier standen die Häuser nicht so eng beieinander. Zwischen manchen lagen freie Grundstücke, strauchbewachsen und dunkel. Gäßler blieb stehen und ließ seinen Ruf ertönen. Diesmal mit dem Zusatz:
»Die Nacht erlischt, heraus zur Tages Pflicht!«
Der Dorfgrabenweg ging in die Gemeindegasse über, rechter Hand, gegenüber vom Herwartschen Steinhaus, ragten auf dem Hausplatz der halben Hube die Grundpfeiler eines Neubaus in die Nacht. Hofmann, der Eigner, ließ ein Haus errichten. Gäßler durchschritt die Gasse. Bevor sie in den Heidelberger Weg mündete, säumte sie linkerhand den Dorfplatz. Er blieb stehen und auch hier vernahmen die erwachenden Bürger und Bauern, die Handwerker und Tagelöhner den Weckruf des Nachtwächters. Dann bog er rechts ab in den Heidelberger Weg, der am Zollhaus vorbei aus dem Dorf hinaus führte, schnurgerade nach Osten.
Gäßler hielt am Durchgang des brusthohen Dorfzaunes inne und äugte in die Nacht. Dort draußen lagen die Fluren und die Allmende, die in der Ferne begrenzt wurden vom Saum des Hardtwaldes. Da stockte ihm der Atem erneut. Es kam eine Gestalt herangeschritten. Scham und Angst durchfuhren ihn: Saß er wieder einer Täuschung auf, die ihm Gestalten vorgaukelte, wo es keine gab? Er beugte sich nach vorn, hielt die Laterne am ausgestreckten Arm auf Augenhöhe vor sich und spähte in die Nacht. Die Hellebarde umklammerte er mit festem Griff. Er kniff die Augen zusammen, das Kerzenlicht blendete. Er stellte die Laterne ab, um nach dem Augspross zu fassen, kippte hernach in gewohnter Weise den Leib mit großer Gebärde nach hinten und machte ihn auf gespreizten Beinen standfest. Dergestalt seiner Erscheinung den nötigen Respekt und obrigkeitliche Würde verleihend, sowie sich selbst den erforderlichen Mut durch das Berühren des Talismans, rüstete er sich für den Ruf »Wer da? Gebt Antwort, Kerl!«, als er die näherkommende Gestalt am Gang erkannte.
So wie sie ging keine. Sie schritt gemächlich einher, setzte mit Bedacht einen Fuß vor den anderen. Bei jedem Schritt wogte ihr der Arsch, dass sich Gäßler erinnert fühlte an das Schaukeln eines Kahns auf einem ruhigen See. Auch wenn man das Weib, wie jetzt, von vorne sah, wies das Pendeln auf das Prachtstück hin, zum Henker aber auch. »Die Heilmännin, die Krauthex«, murmelte er halblaut.
Und er sah sie im Geiste vor sich, sah die Rundungen ihres Leibs, das schmale Gesicht, noch immer schön, obwohl sie nicht mehr jung war. Weich, man mochte sich in sie betten – zum Henker, was ging ihm da durchs Hirn!
»Barbara Heilmann«, brummte er leise und machte kehrt. Als er an ihrem Haus vorüberkam, dem letzten am Heidelberger Weg vor dem Dorfzaun, schoss ihm ein Gedanke ins Hirn: Er hatte sie nicht hinaus gehen sehen. Wo ihm doch nichts auskam in der Nacht! Wahrscheinlich ist sie grad zum Schornstein raus wie all die Teufelsbuhlen, dachte er. Der Kiefer klappte ihm herunter. Er suchte zu fassen, was er da eben gedacht hatte. Holla! Anders konnte das gar nicht sein. Er hätte sie sonst doch sehen müssen. Und wer bleibt schon draußen in der Nacht, wo all das Gelichter vorkriecht, das Teufelszeug umgeht? Nur die, denen das nichts anhaben kann!
Überrascht vom eigenen Scharfsinn und verdutzt darüber, dass er das noch nicht früher erkannt hatte, fühlte er Stolz in sich aufkeimen. Was, wenn er recht hätte? Was, wenn sie wirklich mit dem Leibhaftigen im Bund war?
Als drücke ihm jemand die Spitze seiner Hellebarde ins Hinterteil, hastete Gäßler los und suchte seinen Rundgang eilends zu beenden. Er haspelte in der Dorfstraß nach Mannheim seine Sprüche nur noch nachlässig herunter. Rauschte zurück gen Ortsmitte, dass sich sein dunkler Wollumhang hinter ihm blähte wie die Schwingen eines dicken, fremdartigen Vogels.
Erhitzt und außer Atem in die Stube im Rathaus zurück. Er würde die Sache im Auge behalten. Mehr als das. Er würde sie dem Zentgrafen melden. Nicht vorstellbar, dass der dem keine Beachtung schenkte.
2
Barbara Heilmann schlüpfte durch die Tannen, die ihren Garten auf der Nordseite begrenzten. Der Garten besaß keinen eigenen Zugang, war nur vom Haus aus zu betreten, doch zuweilen zwängte sie sich aus Faulheit oder weil sie Lust hatte, einen anderen Weg zu nehmen, durch die Tannenzweige. Gerade eben war jedoch Gäßler der Grund. Sie hatte seine Leuchte am Durchgang des Dorfzaunes gesehen, war vom Weg abgeschwenkt und hintenherum durch den Garten heimgekehrt. Sie mochte es nicht, jemandem zu begegnen, wenn sie im Morgengrauen nach Hause kam. Erst recht nicht Gäßler.
Sie war die halbe Nacht im Wald gewesen. Sie fror, der Umhang war klamm. Durch die Hintertür betrat sie die Küche, warf die Leinenbeutel mit der nächtlichen Ausbeute auf den Tisch und entzündete ein Talglicht. Nachdem sie Feuer entfacht und einen Topf mit Wasser auf den Herd gestellt hatte, leerte sie die Beutel. Ein Häuflein Bibernellenwurzeln. Sie blies sich einen kastanienbraunen Haarstrang aus dem Gesicht und fuhr prüfend mit dem Daumen über die wurmschmalen Dinger. Das waren zu wenige und sie waren zu klein. Zudem waren sie von Wurzelfäule befallen.
»Na! Du machst ein Gesicht als hättest du Spinnen gefressen!« Die knarzige Stimme ihrer Mutter durchbrach die morgendliche Stille. Sie stand in der Tür der Schlafkammer, im Nachtgewand, barfuß und mit zerwühltem Haar.
»Erschrick mich nicht so!«, murrte Barbara.
Katharina Großhans räusperte sich die Morgentrockenheit aus dem Hals und schlurfte zum Küchentisch heran. »Du lieber Gott, das sieht aber net gut aus!«, stellte sie nach einem Blick auf die Bibernellenwurzeln fest. Barbara erwiderte nichts und griff nach dem Messer, um die Ausbeute der Nacht zu bearbeiten.
Das Feuer begann zu prasseln und vertrieb die feuchte Kälte aus der Küche. Ihre Mutter neigte sich über die Holzbank an der Wand hinter dem Küchentisch, gab Schreihals einen Schubs und ließ sich auf die Bank plumpsen, dass diese knackte. Wohlig setzte sie sich auf dem von der Katze vorgewärmten Platz zurecht. Auf ihrem Gesicht lag ein Grinsen. Sie zog die Backen hoch und das weiße Haar, das rechts von ihrer Oberlippe waagrecht in die Luft stach wie ein einzelnes Spinnenbein, bewegte sich auf und ab. Schreihals warf ihr einen empörten Blick zu, schüttelte den Kopf und leckte dann zweimal mit festem Kopfnicken den Hals hinunter. Sie drehte der Alten den Rücken zu, dann rollte sie sich neben ihr zusammen, ein rotweiß-schmutzgraues Fellknäuel.
»Na«, machte Katharina und hob den Blick.
Barbara schmunzelte. Das Gerangel um diesen Platz war ein altes Spiel zwischen ihrer Mutter und Schreihals. War ihre Mutter in Laune, ihren Platz zu behaupten, verlor die Katze. War sie süßlich gestimmt oder stolz auf eine erfolgreiche Mäusejagd Schreihals’, war sie gewillt, auf die zweite Bank unter dem Fenster auszuweichen.
Barbara wies mit dem Messer auf die dunklen Verfärbungen an den Wurzeln. »Wurzelfäule. Muss ich alles wegschneiden! Der Mond ist so gut wie voll, ich hatte mehr erhofft.«
»Wo warsch?«
»Hardtwald. Richtung Haustücker, Unterfeld.«
Katharina gähnte, zog die Schultern hoch und schüttelte sich wie zuvor Schreihals.
»Machst jetzt Aufguss statt Tinktur?«
»Was bleibt mir übrig? Für die Tinktur hätte ich mehr gebraucht.«
Im Alkohol hätten sich die heilsamen Kräfte der Wurzel besser gelöst. Auch sorgte der für gute Haltbarkeit. Jetzt musste sie einen Aufguss ansetzen. Und jenen, die Husten hatten und Brustreißen, morgen noch einmal einen Kaltwasserauszug bringen. Was hieß, sich deren Gejammer ein zweites Mal anhören und sich ermutigende Worte abpressen. Sie hasste es. Dass sie nämlich einerseits für Heilung sorgte – soweit es in der Kräuter Macht stand –, andererseits jedoch nicht wirklich Teilnahme am Schicksal der Menschen aufbringen konnte. Nicht mehr.
»Dem Senfkorn und der Fitterling bringe ich einen Aufguss«, zählte sie ihrer Mutter vor, die sie noch immer erwartungsvoll ansah. »Der Offenloch aber hustet Schleim, dem werd ich noch Thymian beigeben. Vielleicht finde ich kommende Nacht weiter östlich einigermaßen trockene Wiesen mit Bibernelle. Aber bei dem Dauerregen …«
»Regnet’s?«, fragte Katharina, drehte den Kopf und sah zum hinteren Fenster hinaus. Im grauen Morgenlicht konnte man am Gewirr der fast noch kahlen Äste den Ansatz hellgrüner Blättchen erkennen, wie ein von Riesen gefertigtes Netz, in dem kleine grüne Federn hingen.
»Gerade nicht, aber’s müht sich mit dem Tag werden,« erwiderte Barbara.
»Sieht aus als hätte jemand einen Aufguss aus Galläpfeln verschüttet,« deutete Katharina den trüben Himmel.
»Scheint sich auch dieses Jahr einregnen zu wollen. Viele sind krank. Gliederreißen, Melancholie. Kein Kraut sprießt. Wenigstens ist die Birkenrinde brauchbar.« Barbara wies mit dem Messer auf die Rinden, die sie in den Weidekorb neben der Hintertür geworfen hatte. Ein zweiter Korb daneben verwahrte allerlei Leinensäckchen. Einen Teil der Rinden behielt sie für Heiltränke. Ein durchfahrender Händler kaufte ihr den Rest ab und veräußerte diesen an Gerber in Schwetzingen und Heidelberg. Barbara kratzte an einer Wurzel herum und warf sie anschließend auf den Haufen zu den bereits gesäuberten.
Ihre Mutter beobachtete ihr Hantieren mit Messer und Wurzeln und sagte: »Was gesprossen war, hat der Frost erfrieren lassen. Hätt’s wenigstens geschneit. Dann hätten die Pflänzchen überleben können.«
Barbara merkte, der Blick ihrer Mutter folgte jeder abgeschabten Wurzel. Sie beobachtet mich wie Schreihals einen Käfer beobachtet, der hin und her krabbelt, dachte sie. Und wenn ihr auch noch links ein so langes Barthaar wächst wie auf der rechten Seite, so sieht sie auch bald so aus wie Schreihals. Die aschgrauen Stellen in ihrem weiß werdenden Haar sind wie die aschgrauen Flecken im rot-weißen Fell der Katz. Und obwohl sie es nicht mochte, derart beäugt zu werden, belustigte sie diese Vorstellung und sie musste schmunzeln. »Geh dich anziehen, Mutter!«, sagte sie und spürte selbst die Wärme, die in ihrem Ton mitschwang. »Die Geiß meckert schon und die Hühner rufen nach dir.«
»Die Hühner! Es regnet ihnen ins Stroh, das mögen sie net. Drängen sich in der Ecke zusammen, legen weniger Eier und verlangen ein wasserdichtes Dach. Matthias muss endlich kommen!«
Matthias, ihr ein Jahr älterer Bruder, hatte versprochen, noch vor Georgi das Loch im Dach des Schuppens auszubessern. Aber bis jetzt war er noch nicht da gewesen. Barbara nahm ihn in Schutz: »Er muss seine eigenen Dinge in Ordnung bringen, bevor die Fron losgeht. Er wird schon kommen.«
Matthias hatte ins Nachbardorf Reilingen geheiratet und besaß dort einen kleinen Hof. Wenn seine Arbeit es erlaubte, halfen sowohl er als auch seine Frau Gundel und die Kinder Hedwig und Michel ihnen im Haus, Garten und auf der Hube. Wurde die Arbeit im Frühjahr und Herbst jedoch gar zu viel, beschäftigten sie zuweilen auch einen Tagelöhner. Der packte gegen Kost und Lager mit an, wohnte dann in der Stube im ersten Stock, die über die Außentreppe im Garten zu erreichen war.
»Na«, machte Katharina, was bei ihr alles heißen konnte.
Dieses Na mochte bedeuten: »Mal sehen, ob das vor dem Sommer noch was wird mit dem Dach.«
Nach kurzem Schweigen fragte sie: »Leute gesehen auf dem Heimweg?«
»Warum?«, wollte Barbara wissen.
»Na.«
»Ich war im Wald, Mutter. In der Nacht. Da laufen nicht gerade viele Leute herum.«
»Man wär bereit, die Obrigkeit um Untersuchung anzugehen, was die vielen Unwetter anlangt. Hat mir die Schwechheimerin vor zwei Tagen erzählt, als ich wegen ihrem offenen Bein bei ihr war.«
Barbara sah ihre Mutter verwundert an. Katharina schob die Unterlippe vor.
»Deshalb hätte mir wer begegnen sollen?«, fragte sie.
»Na!«, machte Katharina. Es klang unzufrieden, da Barbara sich so begriffstutzig zeigte. »Die Schwachköpfe wollen ernst machen und untersuchen, wer’s Wetter verhext.«
Barbara fragte sich, worauf ihre Mutter hinaus wollte. Katharina wusste so gut wie sie, dass es in ihrer Heimat als erwiesen galt, dass Unwettermachen durch Menschenhand nicht möglich war. Katharina sagte. »Die Schwechheimerin hatte eine Flugschrift. Da war eine abgebildet, wie sie Wetterzauber auf der Flur macht. In einem Kessel, aus dem Brodem aufsteigt.«
Barbara sah nicht auf. Irgendwelche Flugschriften waren ihr so gleichgültig wie das Geschwätz der Schwechheimerin. Was hatte sie mit dem zu schaffen? Sie ließ die Leute in Ruhe und wollte von ihnen in Ruhe gelassen werden. Sie erwarteten von ihr ein Kraut bei ihren Gebrechen, und das bekamen sie. Damit genug.
Dass es seit Jahren so verregnet und eisig war, die Kälte sich bis weit ins Frühjahr hinein hielt, das Getreide auf den Fluren vom Hagel zerschlagen wurde, das ging nicht mit rechten Dingen zu, sagten die Leute. Sie sagten, eine Hexensekte sei für das Widernatürliche in der Welt verantwortlich. Der Teufel rotte sich mit seinen Helferinnen zusammen, um den Menschen zu schaden, sie von Gott und dem rechten Weg abzubringen. Welch unsinnige Vorstellung, jemand könne Wetter machen! Gott sei Dank glaubte man das hier in der Kurpfalz nicht. Außer natürlich die Schwechheimerin und einige andere Weiber.
»Geschwätz!«, entgegnete sie deshalb. »Wollen sich doch nur um die Abgaben drücken! Es verbietet’s Gesetz einen solchen Glauben. Es besagt, der Teufel hat nicht die Macht, Wetter zu machen. Erst recht kein Mensch.« Mit raschen Bewegungen schnitt sie eine Wurzel nach der anderen in kleine Stücke.
»Was die Leute glauben und was das Gesetz ihnen befiehlt zu glauben, Tochter, sind ebenso zweierlei Wesen wie Regen und Sonnenschein. Vergiss net, dass sie auch über dich tratschen.«
»Pah«, machte Barbara und erhob sich. Die letzte Wurzel landete klein geschnitten im Topf. »Luftgeplärr!«
»Die Elli sagt, im Wirtshaus reden sie«, ließ ihre Mutter sich nicht beirren.
»Elli ist eine dumme Schnattergans.«
»Sie sagt, die hohen Herren steigen dort ab, da würde sie so einiges hören.«
»Auch die hohen Herren scheißen wie alle!« Aus einem braunen Steingutkrug goss Barbara kaltes Wasser über die Wurzeln und schob den Topf an den Rand des Eichentisches. Sie stemmte die Arme in die Seiten und sah die Mutter herausfordernd an. »Gott ist für uns, drum kannst du, Teufel, uns schaden nicht ein Haar. So sagt der Katechismus.«
»Weil du dich so viel um den Katechismus kümmerst!«
»Niemand kann Unwetter machen!«
Katharina stützte die Hände auf den Tisch und zog sich in die Höhe. »Manchmal wünschte ich, ich könnt’s.« Sie beugte sich zur Katze hinunter und ergänzte: »Hier und da zwei Handvoll Mäuse auf die Flur der aufgeblasenen Wichtigtuer plumpsen lassen, was meinst du, Schreihals? Fette Mäuse?« Sie verzog das Gesicht zu einem schiefen Grinsen, das Barthaar zuckte. Schreihals erhob sich ebenfalls, machte einen Buckel und blinzelte Katharina an. Katharina schlurfte Richtung Schlafkammer.
»Ich gebe jetzt die Hirse rein«, sagte Barbara, griff nach der Holzkelle und schöpfte Hirse aus dem Sack, der in einer gezimmerten Kiste neben dem Herd stand. Zwei andere lagerten dort ebenfalls, in welchen sie Hafer und Spelz aufbewahrten. Sie überlegte, ob Mutter wohl recht hatte mit dem, was sie zuvor gesagt hatte. Dass man die Amtsleute um Untersuchung angehen wolle. Sie gab das Getreide in das kochende Wasser. Nein, Schultheiß Würth würde das zu verhüten wissen, da war sie sicher. Er hielt nichts von dem dummen Aberglauben. Er war ein rechtschaffener, gebildeter Herr. Barbara nahm einen Scheit Holz vom Stapel, der zwischen Herd und hinterem Eingang aufgeschichtet war. Das Ofentürchen quietschte sanft, als sie es öffnete und schloss. Gewissenhaft prüfte sie den eisernen Haken, ob er sich auch richtig einhängte.
Ein lautes Poltern an der Haustür ließ sie zusammenzucken. Katharina, die eben in die Kammer verschwinden wollte, machte einen Schritt auf die Tür zu, als diese auch schon aufgestoßen wurde und eine junge Magd derart ungebärdig hereinstürmte, dass das Stroh auf dem Boden einen halben Klafter weit in den Raum hinein wirbelte.
»Schnell!«, schrie die junge Frau mit weit aufgerissenen Augen. Sie legte ihre Hand auf den Busen wie jemand, der sein Herz beruhigen möchte, und wies mit dem anderen Arm zur Tür hinaus.
»Morgen, Elli«, grüßte Barbara mit Nachdruck.
»Kommt schnell, Heilmännin«, rief Elli atemlos. Ihre Backen, auch sonst recht gut durchblutet, waren vom Laufen sehr gerötet, Gestank nach Schweiß und Kochdünsten wehte mit der Magd in die Küche, ihre lange weiße Schürze hatte Flecken. Schreihals suchte mit zitternden Schnurrhaaren das Weite.
»AchGottachGott, die haben einen gefunden, droben, bei der Straße nach Reilingen, halb tot ist der«, rief Elli und hielt den Arm noch immer ausgestreckt.
»Wer?«
»Weiß nicht. War auf dem Weg zu Herwarts, als der Schockelheinz gerannt kommt und sagt, ich soll Euch holen.«
Elli, Tochter des Zollerwirts, war Magd beim Hofbereiter Herwart. Sie hatte wohl gerade ihren Dienst antreten wollen, als der Ortsbüttel sie traf und zu ihr, Barbara, schickte.
»Dann weißt du auch nicht, was ihm fehlt?«
»AchGottachGott, wie denn? Ich hab doch bloß den Schockelheinz gesehen, und der war ganz außer sich!«
»Ist gut. Ich mache mich auf den Weg. Geh zu deiner Arbeit!«
Elli nickte. Dann schlug die Tür mit lautem Krachen hinter ihr zu.
3
»Bea!« Agnes zuckte angewidert zurück und ließ den Reisigbesen fallen. Mit einem Knall schlug der Holzstiel auf den Steinboden der Küche. Sie fasste nach dem Rock und machte einen Satz rückwärts.
Die Magd fuhr erschrocken zusammen und wandte sich zu ihr um.
»Mach den weg! Sofort!«, befahl Agnes ihr ohne sie anzusehen. Sie deutete auf den Boden. Wie sie es hasste!
Bea, wenige Jahre jünger als sie selbst, doch mit dreimal so viel Leibesumfang, wackelte drall herbei. Ihre Miene drückte Gleichgültigkeit aus und Agnes hätte ihr am liebsten den Besen übergezogen. Doch hilflos musste sie zusehen, wie dieser Krautkopf die runden Backen blähte und geräuschvoll Luft ausblies. »Was denn, Fräulein Agnes?«, fragte sie langsam.
»Da hinunter ist er. Tu ihn weg!«, schrie Agnes. Sie wies unter den Küchenschrank, einen breiten, großen Eichenschrank, wie ihn sonst niemand besaß. Er fasste den gesamten Hausrat des Freihofs.
Agnes fühlte die Furcht, sie kribbelte von den Zehen aufwärts, zwickte und zwackte durch die Beine nach oben, gelangte in den Bauch und verursachte unerträgliches Gewimmel darin.
»Wieder so ein harmloser Ohrwurm?«, fragte Bea ungerührt. Teilnahmslos folgte ihr Blick Agnes’ ausgestrecktem Finger.
»Harmlos?!«, keuchte Agnes. Wie konnte diese einfältige Kuh es wagen! »Harmlos, meinst du? Soll ich dir mal einen ins Ohr setzen, du nutzloses Geschöpf? Dann will ich sehen, wie harmlos du ihn findest!« Sie merkte, dass sie zu zittern begann.
Bea zuckte die Schultern, beugte sich vor und fuhr mit ihrem Besen unter dem Schrank entlang. Agnes unterdrückte das Würgen. Der Ekel war unaussprechlich. »Mach ihn tot!«, presste sie zwischen den Zähnen hervor. »Hast du ihn, sag ich?«
»Er wird in eine Ritze gekrabbelt sein, er ist weg«, antwortete die Magd matt und richtete sich wieder auf. »Wenn Ihr weiter so zimperlich seid, werden wir nicht bis Mittag fertig. Eure Mutter sagte …«
»Sie ist nicht meine Mutter!«, fuhr Agnes ihr scharf ins Wort.
»Eure Stiefmutter eben. Sie wollte, dass Ihr mir zur Hand geht beim Frühjahrsputz. Wir sollen nach der Küche in den Kammern weitermachen, ich soll die Wintergewänder nach Löchern und Flecken durchsehen, sie säubern und in den Truhen verstauen, auch wenn ich meine, dass es dafür noch zu früh ist, ich soll zum Fleischer und zum Bäcker gehen, das Mittagsmahl bereiten, ich …«
»Das werde ich übernehmen!«, unterbrach Agnes sie.
»Das Mittagsmahl?«, fragte Bea ungläubig.
»Das Einkaufen!«
»Wie Ihr wollt.«
»Ich hasse dieses Reinemachen! Ich hasse dieses Krabbelzeug, das in allen Ritzen haust!«
Beas Gesichtsausdruck wurde schadenfroh. »Deshalb sollen wir ja auch alles gründlich machen. Aber vielleicht hättet Ihr besser nicht in jener Ecke dort angefangen« – ihr Kopf nickte in Richtung des Holzstapels zwischen Herd und Schrank – »dort hat sich’s Getier über’n Winter wohl sein lassen.«
Agnes Blick ruckte zum Holzstapel und sie betrachtete ihn voll Abscheu. Sie bemerkte das kaum verhohlene Vergnügen, mit dem die Magd sie beobachtete. Sie hasste sie dafür. Sie wagte kleine, vorsichtige Schritte Richtung Tür. »Egal was die Hausfrau meines Vaters sagt: Ich werde nur noch meine eigene Stube säubern. Die halte ich stets rein. Dort nisten keine Ohrwürmer. Und dann gehe ich ins Dorf und erledige die Einkäufe!«
Erleichterung machte sich in ihr breit, als sie die Küchentür erreichte. Sie hatte die Tür kaum hinter sich geschlossen, als die Haustür aufgerissen wurde und der Schockelheinz hereinstürmte. Atemlos verlangte der Ortsbüttel nach ihrem Vater.
»Der ist im Stall, denke ich«, sagte Agnes. »Warum?«
»Die haben den Magister Baumann erschlagen! An der Straße nach Reilingen liegt er in seinem Blut! Der Zentgraf muss her!«
4
Barbara kniete neben Hartmann Baumann im feuchten Straßengraben und hob seine Augenlider an. Der junge Lehrer war nicht bei Bewusstsein, aber er lebte. Ein schwacher Hauch Bierdunst umgab ihn.
»Und, wie lange gebt Ihr ihm noch?«, hörte sie Margarete Herwart, die mit einigen anderen nahebei stand, höhnisch fragen.
Es hatte wohl rasch die Runde gemacht, dass ein Verletzter am Ortsrand gefunden worden war. Da ließen die Maulaffen nicht lange auf sich warten. Barbara ärgerte sich über die Herwartin, achtete indes nicht auf sie. Vorsichtig drehte sie den Kopf des Lehrers zur Seite, um die Wunde zu betrachten. In seinem Nacken klebte eingetrocknetes Blut. Unterhalb des linken Ohres zog sich ein fingerlanger Schnitt oder Riss waagrecht bis unter die hellbraunen Haare.
»Ihr braucht jemandem doch nur in die Augen zu sehen und wisst, wie lange er noch zu leben hat«, setzte Margarete nach. Es klang, als gäbe sie keinen Pfennig auf diese Gabe, fürchte sie insgeheim aber doch.
Barbara blickte über die Schulter zu ihr empor und sagte kühl: »Es nimmt mich wunder, dass Ihr so kaltschnäuzig daherredet. Kümmert es Euch gar nicht, ob der Freund Eures Sohnes sein Leben aushaucht?«
Die Fünfzigjährige zog die Mundwinkel nach unten. Auf ihren Wangen zeigten sich rote Flecken, sie fasste sich in einer nutzlosen Geste an das schwarze Barett, das eine rote Perlenschnur schmückte, der einzige Zierrat, den die Bürgerfrau sich zugestand, und fauchte: »Lasst meinen Sohn aus dem Spiel! Und hört auf, mich so anzusehen. Mir jagt Ihr damit keine Angst ein!«
»Ihr könnt mich mal!«, entgegnete Barbara und wandte sich wieder dem Verletzten zu. Ihr Herz klopfte, sie war wütend. Giftmaul!, dachte sie.
»Man sollte besser einen Arzt rufen«, bemerkte Margarete spitz.
Barbara erhob sich. Die Herwartin trat einen Schritt zurück, straffte die Schultern.
»Frau Herwart«, sagte Barbara, »was ich tue, tue ich nach bestem Wissen. Wenn Ihr den Arzt für den Lehrer bezahlen wollt, so lasst nach ihm schicken.« Sie bemühte sich, mit fester Stimme zu sprechen, doch sie wusste, ihr Ärger war nicht zu überhören.
»Frau Herwart, bis wir den Studierten aus Schwetzingen geholt hätten – wer weiß, was da mit Baumann wäre.«
Gemurmel und Kopfnicken zeigte an, dass man Bauer Reinhardt zustimmte. Margarete Herwart kniff die Lippen zusammen und erwiderte nichts. Wie wenig Friedgard von dir hat, dachte Barbara. Sie musste immer an den Sohn denken, wenn sie die Mutter sah. Sie wandte sich von Margarete ab und fragte Reinhardt: »Ist jemand unterwegs, eine Trage beizuschaffen? Wir müssen ihn in seine Wohnung bringen.«
»Was denkt Ihr, Heilmännin, er ist überfallen worden, nicht wahr?«, fragte Kaufmann Gundt.
Barbara fuhr sich mit dem Handrücken unter der Nase lang. Das war genau das, was sie vermutete. Eine solche Wunde zog man sich nicht bei einem Sturz zu. Aber wer sollte den harmlosen Lehrer derart verletzen? Und warum? Der junge Mann besaß doch nichts. Freilich, Diebsgesindel mordete auch schon wegen ein paar Kreuzern. Sie zuckte die Schultern. »Vielleicht kann er uns Aufschluss geben, wenn er wieder zu sich kommt.« Und zu einem Knaben, der mit offenem Maul dastand, sagte sie: »Lauf und schick den Bader zu Baumanns Wohnung.«
»Des war’n bestimmt die Hexen!«, wisperte der Junge.
»Dummes Zeug! Geh, lauf!«, erwiderte Barbara und drehte ihn an der Schulter in Richtung Ort.
»Nimmt mich nicht wunder, dass Ihr diese Möglichkeit außer Acht lasst«, giftete Margarete Herwart. »Gottesfürchtiges Volk meidet den Kirchgang nicht.«
Es reicht, und wenn du hundertmal die Frau eines Amtmannes bist, dachte Barbara. Sie wandte sich Margarete zu. Barbara zwang sich zu einem honigsüßen Lächeln. »Ihr seid entsetzt wie wir alle, Ihr zittert ja. Vielleicht solltet Ihr Euch dieser feuchten Kühle nicht länger aussetzen, wo Ihr doch zu einer empfindlichen Blase neigt.«
Margarete schluckte. »Habt ihr gesehen wie sie mich ansieht!«, keifte sie und drehte sich zu den Umstehenden. »Sie will mir den Teufel in den Leib hexen mit ihrem starren Blick!«
»Frau Herwart …«, mahnte einer aus dem Unterdorf, doch weiter kam er nicht, denn Margarete kreischte mit schriller Stimme: »Gottlose Personen gibt es nicht nur in Herrnsheim und anderswo! Auch bei uns wüten sie, doch niemand will das wahrhaben! Oh, wir werden alle Gottes Verdammnis anheimfallen, wenn wir das Pack nicht ausrotten!«
Betretenes Schweigen folgte. Barbara merkte, wie sprachloser Schrecken sich zu ihrer Wut gesellte.
Erleichtert rief jemand: »Der Zentgraf kommt!« Man ruckte die Köpfe.
Barbara bezwang ihre Erregung. Sie brauchte für das hier einen klaren Kopf. Sie sandte Margarete genau jenen Blick, vor dem diese sich fürchtete. Zufrieden sah sie, wie sie zurückwich.
Schon stapfte Johannes Zahn heran. Gewaltig, breitschultrig und mit wehendem dunkelbraunem Umhang. Hinter den grellfarbenen Straußenfedern auf seinem Barett hüpfte der kantige Hut des Ortsbüttels auf und nieder. Heinz Maurer, genannt Schockelheinz, war alles andere als schmächtig, dennoch verschwand seine Gestalt halb hinter dem Hünen.
»Was ist geschehen?«, fragte Zahn im Amtston und baute sich vor den Leuten auf wie ein Bär. Er warf einen raschen Blick auf den verletzten Baumann und sah dann Barbara an. Wiewohl um die fünfzig, strotzte er nur so vor wuchtiger Kraft. Sein Haar wallte ihm noch immer dunkelbraun über die Ohren, wo er sich rasierte, schimmerte es schattig von nachsprießendem Barthaar.
»Lebt er?«, fragte er sie.
Barbara nickte.
»Hat Gäßler ihn gefunden?«, wollte Zahn wissen und blickte umher.
»Gäßler?«, schnaubte der Kaufmann verächtlich. »Der würde doch nicht mal den Leibhaftigen bemerken, selbst wenn der sich ihm breitbeinig in den Weg stellte! Bauer Geiß hat ihn da liegen sehen.«
»Wo ist Geiß?« polterte Zahn.
»Treibt sein Vieh zur Sommerweide. Er klopfte beim Gundt« – Reinhardt zeigte auf den Kaufmann, dessen Haus das letzte am Ortsausgang nach Reilingen war, und der darin ein Ladengeschäft betrieb, in welchem er allerlei Besatzware wie Litzen, Borten, Bänder und Quasten feilbot – »der holte den Schockelheinz.«
Der Schockelheinz nickte eilfertig bei diesen Worten. »Und ich fand dann Euren Hengst, wie ich Euch schon sagte«, gab er sich emsig.
Zahn fuhr gebieterisch mit dem Arm durch die Luft. »Heilmännin!«
Barbara zuckte unter dem harschen Ton zusammen.
»Was ist ihm widerfahren?«
Zahn tat zwei Schritte auf sie zu, sofort stieg ihr sein saurer Leibgeruch in die Nase. Unauffällig, wie sie hoffte, trat sie etwas zur Seite.
»Er hat eine fingerlange Wunde im Nacken. Der Bader muss sie womöglich nähen. Das sehe ich erst, wenn der ihn auch rasiert hat.« Sie atmete flach, kämpfte mit dem Ekel.
»Unfall?«
Barbara zuckte die Schultern. »Vielleicht ist er gestürzt«, entgegnete sie.
Zahn musterte sie mit durchdringendem Blick. »Sagte er etwas?«
»Als ich kam, war er nicht bei Bewusstsein.«
Zahn trat näher, beugte das Knie und betrachtete den Verletzten aus der Nähe. Er tastete dessen Brustkorb ab, drehte den Lehrer vorsichtig hin und her. »Wo sind seine Sachen?«, fragte er, ohne aufzusehen.
»Welche Sachen, Zentgraf?«, fragte Gundt.
»Hatte er nichts bei sich?«
Pferdegetrappel wurde laut, alle sahen auf.
Schultheiß Würth sprengte herbei. Er griff dem Tier hart in die Zügel, so dass es den Kopf in die Höhe warf und schnaubend zum Stehen kam. Auch Agnes Zahn, die Tochter des Zentgrafen, war auf dem Weg zu dem Unglücklichen, der Schultheiß hatte sie überholt. Er sprang behände ab, streichelte seinem Gaul entschuldigend über die Nüstern und warf dem Nächststehenden die Zügel zu.
Schultheiß Nicklas Würth ging wohl auf die vierzig zu, ein spitzer, dürrer Mensch bis hinauf zum sorgfältig gestutzten, rötlich-goldenen Spitzbärtchen und der scharf gebogenen Raubvogelnase. Er hüllte seinen kleinen spitzen Leib gerne in gülden-rötliche Stoffe, die meisterhaft zu seinem kupfernen Haar passten. Sorgfältig zog er sein lohfarbenes Barett zurecht, das ihm beim scharfen Ritt verrutscht war. Es war wie stets mit drei grauen Reiherfedern geschmückt, die sich gut mit dem Kieselgrau seiner Augen vertrugen. Des Schultheißen Vorliebe für alles Sonnenrote gipfelte in dem goldenen Ring mit dem leuchtend orangenen Karneol, den er am kleinen Finger der linken Hand trug.
Er trat heran, und während man ihn ehrerbietig grüßte, machte Zahn keine Anstalten dazu. Er sah nicht einmal auf, sondern hielt das Gesicht des verletzten Lehrers in seiner Pranke als genüge dies bloße Berühren, um ihn wieder zu Bewusstsein zu bringen. Tatsächlich gab Baumann ein leises Stöhnen von sich.
Barbara hörte, wie der Zentgraf leise murmelte: »Wieso hier?«
Erst dann erhob er sich, um dem Schultheiß entgegenzutreten. Aber auch jetzt grüßte er diesen nicht, sondern sagte schroff: »Liegt wahrscheinlich noch nicht lange hier. Gäßler hätte ihn sonst bemerken müssen.«
Nicklas Würth wünschte Zahn einen guten Morgen. In beiläufigem Ton, der verdeutlichte, dass er die Gebote der Höflichkeit nicht missachtete. Barbara senkte den Kopf, damit niemand ihr Schmunzeln sah, das sie trotz der ernsten Lage nicht unterdrücken konnte. Ihr gefiel Würths tiefe, wohltönende Stimme, die so sehr im Gegensatz zu seiner körperlichen Erscheinung stand. Und wenn sie, wie eben, mit spöttischer Herablassung gegen Zahn gespickt war, gefiel sie ihr noch mehr. Der Schultheiß nickte ihr einen Gruß zu, Barbara erwiderte ihn mit ebenso raschem Nicken. Dann trat er zu dem Verletzten.
Zahn, neben Würth ein Bär, der auf einen kleinen spitzen Vogel herabschaut und sich anschickt, diesen mit einem Prankenhieb zur Seite zu fegen, blaffte: »Die blutige Wunde ist ein Fall für die Zent. Lasst mir den jungen Herwart holen, damit er die Sache protokolliert!«
Mit dem jungen Herwart war Friedgard gemeint, Margaretes Sohn und Gerichtsschreiber, dem Schultheiß zur Seite gestellt und verantwortlich für den Schriftverkehr mit der kurfürstlichen Kanzlei in Heidelberg. Barbara sah, dass Margaretes Züge sich bei der Erwähnung ihres Sohnes entspannten. Sie war sicher einmal schön gewesen, und diese sanfte Schönheit, die Pfirsichhaut, mit der die Ältere noch immer gesegnet war, hatte sie an Friedgard weitergegeben.
»Ich kann das tun«, rief Agnes Zahn aufgeregt dazwischen. Sie hatte die Ansammlung erreicht, war vom raschen Gehen außer Atem und hielt sich die rechte Seite. Bittender Eifer stand in ihrem Gesicht, ihre dünne, brüchig wirkende Gesichtshaut mit dem zarten Flaum feinster Härchen schimmerte rosa.
Zahn bedachte seine Tochter mit einem missbilligenden Blick und polterte: »Das ist nicht deine Sache! Maurer wird das übernehmen.«
Fügsam senkte Agnes den Kopf. Aber Barbara bemerkte die zusammengepressten Lippen.
Würth wandte sich an den Zentgrafen. »Selbstverständlich soll protokolliert werden. Doch wollt Ihr dies sicher nicht hier draußen tun. Es nieselt.« Er lächelte Zahn an, als habe er einen Dummkopf vor sich. »Wäre schade um das teure Papier.«
Zahn blaffte den Ortsbüttel an: »Der Gerichtsschreiber soll in Baumanns Wohnung kommen und jedes Wort festhalten, wenn er wieder zu sich kommt! Wir müssen eine Untersuchung anordnen!« Er scheuchte Maurer mit einem Armschlenker von dannen.
»Und Baumann braucht Hilfe!«, wagte Barbara einen Zwischenruf. Es missfiel ihr, dass man Zeit mit Geschwätz zubrachte, statt den Lehrer endlich in seine Wohnung zu schaffen, zumal der Regen heftiger wurde.
»Ihr habt recht, Heilmännin«, sagte Würth und nickte, »Schafft Baumann fort.«
Eine Trage wurde gebracht und neben Baumann abgesetzt. »Seid vorsichtig,« sagte Barbara zu Reinhardt und Gundt, »wir wissen nicht, ob er nicht auch etwas gebrochen hat.«
Sie bemerkte den Blick, mit dem Zentgraf Zahn den Verletzten bedachte. Angespannt. Vorwurfsvoll. Etwas quälte Zahn. Ihr fiel ein, was er zuvor gemurmelt hatte: ›Wieso hier?‹ Was hatte das zu bedeuten?
Die Ankunft von Reitern aus Reilingen zerstreute ihre Gedanken. Barbara blickte flüchtig zu ihnen hin. Königsleute. Vier Mann in dunklen Umhängen, auf ihren breitkrempigen Hüten leuchteten weiße Federn, zerdrückt vom Regen. Sie grüßten. Einer fragte, ob Hilfe benötigt wurde. Ein Großer mit dunklem Haar und Augen, schwarz wie die Nacht. Und mit dunklen Linien am unteren Lidrand als hätte er sich Kohle aufgestrichen.
Barbara kannte weder ihn noch die anderen. Wie die meisten im Ort hatte auch sie nichts mit den Königsleuten zu schaffen. Die Bauernkrieger um Schloss Wersau blieben gerne unter sich. Sie nickte nur flüchtig zum Gruß, dann fasste sie vorsichtig Baumanns Schulter, um Reinhardt und Gundt zur Hand zu gehen, die den Verletzten auf die Trage hievten. Der Große mit den schwarzen Augen war auf einmal neben ihr. Er fasste den Verletzten vorsichtig um die Körpermitte und zog ihn vollständig auf die Trage.
»Was ist ihm widerfahren?«, erkundigte er sich.
Da Reinhardt und Gundt Barbara anblickten, sah auch der Königsmann ihr ins Gesicht. Barbara gewahrte die feinen Fältchen seitlich seiner nachtschwarzen Augen, da er sie freundlich anlächelte. Er mochte etwa so alt sein wie sie selbst, Mitte der dreißig. Ein stattlicher Mann. Mit höflicher Anteilnahme erwartete er die Antwort.
»Das wird er uns hoffentlich sagen, wenn er wieder zu sich kommt«, entgegnete sie.
»Ihr seid heilkundig?«
»Heilmännin«, unterbrach Zahn, »es ist keine Karre hier, um Euch mitzunehmen, seht zu, dass Ihr mit den anderen Schritt haltet!« Der Königsmann erbot sich, sie auf seinem Pferd mitzunehmen. Sie lehnte ab, nickte als Gruß und eilte hinter den beiden Männern mit der Trage her.
5
Inzwischen schüttete es wie aus Eimern. Zum Glück hatte Barbara es nicht weit von Baumanns Wohnung zu ihrem eigenen Haus. Der Lehrer wohnte zur Miete in der Gemeindegasse und die lag um die Ecke vom Heidelberger Weg. Barbara hastete auf das kleine Lehmfachwerkhaus am Ende der Gasse zu. Es war einfach, das Dach mit Holzschindeln gedeckt. Es war ihr Elternhaus, hier wohnte sie seit dem Unglück vor fünf Jahren. Vor zwei Jahren hatte Mutter ihr das Haus übereignet und sich selbst lebenslanges Wohnrecht eingeräumt.
Sie stieß die Eingangstür auf. Dämmrige Wärme und Geruch nach getrockneten Kräutern, Hirsebrei und ausgelassenem Speck füllte die Küche.
»Na!«, grüßte Katharina.
Ihre Mutter saß auf ihrem angestammten Platz auf der Bank.
Ihr gegenüber am Tisch lehnte Friedgard behaglich im Stuhl, hatte Schreihals auf dem Schoß und kraulte sie unterm Kinn, das diese weit vorstreckte.
»Ach hier steckst du!«, sagte Barbara anstelle eines Grußes.
Friedgard lächelte sie an. »Ich habe mich zum Mittagessen eingeladen«, sagte er fröhlich.
»Erzähl schon!«, drängte Katharina und hob ihren Zinnbecher in Barbaras Richtung. Barbara roch das Bier darin. Würzig und streng. Ihre Mutter braute es seit alters her und scherte sich nicht um Anordnungen. Entsprechend schmeckte es.
»Sie haben dich gesucht!«, sagte Barbara zu Friedgard.
»Mich? Weshalb?«
Barbara hängte den nassen Umhang an einen Nagel neben der Hintertür.
»Weil du aufschreiben solltest, was Baumann zu sagen hätte, falls er zu Bewusstsein kommt. Aber er kam nicht zu Bewusstsein.«
Mit einem Satz sprang Friedgard auf, Schreihals landete unsanft auf dem Lehmboden und guckte verwirrt. »Der Verletzte ist Hartmann?«
Sie nickte und setzte sich auf die Bank unter dem hinteren Fenster. Sie zerrte sich die nassen Schuhe von den Füßen. Ihre Wollsocken waren ebenfalls feucht. Sie zog sie aus, schlug das linke Bein übers Knie, knetete den Fuß und berichtete, was geschehen war.
Während sie erzählte, lief Friedgard auf und ab.
»Und er ist noch immer nicht bei Bewusstsein?«, fragte Friedgard, nachdem sie geendet hatte.
Barbara schüttelte den Kopf. »Ein Segen für ihn, Meister Bastian musste ihn nähen. Johanniskrauttinktur, Nussöl und Honig hatte ich dabei. Wir haben ihm einen Verband angelegt und Bader Bastian sorgte mit einem opiumgetränkten Schwamm zudem dafür, dass er schläft. Wenn er erwacht, wird ihm der Schädel brummen wie ein Bienenstock.«
»Ich muss zu ihm!«
»Geh am Abend zu ihm. Ich gebe dir einen Kräutersud für ihn mit und Eier. Du kannst einen Krug Roten bei deinem Vater abzapfen. Flöße ihm ein Gemisch daraus ein.«
»Was denkst du, Tochter?«
Barbara sah Katharina kurz an, äugte dann auf das Brot. Sie spürte ihrer Mutter und Friedgards Blicke auf sich.
Friedgard setzte sich wieder. Für einen Augenblick ließ sie sich von seiner Schönheit verzaubern, die großen, rehbraunen Augen, die gerade Nase, seine Pfirsichhaut, die er von seiner Mutter geerbt hatte, und die bei ihm genauso wenig welken würde wie bei ihr. Seine Haare hatten das Goldgelb von Johanniskrautblüten, er trug sie länger, als derzeit Mode war. Für einen Augenblick war sie versucht, ihm durch die Sonnenlocken zu wuscheln wie sie es so oft getan hatte, als er noch ein Knabe war. Sie tat es nicht. Er war sechsundzwanzig und kein Knabe mehr.
»Und?«, machte er und schürzte die Lippen.
»Er wird es überstehen«, sagte sie.
»Was noch?«, fragte Katharina, die, das merkte Barbara deutlich, zu Recht vermutete, dass da noch mehr war.
Schreihals maunzte, und als Friedgard nicht darauf einging, schlüpfte sie unter dem Tisch hindurch und nahm ihren Platz neben Katharina auf der Bank ein.
»Nun gut.« Barbara fuhr sich mit dem Handrücken unter der Nase lang. »Ich frage mich, warum Johannes Zahn es für nötig erachtet, höchstpersönlich nach dem Verletzten zu sehen. Kaum dass der Bader und ich ihn in seiner Wohnung zu behandeln begannen, trampelt er herein wie ein wildgewordener Ochse und will ihn befragen. Befragen! Einen Bewusstlosen. Er glaubte nicht, was Meister Bastian ihm sagte: dass nämlich Baumann vorerst nichts von sich gibt. Und er tobte, weil er dich nicht finden konnte.«
Sie sah Friedgard in die Augen. »Wo warst du eigentlich? Deine Schreibstube leer, im gesamten Rathaus keine Spur von dir.«
»Hast du uns was verschwiegen, Junge? Wird aber auch Zeit!«, grinste Katharina. »Wer ist sie?«
Friedgard wurde rot.
»Das wird deiner Verehrerin aber gar nicht gefallen. Agnes war auch draußen und ganz versessen darauf, dich beizuholen«, ging Barbara auf die Anspielung ihrer Mutter ein.
Friedgard stöhnte auf und raufte sich in gespielter Verzweiflung die Locken. »Genug der schrecklichen Nachrichten!«
Barbara schmunzelte und Katharina schob den Bierkrug näher zu Friedgard hin. »Hier Junge, stärke dich!«
Barbara bemerkte erst jetzt, dass auch vor Friedgard einer der beiden fein ziselierten Zinnbecher stand, die ihrer Mutter gehörten, und welche diese ebenso hütete, wie sie selbst ihre zwei mit Emaile umzierten Glashumpen. Kein anderer Besucher erhielt diese Ehre.
»Nicht dass sie nicht ansehnlich wäre. Aber da ist etwas in ihrer Art … Sie scheint stets von einem Ärgernis zu beben, etwas verbrennt sie innerlich. Diese Unruhe, die von ihr ausgeht … nein, das kann ich nicht gebrauchen.« Er seufzte.
Katharina hob den Becher an die Lippen, nahm einen gehörigen Schluck. »Liebestolle Weiber sind net anders als liebestolle Mannsbilder: unberechenbar und verblendet. Nimm dich in Acht!«, warnte sie schließlich.
Sie schwiegen. Barbara wusste wohl um Agnes’ Vernarrtheit in Friedgard. Sie nahm sie nicht ernst. Sie räusperte sich. »Was bleibt, ist mein Gefühl, dass Zahn etwas mit des Lehrers Unfall zu tun hat. Du bist Baumanns Freund, Friedgard, gibt es etwas, das die beiden miteinander zu schaffen haben?«
Verblüfft sah Friedgard sie an. »Nein. Was sollte das sein?«
»Zahn schien bei Baumann etwas zu suchen.« Sie zögerte. »Er fragte ›Wieso hier?‹.«
Nachdenklich schüttelte Friedgard den Kopf.
»Wo war Baumann gestern?«, fragte Katharina geradewegs.
Friedgard zauderte.
»Ohne Antwort kein Mittagessen!«, sagte Katharina in gespielt strengem Ton.
Da lachte Friedgard und auch Barbara musste schmunzeln.
»Also gut«, begann er. »Er wollte in St. Leon bei einer Familie vorstellig werden, an die ihn sein einstiger Mentor aus Heidelberg empfahl. Er …« Friedgard stockte und sah sie abwechselnd an. »Ach was soll’s. Hartmann möchte sich verheiraten und sucht ein geeignetes Mädchen. Auf Vermittlung seines einstigen Mentors hin hat er mit der Familie in St. Leon Verbindung aufgenommen. Sie haben eine Tochter, der Vater ist ebenfalls Lehrer …«
Katharina lachte schnarrend. »Der Gute wandelt auf Freiersfüßen!«
»So weit ist es ja noch nicht«, beschwichtigte Friedgard. »Es sollte der erste Besuch sein.«
»Na!«, machte Katharina und gönnte sich einen weiteren Schluck aus ihrem Becher.
»Aber er wollte eigentlich gestern Abend zurück sein. Jetzt, da die Arbeit draußen wieder anfängt, kommen zwar nicht mehr so viele Schüler zu ihm, doch einige der Jüngeren wären sicher angetrabt.«
Der junge Lehrer hielt in seiner Wohnstube Schule ab, und tatsächlich hatten Barbara und Bader Bastian mehre Jungen und Mädchen fortschicken müssen, die am Morgen zum Unterricht gekommen waren.
»Vielleicht liefen die Gespräche vielversprechend und er blieb über Nacht?« Katharina grinste vieldeutig.
Friedgard zuckte die Schultern. »Möglich«, meinte er, doch so lahm, wie er es sagte, schien er das für unwahrscheinlich zu halten.
Barbara stand auf, ging zum Herd hinüber und äugte in den Topf mit Hirsebrei. »Das erklärt alles nicht, was Zahn damit zu schaffen hat.«
»Hartmann war in Heidelberg. Er hatte Bücher beim Buchhändler bestellt. Von Heidelberg wollte er am Nachmittag nach St. Leon. Er mietete von Zahn ein Pferd.«
Barbara nickte abwesend und ging zum Wandbord hinüber. Sie griff nach den Tonschalen. Einen Augenblick starrte sie auf die irdenen Salbtöpfe, die glasierten Tiegel und die drei Medizinfläschchen aus grünem Waldglas, als müsse sie sich besinnen, was diese Gefäße dort zu suchen hatten. Sie wandte den Kopf und sah Friedgard über die Schulter hinweg an, den Arm mit den Schalen in der Luft. »Zahn schien etwas zu suchen, was dein Freund bei sich haben müsste. Und der Eifer, mit welchem er die Untersuchung betreibt, ist auffällig.«
»Das mag noch andere Gründe haben«, bemerkte Friedgard.
Barbara stellte die Schalen auf dem Tisch ab und sah ihn erwartungsvoll an.
»Na?«, machte Katharina, als er nicht sprach.
»Die vielen Unwetter«, hob Friedgard schließlich an. »Die Hexensekte, die dafür verantwortlich sei … er will, dass Untersuchungen gemacht werden, damit die endlich aufhören!« Er seufzte, es klang missbilligend.
»Zahn weiß, dass das Gerede über die Hexensekte Unfug ist. Was glaubt er, in Heidelberg ausrichten zu können? Der Oberrat wird ihn auslachen, das muss ihm doch klar sein!«
»Ich fürchte nicht«, entgegnete Friedgard. »Durch die Sache mit Herrnsheim ist auch der Oberrat sehr darauf bedacht, die Anschuldigungen zu entkräften. Er muss alles tun, um Vorwürfe, die Kurpfalz decke das Treiben der Unholde in ihrem Territorium, zu widerlegen. Es wird vermehrt Untersuchungen geben. Es sind Schreiben aus Heidelberg gekommen, die diese Sache betreffen.«
Barbara hatte den Vorfall vom Februar noch in lebhafter Erinnerung. Rasch hatte die Runde gemacht, dass bei der Hinrichtung einiger Hexen zu Herrnsheim, einem Flecken, der zur Dalbergischen Herrschaft nordwestlich von Worms gehörte, der Dalbergische Gerichtsschreiber öffentlich erklärt hatte, es werde alles nicht helfen und guttun, wenn die Obrigkeit zu Herrnsheim allein das Übel strafe, das Beste tue und hinwegbrenne, wenn es andere Obrigkeiten nicht auch endlich angingen und angriffen. Das war ein deutlicher Hieb gegen die Kurpfalz gewesen, die natürlich in aller Schärfe gegen solche Reden protestiert hatte, die den Eindruck erwecken mussten, man vernachlässige obrigkeitliche Pflichten und lasse Verbrechen ungestraft.
»So glaubt man inzwischen auch in Heidelberg, Menschen machten die Unwetter? Niemals!« Sie konnte sich nicht vorstellen, dass sich etwas an der Haltung ihres Landesherren und seiner Berater ändern sollte. Seit sie denken konnte, verurteilte man in der Kurpfalz das Gerede um die Möglichkeit des Unwettermachens. Das würde gegen die Allmacht Gottes sprechen. Mensch und Tier konnte man schaden, aber niemandem war es möglich, ein Unwetter heraufzubeschwören. Diese Glaubenssätze hatte man ihr gründlich mit dem Katechismus eingetrichtert. Und obwohl sie der calvinistischen Lehre nicht zugetan war, glaubte sie doch fest an diesen Grundsatz. Und dass der Zentgraf Untersuchungen in dieser Sache anstellen wollte? Nun, wenn Heidelberg das vorgab, würde Zahn sich danach richten müssen. Was aber hatte das mit dem verletzten Lehrer zu tun? Glaubte Zahn ernsthaft, Baumann wäre von Hexen angegriffen worden? Das war doch Unsinn!
»Ich dürfte darüber gar nicht mit Euch reden.«
»Du hast nichts gesagt«, erwiderte Katharina mit Unschuldsmiene.
»Seltsam aber, dass ich zum zweiten Mal an diesem Tag von Herrnsheim höre«, sagte Barbara nachdenklich. »Deine Mutter sprach auch davon heute Morgen. Allerdings auf sehr unschöne Art.«
»Na!«, machte Katharina verächtlich.
Friedgard schaute verlegen drein. »Meine Mutter ist Euch nicht hold«, bekannte er schließlich.
»Das ist nett ausgedrückt!«
Friedgard schürzte die Lippen. Was sah er herzzerreißend ratlos aus! Barbara unterdrückte erneut den Drang, ihm durchs Haar zu wuscheln. Er war jetzt ein Amtmann, dem Achtung gebührte, auch wenn er für sie immer der Junge bleiben würde, den sie einst ins Herz geschlossen hatte. Sie ging hinüber zum Herd, nahm den Topf herunter und trug ihn zum Tisch. Friedgard beeilte sich, die Löffel aus der Lade zu holen, etwas, das er seit seiner Knabenzeit tat, und wofür er sich auch jetzt nicht zu alt oder zu fein war, auch wenn es weder seinem Geschlecht noch seinem Stand angemessen war.
»Muss noch Grünzeug rein«, meinte Katharina, als Barbara den Topf auf dem Tisch abstellte. Ächzend erhob sie sich, um im Garten einige der frühen Kräuter zu holen.
Friedgard verteilte die Löffel und sagte mit gesenktem Kopf: »Es war ja früher schon so. Dass ich mit Euch im Wald umherzog, gefiel ihr nicht. Und als Ihr mir an jenem verhängnisvollen Abend noch dazu das Leben rettetet, ich denke, das hat sie nie verwunden. Dabei müsste sie Euch dankbar sein. Und nun bin ich ein angesehener Amtmann seiner kurfürstlichen Gnaden und Ihr …« Er unterbrach sich selbst, sah sie an und hob die Hände in einer Geste, die ihr sagen sollte, dass ihm der Standesunterschied gleich war. »Ich erzähle ihr nicht, dass ich zu Euch gehe«, schloss er.
Barbara setzte sich und fuhr mit dem Daumennagel Ritzen in der Tischplatte nach. Wer soll es Margarete verdenken, dachte sie. Wäre nicht auch ich zornig gewesen auf ein Weib, mit dem mein Kind mehr Zeit zubringt als mit mir? Kaum dass Herwarts nach Hockenheim gezogen waren, war ihr Friedgard nicht von der Seite gewichen. Er hatte sie im Wald entdeckt und zu seiner Mentorin auserkoren. Zehn war er da gewesen, ihr sonniger Schützling, und sie eine junge Frau von einundzwanzig. Sie hatte ihm die Pflanzen erklärt, die Bäume, das Wetter. Und spätestens durch den Angriff der Wildsau auch das Verhalten der Tiere. Er war mit dem Schrecken davongekommen, sie beide waren das, doch Margarete hatte getobt. Barbara wusste: Schuldgefühle plagten Friedgards Mutter, weil sie wieder einmal nicht achtgegeben und bemerkt hatte, dass ihr Sohn sich in den Wald schlich. Auch noch mit jener Weibsperson, in deren Obhut sie ihn ohnehin nicht lassen wollte. Und die rettete ihn dann auch noch davor, von einer Bache zertrampelt zu werden.
Schließlich hatte man Friedgard zurück nach Heidelberg aufs Pädagogium geschickt. Aber dann war er vor zwei Jahren zurückgekehrt, obwohl seine Eltern nichts sehnlicher wünschten, als dass er sich in der kurfürstlichen Rechenkammer sein Auskommen sicherte, sich nach Stand verheiratete und in Heidelberg niederließ. Doch das wollte er nicht. Er hatte das Studium der Rechte abgebrochen, war mit einundzwanzig Sekretär in der Kanzlei geworden, hatte festgestellt, dass ihn sowohl das Kanzleigerangel als auch Heidelberg abstießen, und hatte sich als Gerichtsschreiber nach Hockenheim bestallen lassen. Und kaum war er zurück, der junge Skribent, hatte er die Anhänglichkeit aus Kindertagen erneuert und seine Besuche bei ihr wieder aufgenommen. Margaretes Wut war wieder aufgeflammt. Dahin ihre ehrgeizigen Träume für ihren Sohn. Wer wollte es ihr also verdenken, dass sie …
»Ich kann ihr nicht begreiflich machen, dass Ihr mir nicht die Mutter ersetzt«, unterbrach Friedgard ihre Gedanken. »Dass Ihr ihr nichts wegnehmt, denn ich bin nicht Euer Sohn.«
»Auch nicht ihr Liebhaber?«, vernahmen sie Katharinas Stimme von der Hintertür.
Barbara fuhr herum und sah ihre Mutter verdutzt an.
»Mutter, was sollte das?«
»Na«, machte Katharina und zuckte die Schultern. Sie schabte die Kräuter in den Brei und rührte ihn mit dem Messer um.
»Mutter!«
»Hab’s nie gesagt, aber’s gibt Geschwätz. Schon länger. Ich halte dagegen, aber wer glaubt schon einem alten Weib, zumal sich’s um ihre Tochter handelt.«
»Aber …!« kam es wie aus einem Munde. Barbara sah Friedgard aufgeschreckt an.
»Na, bist eine ansehnliche Wittib, kein Mann in Sicht außer diesem jungen Burschen, der im Haus ein und aus geht, da denken sich die Leute ihren Teil.«
Friedgard klappte der Kiefer runter. Auch Barbara war sprachlos. Nie war ihr etwas Derartiges zu Ohren gekommen. Aber wann sagten einem die Leute schon mal was direkt ins Gesicht?
Katharina, das Messer in der Luft, ergänzte: »Und du, junger Freund, machst keine Anstalten, dich zu verheiraten. Das Alter hast du inzwischen. Und deine sechzig Gulden im Jahr bestimmt auch. Wie viel Malter Korn dazu? Hafer? Einen halben Fuder Wein?«
»Ihr wisst aber gut Bescheid, Frau Großhans«, gab Friedgard zurück. Missgestimmt schürzte er die Lippen.
Katharina winkte nur ab. Friedgard entspannte sich wieder und zuckte die Schultern. »Sei’s drum. Wir sollten etwas dagegen unternehmen.«
»Was denn? Die Leute reden, was sie wollen. Oder willst du uns künftig nicht mehr besuchen?«
»Natürlich nicht.«
»Du must heiraten!«, meinte Katharina.
»Wen denn? Agnes etwa?« Er hielt Katharina seine Schale hin, damit sie ihm Hirsebrei auftun konnte.
»Mach’s wie dein Freund Baumann! Frag herum, wer eine Tochter hat. Du wirst doch aus deiner Zeit in Heidelberg Verbindungen haben.«
Barbara hielt Katharina ebenfalls ihre Schale hin. Sie war wie benommen davon, was man ihr und Friedgard unterstellte. Nie wäre sie auf einen solchen Gedanken gekommen.
»Frau Heilmann, wie ist es mit Euch?«, fragte Friedgard.
»Was?«
»Nun, mit Verlaub, warum ich?«
»Warum du was?«
»Eure Worte sind oft spitz und schroff. Doch Eure Erscheinung ist weich, umflort von einem warmen Rostton, angenehm wie dunkles Holz. Warum heiratet Ihr nicht wieder?«
Sie war so überrascht, dass sie den Löffel fallen ließ.
Katharina lachte ihr schnarrendes Lachen. »Gut gemacht, Junge!«
Barbara spürte, wie ihr die Röte in die Wangen stieg. Sah er sie wirklich so? So … so … auf so hübsche Art? Seit Leonhards Tod hatte sie keinen einzigen Augenblick an eine Wiederheirat gedacht. Wegen Leonhard nicht und nicht mit diesem … Makel. Friedgards Worte trafen sie ins Mark. Er bemerkte es.
»Ich meine ja nur«, flüsterte er verlegen. »Auch Ihr könntet wieder … ich meine …«
»Lass gut sein, Junge!«, mischte Katharina sich ein. »Iss, bevor alles kalt wird.«
Sie löffelten schweigend.
Barbara hatte Katharina im Verdacht, extra laut zu schmatzen, um die unangenehme Stimmung zu vertreiben. Mit einem Mal musste sie schmunzeln. Sie sah zu Friedgard hin. Er erwiderte ihren Blick. Ein Grinsen stahl sich auf sein Gesicht. Sie leckte ihren Löffel ab und schlug ihm damit sanft auf die Backe. »Lümmel!«, sagte sie weich. »Und nun sag uns endlich, wo du gesteckt hast den ganzen Morgen!«
Er wurde wieder rot.
»Nun? Wir hören!«, mampfte Katharina.
Friedgard legte den Löffel beiseite und rang sichtbar mit sich. Schließlich sagte er: »Ihr wisst ja von meinem Versuch, eine Geschichte zu schreiben …« Er stockte, sah Barbara an und fuhr fort: »Ich habe Euch davon erzählt, wie schwer das ist …«
Barbara wusste um den Kampf, den er mit sich ausfocht, weil er mit dem Schreiben nicht so vorankam, wie er es sich wünschte. Oder wie er dachte, wie es sich gehörte.
»Du kommst also voran und arbeitest an einer Heldengeschichte?«, fragte sie deshalb aufmunternd, auch wenn sie sich nicht wirklich etwas darunter vorstellen konnte. Natürlich kannte sie Erzählungen, natürlich gab es Menschen, die sie aufschrieben, aber eine eigene, neue Geschichte erfinden, wie Friedgard es wollte?
»Also, hinter der Schwopschen Mühle, da gibt es die Wiese mit der winzigen Hütte des Müllers, wo er alte Säcke und Tand aufbewahrt. Dort ist es ruhig, nur das Murmeln des Bachs und das Ächzen des Mühlrades. Dort fühle ich mich … ungestört eben.« Friedgard unterbrach sich. Erklärend fügte er hinzu: »Dort schreibe ich. In der Schreibstube kommt ja alle Nase lang einer gerannt. Und daheim ist stets so viel Umtrieb mit den Schwestern und so.«
»Du hast also einen Geheimplatz«, sagte Katharina und es klang zufrieden.
Barbara fiel noch etwas anderes ein. »Hab Weißmannen im Dorf gesehen. Was wollen die hier? Ist irgendetwas los?«
Friedgard nickte. »Denke, die müssen sich besprechen wegen dem Geleitzug im Mai«, verkündete er schließlich. »Einige von ihnen werden den Kurfürst nach Dillenburg begleiten. Der will, dass seine Königsleute dabei sind, wenn er zur Braut zieht. Aber …« Er hob beide Hände abwehrend hoch. »Das geschieht unter dem Siegel der Verschwiegenheit, in aller Eile und Heimlichkeit. Kurfürst Friedrich will die Untertanen nicht unnötig beschweren, wie er sagt. Alles leeres Geschwätz, wenn ihr mich fragt. Es ist Politik, nichts weiter. Wir Reformierten stehen nicht im Schutz des Religionsfriedens. Die lutherischen und katholischen Fürsten sitzen uns im Nacken, behaupten, dass man uns im Reich nicht dulden dürfe. Erinnert euch daran, wie der Kaiser im vergangenen Jahr in Aachen bestimmte, die Reformierten seien den Mitgliedern erlaubter Konfessionen nicht zuzuzählen. Ich sage euch, es geht mit dieser Hochzeit nur darum, mit den Wetterauer Grafen das calvinistische Bündnis zu stärken und die Kurpfalz zu stützen.« Friedgard kratzte den letzten Rest Brei mit dem Löffel zusammen.
»Nichts, was wir nicht auch wüssten!«, winkte Katharina ab und gab Friedgard damit zu verstehen, dass er keine Regierungsgeheimnisse ausplauderte. Womit sie Recht hatte. Der junge Friedrich wollte sich mit Prinzessin Louise Juliane vermählen, der Tochter Wilhelms von Oranien und Nichte Graf Johanns des Älteren von Nassau-Dillenburg, einem der Wetterauer Grafen. Der war ein einflussreicher Ratgeber Johann Casimirs gewesen, dem vorjährig verstorbenen Administrator und Oheim des jungen Friedrich. Allgemein bekannt. Und daher nicht verwunderlich, dass Friedrich jene Männer mitnahm, die dem Kurfürsten seit alters her treu ergeben waren. Sie hätte von sich aus drauf kommen können. Die Kriegertruppe machte was her. War ansehnlich in den weißen Hosen und Röcken. Heimlichkeit und Eile hin oder her, natürlich würde der Kurfürst nicht auf sie verzichten. Barbara dachte an den großen Königsmann mit den schwarz untermalten Augen, den hohen Wangenknochen und dem strichdünnen Oberlippenbärtchen, das von jedem Mundwinkel zu den Nasenlöchern aufstieg wie ein dreieckiges Giebelchen über einem schön geschwungenen Dach. Sie erinnerte sich an sein sparsames Kinnbärtchen und verschwieg, dass ihr hastiges Davongestolpere, als sie am Morgen Reinhardt und Gundt hinterher eilte, fast zu einem Sturz geführt hätte. Die rasche Bewegung hatte irgendwie nicht zu ihren Schritten gepasst, sie war auf ihren schlammnassen Rocksaum getreten und fast gestürzt. Vor aller Augen! Armerudernd suchte sie ihr Gleichgewicht zu halten. Da war der Königsmann schon wieder neben ihr, rief »Holla!« und hielt sie am Ellbogen. So war sie nicht gestürzt. Hatte einen Dank gemurmelt und gemerkt, wie sie heiße Wangen bekam. Und die bekam sie auch jetzt, da sie daran dachte.
»Was ist?«, sagte Friedgard und schob die leere Schale von sich.
»Was soll sein?«, entgegnete sie.
»Woher rühren Eure rosigen Wangen?«
»Schau dir deine an, du Poet! Vom heißen Brei, woher sonst!«