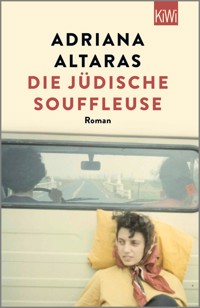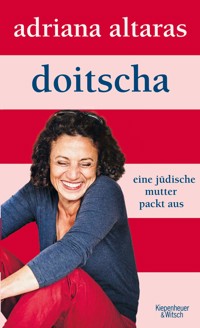11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Adriana Altaras erzählt von ihrer Tante, der schönen Teta Jele. Von einer Frau, die 101 Jahre alt wurde, die spanische Grippe, das KZ und ihre norditalienische Schwiegermutter überlebte. Von einer so liebevollen wie eigensinnigen Beziehung. Und davon, wie man lernt, das Leben anzunehmen. Als ihre Eltern aus Zagreb fliehen müssen, kommt Adriana mit vier Jahren zu ihrer Tante nach Italien. Dorthin wird sie ihr Leben lang zurückkehren. Als Jugendliche in den Sommerferien, mit ihrer gesamten Abiklasse – und mit all ihren Liebhabern, die Tantchens aristokratischem Blick standhalten müssen. Und auch als Adrianas Mann sie nach dreißig Jahren Ehe verlässt, ist es ihre 98-jährige Tante, die ihr am Gardasee mit jeder Menge Pasta, pragmatischen Ratschlägen und Barbesuchen zur Seite steht. Ausgerechnet Teta Jeles hundertsten Geburtstag können sie nicht miteinander feiern. Adrianas Tante ist im Pflegeheim, wegen der Pandemie darf sie keinen Besuch empfangen. Umso häufiger telefonieren die beiden miteinander. Und lassen dabei Jeles Jahrhundertleben Revue passieren. Die Kindheits- und Jugendjahre in Zagreb, die Rettung durch Giorgio, der die Tante nach Mantua brachte und den sie nur aus Dankbarkeit heiratete. Die Liebe zu Fritz Epstein, der rechtzeitig nach Australien floh. Den Umgang mit dem Altwerden und der eigenen Geschichte inmitten des Weltgeschehens. Adriana Altaras entwirft ein zartes, bewegendes und zugleich irre komisches Porträt einer wunderbar kapriziösen Frau. Ein tröstliches, ein inniges Buch, das erzählt, wie man das Leben annehmen und wie man es loslassen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Adriana Altaras
Besser allein als in schlechter Gesellschaft
Meine eigensinnige Tante
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Adriana Altaras
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Adriana Altaras
Adriana Altaras wurde 1960 in Zagreb geboren, lebte ab 1964 in Italien, später in Deutschland. Sie studierte Schauspiel in Berlin und New York, spielte in Film- und Fernsehproduktionen und inszeniert seit den Neunzigerjahren an Schauspiel- und Opernhäusern. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Bundesfilmpreis, den Theaterpreis des Landes Nordrhein-Westfalen, den Silbernen Bären für schauspielerische Leistungen und und den Deutschen Hörbuchpreis. 2012 erschien ihr Bestseller »Titos Brille«. 2014 folgte »Doitscha – Eine jüdische Mutter packt aus«, 2017 »Das Meer und ich waren im besten Alter«. Adriana Altaras lebt mit ihrer Familie in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Adriana Altaras erzählt von ihrer Tante, der schönen Teta Jele. Von einer Frau, die 101 Jahre alt wurde, die spanische Grippe, das KZ und ihre norditalienische Schwiegermutter überlebte. Von einer so liebevollen wie eigensinnigen Beziehung. Und davon, wie man lernt, das Leben anzunehmen.
Als ihre Eltern aus Zagreb fliehen müssen, kommt Adriana mit vier Jahren zu ihrer Tante nach Italien. Dorthin wird sie ihr Leben lang zurückkehren. Als Jugendliche in den Sommerferien, mit ihrer gesamten Abiklasse – und mit all ihren Liebhabern, die Tantchens aristokratischem Blick standhalten müssen. Und auch als Adrianas Mann sie nach dreißig Jahren Ehe verlässt, ist es ihre 98-jährige Tante, die ihr am Gardasee mit jeder Menge Pasta, pragmatischen Ratschlägen und Barbesuchen zur Seite steht.
Ausgerechnet Teta Jeles hundertsten Geburtstag können sie nicht miteinander feiern. Adrianas Tante ist im Pflegeheim, wegen der Pandemie darf sie keinen Besuch empfangen. Umso häufiger telefonieren die beiden miteinander. Und lassen dabei Jeles Jahrhundertleben Revue passieren. Die Kindheits- und Jugendjahre in Zagreb, die Rettung durch Giorgio, der die Tante nach Mantua brachte und den sie nur aus Dankbarkeit heiratete. Die Liebe zu Fritz Epstein, der rechtzeitig nach Australien floh. Den Umgang mit dem Altwerden und der eigenen Geschichte inmitten des Weltgeschehens.
Adriana Altaras entwirft ein zartes, bewegendes und zugleich irre komisches Porträt einer wunderbar kapriziösen Frau. Ein tröstliches, ein inniges Buch, das erzählt, wie man das Leben annehmen und wie man es loslassen kann.
Inhaltsverzeichnis
Meine Tante sitzt fest …
Sie schieben mich …
So hatte ich mir …
Mir ist unglaublich langweilig …
Viele haben ein Wochenendhaus …
Die Nachtschwester ist krank …
Heute habe ich mich wieder …
Adriana will ständig …
Wie spät ist es? …
Habe ich Glück gehabt? …
Tante verändert sich …
Signora Fuhrmann! …
Das Grandhotel Due Torri …
Wo bin ich? …
Tante war heute wieder einmal verzweifelt …
Habe ich alles erledigt? …
Ist die Tante tot? …
Träume ich noch …
Obwohl ich sicher weiß …
Meine neue Zimmernachbarin …
Meine Tulpen haben ewig gehalten …
Ist heute Mittwoch? …
Es ist wirklich erstaunlich …
Adriana kocht im Frühling Gans …
Seit Stunden …
Ich weiß nicht …
Wenn man um sieben Uhr früh joggt …
Es kommt in Wellen …
Seit zwei Stunden …
Wieder habe ich …
Seit über einer Stunde …
Ich hätte nie für möglich gehalten …
Meine Arbeit als Opernregisseurin …
Gestern schlichen alle …
Ist das unser letztes Telefonat? …
Ich weine …
Ich weine …
Heute geht es mir besser …
Mein Plan war …
Sie haben einen riesigen Kuchen gebacken …
Heute ist der hundertste Geburtstag …
Die runden Geburtstage …
Warum nur …
Großen Dank an …
Meine Tante sitzt fest. Sie kann nicht raus und ich kann nicht rein. Ich darf nicht nach Mantua reisen, ich darf sie nicht in ihrem Pflegeheim besuchen, denn Mantua ist »rote Zone«, hundertzwanzig Kilometer von Bergamo, dem Epizentrum, entfernt. Alles ist zu, verschlossen, abgeriegelt. Ich müsste heimlich über die Alpen, wie eine Partisanin. Aber ohne Hollywood-Musik. Das traue ich mir nicht zu.
Es ist April und die japanische Kirsche im Rondell vor meinem Haus blüht schöner denn je. Niemand sitzt unter den rosa Blüten, wie sonst jedes Jahr, überhaupt ist niemand auf der Straße, es ist gespenstisch still. Eine fette Ratte knabbert an einem achtlos hingeworfenen Sandwich. Oder ist es ein Kuchenstück? Aus dem vierten Stock ist es schwer auszumachen. Sicher ist, es ist eine echte vollgefressene Berliner Ratte.
»Casa di cura, Villa Paradiso. Sono Daniela«, höre ich es aus dem Apparat.
»Buongiorno Daniela. Sono Adriana, la nipote della signora Jelka Motta-Fuhrmann.«
»Ah sì, Adriana, die Nichte.«
Als ich die Tante noch im Pflegeheim besuchen durfte, habe ich Daniela kennengelernt. Sie ist groß, hat rot gefärbte Locken, liebt Süßigkeiten. Ihr Büro befindet sich am Eingang, sie geht aber regelmäßig bei Tante vorbei, denn die Teeküche ist neben Tantes Zimmer und Daniela hat immer Hunger. Ich brachte ihr und Tante Lübecker Marzipan, Stollen und Dominosteine mit, sie aßen gemeinsam ihre tägliche Portion. Meine Tante, die Hundebesitzerin, Daniela, die drei Katzen hat, der Gesprächsstoff ging ihnen nie aus.
»Wie geht es meiner Tante?«
»Sie ist wirklich ein Engel, unser Glücksbringer! Allerdings behauptet sie, wir hätten ihre Cashmere-Twinsets gestohlen, aber wir …«
»Keine Sorge, ich weiß, Daniela, Sie machen alles Menschenmögliche. Ich werde mit ihr sprechen, grazie per tutto.«
»Bene, ve la passo, salve.«
Daniela nimmt den tragbaren Hörer und ich höre sie rufen:
»Signora Fuhrmann, Signora Fuhrmann! Sua nipote! Hören Sie? Sua nipote!«
»Ah, grazie. Pronto, pronto?«
»Signora Fuhrmann! Sie müssen den Hörer andersherum halten! Signora Jelka Fuhrmann, cosí!«
Daniela schreit sich die Seele aus dem Leib, das kann ich deutlich durchs Telefon hören. Man muss sehr gute Nerven haben, möchte man es in der Geriatrie zu etwas bringen.
»Tantchen, Zia, ich bin es, wie geht es dir?«
»Na endlich. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wie soll es mir gehen? Ich lebe in einem Totenhaus. Stille und Leere überall. Unheimlich. Es soll ein Ende haben.«
»Was? Dein Leben?«
»Nein, Kindchen, nicht das Leben, ich lebe gern noch ein Weilchen.«
»Tante, du weißt, du wirst bald hundert Jahre alt.«
»Ja, verrückt, nicht? Wer hätte das gedacht, dass ich jemals so alt werde? Ich bin wirklich schon sehr … sehr alt.«
»Ja, das bist du. Du bist auch sehr schön, Tante.«
»Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun.«
»Ja, ich weiß. Aber bei dir stimmt es trotzdem.«
»Geht es dir gut? Geht es dir wirklich gut?«
»Ja.«
»Und den Kindern?«
»Auch gut. Alles in Ordnung.«
»Kommst du aus mit dem Geld? Es sind noch einige Rechnungen zu zahlen. Sie haben die Steuern auf eine unverschämte Weise erhöht. Der blanke Ruin. An der Regierung sind jetzt nur noch Verbrecher, oder?«
»Ich weiß nicht, Berlusconi war auch kein Held.«
»Oh doch. Aber davon willst du nichts verstehen. Wie deine Mutter.«
»Ich werde alle deine Rechnungen bezahlen, mach dir keine Sorgen.«
»Ums Geld mache ich mir keine Sorgen. I soldi ci saranno, ma noi non ci saremo più.«
Das Geld wird es geben, uns aber nicht mehr. Eine von Tantes Lieblingsweisheiten.
»Brauchst du etwas, Zietta?«
»Was soll ich hier brauchen?«
»Deine Shiseido-Creme vielleicht?«
»Ja, stimmt. Wenn du mir die kaufen könntest? Sie ist teuer.«
»Kein Problem. Mache ich gern. Sonst noch was?«
»Sie haben meinen Pullover gestohlen. Meinen besten, teuersten Pullover.«
»Ich weiß.«
»Woher weißt du?«
»Daniela und die Schwestern haben es mir erzählt, sie waren es nicht, sie haben schon die Polizei informiert.«
»So? Und du glaubst ihnen? Die Carabinieri werden nichts ausrichten.«
»Das mag sein. Aber es ist doch klug, dass sie sie eingeschaltet haben.«
»Ich weiß nicht. Ich bin froh, dass du angerufen hast. Ich habe mir schon Sorgen gemacht.«
»Musst du nicht. Beim letzten Telefonat hast du mich gar nicht gehört. Du hast immer wieder geschrien: ›Ich höre dich nicht!‹«
»Ja, das war lustig.«
»Auch wenn ich nicht anrufe, Tante, ich denke immer an dich und bin für dich da.«
»Aber das weiß ich doch, Liebchen. Das weiß ich doch. Ich auch für dich. Pass auf dich auf. Danke, dass du mich angerufen hast. Ich bin sehr erleichtert, dich zu hören. Ich mache mir immer Sorgen um dich.«
»Warum? Ich bin erwachsen. Lach nicht! Ich werde morgen sechzig, Zia!«
»Das war schön, als ich sechzig wurde. Ich war so jung. Du hast noch so viel vor dir.«
»Wenn du meinst. Aber hör auf, dir Sorgen zu machen, das nervt. Du machst dir Sorgen, wenn ich Fahrrad fahre, wenn es dunkel wird … Das ist absurd!«
»Sorgen machen ist normal. – Mach dir Sorgen, Gründe folgen! Jetzt höre ich dich nicht mehr. Hallo? HALLO? Ich lege jetzt auf …«
»Warte, Zia! Warte kurz!«
»Was gibt es noch?«
»Wollen wir morgen sprechen?«
»Schon wieder?«
»Ich habe Geburtstag, ich kann nicht kommen, aber wir können telefonieren!«
»Gut, meine Kleine …«
Als ich auflege, hat die Ratte das Sandwich aufgefressen und sich genüsslich in die Sonne gerollt.
Sie schieben mich zu dem großen Fenster. Ich kann den Park sehen. Die Bäume, sogar einen Zipfel des Sees. Die dünnen Pappeln bewegen sich aufgeregt im Wind. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Sehen tue ich schlecht. Viel schlechter, als ich zugebe. Die letzten Jahre habe ich auf Verdacht gekocht. Ich habe die Espresso-Maschine mit Kaffee gefüllt, das Streichholz ertastet, meine Hand kurz über die Flamme gehalten, dann wusste ich, sie ist an. Man hört, wenn der Kaffee fertig ist, und man riecht es. Es ist nichts Schlimmes passiert, also wozu die Aufregung? Es ist ein paar Jahre gut gegangen. Blinde leben doch auch hervorragend allein?!
Ich liebe die Natur, aber ich bin nicht gerne vor diesem Fenster. Die anderen Alten werden auch hergeschoben. Sie reden und reden. Ich verstehe sie nicht, aber ihr Murmeln ist störend. Manches höre ich, immer weniger eigentlich, und nur an manchen Tagen. Sie schauen mich an und es kommt mir vor, als ob sie schreien. Ich sehe in ihre zahnlosen Münder. Was wollen sie mir sagen und warum? Ich möchte meinen Gedanken nachhängen. Denn obwohl nichts passiert, den lieben langen Tag, werde ich nicht fertig mit dem Denken.
Ich denke nicht chronologisch. Sonst wäre es auch schrecklich langweilig. Alles passiert gleichzeitig in meinem Kopf. Was lange vorbei ist, was gestern war, was heute ist. Alles eins. Wie bei den Restaurants mit »internationaler Küche«. Es gibt Schnitzel dort und Tzatziki und Pizza. Alles durcheinander.
Ich denke an meine Nichte. Daran, wie wir beide im letzten Sommer im Gardasee schwammen. In unseren erlesenen Bademoden, versteht sich.
Ich habe dafür gesorgt, dass sie schon mit vier hervorragend schwimmen konnte. Ohne diese albernen Schwimmflügelchen. Manchmal ist sie untergegangen, aber nur ganz kurz, ich habe sie rasch hochgezogen, dann hat sie gehustet und ist weitergeschwommen. Schwimmen gehört zu den überlebenswichtigen Disziplinen. Ich liebe Wasser und das sollte sie auch. Letztes Jahr allerdings schwamm sie wie eine Wahnsinnige in die Mitte des Sees und ich war froh, dass sie an Land zurückgefunden hat. Sie haben hier eine Turnhalle im Untergeschoss, wo sie mit uns Alten Übungen machen. Unsinniges Strecken. Wenn es ein Schwimmbecken gäbe, wäre ich schon längst gesund, auf und davon.
Und dann fällt mir ein, wie ich Adriana gebadet habe, als sie klein war. Sie quietschte vor Vergnügen, die Hunde sprangen um die Wanne, bellten, wollten hinein, hielten es für ein Spiel. Alles war nass, das Bad, die Tiere und mein Kleid ebenfalls.
Meine Schwester sagte am Telefon, die Kleine solle bald nach Deutschland. Draußen lachten Kinder und die Rosen blühten. Es war Mai, kurz vor meinem vierundvierzigsten Geburtstag. Für eine Weile dachte ich, das sei ein Scherz. Aber meine Schwester Thea meinte es ernst. Ich solle im Sommer die Kleine nach Deutschland bringen.
Zwischendurch werde ich geduscht. Sie heben mich hoch wie ein Baby und setzen mich auf einen Stuhl unter die Dusche. Das Wasser ist lauwarm, hinterher fühle ich mich gut, aber währenddessen würde ich sie am liebsten kratzen. Sie waschen meine Haare und kämmen sie lange und gründlich. Von fremden Menschen gewaschen zu werden ist anstrengend. Scham macht müde.
So hatte ich mir meinen Geburtstag nicht vorgestellt. Er sollte ganz, ganz anders werden.
Ich hatte eine Riesenparty mit hundertfünfzig Gästen geplant. Meine Söhne hatten »Dragqueen« als Motto vorgeschlagen. Ich bin eigentlich kein Fan von Mottopartys. Prinzessinnen und Cowboys wie in der Grundschule? Aber dann gefiel mir die Idee doch: alle meine Freunde aufgehübscht bis zur Unkenntlichkeit. In Leder, Lack, Strass und langen falschen Wimpern. Die Einladung war cool, die Zusagen vielversprechend.
Meine To-do-Liste – ich liebe To-do-Listen – war herrlich lang. Crémant und Cocktails. Süßes und Salziges. Es würde Berge an Essen geben. Eine Jury für das beste Outfit wurde ausgelobt, Karaoke vorbereitet. Tanzen, trinken, kleine Häppchen, um weiter zu trinken und zu tanzen. Und ein bisschen falsch zu singen.
Und dann kam alles anders. Ich hielt die Gäste on hold und sagte schließlich die Feier ganz ab. Meine schöne To-do-Liste landete im Papierkorb, es war nicht die Zeit für minutiöses Planen. Man musste im Moment leben. Wer plante, wurde mit der Realität bestraft.
Ich würde einfach neunundfünfzig bleiben, bis ich das rauschende Fest würde nachholen können.
»Auguri tesoro! Bin ich die Erste?«
Das Handy rutscht mir fast aus der Hand, ich bin schlaftrunken, halb acht in der Früh.
Es ist Tantchen. Sie hat die ganze Station verrückt gemacht, sie wollte meinen Geburtstag auf keinen Fall vergessen.
»Meine besten Glückwünsche, Nanuschka, hundertzwanzig sollst du werden!«
»Danke, Tante! Ich bin ja schon sechzig. Nur noch sechzig Jahre und das Ziel ist erreicht. Mein Gott, bin ich alt! Sechzig, Zia, sechzig!«, wiederhole ich fassungslos.
»Sei ancora una fanciulla, questa è la faccenda«, antwortet charmant die Tante. »Du bist immer noch ein Mädchen. Meine Kleine, du bist jung und schön. Wie glücklich bin ich, dir gratulieren zu können. Jedes der sechzig Jahre mit dir war ein Gewinn, ich bin so stolz auf dich. Die ganze Station weiß, dass du Geburtstag hast. Seit sechs Uhr in der Früh!«
»Da haben sie sich bestimmt sehr gefreut. Hättest du dir jemals vorstellen können, dass ich sechzig werde?«
»Aber natürlich, warum denn nicht? Geht es dir gut? Du klingst wie ein verwirrtes Kind.«
»Nein, nein, alles gut. Ich fühle mich nur wie vierzehn und glaube, wie zwanzig auszusehen, aber ich fürchte, das kann so nicht stimmen. Weißt du, es ist schon komisch, alt zu werden …«
»Wem sagst du das?! Vergiss nicht: Buon sangue non mente.«
»Was? Ach ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder weinen soll. Wenn du hundert wirst, Tante, werde ich da sein. Versprochen!«
Aber da hat Tantchen schon aufgelegt. Buon sangue non mente – Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm …
Die Feier ist zwar ausgefallen, mein Geburtstag aber nicht. Kurz überlege ich, einfach vierundzwanzig Stunden durchzuschlafen. Stattdessen kaufe ich zwölf Flaschen Crémant und stelle sie kalt, man weiß ja nie.
Als Kind dachte ich, Menschen mit sechzig sind praktisch tot. Dement und säuerlich riechend.
Jetzt bin ich diese Sorte Lebewesen geworden. Quasi über Nacht. Was habe ich schon Großes erlebt? Im Vergleich zur Tante nichts. Gar nichts. Tantchen hat zwei Seuchen erlebt, die spanische Grippe und dieses Desaster jetzt. Einen Weltkrieg, die Shoa mitsamt KZ und eine norditalienische Schwiegermutter.
Ich bin Waldorfschülerin und wurde nur einmal beim Klauen im Marburger Kaufhaus Ahrens erwischt. Ich hatte einen Rotring-Stift gestohlen für meinen Freund Florian. Florian ist tatsächlich Künstler geworden, obgleich der Rotring schon nach einer Woche verklebte und kein bisschen Tinte mehr aus ihm herausfloss. Was für eine banale Vita habe ich vorzuweisen.
Alt werden ohne nennenswerten Lebenslauf und dann noch nicht einmal feiern können!
Mein Geburtstag ist vorbeigerauscht, unspektakulär und doch schöner als erwartet. Meine beiden Söhne haben sechzig Sushis ins Wohnzimmer balanciert, dabei verwegen gegrinst und den ersten Crémant geöffnet. Habe ich mich jemals über sie beschwert? Wie konnte ich nur? Ich kicherte, fühlte mich wie vierzehn und sah auf den Selfies von uns dreien aus wie zwanzig. Schönheit kommt eben wirklich von innen …
Im Stundentakt kamen Freunde vorbei, ich stieß mit ihnen gegen die lauernde Melancholie an, mit jedem einzeln zwar, aber dafür umso gründlicher. Ganz regelkonform, im Treppenhaus, auf dem Bürgersteig, im Park. Als die Sonne unterging, waren die zwölf Flaschen leer. Der Weltschmerz war geblieben. Ich war amtliche sechzig, die Lebensmitte war eindeutig überschritten, es galt nun, jede Bewegung zu überprüfen. Nur noch Sinnvolles wollte ich vollbringen. Nichts Überflüssiges mehr, die Zeit wurde knapp.
»Jetzt bitte kein Katzenjammer!«, sagte Tantchen am nächsten Morgen, als ich ihr meine hochtrabenden Pläne anvertraute. »Altro giro, altro regalo.« Nächste Runde, nächstes Geschenk, oder: Neues Jahr, neues Glück.
Tante ist eine Schatzkammer an Sprichwörtern.
Vom Balkon aus sehe ich den Bienen zu, sie arbeiten sich fleißig durch den Kirschbaum. Sie kennen keine Jahrestage oder Jubiläen, wetten? Kleine rosa Blüten fliegen an mir vorbei, als würde es schneien. Auf mich! Und die Bienen! Und auf Tante, die in sieben Wochen hundert Jahre alt wird, in diesem merkwürdigen, einsamen Jubiläumsjahr. Wozu braucht es überhaupt Jubiläen? Man schwelgt in Erinnerungen, früher war alles lustiger, wilder, sogar das Wetter war besser.
In diesem Zustand scheint mir Putzen das Sinnvollste. Die äußere Ordnung wird die innere nach sich ziehen.Ich widme mich dem Frühjahrsputz, als ginge es um mein Leben, finde Dinge, die ich sicher schon einmal weggeworfen habe. Oder doch nicht?
Meine Tante hat seit fünfundsiebzig Jahren nichts mehr weggeworfen. Sie hat alles aufbewahrt. Leere Cremedosen und alte Puppen. Twinsets und Castagnoli-Schuhe. Sie geht davon aus, dass ich alles übernehmen werde. Wer wegwirft, ist ein Faschist. So ihre Devise.
Wer wird nach mir aufräumen, wenn es mich nicht mehr gibt?
Meine Söhne sicher nicht. Sie sind vor ein paar Wochen ausgezogen. Erst der eine, dann der andere. Das gehört sich so. Haben alles dagelassen, was sie als Kinder gebastelt haben, zweimal je fünf Jahre Grundschule sind zehn Jahre Tonarbeiten, Bilder und mehr.
Dazu noch alles, was sie im Moment nicht mehr brauchen, aber nicht wegwerfen wollen. Achtzehn Bälle, geeignet für Hockey, Basket-, Volley- und Fußball. Zweiundzwanzig Trikots, von Pelé bis Maradona, von Zidane bis Messi und Ronaldo ist alles dabei.
Ich bin die Verwalterin ihrer Kindheit auf einhundertsechsundsechzig Quadratmetern.
Zwei Flüchtlingsfamilien könnten einziehen, sobald ich alles sauber habe.
Der Staubsauger ist entsetzlich laut, ein Playmobil-Männchen von 1997 hat sich verfangen, will weder vor noch zurück. Wenn ich den Staubsauger jetzt auseinanderschraube, bekomme ich ihn nie wieder zusammen. Ich bin sechzig, sitze auf dem Fußboden einer riesigen Altbauwohnung, allein mit einem alten Miele-Staubsauger, und kann die Tränen nicht aufhalten. Dabei sind sie doch unverwüstlich, diese Miele-Geräte, sagt die Werbung.
Mein Mann ist seit einem Jahr mein Ex-Mann und das hier ist kein Treatment zu einem Degeto-Film. Es ist die Realität, es ist mein Leben. Der Staubsauger und ich, wir sind wirklich nicht zu retten!
Er hat sich auf und davon gemacht und mich mitsamt Kinderspielzeug, Haushaltsgeräten und einem Phasenprüfer alleingelassen. Ich bin keine leidenschaftliche Köchin, verstehe nicht viel von Elektrizität und strebte einen gemeinsamen Lebensabend an, inmitten einer Schar von Enkelkindern.
Umringt von maroden Küchengeräten und kaputten Elektroteilen werde ich nun langsam alt. Beim Berliner Recyclinghof begrüßt man mich schon per Handschlag. Ich könnte vom Eiffelturm springen, aber Paris ist gesperrte Zone. Der Funkturm in Berlin ist sowieso näher. Allerdings erinnere ich mich dunkel, dass ein Fangnetz um die Spitze hängt. Nicht auszudenken: Man springt und zappelt stundenlang wie ein Fisch im Netz, halb Berlin kann hochschauen und sich mokieren: »Ist sie nicht schon zu alt für solche Kinkerlitzchen? Ein bisschen mehr Reife hätten wir ihr schon zugetraut.«
Ich muss weiterputzen, sonst wird das heute nichts mehr mit der guten Laune. Dabei habe ich eine Stauballergie.
Tante findet, es gebe keine zu großen Wohnungen, und allein sein sei herrlich. Sie wird mir zum tausendsten Male auf mein Lamento, ich sei so allein, antworten:
»Meglio soli, che mal accompagnati.«
Besser allein als in schlechter Gesellschaft. Wieder so eine Lebensweisheit.
Ich finde, das stimmt nicht. Es gibt schreckliche Gesellschaft, die sehr unterhaltsam sein kann.
Letzte Woche am Telefon habe ich Tante gefragt, ob sie noch leben möchte. Sie hat ganz klar geantwortet: Ja. Sie ist eine Greisin, sie lebt im Pflegeheim, sie hört wenig und sieht noch weniger, aber sie ist nicht lebensmüde. Ich bin lebensmüder als sie. Das ist doch irre.
Ich habe sie schon früher oft gefragt: Wie geht das, leben? Sie hat dann einen Moment nachgedacht, gelächelt und weise, wie sie ist, keine Antwort gegeben. Dabei hätte gerade sie wenig Grund zum Lächeln.
Was willst du noch, Tante? Das habe ich sie natürlich nicht gefragt. Aber das frage ich mich. Wartet sie noch auf etwas? Eine Entschuldigung? Eine Erklärung? Von wem?
Bis vor einem Jahr hat sie allein gelebt. Immer mit einem Hund. Die Hunde wurden mit der Zeit kleiner, sie auch. Sie trank ihren Cappuccino am Morgen, dann ging sie spazieren und freute sich des Lebens. Einfach so. Staunend sah ich bei meinen Besuchen ihrem ruhigen Treiben zu. Sie tastete sich in ihrer Wohnung fröhlich von Möbel zu Möbel, wie eine Schlafwandlerin. Ich hatte mich schon länger gefragt, wie gut sie überhaupt noch sehen konnte, und irgendwann eine Augen-OP für sie organisiert. Tante schwor danach, es sei viel, viel besser geworden, und rannte gegen den Esszimmertisch.
Es ist etwas Feines, nicht mehr so gut zu sehen. Man ist sicher auch viel schneller mit dem Putzen fertig. Im Nu wirkt alles sauber und die Wollmäuse können unter dem Bett gelassen ihre Partys weiterfeiern. Wahrscheinlich ist putzen überbewertet, ich sollte ins Bett gehen und auf die heilende Wirkung des Schlafes hoffen, zumindest was meine Laune betrifft.
Als ich Tantchen heute früh angerufen habe, hat sie gelächelt. Man kann es hören, das Lächeln, gerade am Telefon ist es gut hörbar. Sofort hat sie mich gefragt, warum ich so deprimiert sei. Die Berichterstattung über meinen Geburtstag fand sie schön, ich solle mich freuen. Das Leben sei herrlich, voller Überraschungen und ich sei ein Glückspilz. Da ich aus sicherer Quelle weiß, dass es den Begriff Pechpilz nicht gibt, habe ich ihr nicht widersprochen. Hätte ich aber gerne.
»Wir sind beide Glückspilze«, fügte sie hinzu. »Du noch mehr als ich.«
Was für ein Wettbewerb!
»Warum bist du so schwermütig, was ist los?«, insistierte sie.
»Ich weiß es nicht«, log ich. Mir war wirklich nicht danach, das vertraute Liebeskummer-Wehklagen anzustimmen.
»Es ist ja so, die guten Dinge gehen vorbei und die schlechten auch. Du wirst sehen, auf einmal ist der Kummer weg und das Blatt hat sich gewendet.«
»Ist das der Kalenderspruch von heute, Zietta?«
Wäre sie nicht meine geliebte Tante, hätte ich auf diesen plumpen Tagestipp gepfiffen. So ließ ich ihn zwei, drei Minuten auf mich wirken und schob ihn dann nachdenklich zur Seite.
Mir ist unglaublich langweilig. Das Zimmer ist von einem so blassen Gelb, dass man permanent gähnen möchte. Die Lampen sind altersschwach und auch von außen kommt zu wenig Licht herein. Adriana behauptete bei ihrem letzten Besuch, es sei in Wahrheit sehr hell, es läge an meinen Augen. Das ist natürlich Unsinn.
Ich bitte die Schwestern, das große Licht einzuschalten, stattdessen lüften sie. Diese Lüftungsmanie ist krankhaft, ich friere schrecklich, ich hasse Durchzug. Kaum sind sie aus dem Raum, rolle ich zum Fenster und schließe es wieder. Sie lachen, wenn sie mich dabei erwischen, ich bin die Älteste und ihr Glücksbringer, sagen sie.
Vor ein paar Wochen noch haben sie mich auf die Stirn geküsst, zur guten Nacht umarmt. Plötzlich hieß es, Berührungen seien verboten, das bringe Krankheit und Tod. Ohne einander zu berühren, sollen wir jetzt leben? Das wird zu nichts führen, so viel ist sicher.
Wenige Tage später liefen sie alle mit Masken herum, als müssten sie uns gleich operieren. Seitdem erkenne ich niemanden mehr. Sie verlangen von mir ebenfalls, so einen Lappen vor dem Mund zu halten, was nicht klappt. Das Ding rutscht ständig herunter, hängt mir am Ohr oder unter dem Kinn.
Nach dem Lüften mache ich Physiotherapie, ich ziehe die Therapeutin hinter mir her, so langsam läuft sie. Ich will wieder gut und schnell laufen können, dann gehe ich fort von hier, nach Hause, und hole mir einen neuen Hund. Die Therapeutin ist nach den Übungen erschöpft, setzt aber mich in den Rollstuhl.
Früher kam häufig Besuch. Wie lange ist das jetzt her?
Gino ist der Hauswart aus dem Gebäude, in dem meine Wohnung liegt. Eine Seele von Mensch, mit roten Wangen und immer fröhlich. Jeden Tag hat er einen Espresso bei mir getrunken. Seine Frau Marisa schaut nach der Post, solange ich hier bin. Sie weiß alles besser, aber sie hilft, wo sie kann. Als es noch ging, brachte sie mir Medizin und Schokolade. Aus der jüdischen Gemeinde kam Miriam. Dann wusste ich, wann die hohen Feiertage waren, wann ich fasten musste und wann das neue Jahr begann. Auch Dr. Norsa, unser Vorsitzender, schaute ab und zu herein. »Es ist eine schöne Mizwa für mich, nach Ihnen zu sehen«, sagte er jedes Mal. Mizwa, Schmizwa, er war froh, dass er nicht hier drinnen festsaß, so wie ich. Deshalb kam er. Auf dem Nachhauseweg dankte er Gott dafür und aß eine Sbrisolona in der Konditorei. Aber immerhin, es kam Besuch. Auch Adriana kam ab und zu, sie brachte die Schwestern zum Lachen und die Ärzte zur Verzweiflung.
Jetzt ist es öde und langweilig wie in einem Grab.
Eine Stimmung zum Weinen ist das. Nur der Tod wagt sich in meine Nähe. Er sitzt entspannt auf der Bettkante. Ab neunundneunzig Jahren kann man sich auf seinen unangemeldeten Besuch einstellen.
Ich kann nicht davonlaufen, ich bin hier eingeschlossen. Zu Hause wäre ich aufgestanden, hätte Staub gewischt oder irgendetwas gesucht. Ich suche seit Jahren Sachen. Ich suche einen Schlüssel, um einen Schrank zu öffnen, in dem sich mein Portemonnaie befindet. Nach Monaten taucht der Schlüssel auf, aber dafür ist das Portemonnaie weg.
Hier ist es aseptisch sauber und aufgeräumt, in meinem kleinen Metallschrank befindet sich nur noch der Bademantel, zwei T-Shirts liegen zusammengefaltet in der Schublade, der Rest wurde ohnehin gestohlen.
Mir wird viel gestohlen, schon seit Längerem. Trotzdem suche ich die Sachen. Vielleicht, weil alle sagen, dass sie nicht gestohlen sein können, dass ich es mir nur einbilde. Manchmal finde ich wirklich etwas wieder. Selten. Und immer das, was ich nicht gesucht habe.
Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich will nur nicht krank werden und ewig in dieser »Villa Paradiso« dahinsiechen. Was für ein romantischer Name. Die Villa liegt sogar an einem See. Aber die Seen um Mantua sind mickrig, Tümpel eher, und die Villa sieht von innen aus wie ein Krankenhaus. Die Romantik bleibt im Namen stecken.
Über meinen Sturz habe ich mich schrecklich geärgert. Ich war am Gardasee, ging mit Lilly, meinem Hund, spazieren, es war ein ausnehmend schöner Tag. Der See glitzerte in verschiedenen Blautönen, zum Weinen schön. Sie sagen, der Hund habe an der Leine gezogen, weil er mit einem anderen Hund toben wollte, ich sei zu schwach gewesen, ihn zu halten, und schließlich über die Leine gefallen. Es sei ein grober Fehler gewesen, mich mit einem Hund allein zu lassen. Das ist doch Unsinn! Mir war plötzlich schwindelig, nur deswegen bin ich gefallen. Der Hund spielte dabei überhaupt keine Rolle. Sie gönnen einer alten Dame ihren Liebling nicht. So ist das.
Ich hätte schon längst wieder zu Hause in Mantua sein sollen, wenn es nach Adriana ging, samt einer Rundum-Betreuung, aber ich wollte nicht weg vom See. Habe es Tag um Tag hinausgezögert. Bis ich gefallen bin. Adriana hat sich maßlos aufgeregt, sie sagt, ich sei furchtbar stur. Das sagt die Richtige.
Ich bin gefallen und der Oberschenkelhals war durch. Warum der nicht stabiler gebaut ist, frage ich mich. Unmengen alter Leute brechen sich genau den.
»Das ist der Anfang vom Ende«, sagte Dr. Norsa, unser Gemeindevorsitzender, der alles besser weiß. Anfang von welchem Ende? Von der Hölle? Das jetzt hier, dieses Eingesperrtsein, dieses Umeinander-Herumschleichen, ohne sich zu berühren, das ist der Anfang vom Ende. Dagegen wird die wirkliche Hölle, so es sie überhaupt gibt, ein Paradies sein. Die ersten Wochen waren besonders schlimm. Die OP war lang, die Schmerzen groß und in einem Rollstuhl zu sitzen ist nichts für mich. Inzwischen laufe ich manchmal wieder und möchte los, raus in die Welt. Adriana sagt, die Welt, die ich kannte, bevor ich gestürzt bin, gibt es nicht mehr. Was soll das denn heißen?
Er sitzt wieder da, auf der Bettkante. Mein Freund. Er lächelt still vor sich hin. Schlawiner. Ich fürchte mich nicht, du Beelzebub. Eines Tages werde ich einfach nur nicken. Und einschlafen. So wird das sein.
Den Krieg habe ich mir nicht ausgesucht, und genickt habe ich dazu schon mal gar nicht. Ich habe vier Jahre im Krieg zugebracht, wir haben alles verloren. Gehungert habe ich und mich nicht beruhigen können. Nach dem Krieg wurde es nicht wirklich besser, aber lebensmüde war ich nie. Solange man sich ein Leinenkleid kaufen kann, für das man lange gespart hat, ein paar sehr feine Schuhe von Castagnoli … Nichts können diese Sachen ungeschehen machen, aber sie können trösten und zeigen, dass man am Leben ist.
Gleich gibt es Mittagessen. Jeden Abend kommt eine Schwester und setzt sich zu mir. Sie liest mir den Speiseplan für den nächsten Tag vor, ich suche aus, was ich essen möchte. Es stehen zur Wahl: Minestrone, Pastina oder Pasta und dann Fleisch, Fisch oder nur Gemüse.