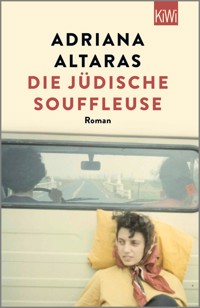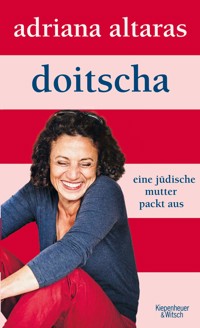9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Gegenwart ist nichts für Feiglinge Eine Ehekrise, die am gemeinsamen Bücherregal ausgetragen wird. Ein KZ-Gedenkstättenbesuch mit dem jüngsten Sohn. Eine Liebeserklärung an die jüdische Literatur und eine Kriegserklärung an die Angst. In ihren urkomischen und berührenden, ihren stets überraschenden und scharfsinnigen Geschichten vermisst Adriana Altaras unsere Gegenwart. Sie erzählt von Mut und Zivilcourage, vom Älterwerden und dem Umgang mit Erinnerung. Von Nachhilfestunden in türkischer Geschichte beim Fischhändler ihres Vertrauens und davon, warum sie nie bereuen wird, Kinder zu haben. Im familiären Alltag, in kurzen zwischenmenschlichen Begegnungen, im Film, der Literatur und dem Theater spürt sie in ihrem unvergleichlich charmanten und mitreißenden Ton den existenziellen Fragen nach, die uns alle angehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Adriana Altaras
Das Meer und ich waren im besten Alter
Geschichten aus meinem Alltag
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Adriana Altaras
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Adriana Altaras
Adriana Altaras wurde 1960 in Zagreb geboren, lebte ab 1964 in Italien, später in Deutschland. Sie studierte Schauspiel in Berlin und New York, spielte in Film- und Fernsehproduktionen und inszeniert seit den Neunzigerjahren an Schauspiel- und Opernhäusern. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Bundesfilmpreis, den Theaterpreis des Landes Nordrhein-Westfalen und den Silbernen Bären für schauspielerische Leistungen. 2012 erschien ihr Bestseller »Titos Brille«. 2014 folgte »Doitscha«, ihr hochgelobtes zweites Buch. Adriana Altaras lebt mit ihrer Familie in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
In ihren mitreißenden, charmanten Geschichten erzählt die Autorin der SPIEGEL-Bestseller »Titos Brille« und »Doitscha« von ihrer und unserer Gegenwart. Von Heimat und Fernweh, von Nachhilfestunden in türkischer Geschichte beim Fischhändler ihres Vertrauens und davon, warum sie nie bereuen wird, Kinder zu haben. Im familiären Alltag, in kurzen zwischenmenschlichen Begegnungen, im Film, der Literatur und dem Theater spürt sie in ihrem unvergleichlichen Ton den existenziellen Fragen nach, die uns alle angehen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Herbst
Septembermeer
Amour fou
Bühnenasyl
Angst
Schlaflosigkeit
Arabische Geschäfte
Deutschland fährt Rad
Hohe Feiertage
Winter
Hänsel und Gretel
Bücherregal
Berlin, meine große hässliche Geliebte
Parallelwelten
Mascha Kaléko
Dilemma
Mutprobe
Krisengebiet Weihnachten
Frühling
Luther und die Sauna
Im Jahr des Sports
Abenteuer Bibliothek
Die andere Seite der Medaille
Meeresoase
Zum Muttertag
Fernweh
Weimar
Sommer
Das Finanzamt und ich
Das grüne Leuchten
Unikate
Die Bluse
Das falsche Maß
Das Schweizer Kreuz
Provinz
Die Alten und die Jungen
Herbst
Dank
Nachweis der Veröffentlichungen
Nachweis der Zitate
Disclaimer
Für Billy
Herbst
Meine Liebe,
willst Du wirklich ein ganzes Jahr fortbleiben? Vielleicht löst sich währenddessen Europa auf? Wär’ doch schade drum!
Danke Dir für Deine Synagogenplatzkarte für die »Hohen Feiertage«. Es wird schrecklich öde ohne Dich, mit wem soll ich die Neuigkeiten aus dem Stetl durchhecheln?
Ansonsten gibt es nicht viel Neues, Stau in der Leipziger Straße, denn alle sind wieder zurück in der Stadt und müssen sofort in die Philharmonie oder ins Theater. Die Saison hat begonnen, die ersten hoffnungsvollen Premieren entpuppen sich als Flops, noch kein Skandal am Horizont, kommt schon noch, die Spielzeit ist ja noch jung.
Die Herbstmode sieht genauso aus wie letztes Jahr, die Stiefel kosten 600 Euro, die Sohle scheint aus Gold zu sein, ich lasse meine Absätze neu machen, muss reichen.
Es regnet seit Tagen.
Wir wollen in den Herbstferien noch rasch ans Meer, die lieben Gören haben ein schrecklich langes Schuljahr vor sich, und mir graust es vor dem Berliner Wetter.
Habe mir einen tragbaren Kamin gekauft, der mit einer gefährlichen Flüssigkeit betrieben wird, nicht wärmt, aber echtes Feuer hat. Habe ihn »Ahasver« genannt, der ewige Wanderkamin.
Als ich es mir gestern bequem machte und mehr auf die Flammen schaute als auf den »Tatort«, kam Sammy hereingestürmt, »Schalt um!«, brüllte er. »Es geht wieder los.«
Die Nacht haben wir vor dem Fernseher verbracht. Ich weiß, dass dies nicht die ersten und nicht die letzten Toten sind, aber ich weiß auch, dass diese Attentate Europa verändern werden. Jetzt ist es hier wie bei Euch.
Septembermeer
»Un mare settembrino«, sagte die Frau, die neben mir ins Wasser stieg. Septembermeer. Was für ein anmutiger Begriff. Ich war mir gar nicht sicher, ob die junge Frau es positiv gemeint hatte, un mare settembrino, ich jedenfalls solidarisierte mich gleich mit dem Gewässer, das im dritten Quartal seines jährlichen Daseins sanfte Wellen schlug. Der heiße August war gerade vorbei und die Oktoberstürme ließen noch auf sich warten.
Drittes Quartal, normalerweise ein Ausdruck, von dem ich mich entschieden distanziere, vom Finanzamt missbraucht, durch drohende Steuerzahlungen angstbesetzt. Hier, mit den Füßen im Sand, wurde mir klar, dass auch ich dem dritten Quartal entgegensteuerte, wenn nicht schon mittenmang war. Na und? Das Meer und ich waren im besten Alter. Weise, dabei herrlich entspannt. Oder, was meinst du, mare adriatico? Wie alt würde ich werden? Achtzig? Sechsundneunzig wie meine Tante, die sich immer noch bester Gesundheit erfreute?
Auf jeden Fall war ich eindeutig über die Mitte hinweg, falls ich nicht doch ein biblisches Alter erreichte, aber ehrlich gesagt: Wer will das schon? Wie Sarah und Abraham mit über hundert noch Kinder bekommen?
Das Meer liegt friedlich vor mir, ahnt nichts von meinen tiefgreifenden Überlegungen, ist herrlich türkis und warm. Perfekt eigentlich. Was man von mir so nicht behaupten kann. Ich bin zwar sportlich, doch drei Kilo zu viel sind drei Kilo zu viel. Täglich trage ich kleine Kämpfe mit meiner Waage aus, drehe am Zeiger, vielleicht ist sie doch zu alt und ungenau, aber irgendwie arrangieren wir uns immer.
Wie wird man am besten alt? Mir kommt es so vor, als ob in Berlin eine Weile lang alle gleich alt, also extrem jugendlich sind, mit Rucksäcken, Bärten und feschen Klamotten. Einige Jahrzehnte lang sogar, und dann, ganz plötzlich, eines Morgens, sind sie steinalt.
»In Würde altern!« heißt es in Broschüren, die einem Versicherungen für einzelne Körperteile anraten oder die Reklame machen für Seniorenresidenzen am Stadtrand. Ich habe aber diesen Slogan auch schon bei Burberry gesehen, oder war es Benetton? Bitte schön, was heißt das denn: »In Würde altern«? Heißt das, es ist peinlich, wenn ich im Wilmersdorfer Stadtbad vom Zehner springe? Oder mich in einen jüngeren Mann verliebe? Oder muss ich ab fünfundfünfzig Mausgrau und Beige tragen? »Das eigene Alter akzeptieren« steht kleingedruckt drunter. Aber auch das verstehe ich nicht.
Was ich allerdings sofort begreife: dass ich in der Kunst aufpassen muss. Ja, ich will weder ein grauhaariges Fräuleinwunder werden noch geriatrisches Theater mit schlüpfrigen Witzen und minderjährigen Hauptdarstellerinnen machen.
Aber wen bitte ich, mich zu kontrollieren? Meine Kollegen sind genauso alt wie ich, bis ich ihnen erklärt habe, was ich meine, sind wir alle tot. Meine Kinder finden mich seit ihrem zwölften Lebensjahr peinlich, die fallen als Berater ebenfalls aus.
Und auf mein innerstes Ich zu hören, halte ich für gefährlich. Was weiß das Innerste, was ich nicht wüsste?
Das Meer zeigt sich von seiner besten Seite. Ich spiele toter Mann, für die Genderbeauftragten tote Frau, und lasse mich treiben und treiben. Wenn toter Mann sein so schön ist, warum nicht gleich hier und jetzt?
Als ich mich im zweiten Quartal befand, gehörte ich einer freien Theatergruppe an, die sich rühmte, immer aktuell, auf der Höhe der Zeit zu sein. Wir waren ein Kollektiv, das alles gemeinsam diskutierte, und wenn am Ende nicht alle zerstritten waren, gab es witzige Theaterabende, zeitgemäß und sogar ziemlich avantgardistisch. Das Kollektiv war nervig, manchmal dauerte es drei Monate, bis wir uns auf ein neues Thema einigen konnten, aber gleichzeitig war es eine Art Kontrollinstanz, ein Korrektiv.
Auf die Kritiker zu hören, halte ich auch nicht für die letzte Weisheit, sie sind launisch wie ich selbst und auch nicht mehr die Jüngsten …
Ach, es ist ein Kreuz. Besser weiterplanschen, auf den kleinen Wellen schaukeln, obwohl mir langsam Schwimmhäute wachsen.
Wenn ich meine Tante anschaue, bekomme ich Herzflattern. Sie hört fast nichts mehr (was nur sie genießt), hat alle überlebt, vor allem ihren Mann (was ihr die größte Freude bereitet), fährt immer noch Auto, wenn’s sein muss, auch ohne Brille, obwohl sie schon mit Brille wenig sieht, und hangelt sich von einem Monat zum nächsten. Sie überquert die Straßen wie ein somnambuler Tänzer. Die meisten Autos haben gute Bremsen. Und den Dreck im Zimmer sieht sie nicht mehr, eine echte Entlastung. Man könnte auch von sanfter Verwahrlosung sprechen. Für sie selbst scheint die Welt so in Ordnung. Wäre sie das auch für mich? Ich glaube, das möchte ich nicht testen.
Ich finde, Greise wirken am schönsten im Märchen, dort sind sie weise und gut, bekleckern sich nicht mit Soße und haben von Alzheimer noch nie gehört.
Ich habe mir, sollte Plan A: »der Tod erwischt mich urplötzlich auf der Probe – zack! – und es ist vorbei«, nicht funktionieren, folgenden Plan B überlegt: Tabletten.
Ich stehle ab jetzt meinen jüdischen Freunden, sooft ich die Gelegenheit habe, eine Schlaftablette. Oder auch mehrere. Sie nehmen alle Schlaftabletten, schon bald müsste ich eine ordentliche Menge zusammenhaben. Mein Mann will mir nicht glauben, er meint, so viel, wie ich darüber redete, würde ich es eh nicht machen.
Man muss natürlich enorm aufpassen, denn sollte die Demenz gewinnen, vergisst man vielleicht noch, dass man am Leben ist …
Sobald ich peinlich werde in Kleidung, Haltung und Kunstanspruch, schlucke ich das Zeug, und aus die Maus. Ob ich gerade dann hemmungslos am Leben hängen werde? Na, mal sehen. Ich weiß, dass die Religionen so etwas nicht mögen, aber die mögen auch keine Kondome, Homosexuelle und Miniröcke.
Alternativ könnte ich mir die Provence vorstellen, dort gibt es, vor allem im September, ein herrliches Meer. In Griechenland und Süditalien auch. Es geht nichts über ein Septembermeer, mare settembrino. So ein Meer, würd’ ich mal sagen, toppt vorerst eine gute Dosis Schlaftabletten.
Amour fou
Mein Mann Georg teilt meine Liebe zum französischen Film nur bedingt. Er liebt zwar den »Film noir« mit Jean Gabin als Kommissar, Lino Ventura und Alain Delon als Ganoven, die einander mal in alten Lieferwagen, dann wieder in feinen schwarzen Citroëns quer durch Paris verfolgen, Einbrecher und sympathische Verlierer.
Wenn es aber um Truffaut oder Godard geht, wird er unwillig, spüre ich Widerstand.
Ich sage: »Georg, liebst du mich?« Er denkt nach. Ich sage: »Georg, bitte jetzt nicht denken, einfach sagen, ja, Liebling, ich liebe dich.« Er wird einsilbig.
Ich sage: »Das ist wie in französischen Filmen, da wird stundenlang über die Liebe geredet. Das macht Spaß, das ist ein Spiel, ein Vergnügen, verstehst du?« Er schweigt nun endgültig und verlässt das Zimmer. Ich glaube, er begreift mich nicht.
Dabei gibt es doch kaum etwas Schöneres im Leben, als folgenden Dialog zu führen:
Liebst du mich? – Ja, Liebling. – Mehr als früher? – Natürlich. – Wann ist für dich früher? – Vor Jahren und gestern. – Findest du mich auch noch genauso attraktiv? – Eigentlich noch mehr. – Du lügst. Magst du meine Beine? – Ja, mag ich. – Meine Hände? – Ja, die auch. – Meine Brüste? – Aber ja, die ganz besonders. – Mehr als meine Beine und meine Hände? – Das ist schwer zu sagen. – Versuch’s.
So könnte es ewig weitergehen, ich wäre glücklich.
Aber leider denkt Georg immer nach. Er wolle keine billige Antwort geben, sagt er, nicht wie auf Stichwort reagieren, nein, er prüft seine Gefühle, seine Aussagen, forscht permanent nach deren momentanem Wahrheitsgehalt. Unvorstellbar für mich. Was für eine unnötige Mühe!
Moment mal: Heißt das, wenn er schweigt, liebt er mich nicht mehr? Oder nur noch ein bisschen? Nicht genug? Ist sich seines Gefühls nicht mehr sicher?
Ein knappes »Ja«, die Sache wäre vom Tisch, und jeder könnte zufrieden seiner Arbeit nachgehen.
Ich hätte es schon früher wissen können. Schon bald nachdem wir uns kennengelernt hatten, fragte ich ihn: »Wie viele Frauen hattest du vor mir?«
Auch da hätte mir eine Standardantwort gereicht, etwas in der Art wie: »zwei« (aber Vorsicht: bitte nur bis höchstens fünfzehn!), »doch das war etwas ganz anderes, ist sehr lange her, und keine habe ich so geliebt wie dich!«
Georg jedoch schaute mich ernst an, setzte sich in den Ohrensessel – was ich an sich schon unpassend fand, so patenonkelig –, setzte sich also in diesen Riesensessel und begann zu schreiben. Er hatte sich ein kleines Notizheft genommen, Hausschuhe angezogen und vertiefte sich in die Arbeit.
Nach wenigen Minuten wurde ich nervös. »Was wird das denn?«, fragte ich betont locker.
»Ich schreibe meine Frauen auf.«
»Alle?«
»Ja, alle, an die ich mich erinnere.«
Lange Zeit später saß er immer noch konzentriert im Sessel und führte Buch über sein Liebesleben. Ich fand es nicht mehr komisch.
Nicht, dass mich die Menge allein verunsicherte, ja, schon auch – aber mehr noch die Genauigkeit, mit der hier katalogisiert wurde. Name, Nachname, Ort der Begegnung, Kosenamen, was weiß ich, was da alles zu Papier gebracht wurde.
Ich ging auf und ab, im Zimmer, in der ganzen Wohnung, so genau wollte ich es wirklich nicht wissen.
Als er sich erhob, um sich einen Tee zu machen, spickte ich hastig in die ersten Seiten: »Nora K., 22, mein Nordisches Pferd.«
Halleluja.
Hätte ich nur nicht gefragt! Hätte ich doch nicht in das Buch geschaut. Meine Fantasie galoppierte davon …
»Sascha M., Kommilitonin aus der Anti-AKW-Gruppe, wohnte in Dreier-WG.«
Das hieß bestimmt Gruppensex, was denn sonst?
»Auf Tournee, Würzburg, Übernachtung gespart.«
Wie lange war Georgs Theatertruppe damals auf Tournee gewesen?
Schnell legte ich das Buch zurück, Georg kam wieder, vertiefte sich weiter in seine Aufzeichnungen.
Nicht dass ich ein Kind von Traurigkeit gewesen wäre. Ich war ein halbes Jahr in New York, lange bevor Aids ein Thema war, es wurde Winter, ich war neunzehn. Aber Georg hatte mich ja nicht gefragt. Und ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mich an mehr als fünf Namen erinnert hätte, von Nachnamen ganz zu schweigen.
Georg hatte bis dato auf mich nicht den Eindruck eines Sexmaniacs gemacht. Im Gegenteil: Er hatte scheu gewirkt, als wir uns kennenlernten, fast verklemmt. Und dass wir überhaupt zusammengekommen waren, hatte eindeutig an meiner Initiative gelegen.
So konnte man sich täuschen.
Als der Abend dämmerte, und er immer noch schrieb, fing ich an zu weinen. Ich hatte ein französisches Spiel mit meinem deutschen Mann spielen wollen, aber es hatte nicht funktioniert. Ich zog die Nase hoch, sagte mit zitternder Stimme: »Okay, lass uns einen Plan machen und sie der Reihe nach besuchen, ich möchte sie alle kennenlernen …«
Georg schaute kreidebleich auf, umarmte mich kurz und legte dann stumm das Heft beiseite.
Ich habe ihn nie wieder danach gefragt.
Das Bild des Nordischen Pferdes allerdings werde ich nicht los, und bei harten Streitereien greife ich darauf zurück: »Geh doch zu deiner Nora, dieser Frigga, zu deinem arktischen Gaul …«
Was die französischen Filme angeht, wird es besser, geradezu täglich.
»Liebst du mich?«, habe ich ihn neulich wieder gefragt. Und er hat gelächelt und mich geküsst. Immerhin.
Bühnenasyl
Als meine Familie Kroatien verlassen musste, hieß es noch Jugoslawien, und Marschall Tito war ein mächtiger Mann. Er starb 1980, da lebten wir schon lange in Deutschland. Sein Staatsbegräbnis war imposant und von allgemeiner Trauer geprägt. Doch schon bald begannen Unruhen, und wenig später hatten wir in Europa einen Bruderkrieg.
Meine Eltern verfolgten Tag und Nacht die Nachrichten. Meine Mutter ergriff Partei für die Serben, mein Vater für die Kroaten, meine Tante sagte, sie hasse die Kommunisten noch mehr als die Faschisten. Alle stritten sich, hüben wie drüben.
Als ich ein paar Jahre später in die alte Heimat fuhr, hatte sich einiges verändert. In Sarajevo gab es mehr Friedhöfe als Kirchen und Moscheen, in Zagreb sprangen Nationalisten aus dem Wagen, wenn vor ihnen ein Pkw mit serbischem Nummernschild fuhr, und bei Fußballspielen kam es zu brutalen Schlägereien.
Ich hatte den Eindruck, der Krieg habe die Lage bloß verschlimmert – aber das ist keine ganz neue Weisheit.
Im Theater erzähle ich selten, dass ich vom Balkan komme, zu kompliziert liegen die Dinge, um sie bei einem Latte macchiato zu erörtern. Außerdem treffen im deutschen Musiktheater derart viele Nationalitäten aufeinander, dass es müßig wäre, mit seiner speziellen Herkunft zu prahlen. Was sollen die bedauernswerten Tenöre sagen? Sie kommen aus dem fernen Korea angereist, um als Almaviva bei Rossini oder als Belmonte bei Mozart so zu tun, als wären sie waschechte Europäer.
In den letzten zwei Jahren allerdings sind mir bei meinen Operninszenierungen drei starke Frauen begegnet, als Darstellerinnen von Tosca, Carmen und Traviata, alle drei von erstaunlicher Begabung, aber vor allem mit extremem Ausdruckswillen und Freiheitsdrang. Erst nach und nach ging mir auf, dass alle drei Frauen vom Balkan kamen.
Tosca ist eine eifersüchtige Frau, eine extrem eifersüchtige Frau. Mir ist das nicht fremd, im Gegenteil. Obwohl ich natürlich – wie vermutlich auch Tosca – weiß, wie dumm, unnötig, ja geradezu gefährlich Eifersucht ist.
Also: Tosca ist eine berühmte Opernsängerin in Rom, und sie hat einen Geliebten, den Maler Cavaradossi. Ab und zu treffen sie sich heimlich zum Tête-à-Tête und mehr in seinem Landhäuschen, meistens scheint der Mond dazu, so jedenfalls singen sie. Sie sind ein glückliches, sehr verliebtes Paar, außer ihren Eifersuchtsszenen gibt es wenig zu bemängeln.
Dann wird Cavaradossi von der Polizei festgenommen. Man vermutet zu Recht, er helfe den Revolutionären. Auch unter Folter sagt er nicht aus. Der Polizeipräsident Scarpia, ein schlauer und bösartiger Jagdhund, wird sich Toscas Eifersucht zunutze machen, um das Versteck des revolutionären Anführers Angelotti zu finden.
Miri kommt aus Albanien und sieht ein bisschen aus wie die Callas, ein bisschen wie die Loren, dabei hat sie das Lachen einer Straßengöre. Sie ist mir sofort sympathisch, auch für sie sind Berührungsängste ein Fremdwort. In meiner Küche erklärt sie mir, was ich zu tun oder zu lassen habe, wir kennen uns gerade fünf Stunden.
Als Miri acht Jahre alt ist, sterben ihre Eltern in einem Feuer. Ein Brandanschlag der Miliz. Sie wird von der Familie des Onkels aufgenommen, der in die USA emigriert, als das Mädchen keine vierzehn ist. Mit sechzehn geht sie alleine zurück nach Europa, denn sie will Sängerin werden.
Sie schlägt sich durch. Meistens als Servier- oder Zimmermädchen, in Österreich hat man sich an Personal vom Balkan gewöhnt. So finanziert sie sich das Gesangsstudium, keine Zeit, um zimperlich oder zickig zu sein. Von Wettbewerb zu Wettbewerb, sie singt in Graz und Wien, Ljubljana und Zagreb. Ab und an singt sie eine Gala in ihrer Heimatstadt, dort feiert man sie wie einen Weltstar.
Miri ist die Tosca in meiner Inszenierung zur Spielzeiteröffnung. Sie braucht keine ausgefeilten Regieanweisungen. Ich sage das Wort »Polizeipräsident«, und sie spielt den Akt durch. Zwischen den musikalischen Phrasen erkenne ich die Wut über den Schmerz, den man ihr als Kind zugefügt hat, die Demütigung, sich nicht wehren zu können. Jetzt hat sie auf der Bühne die Chance auf Freiheit, sie nimmt das Obstmesser und sticht Scarpia, den verhassten Polizeipräsidenten von Rom, nieder. »Muori dannato, muori, muori!«, Stirb, stirb … sie kann es nicht oft genug singen. Dann springt sie, bevor man sie festnehmen kann, in den Tod.
Alma spielt die Carmen. Das ist seit Langem ihr Wunsch, endlich ist es so weit.
Alma stammt aus einem kleinen Städtchen an der Grenze – die Mutter Kroatin, der Vater Muslim, beide mit jüdischen Vorfahren. An einem Morgen sind die serbischen Nachbarn plötzlich in Uniform. Alma ist in diesem Moment noch klein, sie klettert auf einen Stuhl und sieht Männer durch den Garten robben. So lustig es in diesem Moment auch aussieht, es markiert den Anfang vom Ende. Es ist Krieg. In diesem Krieg spielen das Muslimische und das Katholische plötzlich eine große Rolle. Der Vater kommt in Haft, wird gefoltert, die Familie beantragt Asyl und landet in Gelsenkirchen.
Alma darf Nordrhein-Westfalen nicht verlassen. Wenn sie Ferien macht, dann nur mit der Kirchenfreizeit, dort kann sie sich frei bewegen, nur unter dem Deckmantel der Kirche darf sie Deutschland verlassen.
Alma ist groß, hat lange dunkle Haare und grüne Augen. Sie redet nicht viel, und wenn, klingt ihre Stimme ernst und der Tonfall nach Ruhrpott.
Carmen lacht den Soldaten Don José aus, der möchte nämlich, dass Carmen nur ihm gehört, nur für ihn da ist. Selbiges möchte der stolze Torero Escamillo. »Wer mich liebt, der kommt zu mir!«, schmettert er.
Almas Augen werden zu schmalen Schlitzen, wenn man sie einengen möchte. »Selbstbestimmung«, sage ich, »das ist es, was Carmen will.« Und Alma singt Arie um Arie vom Leben im Krieg und der Freiheit jetzt.
Lilly möchte in Berlin russisch-orthodox heiraten. Das war ihr nämlich untersagt, sie wuchs auf der falschen Seite der Grenze auf. Sie wollte trotzdem nicht weg, man schob sie ab ins Auffanglager Gießen. Jedes Mal, wenn sie als Traviata »Addio del passato« singt, legt sie ihre Geschichte in diese Verdi-Arie.
Schauspieler und Sänger arbeiten immer mit ihren Erfahrungen, ihren Emotionen. Es klingt vielleicht zynisch, aber der Balkankrieg hat meinen drei Hauptdarstellerinnen eine sehr spezielle »Ausbildung« verpasst. Sie verfügen über eine schmerzhafte Vergangenheit, über Erfahrungen, die sie sich zwar nicht ausgesucht haben, die in ihrem Theaterberuf nun jedoch Reichtum bedeuten. Und für jede der drei Sängerinnen ist ihr Beruf die Rettung. Nicht nur Deutschland, auch die Bühne hat ihnen Asyl geboten. Sie sind nicht mehr wehrlos gegenüber einer kriegerischen, männlichen Macht, familiären oder politischen Besitzansprüchen ausgeliefert oder Opfer religiöser Grabenkämpfe.
Die Kunst gibt ihnen Freiheit – und ihr südländisches Temperament sorgt für den Rest. Die deutsche Opernlandschaft profitiert von Sängerinnen, die viel mehr besingen als nur die Liebe.
Ich stelle mir vor, alle Sänger vom Balkan müssten Deutschland verlassen, denn sie sind ja genau genommen nur Wirtschaftsflüchtlinge. Vielleicht müssten die deutschen Opernhäuser nicht gleich schließen, vielleicht könnten sie mit deutschen und koreanischen Sängern ihren Spielplan aufrechterhalten. Aber es wäre öde, und mir würden die Geschichten von Miri, Alma und Lilly fehlen, die durch Tosca, Carmen und Traviata hindurchschimmern. Und ja, ich bin sicher, dass Verdi, Bizet und Puccini genau solche Frauen meinten, oder Jungs?
Angst
»Hast du Angst?«, hat man mich in letzter Zeit häufig gefragt. »Hast du jetzt mehr Angst als früher? Versteckst du dich? Bleibst du zu Hause? Holst du deine Kinder immer und überall ab?« Ich habe trotzig geantwortet: »Nein! Ich habe keine Angst. Und du? Ich habe erst Angst, wenn du keine hast!«
Das war zu spitzfindig, mein Gegenüber kräuselte die Stirn, dachte nach, derweil bin ich schon mal zum Büfett. Vielleicht hätte ich antworten sollen: »Ich will keine Angst haben.« Und schon gar nicht, weil ich Jüdin bin. Ich will nicht, denn Angst essen Seele auf, das hat schon der olle Fassbinder gewusst.
Ganz ehrlich, ganz im Vertrauen, ganz unter uns: Natürlich habe ich Angst. Aber jeder vernünftige Mensch hat jetzt Angst, ob Jude, Nichtjude oder Atheist.
Wenn ein paar brutale, durchgeknallte orthodoxe Terroristen sich und andere in die Luft sprengen, ist das zum Fürchten. Und es wird täglich schlimmer, und es kommt täglich näher.
Paris, Brüssel, Kopenhagen, Istanbul, Nizza, aber auch Sousse, alles nur ein Katzensprung von Berlin. Der IS ist kosmopolitisch. International besetzt mit Engländern, Franzosen und Deutschen. Das ist das fürchterlich Neue an ihm: Er ist überall und nicht zu erkennen.
Ich habe schreckliche, vollständig bebilderte Zukunftsvisionen, und da ist Angst noch das harmloseste Gefühl. Aber ich will nicht. Ich will mich nicht fürchten müssen. Und ich will mich nicht kleinmachen. Denn so wollen sie mich haben: klein, vor Angst erstarrt, totgestellt wie ein Tier in der Hoffnung, nicht gesehen zu werden. Also schlage ich die überaus freundliche Einladung Netanjahus nach Israel aus, man muss wahrlich nicht jede Einladung annehmen, vor allem nicht von einem so windigen Typen, der bis zum Hals im politischen Morast steht.