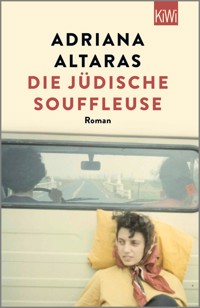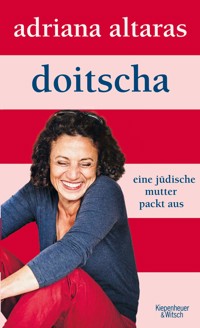10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die außergewöhnliche Familiengeschichte der Schauspielerin und Regisseurin Adriana Altaras – eine humorvolle und einfühlsame Verwebung von Vergangenheit und Gegenwart. Adriana Altaras führt ein ganz normales chaotisches und unorthodoxes Leben in Berlin. Mit zwei fußballbegeisterten Söhnen, einem westfälischen Ehemann, der ihre jüdischen Neurosen stoisch erträgt, und mit einem ewig nörgelnden, stets liebeskranken Freund, der alle paar Monate verkündet, endlich auswandern zu wollen. Alles bestens also... bis ihre Eltern sterben und sie eine Wohnung erbt, die seit 40 Jahren nicht mehr ausgemistet wurde. Fassungslos kämpft sich die Erzählerin durch kuriose Hinterlassenschaften, bewegende Briefe und uralte Fotos. Dabei kommen nicht nur turbulente Familiengeheimnisse ans Tageslicht. Auch die Toten reden von nun an mit und erzählen ihre eigenen Geschichten... Mit furiosem Witz und großer Wärme verwebt Adriana Altaras Gegenwart und Vergangenheit. In eindringlichen Episoden erzählt sie von ungleichen Schwestern, von einem Vater, der immer ein Held sein wollte, und von einer Mutter voller Energie und Einsamkeit. Vom Exil, von irrwitzigen jüdischen Festen, von einem geplatzten italienischen Esel und einer Stauballergie, die ihr das deutsche Fernsehen einbrockte – und von den vielen faszinierenden Mosaiksteinen, aus denen sich ein Leben zusammensetzt. Eine außergewöhnliche Familiengeschichte, die ihre Spuren quer durch Europa und das bewegte 20. Jahrhundert zieht – um wieder in der Gegenwart anzukommen und eine ebenso kluge wie hellsichtige Zeitdiagnose zu liefern. Unwiderstehlich witzig, anrührend und unvergesslich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Adriana Altaras
Titos Brille
Die Geschichte meiner strapaziösen Familie
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Adriana Altaras
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Adriana Altaras
Adriana Altaras wurde 1960 in Zagreb geboren, lebte ab 1964 in Italien, später in Deutschland. Sie studierte Schauspiel in Berlin und New York, spielte in Film- und Fernsehproduktionen und inszeniert seit den Neunzigerjahren an Schauspiel- und Opernhäusern. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Bundesfilmpreis, den Theaterpreis des Landes Nordrhein-Westfalen und den Silbernen Bären für schauspielerische Leistungen. 2012 erschien ihr Bestseller »Titos Brille«. 2014 folgte »Doitscha – Eine jüdische Mutter packt aus«, 2017 »Das Meer und ich waren im besten Alter«. Adriana Altaras lebt mit ihrer Familie in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die außergewöhnliche Familiengeschichte der Schauspielerin und Regisseurin Adriana Altaras – eine humorvolle und einfühlsame Verwebung von Vergangenheit und Gegenwart.
Adriana Altaras führt ein ganz normales chaotisches und unorthodoxes Leben in Berlin. Mit zwei fußballbegeisterten Söhnen, einem westfälischen Ehemann, der ihre jüdischen Neurosen stoisch erträgt, und mit einem ewig nörgelnden, stets liebeskranken Freund, der alle paar Monate verkündet, endlich auswandern zu wollen.
Alles bestens also … bis ihre Eltern sterben und sie eine Wohnung erbt, die seit 40 Jahren nicht mehr ausgemistet wurde. Fassungslos kämpft sich die Erzählerin durch kuriose Hinterlassenschaften, bewegende Briefe und uralte Fotos. Dabei kommen nicht nur turbulente Familiengeheimnisse ans Tageslicht. Auch die Toten reden von nun an mit und erzählen ihre eigenen Geschichten …
Mit furiosem Witz und großer Wärme verwebt Adriana Altaras Gegenwart und Vergangenheit. In eindringlichen Episoden erzählt sie von ungleichen Schwestern, von einem Vater, der immer ein Held sein wollte, und von einer Mutter voller Energie und Einsamkeit. Vom Exil, von irrwitzigen jüdischen Festen, von einem geplatzten italienischen Esel und einer Stauballergie, die ihr das deutsche Fernsehen einbrockte – und von den vielen faszinierenden Mosaiksteinen, aus denen sich ein Leben zusammensetzt.
Eine außergewöhnliche Familiengeschichte, die ihre Spuren quer durch Europa und das bewegte 20. Jahrhundert zieht – um wieder in der Gegenwart anzukommen und eine ebenso kluge wie hellsichtige Zeitdiagnose zu liefern. Unwiderstehlich witzig, anrührend und unvergesslich.
Inhaltsverzeichnis
disclaimer
prolog
mein vater, der held
der rabbi in der aldi-tüte
raffi
das jüdische massaker
die bestickte bluse aus bjelovar
trauer to go
»wer wegwirft, ist ein faschist«
heimweh
teta jele
der kroatische saftladen
der kotzbrocken
aktenberge
die macht der gewohnheit
ein satz in südafrika
milch und honig
panzerglas
happy new world
auf der suche nach dem afikoman
bar jeder mizwa
gießen an einem sonntag
epilog
danke, danke!
Zum Schutz von Personen wurden Namen und Orte zum Teil verändert und Handlungen, Ereignisse und Situationen an manchen Stellen modifiziert.
prolog
Meistens bin ich unbekümmert. Das ist auch besser so. Ich radele am Tiergarten vorbei und pfeife ein Ständchen auf Berlin, das sich an manchen Tagen wirklich gut macht.
Die Buchläden sind überfüllt mit jüdisch-deutscher Literatur. Historiker streiten, Gegner und Befürworter jeder These haben sich verausgabt. Volkshochschulen und Mahnmale erledigen den Rest. Ich brauche mich um nichts zu kümmern. Die Zeit wird die restlichen Wunden heilen.
Doch dann mache ich an diesem sonnigen Tag einen Fehler, ich gehe in eine Ausstellung im Gropius-Bau, und da hängt ein Foto. Es zeigt eine Frau in einem verwaschenen Hemd. Ihr Kopf ist nicht zu sehen, aber auf der Brust lese ich eintätowiert: Feld-Hure NR. 712834.
Mir wird schwindelig. Es ist stickig in dem Raum und dunkel. Ich warte auf den Stufen vor dem Museum, dass es mir besser geht, und weiß genau, dass überhaupt keine Zeit, nie, nie, nie die Wunden heilen wird. Meine Tante hat recht: Die Vergangenheit ist jetzt.
Ich steige wieder aufs Fahrrad und trete in die Pedale.
Ich bin 1 Meter 57 groß. Eigentlich nur 1,55, aber im Einwohnermeldeamt habe ich 1,57 angegeben. Ich freue mich riesig, den deutschen Staat um zwei Zentimeter betrogen zu haben.
Also, ich bin nicht sonderlich groß, habe schöne, kräftige Waden, weil ich mit den Hacken auftrete beim Gehen, wie früher meine Mutter. Das Fahrradfahren tut das seinige dazu.
Ich rede gerne. Höre gerne zu. Das ist eine runde Sache.
Ich lebe in Berlin, im Westen, in Schöneberg, dort, wo nie etwas passiert.
Ich wohnte in Kreuzberg 61, als nach dem Mauerfall die Milch in der Markthalle ab 12:00 Uhr mittags ausverkauft war. Im Tiergarten führte ich meinen riesigen Hund (inzwischen tot) spazieren, als die damalige Kongresshalle, die »Schwangere Auster«, in sich zusammenbrach und daraufhin in »Haus der Kulturen der Welt« umbenannt wurde. Ich besuchte die Max-Reinhardt-Schauspielschule, die in »Hochschule der Künste« umbenannt wurde und heute »Universität der Künste« heißt. Ich lernte dort Schauspiel. Zum Abschluss erhielt ich den Titel »Dipl.-Schau.«. Man könnte mich Diplom-Schauspielerin nennen, aber wem würde das nützen?
Ich trank Kaffee im »Schwarzen Café« oder im »Terzo Mondo«, feierte im »Zwiebelfisch« oder tanzte die Nacht durch im »Dschungel«. All das gehört zu einem längst versunkenen Westen. Überhaupt verschwand der Westen, vor allem dieses Westberlin, schneller als die ganze viel beklagte DDR. Beinahe über Nacht. Es hinterließ nur ein paar Details.
Ja, so lange bin ich schon da.
Ich habe eigentlich nur J. F. Kennedy verpasst und den Zweiten Weltkrieg.
Ich bin Jüdin. Jahrgang 1960. So, jetzt ist es heraus.
Ich wurde in Titos Jugoslawien geboren. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, es muss die Blütezeit seiner Herrschaft gewesen sein, denn sein Porträt hing groß und imposant überall. Auch in unserem Kindergarten. Dort sogar in Farbe. Vor dem Frühstück begrüßten wir Kinder ihn mit »Dobar dan Druže Tito« (»Guten Tag, Genosse Tito«). Er antwortete nie, wir fanden ihn unhöflich.
Als ich drei Jahre alt war, wurde ich zu einem Casting eingeladen. Das Leben des Nikoletina Bursač, einer heldenhaften Partisanenfigur aus einer Erzählung von Branko Cópić, sollte verfilmt werden. In der Endauswahl schlugen sich eine kleine Blondine und ich um die Rolle der Erna. Der Held Nikoletina findet in den letzten Kriegstagen ein kleines jüdisches Mädchen in einem niedergebrannten Dorf. Das Mädchen wird zutraulich und erzählt ihm die Geschichte von der Verfolgung und Ermordung ihrer Familie durch die kroatischen Faschisten, die Ustascha. Das jüdische Mädchen sollte ich sein. Ich hatte mir vorgenommen, zu gewinnen und später Schauspielerin zu werden. Beides gelang mir.
Die Dreharbeiten waren nicht sonderlich spektakulär, ich trug dicke Wollsocken, die kratzten, musste eklig schmeckende Ziegenmilch trinken und an ausgesuchten Stellen weinen.
Weinen, wenn der Held Nikoletina mich findet, in einem Bergdorf, in dem die Ustascha alle Juden getötet haben, nur mich, die kleine Erna, haben sie nicht gefunden.
Die Ustascha, erklärte man mir bei den Dreharbeiten, seien kroatische Nationalisten gewesen, angeführt von Ante Pavelić, die nach dem Vorbild der SS ihre Rassengesetze mit brutalem Terror durchgesetzt hätten. Sie wären eine radikale Minderheit geblieben, wenn sie nicht von Hitler und Mussolini in den Rang einer Staatsgewalt gehoben worden wären. Ihr Ziel sei es gewesen, die Endlösung möglichst noch vor den Nazis zu vollbringen. Die Ustascha-Miliz hätte Serben, Roma, Juden und Partisanen ermordet. Ich verstand fast nichts, nur so viel: Hier musste bedingungslos geheult werden.
Im Juni 1964 drehte ich also den ersten Film meines Lebens in den dalmatischen Bergen. Meine Mutter, eine glühende Kommunistin, war begeistert von Inhalt und Form dieses Films. Die Uraufführung fand zu Titos Geburtstag statt, im Sommer des darauffolgenden Jahres. Zu diesem Zeitpunkt aber war ich bereits auf der Flucht und konnte nicht zur Premiere kommen.
Mit 44 Jahren wurde ich Vollwaise. Das ist gar nicht so früh, ich fühle mich seitdem auch nicht speziell anders. Ich würde mich wahrscheinlich niemals selbst so bezeichnen, hätte mich das Erbschaftsamt nicht so angeschrieben. Ich erbte einige Tausend Euro, mit denen ich sofort meine Steuerschuld vom Vorjahr beglich, außerdem einen 26 Jahre alten Mercedes, das Statussymbol meines Vaters, eine Wohnung, die seit 40 Jahren nicht mehr ausgemistet worden war, und ein laufendes Restitutions-Verfahren gegen die kroatische Regierung.
Vor allem aber rutschte ich in die erste Reihe. Vor mir war niemand mehr, der sich schützend vor mich stellte. Meine Eltern waren einfach gestorben. Alle möglichen Dinge kamen zum Vorschein und tun es noch: Geheimnisse, Neurosen, Müll.
Ich fahre nicht besonders gut Fahrrad, vor allem nicht, wenn ich mit mir selber rede.
Und ich hasse Geheimnisse. Ich finde, Geheimnisse sind das Allerletzte. Ich verabscheue sie. Abgrundtief. Auf der Liste der unerträglichen Geheimnisse rangieren die Familiengeheimnisse ganz weit oben. Das habe ich schon als Kind gespürt. Kaum etwas ist hartnäckiger als Familiengeheimnisse. Jede Familie hat gleichermaßen viele Geschichten wie Geheimnisse. Die Geschichten muss man sich unentwegt anhören, damit die Geheimnisse im Dunkeln bleiben.
Zum Beispiel die Geschichte von Titos Brille: Kroatien im Krieg 1944, Marschall Titos Brille ist kaputt. Die Partisanen, angeführt von ihrem Genossen Tito, haben sich in den zerklüfteten Bergen Kroatiens verschanzt, bieten keine Angriffsfläche. Die Ustascha kriegen sie nicht zu fassen. Es sind heikle Momente. Mein Vater repariert Titos Brille. Die Partisanen gewinnen den Kampf. Mein Vater wird zum Helden ernannt und bleibt es fortan.
Ich steige vom Fahrrad, setze mich an die Theke meines Lieblingscafés und rede übergangslos laut weiter. Man kennt mich dort.
»Schön«, sagt Frank, der Kellner im Café Savigny, und lächelt mich freundlich an, »und?«
»Mein Vater ist tot und irgendwie stimmt es vorn und hinten nicht.«
»Aha«, meint Frank.
»Ja«, sage ich, »Marschall Tito trug damals nämlich überhaupt gar keine Brille.«
»Oh! Schade«, meint Frank. Er hat verstanden.
»Aber mein Vater ist und bleibt ein Held.«
»Na klar«, tröstet mich Frank.
»Danke«, stammele ich. Frank ist einiges gewöhnt, ein netter Kerl.
Keine Sentimentalitäten – einfach aufs Rad, weitertreten.
Ich quäle mich und mein armes Rad die Straße des 17. Juni entlang. Alles verschwimmt. Tränen laufen mir über die Wangen. Zu Hause angekommen, sehe ich ramponierter aus als mein Rad. Aber das spielt keine Rolle. In Schöneberg sehen alle mitgenommener aus als im taufrischen Prenzlauer Berg.
Im Briefkasten liegt Post, ein amtlicher Brief mit vielen Briefmarken und Stempeln. Sie wollen einem imponieren, denke ich und überfliege den Inhalt: »In Ihrer Restitutionsangelegenheit bitten wir Sie um Zusendung sämtlicher Sterbeurkunden der betroffenen Personen. Amt für auswärtige Angelegenheiten, Zagreb, Kroatien.«
Na, die sind ja lustig! Mindestens die Hälfte meiner toten Verwandtschaft haben sie selbst zu verantworten, demnach müssten sie die Sterbeurkunden in ihren Archiven haben. Und aus Auschwitz passable Sterbeurkunden zu bekommen, war noch nie ganz einfach.
Wut beginnt in mir aufzusteigen: Auch eine Methode, eine Angelegenheit hinauszuzögern, Zeit zu schinden, zu warten, bis alle nicht mehr betroffen, sondern tot sind, bis auch ich mausetot bin! Aber diesen Gefallen, rechtzeitig zu sterben, werde ich ihnen nicht tun!
Ich starte den Computer, sie werden einen Brief erhalten, der sich gewaschen hat.
Jedes Mal, wenn ich mich konzentrieren will, kommt einer meiner Söhne. Ich habe zwei. Der Ältere sagt: »Fühl mal, diese Fußballschuhe, Leder – kein Vergleich, was?« Und ich sage: »Nein, kein Vergleich.« Glücklich erklärt er mir die Abseitsfalle. Sofort verliere ich den Faden, mein Blick schweift ab und landet auf dem anderen, dem Kleineren, der in der Nase bohrt, als suche er nach Gold. Was soll’s, ich schalte den Computer wieder aus.
mein vater, der held
Adriana! Adria, meine Tochter, du solltest wie unser Meer heißen! Unser schönes Meer!
Wir haben gesungen! Gelacht! – Split! Das war eine Perle an der Adria. Die Dalmatier? Wie Italiener! Laut, fröhlich und vor allem keine Antisemiten. Man hat uns geholfen auszureisen, hat uns versteckt, und wir sind gemeinsam in die Berge. Als Kämpfer! Stell dir vor, die erste jüdische Buchhandlung des Landes gab es in Split: Familie Morpurgo … Schau! Es haben fast alle überlebt. Fast alle Juden aus Split! Bis die Deutschen kamen, aber das ist eine andere Geschichte …
Nachts um halb zwei wache ich auf. Es ist der 7. Dezember, die Nacht nach Nikolaus. Ja, wir feiern Nikolaus. Juden nehmen alle Feiertage mit. Nicht alle Juden und nicht alle Feiertage, aber im Prinzip ist es so. Die Kinder haben sich sämtliche Süßigkeiten aus den Stiefeln in den Mund gestopft und sind mit Bauchschmerzen schlafen gegangen.
Ist das Fenster auf? Es ist so stickig! Sammy hat morgen einen Termin beim Kieferorthopäden, wenn man den vergisst, muss man bis zu den dritten Zähnen warten. Warum bin ich überhaupt aufgewacht? Was ist los? Etwas passiert gerade … Etwas passiert immer gerade irgendwo …
Wenn man jung ist, ist man zu dumm für die Angst. Ich war Arzt. Aber als Jude durfte ich im Krankenhaus nicht mehr arbeiten. Bei den Partisanen natürlich schon. Ärzte, auch so unerfahrene wie ich, bekamen sofort zu tun! Wie viele Zähne ich mit dem Brecheisen gezogen habe! Ich war mutig und dumm.
Stell dir vor, im Juni 1943 bin ich los und habe das Lager auf Rab besucht! Ich wusste einiges von dem Lager, deine Mutter hatte mir geschrieben, wer alles drinhockte, was ihnen fehlte, wie es allen ging. Also habe ich mir eine Bescheinigung selbst ausgestellt, ich sei befugt, die Hygienebedingungen im Lager zu überprüfen. Wahnsinn! Bin rein und sogar wieder raus! Hatte Briefe dabei und Geld und kleine Sachen für all die armen Inhaftierten, die sie bei mir über deine Mutter bestellt hatten. Am Lagertor habe ich dem zuständigen Offizier gesagt, ich sei eine Art jüdischer Gesandter. Die italienische Besatzung hätte mir den Besuch des Lagers gestattet. Er war irgendwie beeindruckt und hat mich ohne weitere Fragen reingelassen! Aber was noch erstaunlicher ist, er hat mich auch wieder rausgelassen! Er hätte mich doch als Juden einfach dabehalten können? War er dumm oder einfach nur gutgläubig? Vielleicht war er ja nur Faschist, kein Antisemit? Ich weiß es nicht. Habe ihn auch nicht gefragt. Rein und wieder raus. Unglaublich! Hier, die Fotos vom Lager sind von mir! Habe ich im Schuh versteckt. Kaum war ich draußen, bin ich dann doch gerannt, ich Held! Gerannt um mein Leben. In einer kleinen Pension am Hafen habe ich die Rollos runtergelassen und auf das nächste Schiff nach Split gewartet! Wahnsinn! Wirklich dumm. Und noch so jung.
Und ich habe Titos Brille repariert! Marschall Titos Brille! Aber das ist noch nicht alles! Ich habe gekämpft, im Wald geschlafen wie ein Bär, und ich habe 40 jüdische Kinder gerettet und nach Nonantola gebracht …
Mein Vater war ein Held, das weiß ich, seit ich denken kann.
Nonantola ist eine kleine Stadt in Norditalien, unweit von Modena. Im April 1943 kommen vierzig jüdische Kinder aus Kroatien dort an. Sie sind, so wird erzählt, mit dem Schiff bis nach Ravenna gelangt, dann vorsichtig durch die Po-Ebene nach Nonantola marschiert. Es ist heiß, es gibt kaum Bäume in dieser Gegend, nur Reisplantagen. Aber auch die sind ausgetrocknet, seit Wochen hat es nicht geregnet. Die Kinder werden in der Villa Emma in Nonantola untergebracht. Die hat einem italienisch-jüdischen Großindustriellen gehört, bis er fliehen musste. Nun steht sie leer. Sie wirken ängstlich, diese Kinder, aber sie haben allesamt italienische Pässe. Mein Vater, der Held, hat sie ihnen besorgt.
Der Carabiniere sitzt in Split in seinem Büro. Er liest den Corriere della sera, als ich reinkomme. Ich druckse herum. Er grinst. Ich möchte vierzig Stempel haben für vierzig jüdische Kinder, die in Sicherheit gebracht werden müssen. Das geht nicht, sagt der Carabiniere. Aber Dalmatien ist italienisch besetzte Zone, sage ich. Wir sind doch alle Italiener irgendwie, nicht wahr? Una faccia, una razza! – und schenke ihm einen Flakon Brillantine, Marke »Soffientini di Milano«, als Zeichen meiner Verehrung. Der Carabiniere lacht. »Birbante«, Schlingel, sagt er und stempelt mir ein »lasciapassare« für vierzig Personen. »Sollten Sie erwischt werden, wissen Sie nicht mehr, wer Ihnen die Pässe gestempelt hat«, ruft er mir nach. Die Eltern weinen am Hafen von Split, als sie ihre Kinder zum Schiff bringen. Aber sie wissen: Es ist ihre letzte Chance. Mit an Bord: italienische Faschisten, deutsche Militärs. Wir singen. Die Kinder und ich singen wie eine Jugendgruppe auf Ferienreise. Wir singen in einem fort. Als wenn nichts wäre. »Ciri biri bella mare moja!« Ein kroatisches Volkslied über unser schönes Meer. Die ganze Reise über haben wir gesungen. Wir haben über jeden Verdacht hinweggesungen!
Mein Vater, der kleine Mann, ist nur wenig älter als die Kinder, zwanzig ist er. Auf dem Abschiedsfoto sehen sich alle ähnlich, dunkel und ernst, mit großen schwarzen Augen.
Mein Vater verabschiedet sich von den Kindern. Nächstes Jahr in Jerusalem!
Er muss in geheimer Mission weiter in den Vatikan. Dort stempelt einmal im Monat ein Priester den Juden ein »I« für »Italiener« in ihre Pässe. Ein solches »I« gilt als »lasciapassare«. Ein Schlupfloch. Da sich Kroatien unter italienischer Okkupation befindet, sind die Juden genau genommen Italiener. Dieses »I« rettet unzählige Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die nicht geflohen sind, warum auch immer.
Zwei Jahre wird die kleine Gesellschaft in Nonantola bleiben. Als sich im September 1943 die Deutschen der Villa Emma nähern, nimmt die Landbevölkerung die Kinder auf und versteckt sie. Vielleicht, weil sie früher einen jüdischen Bürgermeister hatten und Samuel Friedmann immer so freundlich war? Nach dem Krieg und nach einer abenteuerlichen Flucht über die Schweiz landen die Kinder sicher und wohlauf in Haifa.
Weißt du, was schade ist, Adriana? Ich habe mich nie bei dem Carabiniere bedanken können, denn ich wusste ja seinen Namen nicht. Dabei hat er vierzig Kinder gerettet …
Mein Vater, der Held. Hoffentlich ist diese Geschichte wahr. Endlich schlafe ich ein.
Georg, mein Mann, weckt mich, wie mir scheint, nur wenige Sekunden später. »Dein Vater ist tot.« Tot? Aber ist er nicht in Nonantola? Und der Carabiniere?
Ich bin darauf vorbereitet und dennoch bin ich schockiert, atemlos, das ist wohl normal so.
Ich bin froh, dass er es mir sagt und ich nicht selbst am Telefon war.
Mitten in der Nacht steige ich ins Auto und fahre nach Gießen. Es ist eine merkwürdige Fahrt, die Reise zu einem Toten, zum toten Vater. Ich bin unnatürlich wach, unterhalte mich mit ihm. Und irgendwie antwortet er. Das ist tröstlich.
Kennst du den Partisanenwitz mit dem Bären?
Ein Mann hat einen Bären an der Leine. »30 Dinar für den Bären! 30 Dinar!«, schreit er auf dem Marktplatz.
»Schön«, sagt ein Passant. »Aber wofür? Was kann der Bär? Kann er tanzen?«
»Nein.«
»Aha. Kann er auf einem Bein stehen?«
»Nein!«
»Was kann er dann?«
»Nichts, aber er war im Wald!«
Vor einem Jahr hatte mich mein Vater um ein Gespräch gebeten. Feierlich, als wären wir die Familie Buddenbrook, war ich zu ihm nach Gießen gefahren.
»Ich habe dir etwas mitzuteilen.« Er war blass, wusste seit kurzer Zeit, dass er an Pankreaskrebs litt. Ausgerechnet Pankreas war sein Spezialgebiet, er hatte sich die Krankheit selbst diagnostiziert. Ich saß in seinem Arbeitszimmer in der Uniklinik, blätterte im Ärzteblatt.
»Oh, so förmlich! Schieß los.«
Er saß hinter seinem Schreibtisch und lächelte, besprühte sich mit seinem Lieblingsduft. Wir schwiegen, was selten vorkam. Und dann begann er ein Gespräch, ohne mir auch nur irgendetwas Wesentliches mitzuteilen, keine Heldentaten, nichts. Als müsste ich es durch den Nebel von Azzaro hindurch riechen, erraten. Dieses Spiel trieb er danach noch einige Male so oder ähnlich.
Immer wieder rief er mich an, plauderte drauflos, erzählte mir Witze, die ich schon kannte, und bat mich schließlich, doch möglichst schon am nächsten Wochenende erneut vorbeizukommen. Nur ein einziges Mal rückte er wirklich mit der Sprache raus, sagte, seine Zeit sei abgelaufen, und dass 83 doch ein stolzes Alter sei, nicht wahr? Er erklärte mir fachmännisch sein Blutbild, seine Aussichten. Pankreaskrebs war eben sein absolutes Spezialgebiet.
Als er bereits zum wiederholten Male im Krankenhaus lag, saß ich an seinem Bett, und er gab einige Witze aus seinem reichhaltigen Repertoire zum Besten:
»Ein Chirurg kommt nach einem freien Wochenende in die Klinik, wäscht sich die Hände, bereit zu operieren. ›Schwester, wie ist es dem Nierenpatienten vom Donnerstag ergangen?‹
›Tut mir leid, Herr Professor, tot.‹
›Ach ja? So was! Und der Darmverschluss von Freitagvormittag?‹
›Verstorben, Herr Doktor.‹
›So, so … Nun gut, die Dame mit dem Herzkatheter?‹
›Defunt. Ebenfalls gestorben.‹
›Nun gut. Schwester, reichen Sie mir bitte den Kittel.‹
›Aber, Herr Professor, Sie wollen weiter operieren?‹
›Na was denn, Schwester, ich habe keine Angst vor dem Tod!‹«
Ich lachte gerne über diesen Witz, diesmal allerdings zögerlich.
»Adriana, es gibt bekanntlich zwei Möglichkeiten: entweder jung zu sterben oder alt zu werden!« So tröstete er mich, bevor er wegdämmerte.
Als er wieder aufwachte, bat er mich, einen Vortrag Korrektur zu lesen, den er noch halten wollte, in der Theologischen Fakultät: »Sterben und Tod, eine jüdische Sichtweise«:
In der jüdischen Tradition werden die Toten mit großer Sorgfalt behandelt. Schon vor Eintritt des Todes muß man darauf vorbereitet sein, diesem Augenblick mit Verständnis und Fassung zu begegnen.
Wie bei anderen alten Religionen gilt es als Sünde, einen Juden unbeerdigt zu lassen, Verbrennungen werden nicht praktiziert.
Der Sterbende wird bis zum letzten Atemzug als Lebender betrachtet. Es ist die heilige Pflicht, neben ihm zu bleiben, damit er im Todesmoment nicht alleine ist. Weinen und Wehklagen ist verboten, damit der Sterbende nicht leiden muß.
Die Spiegel im Haus werden verhüllt, Bilder an den Wänden umgedreht.
Im »Kitel« wird der Tote beerdigt, dem Hemd, das er bereits zur Hochzeit, zum Seder und an Jom Kippur getragen hat.
Als Zeichen der Trauer ist die Selbstverletzung verboten. Asche auf das Haupt, Zerreißen der Kleider, Fasten ist angebracht.
Das »Schma Israel« wird gesungen oder vorgelesen. Bei der Beerdigung das »El mole rachamim«.
Die Trauernden haben folgende Verpflichtungen: Sieben Tage lang sitzen sie Shive.
Sie sitzen nicht auf Stühlen, sondern auf Hockern oder auf dem Boden.
Sie ziehen keine Schuhe aus Leder an.
Sie begrüßen nicht.
Sie arbeiten nicht.
Sie lesen nicht die Thora.
Der Geschlechtsverkehr ist verboten, 30 Tage lang.
Sie schneiden sich nicht die Haare oder rasieren sich.
Sie baden nicht.
Sie waschen nicht die Wäsche.
Sie beteiligen sich nicht an Unterhaltungen, zwölf Monate lang.
»Woher weißt du das alles?«, fragte ich ihn. »Hast du die fünf Bücher Mose abonniert? Du bist weder besonders religiös noch habe ich dich außer medizinischer Fachliteratur jemals ein Buch lesen sehen.« »Das tun Juden nie, und trotzdem wissen sie alles«, war seine bescheidene Antwort.
Seltsam, dachte ich, er gibt mir ganz klare Anweisungen für später. Damit ich alles richtig mache oder damit ich nicht so allein bin mit der Situation, mich nicht so einsam fühle?
Als es ihm immer schlechter ging, bat er mich wieder zu sich, bedeutungsvoll. Ohne meine Mutter sollte ich ihn im Krankenhaus besuchen. Es war später Nachmittag und bereits dunkel. Ich stützte mich auf sein Bett, er näherte sich meinem Ohr, tat, als wollte er flüstern. Nur, dass er wieder nichts sagte. Gar nichts. Ich war ein bisschen verwirrt, und er schlief ein. Als ich nach zwei Stunden ging, hatte ich nichts Neues erfahren, aber eine Ahnung bekommen, dass dieser alt gewordene Held, dieser Patriarch, seine Geheimnisse mit ins Grab nehmen würde.
Am nächsten Tag saß ich wieder an seinem Bett, spielte ihm aus einem winzigen Rekorder neapoletanische Musik vor. Noch während ich darüber nachdachte, ob Menschen im Delirium Musik hören können, riss er die Augen auf, sagte: »Sento tutto« »ich höre alles«, und ich solle den Wagen nehmen, es sei Zeit. Ich lachte blöd und hilflos. »Non far la stupida« »stell dich nicht so blöd an«, waren seine letzten Worte an mich.
Göttingen, Kassel, Marburg, die Autofahrt zieht sich hin, obwohl ich mit »seinem Mercedes« fahre, den er mir bei meinem letzten Besuch ans Herz gelegt hat. Als ich endlich im Krankenhaus ankomme, hat man ihn schon fortgebracht. Mein Vater ist dort gestorben, wo er jahrelang gearbeitet hat, im Poliklinikum der Uniklinik Gießen.
Er hatte dort als Assistenzarzt angefangen, als er nach Deutschland kam, war 30 Jahre lang geblieben und hatte es bis zum Oberarzt der gesamten Poliklinik gebracht. Im Grunde ist es nur folgerichtig, dass er hier gestorben ist. Übrig geblieben von ihm ist eine Plastiktüte mit ein paar Sachen. Sie steht vor dem Zimmer auf dem Flur. Es ist Donnerstagmorgen, 11 Uhr.
Ich rufe meine Mutter zu Hause an. Sie hat die ganze Nacht bis zu seinem Tod bei ihm verbracht. Sie spricht wie ein Roboter, mechanisch und ferngesteuert, sie wird mir keine große Hilfe sein.
Im Kopf überschlage ich: Innerhalb von 24 Stunden zu beerdigen wäre jüdische Pflicht, aber mit Sabbatbeginn gleichzeitig jüdischerseits verboten. Sonntags für Christen nicht erlaubt. Montag, Montag könnte er beerdigt werden.
Meine Schwester, die nur meine Halbschwester ist, Tochter aus der ersten Ehe meines Vaters, ist aus Zagreb angereist. Sie hatte gehofft, ihn noch lebend zu sehen. Nun ist er tot, und wir müssen warten. Vier lange Tage zusammen warten.
Meine Halbschwester heißt Rosa und ist noch kleiner als ich. Dafür ist sie ziemlich pummelig. Dick sein ist Charakterschwäche, sagte mein Vater immer. Sein Verhältnis zu ihr war nie sonderlich gut, und solche vernichtenden Urteile halfen nicht, die Situation zu verbessern. Es heißt, mein Vater habe seine erste Frau nur auf den Druck der Kommunistischen Partei hin geheiratet. Immerhin hatte er sie geschwängert. Anstatt die Partei zu hassen, die ihn zu dieser Heirat gezwungen hatte, distanzierte er sich zunehmend von der Frau und ihrer beider Kind. Jahre später, als ich ihn fragte, ob das nicht auch eine Art Charakterschwäche gewesen sei, erwiderte er herablassend: »Adriana, du verstehst nichts vom Kommunismus.« Je älter meine Schwester wurde, desto komplizierter wurde auch seine Beziehung zu ihr wie auch die Beziehung meines Vaters zur Partei. Letztendlich war meine Halbschwester ja auch ein Kind der Partei.
Seine erste Frau starb nach 14 Jahren Ehe, im selben Jahr kam ich auf die Welt, das Kind einer neuen Frau: meiner Mutter. Mein Vater übte sich im Spagat: Die Nächte verbrachte er in der Wohnung seiner verstorbenen Frau bei meiner Halbschwester, die Tage bei uns. Er war völlig vernarrt in seine »neue« Tochter, in mich, die ich mit meiner Mutter am anderen Ende Zagrebs lebte. Diese familiäre Akrobatik war für meine Schwester sicher kein Vergnügen. Wahrscheinlich hätte sie mich gern mit meiner Kuscheldecke erstickt.
Mit dem Tod meines Vaters stehen wir nun vor einer neuen Prüfung unseres verwandtschaftlichen Verhältnisses.
Meine Schwester setzt sich auf den Teppich in der Mitte des Arbeitszimmers. Im Grunde steht sie erst vier Tage später wieder auf.
Das Arbeitszimmer liegt im 3. Stock der Universitätsklinik, Abteilung Radiologie. Ich habe meinen Vater immer gern dort besucht. Fläzte mich auf der Ledercouchgarnitur, probierte die Vierfarbstifte der diversen Pharmakonzerne aus, staunte über die radiologischen Aufnahmen von Dickdärmen. Ich bekam stets einen Espresso, genauso wie die Putzfrau oder der Dekan. Für diesen Espresso war mein Vater berühmt. Eine großartige italienische Espressomaschine war das Zentrum des Bücherbords. Auf nichts war mein Vater ähnlich stolz – doch, vielleicht auf sein Auto. Er hatte sich lange mit Renaults und Peugeots herumgeschlagen. Sofort nach seiner offiziellen Einbürgerung in die BRD gönnte er sich einen dicken Mercedes: Für alle war damit sichtbar, dass er wieder einmal angekommen war in einer Gesellschaft. Wenn er durch Gießen fuhr, ließ er den Hut auf, sonst lief er Gefahr, bei seiner geringen Größe nicht gesehen zu werden. Als ich das Abitur machte, bekam ich einen Zweitschlüssel für den Wagen, es war das größte Lob, das ich bekommen konnte: Auch ich war damit in der deutschen Gesellschaft angekommen, mit deutschem Abitur und deutschem Wagen. Noch am selben Abend fuhr ich die Beifahrertür ein. Für meinen Vater eine Bagatelle angesichts unseres unaufhaltsamen Aufstiegs in der deutschen Gesellschaft.
Natürlich könnte ich mir Zeit lassen mit dem Ausräumen des Zimmers. Vonseiten des Klinikums gibt es keinen Termindruck. Ich könnte in die Luft starren, weinen oder sogar in meinem Mikrokroatisch mit meiner Schwester über unseren Vater reden. Oder gar über uns und unser kompliziertes Schwesternverhältnis. Aber mir Zeit lassen, vielleicht sogar nichts tun, ist nicht gerade meine Stärke.
Stattdessen packe ich Kisten über Kisten, meine Schwester sitzt auf dem Teppichboden, raucht und lässt sich im Stundentakt Espresso servieren. Ich schufte wie ein Tier, sie ist versunken in ein tausendseitiges Nachschlagewerk meines Vaters: »Atlas der Darmerkrankungen. Dickdarm und Analregionen«. Gelegentlich zeigt sie mir nützliche Aufnahmen zur Doppelkontrastmethode. Auf einer sieht man, wie es gelingt, eine Magen-Darm-Sonde einzuführen, ohne den Dickdarm zu perforieren. Überwältigt von diesen medizinischen Details setze ich mich neben sie und trinke mit ihr einen Espresso. Zwischen der medizinischen Fachliteratur finden wir in einem kitschigen goldenen Rahmen eine große Fotografie: die Familie unseres Vaters. In der Mitte unser Großvater Leon, ein notorischer Kartenspieler, daneben seine Frau Regina, die die Familie irgendwie durchbringt, umgeben von ihren sechs Söhnen. Alle sind sie dunkelhaarig, dürr und blass, eine typisch sephardische Familie. Unten links der Jüngste der sechs: unser Vater Jakob. Dalmatien, Split, 1922.
Die Brüder unseres Vaters hießen Buki, Mento, Albert, Miko und Silvio. Mento hieß natürlich nicht Mento, sondern Menachem, Buki hieß Israel und Miko Chaim. Aber wie hätte das auf der Straße in Split geklungen? Wenn sie aus dem Haus traten, waren sie Mento, Buki und Miko.
Die Familie war arm. Die sechs Brüder kamen irgendwie zurecht, manchmal lauerten sie ihrem Vater auf und nahmen – hatte er gewonnen – seine Beute für die Mutter mit. Später machten die zwei ältesten Brüder eigene Geschäfte auf. Mentos Laden wurde eine Art Ramschladen, in dem es alles gab: Radiergummis, Bettlaken, Geschirr. Buki betrieb einen Ankauf-Verkauf, die Geschäfte gingen nicht schlecht. So konnten die beiden Ältesten die Jüngeren finanzieren. Albert, Nr. 3, wurde Rabbiner, zu Ehren Gottes und der Familie. Miko, Nr. 4, wurde Ingenieur und fuhr als solcher zur See. Nr. 5 und 6, Silvio und Jakob, unser Vater, durften studieren und wurden Ärzte. Wahrscheinlich ging es in vielen sephardischen Familien so oder ähnlich zu. Bei Canetti jedenfalls kann man es nachlesen.
Nach Kriegsende fanden sich die Brüder wieder. Man hatte nicht so viele Tote zu vermelden wie die aschkenasischen Familien, die sich deutsch fühlten, die den Deutschen blind vertraut und gar nicht oder viel zu spät die Flucht ergriffen hatten. Die Sepharden waren da vorsichtiger gewesen, sie hatten den Deutschen klugerweise misstraut und waren rechtzeitig geflohen.
Unser Großvater Leon wurde, mitten in einem Kartenspiel deportiert, umgebracht. Er hatte so lange am Spieltisch gesessen, dass er darüber zu fliehen vergaß. Alle anderen aber hatten, als die Italiener ihre Haut zu den Alliierten hinüberretteten und den Deutschen Kroatien ganz überließen, sehr schnell das Weite gesucht. Unser Vater war mit seinem Bruder Silvio bei den Partisanen geblieben. Nach Aussagen meines Vaters war Silvio der Schönste und Begabteste der Brüder. Er starb in den letzten Kriegstagen, in Partisanengefechten. Die offizielle Version lautete, Deutsche hätten ihn erschossen. Großmutter Regina und die anderen Brüder hatten sich ins schon befreite Süditalien retten können.
Nach dem Krieg, zurück in Split, mussten die Brüder erfinderisch sein. Die beiden Ältesten übernahmen wieder ihre Geschäfte, spezialisierten sich. Mento machte aus seinem Laden eine Art Billigmarkt, eine Novität für Split: Zahl eins, nimm zwei. Im Grunde war er der Erfinder der Discountmärkte.
Buki hatte sich für seinen Altwarenladen folgenden Slogan überlegt: Bevor du’s wegwirfst, bring’s zu Buki! Sein Zulauf war enorm. Bevor man in Split etwas in den Müll warf – Zink, Blei, Kupfer –, bot man es ihm an. Um dann wieder bei ihm Einzelteile zu suchen, die in ganz Split nur er hatte! Miko, der auf den Kriegsschiffen der Alliierten so ziemlich alles gesehen hatte, hatte genug von Abenteuern. Er war in Zypern gewesen, wo die Engländer die Juden in Lager steckten und in Haifa, wo er endlich heimlich von Bord ging. Er entschloss sich, nach Eretz Israel zu gehen und in Ruhe an der Klagemauer Saft zu verkaufen, für Juden und Christen und andere Touristen. Albert, der Rabbiner, war bis nach New York gekommen, hatte eine kroatische Synagogengemeinde gegründet und lebte mit Frau und Kindern dort, als wäre er noch immer in Split.
Es klang immer wie ein Bericht aus dem Paradies, wenn mein Vater von Split erzählte. Split, immer wieder Split, die engen Gassen der mittelalterlichen Altstadt, gebaut auf den Trümmern des römischen Diokletian-Palasts. Sie waren Straßenkinder, am Strand, in der Synagoge. Die städtische Grundschule, das Wetter, die Promenade, der Rabbiner übernahmen die Erziehung. Sie spielten Fußball auf der Straße. Sie badeten am flachen Strand von Bačvice, dem öffentlichen Strandbad. Nichtjuden, Juden, Moslems, alle zusammen. Den kleinen Ball am längsten in der Luft halten, das ist »Picigin«, es wird im flachen Wasser noch heute so gespielt, über Stunden, in den langen Sommern Kroatiens. »Picigin« ist ursprünglich ein italienisches Wort, überhaupt sprachen alle Italienisch, nebenbei, ganz beiläufig.
»Am 12. Oktober 1918 wurde ich, als Jakov Altaras, Sohn von Leon Altaras und seiner Frau Regina in Split (Jugoslawien) geboren. Abitur im Jahre 1936. Im selben Jahr Immatrikulation an der medizinischen Fakultät in Zagreb. Am 5. April gelingt es mir, nach Split zu fliehen, einen Tag vor der deutschen Okkupation. Das war knapp. Da Split unter italienischer Besatzung steht, ist es mir möglich, weiter an italienischen Universitäten zu studieren. Gleichzeitig schließe ich mich Titos Partisanenarmee an. Ich studiere immer unregelmäßiger, schaffe es aber, 1944 in Bari zu promovieren.« So schreibt es mein Vater in seinem Lebenslauf.
Bei den Partisanen machen ihm die Berge zu schaffen, er kommt von der Küste und sehnt sich nach dem Meer. Doch er ist zäh, das jahrelange Leichtathletiktraining bei Makkabi Split hat ihn gerettet, so scherzt er später, sonst hätte er die meilenlangen Märsche zu Fuß nie überstanden! Er trägt russische Waffen und singt russische Lieder für die Freiheit. Zwei Jahre leitet er seine Brigade, die »prva dalmatinska Brigada« in den Bergen zwischen Schnee und Felsen, bis die Partisanen nach dem Abzug der Italiener die Insel Vis zu Titos Hauptquartier machen können und die Meereskundigen dorthin versetzt werden. Endlich wieder am Meer. Er schwenkt die Fahne in Vis, bereit, gegen den Faschismus zu kämpfen und für Tito sein Leben zu geben. Ein zierlicher, aber ausgesprochen attraktiver Soldat!
Das alles zeigen die Fotos, die inzwischen ausgebreitet vor uns auf dem Boden liegen. Unser Vater auf seinem ersten Transportmittel, einem Esel. Später im Jeep, mit rotem Stern auf der Mütze und Maschinengewehr über der Schulter. Er hat sie mir oft gezeigt, diese Fotos, und sie mit vielen kleinen Geschichten versehen. Ich kann nicht sagen, was davon erfunden, was Märchen und was wahr ist. »Se non è vero, ben trovato!« – falls es nicht wahr ist, ist es doch gut erfun- den!
Er war ein glücklicher, vitaler Kerl, ein Stehaufmännchen, ein Impresario seiner selbst. Die Schwermut, die meine Mutter nach dem Krieg nie wieder ganz losgelassen hat, kannte er nicht. Vielleicht, weil er nie im Lager war, weil ihm Demütigungen dieser Art erspart geblieben sind, weil er als Partisan immer auf der Kämpfer- und schließlich auf der Siegerseite stand.
Irgendjemand kolportierte meinem Vater nach dem Krieg die Wahrheit über den Tod seines Bruders Silvio. Er war nicht von den Deutschen oder der Ustascha, sondern von jemandem aus den eigenen Reihen, also von Partisanen, wegen interner Streitigkeiten kurz vor Kriegsende ermordet worden. Natürlich war das vertuscht worden. Ende der 50er-Jahre begann der Parteizusammenhalt zu bröckeln, der Riss zwischen Tito und Stalin wurde spürbar, die Parteifunktionäre wurden nervös. Mein Vater verfolgte die Sache. Er erhob Anklage, mit dem Ergebnis, dass die Kommunistische Partei nun ihn verfolgte. Die ehemaligen Partisanen wurden nicht gern eines solchen Mordes bezichtigt. Mein Vater, inzwischen eine Berühmtheit in der Partei, bekam einen Schauprozess. Man warf ihm staats- und sozialismusfeindliche Handlungen vor, unter anderem den Besitz von privaten Röntgengeräten. Schriftliche Beweisstücke lagen nicht vor, aber man drohte mit Haft, Arbeitsentzug. Man wollte ihn und seine Anklage loswerden. Einige Denunzianten wurden gefunden, sagten bereitwillig aus. Er floh Hals über Kopf aus Furcht vor Inhaftierung. Seine Enttäuschung war enorm. Er hat nie erfahren, ob der peinliche Prozess, den man ihm machte, eher dem störenden Parteimitglied oder dem Juden galt. Fazit war: Man war ihn los. Seine geliebte Partei hatte ihn doppelt verraten: erst seinen Bruder ermordet, dann ihn diffamiert.
Weißt du, Adriana, mit den immergleichen Anklagen – Zionismus und Kosmopolitismus – waren die Juden doch die Ersten, die aus der Partei herausgefiltert wurden. Ich war weiß Gott nicht der Einzige! Wir hatten zwar in Titos Brigaden im Krieg die Möglichkeit zum Widerstand bekommen, und natürlich gab es später in der Partei genügend ambitionierte Juden in hohen Funktionen, allen voran Moshe Piade! Aber parteiinternen Antisemitismus gab es trotzdem. Nach außen hin blieb Tito der große Sieger, der alle Nationalitäten, Abstammungen und Religionen unter seiner schützenden Hand zu bündeln wusste. Unter ihm konnten wir mehr oder weniger unbehelligt leben. Mehr oder weniger …
Jedes Mal, wenn ich das in einer Gesellschaft erzähle, gibt’s ein großes »Ah« und »Oh«. »Sag bloß, habe ich noch nie gehört, ehrlich? Bist du dir da sicher?« Je mehr Intellektuelle zusammensitzen, desto lauter die Verwunderung. »Was ist daran so merkwürdig?«, antworte ich dann. »Antisemitische Säuberungen gab es in jedem kommunistischen Staat, nur waren sie in Polen früher und extrem heftig und in Tschechien später, aber auch nicht ohne. Und in der Sowjetunion hatte Stalin ein besonderes Faible für Schauprozesse.«
Im Sommer 1964 wird der Schauprozess gegen meinen Vater angestrengt. Es ist abzusehen: Dies ist das Ende der Karriere eines jüdischen Arztes in Jugoslawien. Meine Eltern fliehen – oder besser: Sie versuchen es. Ich erinnere mich, wie nervös alle in unserem Wohnzimmer herumsaßen. Ich war klein, aber an die Panik kann ich mich noch sehr gut erinnern. Mein Vater verschwand mit einem Koffer, in dem er vor allem schwere Schellackplatten mitschleppte: Opern, Benjamino Gigli, Caruso, Zenka Milanov. Es war Hochsommer und sehr warm. Er ging nach Zürich.
Meine Mutter schaffte es nicht. Die Behörden hatten von der Flucht meines Vaters erfahren, entzogen ihr den Pass und behielten sie als Druckmittel in Jugoslawien. Ich wurde von meiner Tante, der Schwester meiner Mutter, nach Italien geschmuggelt.
Meine Mutter blieb allein in Zagreb zurück und hatte ein langes Jahr Zeit, mit der kommunistischen Enttäuschung fertig zu werden. Sie war ein glühendes Mitglied der Partei gewesen, und ebenso glühend wurde nun ihr Hass. Sie habe eines Morgens das rote Parteibuch und ihre roten Handschuhe der Partei gleichzeitig auf den Tisch geknallt. So ist die verkürzte Fassung der Legende. Aber ich weiß, es war sehr schmerzvoll für sie, sie hat mächtig daran zu knabbern gehabt.
Währenddessen versuchte mein Vater, in Zürich Fuß zu fassen, lernte Deutsch oder das, was die Eidgenossen dort für Deutsch hielten. Er wiederholte die Doktorprüfung – auf Schwyzerdütsch. Sie ließen ihn probehalber auf die Verfassung schwören, aber Schweizer wurde er nicht, sein Schwyzerdütsch war offenbar nicht ausreichend.
Was mich angeht, war 1964 auch ein aufregendes Jahr: mein erster Film, mein erstes Exil. Ich war gerade mal vier.
Ich starre auf meine Schwester. Sie trinkt nicht nur ununterbrochen Espresso, sie raucht auch Kette. Der Sozialismus ist doch etwas recht Spezielles, denke ich. Sie legt versonnen ein 750-Teile-Puzzle vom Zürisee, das sie zwischen den Andenken meines Vaters gefunden hat. »Das hat er mir mitgebracht«, will ich eifersüchtig sagen, kann mich aber gerade noch zurückhalten. Und überhaupt, wie kann man in solch einer Situation ein Puzzle legen? »Du bist hyperaktiv, ich trauere.« Mit diesen Worten reicht sie mir die tabellarische Vita meines Vaters herüber und macht ernst und eifrig weiter mit dem Puzzle.
1966 wiederholtes Staatsexamen Zürich Universitätsklinik
1967 Antrittsvorstellung als Oberarzt in Gießen
1969 Außerplanmäßige Professur Humandiagnostik
1970 Beamter auf Lebenszeit
1970 Deutsche Staatsbürgerschaft
1973 C3-Professur
1984 Ruhestand
1985 Bundesverdienstkreuz
1998 Ehrenplakette der Landesärztekammer
Mein Vater hat Erstaunliches geschafft. Aus dem kleinen Straßenjungen aus ärmlichen Verhältnissen ist ein deutscher Professor geworden, ein Beamter auf Lebenszeit. Ein Mann mit Pension und Mercedes. Er entwickelte eine neue Methode zur Früherkennung von Darmkrebs, die sogenannte Doppelkontrastmethode, hielt Kongresse auf der ganzen Welt ab. Besonders in Italien feierte man seine wissenschaftlichen Erfolge. Es gab legendäre Mittagessen, zu denen an die zwanzig junge italienische Ärzte aus allen Regionen angereist kamen, um von ihm zu lernen. Er unterrichtete und unterhielt sie mit Fachwissen und Witzen. Weiterbildungen für europäische Ärzte wurden in Gießen abgehalten. Schon bald rühmte sich die Universität, führend in der Frühdiagnostik von Krebs zu sein. Zahlreiche Publikationen in mehreren Sprachen. Er wurde eine Koryphäe auf seinem Gebiet, war dabei von unschlagbarem Charme und Humor. Eine große Figur aus einem großen Epos vor bewegtem geschichtlichen Hintergrund, denke ich. Eine Art »Dr. Schiwago«, für den ich immer genauso geschwärmt habe wie für Dr. Altaras, meinen Vater.
Sein Imperium war großzügig angelegt. Von der MTA, die in aller Herrgottsfrühe bei ihm einen Cappuccino bekam, bis zum diensthabenden Nachtarzt, der am Abend zu einem Espresso eingeladen wurde. Er verteilte seine Aufmerksamkeiten und sein Lob sehr generös. Ein Pate, der mit Geschenken nicht geizte. Dafür erfüllten sie ihm jeden Wunsch, halfen, wo sie nur konnten. Aber etwas hat er nicht erreicht: Er ist nicht Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland geworden. Stattdessen hatte er immer einen vor der Nase, den er politisch verabscheute. Der ihn wieder zum Partisanen machte. Dem Landesverband Frankfurt und somit indirekt dem Zentralverband der Juden in Deutschland, der nichts dagegen tat, warf er dreckige Machenschaften vor: Veruntreuung von Wiedergutmachungsgeldern. Zu Recht, wie sich später herausstellen sollte. Jahrelang ging er gegen den Verein gerichtlich vor. Man warf ihm Nestbeschmutzung vor. Es dauerte lange, bis sich ein deutscher Rechtsanwalt fand, der den Mut hatte, einen internen jüdischen Fall zu behandeln. Aussichtslos. Mein Vater verlor, der Fall wurde zu den Akten gelegt. Verbittert zog er sich zurück.