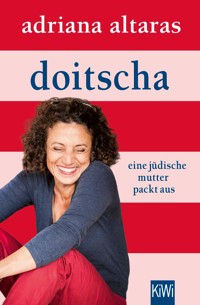
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein kluges, faszinierendes und vielstimmiges Porträt jüdisch-deutscher Gegenwart und ein unvergessliches Buch über Familie in all ihren tröstlichen und irrsinnigen Facetten. David wäre gerne Israeli. Er ist nicht nur hochbegabt, sondern auch hochpubertär und raunzt seinen westfälischen Vater beim Abendessen regelmäßig mit »Ey, Doitscha« an, was ebenso regelmäßig zum familiären Eklat führt. Deutscher zu sein, ist keine einfache Sache, gesteht Adriana Altaras, erst recht nicht in einer jüdischen Familie … Mit Aaron, Davids Patenonkel, ist Adriana Altaras seit ihrer Jugend befreundet. Sie wollten damals auswandern nach Israel, das für sie ähnlich verlockend war wie für die Surfer Hawaii. Doch sie blieben und nutzten das schlechte Gewissen der Deutschen, um umsonst Bahn zu fahren oder schulfrei zu bekommen. Als Aaron stirbt, spitzt sich der Generationenkonflikt in der Familie Altaras zu. David hält nichts mehr in Berlin, er verabschiedet sich kurzerhand ins Gelobte Land, und die Erzählerin reist hinterher – auf der Suche nach dem verlorenen Sohn zwischen Klagemauer, Kibbuz und See Genezareth. In Titos Brille, von den Lesern geliebt und von der Presse gefeiert, hat sich die Autorin der Geschichte ihrer Vorfahren gewidmet. Leidenschaftlich, mitreißend und witzig erzählt sie nun mitten aus dem jüdischen Leben heute in Deutschland. Vom Jüngsten, der lieber »Germany`s next Topmodel« sähe, als zuzuschauen, wie sich seine Mutter in Talkshows über die Beschneidung und die »schönen Schmocks« ihrer Söhne auslässt. Von tragikomischen Identitäts- und Religionskonflikten, die sich an einer rissigen Salatschüssel entzünden, von unkonventionellen Gedenkreden, vom Erben und Vererben. Und nicht nur das: Die ganze Familie kommt zu Wort, das ganze Tohuwabohu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Adriana Altaras
Doitscha
Eine jüdische Mutter packt aus
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Adriana Altaras
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Adriana Altaras
Adriana Altaras wurde 1960 in Zagreb geboren, lebte ab 1964 in Italien, später in Deutschland. Sie studierte Schauspiel in Berlin und New York, spielte in Film- und Fernsehproduktionen und inszeniert seit den Neunzigerjahren an Schauspiel- und Opernhäusern. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den Bundesfilmpreis, den Theaterpreis des Landes Nordrhein-Westfalen, den Silbernen Bären für schauspielerische Leistungen und den Deutschen Hörbuchpreis. 2012 erschien ihr Bestseller »Titos Brille«, 2014 folgte »Doitscha – Eine jüdische Mutter packt aus«, 2017 »Das Meer und ich waren im besten Alter«, 2018 »Die jüdische Souffleuse« und 2023 »Besser allein als in schlechter Gesellschaft«. Adriana Altaras lebt in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
David wäre gerne Israeli. Seinen westfälischen Vater raunzt regelmäßig mit »Ey, Doitscha« an, was ebenso regelmäßig zum familiären Eklat führt. Deutscher zu sein, ist wirklich nicht einfach, gesteht Adriana Altaras, erst recht nicht in einer jüdischen Familie.
Rasant, witzig und liebevoll erzählt sie in ihrem neuen Buch von den Turbulenzen der Second und Third Generation. Vom jüngeren Sohn, der Minigolf und Kirchen liebt und glaubt, er sei bei der Geburt vertauscht worden. Vom älteren, der seine Identität zwischen den Sopranos und dem Gelobten Land sucht. Von Geburtstagen an der Klagemauer und Cluburlauben mit Beschneidungsdiskussionen. Von tragikomischen Identitäts- und Religionskonflikten, von unkonventionellem Gedenken, von zu frühen Abschieden und der Kraft der Erinnerung.
Und nicht nur das: Die ganze Familie kommt zu Wort, das ganze Tohuwabohu.
Ein vielstimmiges, faszinierendes Porträt jüdisch-deutscher Gegenwart und ein hinreißendes Buch über Familie in all ihren tröstlichen und irrsinnigen Facetten.
»Wie frisch und wie mitreißend, wie unverbraucht und wie eigenwillig entfaltet Adriana Altaras ihre atemberaubend ereignisreiche Familiengeschichte.«
Die Zeit über Titos Brille
»Man möchte ihr stundenlang zuhören, so hinreißend kann sie erzählen.«
NDR über Titos Brille
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Kapitel »der partisan«: »Nicht allein« – Absolute Beginner
Musik: Jan Eißfeldt, Dennis Lisk, Guido Weiss
Text: Jan Eißfeldt, Dennis Lisk
Verlegt im: Sempex Musikverlag GmbH
© 2014, 2026, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Marco Hofschneider
ISBN978-3-462-30839-6
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Disclaimer
Motto
prolog
doitscha
der partisan
mini-golfer
unser mann aus dem münsterland
you ruined my auschwitz
wenn ich ein vöglein wär …
love and ignore
to do or not to do
bella giovinezza
so und nicht anders
aufstieg
godfather
uhlandstrasse
man briderl
tacheles
epizentrum
displaced persons
schlachtensee
geh-danken
showbizz
dreihundertfünfzig pinguine
the holy land
hotel atlantic
der club
frühschwimmertarif
welpenaffäre
die letzte stunde
steinsetzung
Dankeschön!
Zum Schutz von Personen wurden Namen und Orte zum Teil verändert und Handlungen, Ereignisse und Situationen an manchen Stellen modifiziert.
Die Juden sind ein Volk, das nicht schläft und andere nicht schlafen lässt.
Isaac Bashevis Singer
Ein Rheinländer trifft einen Westfalen, der einen Papagei auf der Schulter hat, und fragt ihn: »Kann der sprechen?« Sagt der Papagei: »Keine Ahnung.«
prolog
Na ja, sie waren nicht die ganze Zeit da, aber wirklich weg waren sie auch nicht. Sie haben nicht ununterbrochen Party gemacht, mit am Frühstückstisch gesessen oder sich neben mich unter die Bettdecke gekuschelt. Aber sie haben mitgeredet – wie eh und je: meine Dibbuks. Ich spreche von den Seelen der Toten, die den Lebenden keine Ruhe lassen und sie besonders gern nachts aufsuchen. Noch interessanter aber ist, dass sie inzwischen Gesellschaft bekommen haben: von den Lebenden. Genauer gesagt von den Seelen der Lebenden, die mir keine Ruhe lassen und mich nicht nur nachts, sondern jederzeit aufsuchen.
Ein buntes Treiben: Alle reden mit. Tote wie Lebende. Real und in Gedanken. Bei großen wie bei kleinen Entscheidungen, bei dem Kauf dieses oder jenes Kleides, bei der Wahl der Freunde, bei der Entscheidung, wann und wo Urlaub gemacht wird, bei der Ausbildung origineller Neurosen. Es soll ja Menschen geben, die ganz alleine Entscheidungen fällen dürfen. Wahnsinn!
Ich frage mich, wie andere Leute überhaupt einparken ohne diese zahlreichen persönlichen Assistenten.
Es ist, ich gebe es zu, keine ganz freiwillige Beziehung. Ich habe mich an sie gewöhnt, doch ein Leben ohne sie stelle ich mir auch sehr schön vor.
»Sie müssen sich in die Menschen, mit denen Sie in Ihrem Leben zu tun haben, hineinversetzen, ihre Gefühle, ihre Denkweise nachvollziehen«, schlägt Frau Dr. Luise ruhig vor. »Auch wenn es Ihnen nicht sonderlich liegt, versuchen Sie es wenigstens.«
Versetzen Sie sich da hinein und dort hinein. Dann werden Sie verstehen. Das ging schon die ganze Schauspielschulzeit über so. »Versetzen Sie sich doch mal in Lady Macbeth! Na, Adriana, was ist mit Ihnen? Versuchen Sie es doch wenigstens.Die Decke sinkt, der Fußboden ist Moor, die glühenden Wände rücken immer näher, es ist stockfinster, und Sie haben Blut an den Händen. Nun? Wie fühlt sich das an?«
Wie sich das anfühlt? Beschissen fühlt sich das an. Ich hätte schon damals mit der Schauspielerei aufhören sollen! (Das ist auch ein interessantes Thema, gehört aber nicht hierher.)
»Eines Tages werden Sie Ihr Dilemma verstehen und verändern können«, sagt Frau Dr. Luise. Hat die Nerven! Wer jemals mit diesem speziellen deutsch-jüdischen Dilemma zu tun gehabt hat, weiß, dass mit Sich-Einfühlen, Sich-Hineinversetzen in andere nicht das Geringste getan ist. Wetten?
doitscha
adriana
Mein Sohn David nennt seinen Vater »Doitscha«.
»Hey Doitscha! Komm mal runter, du Doitscha! Doitscha, entspann dich …« – und derlei Varianten mehr. Die Anlässe sind verschieden. Schlechte Laune, gute Laune, das Ergebnis klingt immer gleich: »Ey Doitscha, wie bist du denn drauf?«
Ich weiß, das ist nicht nur grammatikalisch fragwürdig, es ist auch komplett daneben.
Das Ganze findet meist zur Abendbrotzeit statt, gegen zwanzig Uhr, eine Uhrzeit, zu der in Familien allgemein die Bombe zu ticken beginnt: Nach einem wie auch immer gearteten Arbeitstag muss man für ein gesundes Abendessen sorgen, Lateinvokabeln abhören, dem kleinen Sohn das Duschen schmackhaft machen. Georg, als Westfale in der Regel die Verkörperung edlen Stoizismus, haut auf den Tisch, dass die leckere Soße auf meine neue Bluse spritzt, und brüllt. Respekt klagt er ein und ein anderes Sprachniveau. Es folgt Geschrei auf beiden Seiten, mir vergeht der Appetit. Sammy, Davids jüngerer Bruder, verzieht sich in sein Zimmer. David setzt sich Kopfhörer auf, nimmt die Zeitung, schaltet auf stur.
»Es ist sowieso gesünder, mittags zu essen, als sich abends den Bauch vollzuschlagen«, seufze ich.
Das sei zwar richtig, verfehle aber das Thema, bemerkt Georg. Er stammt in vierter Generation aus einer Lehrerfamilie, das kann man nicht so schnell abschütteln. Aber er hat recht. »Doitscha« zu sein, ist an sich schon nicht einfach. »Doitscha« in einer jüdischen Enklave zu sein, ist doppelt bitter, weil der »Doitscha« dort weniger wert ist. Klar, das klingt absurd, ist absurd, und in dieser Deutlichkeit wird es natürlich von niemandem ausgesprochen – aber es ist, wie es ist.
Gutmeinende könnten nun anführen, dass sich das Verhältnis zwischen Juden und Deutschen mittlerweile zum Positiven gewendet haben müsste. Bald jähre sich zum siebzigsten Mal das Kriegsende, fast alle Überlebenden seien tot. Ein Neuanfang habe stattgefunden. Ja, ja, ja. Im Bundestag sicher, hier bei uns zu Hause ist von Kriegsende nichts zu spüren, und zu Hause, das ist die Realität.
Da Georg völlig richtig vermutet, ich würde im tiefsten Innern auch so denken, bekomme ich zur Strafe die Aufgabe, unserem Sohn klarzumachen, dass auch er zu mindestens fünfzig Prozent Deutscher ist. Das sei nun mal einfachste Genetik.
Da ich wiederum weiß, dass David gerade das nicht gerne hört – er wäre gerne Israeli oder zumindest hundert Prozent jüdisch –, gehen wir am nächsten Tag Sushi essen; wenn schon unangenehme Tätigkeiten, dann wenigstens in erlesener Umgebung.
Ich hole weit aus, Respekt und Dankbarkeit, bemühe das Alte Testament, das vierte Gebot »Du sollst Vater und Mutter ehren«. David winkt nicht nur gelangweilt ab, er grinst dabei auch noch, tappt nicht in die biblische Falle, stattdessen schlägt er mit den »deutschen Tugenden« um sich, von denen sein Vater seiner Meinung nach zu viele habe.
»Er ist zu ernst, zu verkrampft, stellt absurde Regeln auf, schweigt zu viel, kann nicht verlieren …«
»Sprichst du über dich?«
»Wo hast du nur diesen Menschen her?«, fragt er mich, ohne mit der Wimper zu zucken.
»David, Vorsicht, du gehst entschieden zu weit. Gestern …«
»Gestern wollte er nicht einsehen, dass vor Nixon noch Lyndon B. Johnson Präsident der USA war! Ich hasse ihn.«
Gestern kam schon bei der Vorspeise das Gespräch auf die USA und deren Gesundheitsreform, die wir natürlich befürworten, weswegen David sie zwangsläufig niedermachen musste. »Du bist ein neoliberaler Spießer«, hatte ich von mir gegeben, die Hauptspeise mit ins Wohnzimmer genommen und auf dem Sofa weitergegessen, wohin sich Sammy klugerweise bereits zurückgezogen hatte. David, den prinzipiell jede politische Diskussion auf Temperatur bringt, beschimpfte unvermindert seinen Vater, der tapfer und verbohrt am Tisch die Stellung hielt, als ideologisch verblödeten Hippie, weil er ab und zu mal den Namen »Marx« fallen lässt. Bei der Abfolge der US-Präsidenten war der Disput dann derart eskaliert, dass Sammy und ich die Lautstärke des Fernsehers auf Maximum drehen mussten. Johnson oder nicht Johnson war die Frage, beide verließen irgendwann schreiend den Raum, aus dem einen Zimmer hämmerte kurz darauf Schostakowitsch, aus dem anderen Absolute Beginner.
»Ich dachte, der Mann heißt Obama«, sagte Sammy. Wir starrten uns ratlos an, wahrscheinlich sind wir nicht amerikanophil genug.
David studiert ausgiebig die Sushi-Karte. Weniger nach dem Inhalt als nach dem Preisangebot. Ich würde meinen Chanukka-Leuchter darauf verwetten, dass er schlichtweg das Teuerste aussucht. Mit der Begründung, dass er die selbstverleugnende Bescheidenheit seines deutschen Vaters verabscheue …
»Kennedy, Johnson, dann Nixon.«
»Gut zu wissen«, sage ich. »Kann man sicher irgendwann mal gebrauchen.«
»Ein Schmock«, sagt David.
»Ihr seid euch nicht unähnlich«, erwidere ich möglichst gelassen.
»Nein! Ich und dieser Doitschprinzipienreiter? Niemals!«
»Von wem, meinst du, hast du deine sture Intelligenz?« Meine Stimme bekommt einen unangenehm schrillen Unterton. »Und deine überhöhten Ansprüche hast du auch original von deinem Vater geerbt. Schau mich an: Ich bin bescheiden und glücklich, obwohl ich von Clinton nur die Sexualvorlieben kenne und von Bush junior den Alkoholkonsum, egal in welcher historischen Reihenfolge … Meinst du, die Welt wird besser durch deine Rechthaberei?«
Ich habe mich in Rage geredet, jetzt gibt es kein Halten mehr. Eine Japanerin, die aussieht, als wäre sie soeben aus einem Manga-Heftchen gefallen, nimmt höflich die Bestellung entgegen. Ich bestelle Nr. 12 für dreizehn Euro, einen Sushi-Mix mit dem überzeugenden Namen »Hiroshima«. David denkt und denkt, das Manga-Mädchen wartet, ich warte, und dann fällt er seine Entscheidung. »Pearl Harbour Deluxe«. Kostenpunkt: fünfunddreißig Euro. Ein Schnäppchen, denn Miso-Suppe und ein Jasmin-Tee sind inklusive.
Nein, ich will nicht kleinlich sein, aber muss es immer das Teuerste sein? Ist Luxus ein Geschmacksverstärker?
»Wieso hast du immer noch nicht begriffen, dass man, nein, dass ich das Geld erst einmal verdienen muss? Das heißt: morgens aufstehen …«
»Wer vor neun Uhr auf der Straße ist, ist ein Nichts und wird nie etwas werden. Baron de Rothschild«, entgegnet David mit arrogantem Lächeln.
»Du bist noch Meilen von Herrn Rothschild entfernt, mein Freund!«, presse ich durch die Lippen, während die ersten von Davids dreihundert Sushis aufgetischt werden. »Wenn du ein Taxi auf Italienisch, Englisch oder Hebräisch bestellen sollst, kneifst du, weil du es nicht perfekt kannst, und gehst stattdessen lieber zu Fuß. Du sollst nicht Dante, Rabbi Löw oder Shakespeare rezitieren, du sollst nur ein Taxi bestellen! Jeder x-beliebige Jude kann das in neun Sprachen. Frag mal Familie Dreyfuss! Vielleicht nicht akzentfrei, aber der ewige Jude erreicht immer den Bahnhof. Wenn man nicht in mehreren Sprachen fliehen kann, ist man auch kein Jude. Du bist so deutsch, dass es brummt! Wahrscheinlich wärst du der Erste in Stalingrad gewesen, so militant wie du dich gibst …«
Das wollte ich nicht sagen, vor allem nicht so laut. Pädagogisch vermutlich auch nicht allzu wertvoll, auf jeden Fall ungeschickt. Aber mal ehrlich: David muss noch eine Menge üben, bis er es zu einem Eins-a-Juden bringt.
Er starrt mich an, ein Inside-out-Röllchen auf halbem Wege zwischen Mund und Kehle. Die Gäste an den Nachbartischen tun sehr diskret, Miss Manga lächelt verwirrt. Pause. Stille. Dann mache ich weiter, vorsichtiger und etwas leiser:
»Jeder halbwegs normale Junge arbeitet sich an seinem Vater ab. Das ist bekannt, so weit, so gut. Nicht immer findet der Konflikt in dezenter, stilvoller Form statt. Muss er auch nicht. Oft geht es sogar sehr heftig zu, siehe Ödipus, auch das ist nichts Neues. Die Achtundsechziger marterten ihre Nazi-Väter, Gottfried Wagner musste sich bis zu seinem Komponisten-Großvater durchschuften und ihn – wenigstens literarisch – ermorden, alle Neueinwanderer schämten sich für ihre »primitiven« Eltern mit schlechten Manieren und noch schlechteren Deutschkenntnissen, und Stars werden von ihren Star-Kindern brutal mit allerlei peinlichen Details entthront. Nie war der durchschnittliche Ex-Kanzler-Sohn so weit oben auf der Bestsellerliste wie mit der Abrechnung über seinen schrecklichen Vater …«
»Du vergleichst mich jetzt nicht wirklich mit Kohl junior?«, stammelt David, immerhin kurzzeitig fassungslos. Das Soja-Fläschchen wackelt bedenklich am Tischrand. Ich schiebe es muttermäßig fürsorglich in die Mitte des Tischchens zurück, was David zur Weißglut bringt.
»Ich bin nicht mehr fünf! Die letzten drei kaputten Sojaflaschen gingen auf deine Rechnung, Mama!«, knurrt er beleidigt.
Wir widmen uns einige Minuten ausschließlich dem Essen. Mir kommt es so vor, als würde an den anderen Tischen vorsätzlich geschwiegen, um nichts von unserem Disput zu verpassen.
Also mache ich weiter, wir wollen ja niemanden enttäuschen, alte Bühnenregel. »Wenn meine Eltern nach Berlin kamen, um mich bei einer Premiere spielen zu sehen, trugen sie, egal zu welcher Jahreszeit, schwere Mäntel mit Pelzfütterung. Berlin liegt im Osten, kurz vor Wladiwostok, also ist es kalt, dachten sie. Auch die Ärmel waren gefüttert, deshalb standen ihre Arme ab, sie wirkten wie Pinguine auf dem falschen Kontinent. Nie zogen sie die Pelzmützen aus, auch nicht im überheizten Theatersaal. Ich konnte spielen, was und wo ich wollte: In der ersten Reihe saßen zuverlässig zwei Pelzmützen, Zuschauer wie Darsteller starrten ausschließlich auf sie, meine Pinguin-Eltern, als gehörten sie zur Inszenierung. Sie selbst fanden sich nicht peinlich. Hinterher luden sie das gesamte Ensemble zum Essen ein. Ja, auch dann blieben die russischen Pelzmützen auf ihren Köpfen. Wenn sie begeistert waren, wenn sie lobten, wenn sie gute Fragen stellten, wenn alle sie modern und cool fanden, wollte ich dennoch nicht ich sein, nicht dort, nicht in diesem Moment.«
»Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich«, seufzt David. »Es geht hier wahrlich nicht um den sympathischen Stamm der Pinguine, sondern um …«
Am Nachbartisch wird der Atem angehalten. Kann man denn in Berlin gar nichts mehr privat verhandeln?
»David, dein Vater ist Deutscher. Ich bin Jüdin. Nach dem alten Moses, das brauche ich dir ja nicht zu sagen, seid ihr beide, du und dein Bruder, natürlich Juden. Aber nach der modernen Genetik bist du fünfzig Prozent Deutscher, fünfzig Prozent Jude, ob du willst oder nicht. Und wenn du es noch so sehr bekämpfst, es wird sich nicht ändern. Es ist eine besondere Mischung auf einer, sagen wir »speziellen Basis«. Wenn ich einen Inder geheiratet hätte, wäre es vielleicht leichter. Aber letztlich gäb’s dich dann gar nicht … Dein Vater war weder an der Ostfront noch in der Hitlerjugend. Er kommt nicht einmal aus Münster, nur aus einem kleinen Dorf in der Nähe, und seine mörderische Neigung beschränkt sich auf das Töten von Mücken!« Ich rede und rede um mein Leben. Dabei fällt mir ein Theaterstück von Boris Vian ein, in dem eine Rolle namens »Schmürz« vorkommt. Ein Wesen, halb Mensch, halb Knäuel, komplett bandagiert, das in der Ecke steht und von allen Familienmitgliedern gelegentlich im Vorbeigehen geschlagen wird. Ganz beiläufig. Das wird, so gut es geht, heiter beschrieben, ohne Aufwand und große Tragik kriegt Schmürz sein Fett weg – leidet es, leidet es nicht? – Es sagt nichts, steht nur weiter in der Ecke. Ich kann mich nicht erinnern, wie das Drama endet. Ob Schmürz am Ende krepiert? Das Stück hat mir immer gut gefallen und ja, es erinnert mich an unseren Schmürz zu Hause, an unseren »Doitschen« …
Beim Reden habe ich mich inzwischen großräumig verheddert. Ich stottere und komme zum Halten. »No way out«, blinkt es über dem Ausgang. Die Gäste sind enttäuscht und verlangen die Rechnung. Ich kann von Glück reden, wenn ich sie nicht begleichen muss. David wiederum hat sich gefangen, verfolgt auf seinem iPad nebenbei die News auf Spiegel Online. Mit höchstens halbem Ohr hat er meinen Ausführungen gelauscht. Seine Fünfunddreißig-Euro-Sushi-Platte wird er halb gegessen stehen lassen.
Abends beim Tatort schlafe ich ein. Weder der Tatort noch ich sind das, was wir mal waren. Ich schleppe mich ins Bett, ohne abzuwarten, wer der Mörder ist.
Lärm weckt mich, Gepolter, das Licht geht an.
Vater und Sohn ringen miteinander. Sie fallen auf mein Bett, rollen sich ab, kämpfen auf dem Boden weiter. Beide sind außer sich, David knallrot, sein Vater kreidebleich, ich ziehe meine Füße und Beine aus dem Gefecht. Abwechselnd stürzen sie raus auf den Balkon und brüllen etwas wie »Ich bin der Stärkere«, dann geht es ungehemmt weiter. Es könnte unter Umständen fast komisch sein. Natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn Vater und Sohn sich prügeln. Aber das hier ist keine amtliche Schlägerei, eher ein Kräftemessen zwischen der Jugend und dem Alter, nicht ganz ungefährlich, mächtig archaisch. David in Boxershorts, obenherum nackt, sein Vater inzwischen auch ohne Hemd, das hat ihm sein Sohn vom Leibe gezerrt.
David schreit: »Ich hau ab! Mich seht ihr hier nie wieder!« Sein Vater brüllt: »Das wollen wir doch mal sehen!«
Während ich überlege, wie ich eingreifen könnte, ohne mich zu verletzen, klingelt es. Der Nachbar von gegenüber hat die Ordnungsmacht informiert, zwei Männer in kompletter Kampfuniform kommen die Treppen hoch. Kampfuniform? Was haben sie erwartet? Eine Erste-Mai-Demo im Berliner Zimmer? David versucht, an ihnen vorbeizurennen. »Wo willste denn hin, Kleena, in dem Aufzug? Musste uffpassen, kann hier in Schöneberg leicht falsch aufjefasst wern.« Sie bringen ihn zurück, passen selbst nur schräg durch die Tür, so bullig sind sie. Ich werfe einen Pullover über mein Negligé. Das hier ist kein Spaß, unten wartet vermutlich eine Wanne weiterer Ordnungshüter in voller Kampfausrüstung.
»Wie froh ich bin, dass die Yellow Press sich nicht für mich interessiert«, flöte ich entschuldigend den beiden Polizisten zu, die in Zeitlupe ihre Knüppel wegstecken.
Dann nehmen sich die beiden meine Männer vor, ich habe dort nichts mehr verloren. Es geht um Testosteron, wie samstags bei der Sportschau.
Vorsichtig mache ich die Tür zu Sammys Zimmer auf, er schläft selig wie ein Baby.
»Ich weiß, dass es eigentlich unter aller Kanone ist, wegen häuslicher Gewalt die Polizei im Haus zu haben. Aber was kann ich machen?«, frage ich unschuldig den Polizeibeamten.
Der türkisch-deutsche Kollege erklärt mir ausführlich, dass sie Anklage erheben könnten, eigentlich sogar müssten, es aber nicht täten, der Fall hier sei doch ganz klar. Der Junge wisse vor lauter Kraft und Unsicherheit nicht, wohin mit sich, der Vater ebenso wenig. Und in so »jemischten« Haushalten sei es nie ganz einfach, das sei normal, woher wir die schönen Möbel hätten?
Wie zuvorkommend und kompetent diese Berliner Polizisten doch sind. Wieso sind sie nicht schon bei einer früheren Gelegenheit vorbeigekommen? Im Wohnzimmer plaudert der polnisch-deutsche Polizist mit David und seinem Vater. »Det is der Psychologe, ick bin der Intellektuelle«, erklärt mir sein Kollege. Gleich werde ich anfangen, Pasta zu kochen, wenn es hier so nett und gemütlich weitergeht.
Ja, das sei nicht einfach, meint Emre, inzwischen sind wir beim Du, in einem deutsch-jüdischen Haushalt prallten sehr unterschiedliche Welten aufeinander. Das sei für die Kinder wie für die Erwachsenen eine echte Herausforderung. Er kenne sich aus mit dem »jemischten Zeuch«, seine Mutter sei Türkin, der Vater aus Steglitz. Im Bücherregal findet er mein Buch, geschmeichelt schenke ich es ihm, es ist das erste Mal, dass ich im Nachthemd signiere.
Seit Jahren schlagen wir uns mit Lehrern und Psychologen rum, und da kommen zwei Berliner Bullen mitten in der Nacht und bringen die Sache in drei einfachen Sätzen auf den Punkt.
Der Einsatzwagen wird informiert, die Krise ist deeskaliert, die Ordnungsmacht verabschiedet sich, wünscht eine gute Nacht. Was für nette Jungs doch bei der Polizei arbeiten!
Ich werde beim Regierenden Bürgermeister anrufen und mich für diese Engel in Uniform persönlich bedanken.
Vater und Sohn planen eine dreitägige Klausur, sie wollen sich aussprechen.
Emre bedankt sich am nächsten Morgen überschwänglich für das Buch. Irritiert stelle ich fest, dass er meine Mail-Adresse hat, woher nur? »Darf die Polizei das?«, schreibe ich ihm ahnungslos. »Die Polizei darf dies und viel mehr«, antwortet er mir. Ich fühle mich angenehm überwacht, was weiß und sieht er noch alles …?
Sammy ist sauer, dass er die nächtlichen Turbulenzen verschlafen hat. Zum Trost werden wir Minigolf spielen, bei McDonald’s fein essen und in der Schlossstraße shoppen gehen. Vielleicht treffe ich in Steglitz zufällig Emre, notfalls kann ich immer noch die 110 wählen.
der partisan
david
Paradies: Bett, Boxershorts, Musik. Keine Frage, Standard!
»Zieh dir was an, nimm die Kopfhörer runter, kannst du mal die Geräte für eine Sekunde aus der Hand legen, wie sieht’s denn hier aus? Hallo! Ich rede mit dir!«
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die Alten andauernd wollen. Leute, chillt ma, echt jetzt!
Meine Mutter steht in der Tür. Ich liege auf dem Bett, Handy in der Hand, Computer auf dem Schoß. Sie schubst mich, ich rücke zur Seite. Ich bin riesig im Vergleich zu ihr, reiche ihr die Kopfhörer, geiler Text:
Wenn alles Jacke wie Hose ist, dummes Rumgepose ist
Nix geheuer ist und alles zu teuer ist
Und über kurz oder lang alles gleich wird und träge
Durch dick und dünn, ohne Kollege
Nasebohrend vor’m Kühlschrank, der leer ist
Ich früher weit vorn und jetzt alles weit her ist
Keine Frau, kein Glück, kein Style, da »0190« … und so weiter
Freunde mir Raps stehlen, statt mit mir Pferde
Meine Mutter mich fragt, was ich werde![1]
Cooler Song. Kann man einfach nicht meckern. Safe.
Sie fragt, was das alles heißt, ich sage »Nicht allein« und »Absolute Beginner, egal, verstehst du eh nicht«, – dann ist sie schon wieder draußen, was war das denn für’n Auftritt? Dabei wollte sie bestimmt über gestern reden, sie will immer reden.
Ist es eigentlich Mittag? Oder schon Abend? Egal. Sonne satt. Vorsichtig zur Seite drehen, weiterdösen.
Aber ehrlich, der Alte ist doch gestört!
Ich gestern: extrem entspannt.
Er: steht da in der Tür wie ein Erziehungsberechtigter in den fünfziger Jahren.
Ich: doppelt ruhig, mach auf Sannyasin.
Er: »Wäsche aufhängen, mach dich mal nützlich, wir sind nicht dein Personal, weißt du überhaupt, wie spät es ist?«
Ich: »Ich vermute mal, es ist schon etwas später, weil die letzte Bahn weg war …«
Ich hänge die Wäsche auf, brauche dazu Musik, etwas lauter, versteht sich, sonst klingen die Bässe scheiße.
Er: »Die Musik ist öde, und wie siehst du überhaupt aus?«
»Das eine der zehn Biere war schlecht«, grinse ich, mein Vater grinst so was von gar nicht, wird rötlich, kenn ich. Wir sind beide Choleriker. Also, er zerrt an meinem Shirt, das reißt, Alter! Ich zerre an seinem Hemd, Knöpfe fliegen, Schwitzkasten, denkst wohl, ich wäre noch ein Kind? Er brüllt: »Ich bin stärker!« Ich brülle: »Schon lange nicht mehr«, und so weiter.
Ich renne ins Zimmer meiner Mutter, mache Licht, er schubst mich von hinten, Feigling! Stolpere aufs Bett, wir fighten.
Mutter erschrocken, ich brülle, Nachbarn auf den Balkonen, Fight geht weiter. Der Alte ist echt stark. Nicht stärker, aber voll okay. Macht irgendwie Spaß. Ich irgendwann raus, will weg, kommen zwei Bullen die Treppe hoch, schieben mich vor sich her, der eine voll wie Sil aus den Sopranos. Meine absolute Lieblingsserie, und diesmal spiele ich mit. Geil!
»Bürschchen, langsam, nur keene Eile, wo willsten hin, in ’ner Büchse ohne Hose? Hier im Kiez haste schneller mal wat drin, als de kieken kannst bei dem Outfit! Du setzt dir mal schön ruhich hin, und dann unterhalten wir beede uns mal nett, den Vatta nema dazu, und meen Kolleje kümmert sich um deene Mutta, klaro?!«
Ich hab denen ganz klar erklärt, dass mein Vater ein Tyrann ist. Und dass ich machen kann, was ich will und wann ich will.
»Bürschken, is doch nich deine Liga, machst een uff prollig, bist aba janz sicha wat Besseret. Sei froh! Warum dit falsche Jetue? Ihr beeden Jungs jeht jetzt ma schön schlafen – ne, keene Widarede, ooch nich von Vattern, Testosteron hin oder her, und morgen wird vernünftich jeredet, un jetzt is Feierabend. Schicht, klaro? Ick will ooch ma heim.«
Mein Alter ist tatsächlich schlafen gegangen, und jetzt soll ich mit zur Aussprache nach Regensburg, wo er an irgendeinem verschissenen Theater Musik macht. Zur Aussprache. Dass ich nicht lache!
Meine Mutter saß noch da, hat dann erst mal Espresso gemacht. Zeichen für Katastrophe, macht immer Espresso dann. Blass wie ’ne Leiche. Sich die Nächte um die Ohren zu schlagen, tut ihr nicht gut. Kann’s nicht ändern, ehrlich nicht, war auch hundemüde.
»Warum?«, wollte sie wissen, »wieso?«
Und ich hab angefangen zu heulen wie ein Cockerspaniel. Scheiße.
»Warum immer dieses Theater? Wie stellst du dir vor, soll das weitergehen? Eine Hand am Sack, die andere am Computer? Und dazwischen Stellungskriege mit deinem Vater?«
Bei dem Wort Krieg habe ich aufgehört zu heulen, hatte eine supergeile Idee.
»Ich werde Partisan! Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich mach hier nicht mehr den Bimbo für den Alten. Ich werde für Dinge kämpfen, für die es sich zu kämpfen lohnt!«, höre ich mich sagen, keine Ahnung, warum.
»Partisan?«, wiederholt meine Mutter fassungslos. »Hast du was genommen? Um diese Uhrzeit? Ohne Hose? Und überhaupt, was soll das heißen, kämpfen für Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt? Das sind doch leere Phrasen, wenn du beim Rausgehen den Müll …« Großer Fehler. Sie hätte einfach abwarten sollen, bis sich mein Gefühlsgewitter legt, aber so …
»Mama! Stop! Aus! Was das heißen soll? Ja, ja, ja! Ich bin jung, aber ich weiß Bescheid. Ich hab schon alles gesehen und erlebt hier in Berlin. Apropos Müll. Nein, das möchtest du nicht wissen! Die Clubs. Die Partys. Die Leute. Das ganze Programm. Die Türken gegen die Russen und die wiederum gegen die Araber. Meine Kumpels und ich dazwischen. Dazu diese zugezogene Schickeria. Kein Platz zum Atmen, alles voll. Was an einen normalen mittelbürgerlichen Jungen für Anforderungen gestellt werden, interessiert doch keinen! Lass mich! Ich werde Partisan und Schluss.«
Der Espresso blubbert, ist schon lange fertig. Kaffee, ihr Wunderheilmittel wie bei anderen Nivea oder Sagrotan.
»Lavazza-Maschinchen sind einfach die besten. Darauf zumindest können wir uns doch einigen: kein Stilterror, einfach nur Espresso. Der kleinste gemeinsame Nenner. Ausnahmsweise zwei Stück Zucker?«
Wenn sie mir so kommt, frage ich mich manchmal, ob sie noch alle Tassen im Schrank hat.
»Oder heute drei Stück?«, fragt sie munter weiter. Ganz arme Nummer.
»An einem Tag, an dem der Sohn zu den Brigaden geht, kommt es auf ein Stück Zucker mehr oder weniger wirklich nicht an. Mittelbürgerlich? Gibt es das überhaupt? Ich kenne nur klein- und großbürgerlich.«
Meine Augen werden relativ schmal, man könnte von Schlitzen sprechen.
»Es wäre sinnvoller, morgen nach der Schule weiterzumachen, ich bin so was von müde«, versuche ich einzulenken.
»Partisan, so so«, macht sie hemmungslos weiter, sie will mich nicht verstehen! »Aber in welchen Bergen überhaupt? Ist die Märkische Heide partisanentauglich? Zerrissene Jeans, knappe Boxershorts, geplatzte Chucks machen noch kein Heldenoutfit. Um welche Inhalte geht’s dir überhaupt: Cheeseburger für alle, Clubs geöffnet ab Schulschluss, Abschaffung des Abiturs, nieder mit den Vätern?«
Hört sie mir jemals richtig zu? Wie wär’s mit einem Schweigeseminar, Trappistenkloster in der Provence oder Sahara-Wanderung mit Beduinen?
»Sehr witzig, Mama! Heute schon mit Peter Lustig geduscht, wie? Deine berühmten Inhalte sind so was von verschnarcht. Sozialstaat. Wohngemeinschaften. Aufräumen. Struktur. Komplett überholt. Ja, da staunst du. Klar, du hältst mich für zu jung. Naiv. Kann sein. Aber jetzt ist Zeit für Aufbruch. Da kann der Alte noch so lange im Türrahmen stehen. Wirst schon sehen.«
Ich stehe auf, gehe raus und schlage die Wohnungstür hinter mir zu. Zum dritten Mal fällt die Glasscheibe aus der Fassung. Plexiglas würde sich in unserem Haushalt so was von anbieten. Aber auf mich hört ja keiner.
Vom Balkon aus schaut mir meine Mutter nach. Gute Figur machen. Belmondo oder so. Ich renne über die Straße. Es regnet, echtes Partisanenwetter.
Warum nimmt sie mich nicht ernst? Warum nimmt mich niemand ernst? Warum immer diese Ironie? Wo willst du Partisan werden? In Berlin? Mecklenburgische Seenplatte, Spreewald? Ich renne zurück, pitschnass brülle ich zum Balkon hoch: »Ich meine es ernst, Mama, und sag nicht, das sind die Spätfolgen, du kannst nicht alles darauf schieben! Der Krieg ist vorbei!«
mini-golfer
sammy
Echt? Die Polizei war da? Heute Nacht? Und ich habe nichts gehört. Mist. Ich hab geschlafen. Waren die in Schusswesten? Sondereinsatzkommando? Haben die geschossen? Ist das cool! Und ich schlafe! Aber mein Bruder macht ständig Remmidemmi, da kann man sich ja nicht immer den Wecker stellen, oder?
Mama sagt, David und ich würden uns sehr ähnlich sehen und deshalb hätte sie nicht noch mehr Kinder bekommen, denn es liefe ja wohl immer auf das Gleiche hinaus. In den alten Fotoalben finde ich auch, dass wir gleich aussehen, so mit Wollleibchen und so. Aber da sehen ja alle gleich aus. Alle Babys, die auf dem Bauch liegen, sehen aus wie Babys, die auf dem Bauch liegen. Oder wie kleine Robben. Und bei den Fotos von der Beschneidung ist es derselbe Mohel, meine Mutter ist genauso verheult, und Papa gräbt auf fast allen Fotos irgendwie in Blumentöpfen die Erde um. Er hat mir erklärt, dass er da gerade die Vorhaut auf dem Balkon verstaut. Das gehöre sich so. Also ist auch da alles gleich.
Aber innerlich sind wir nicht gleich, mein Bruder und ich. Gar nicht.
David ist megaeitel. Okay, er sieht super aus, mit Sixpack und so. Aber ich bin viel sympathischer, sagen alle. Bei Getränke Hoffmann, wo ich immer im Türrahmen meine Größe messe, sagen die Jungs, David sei der Schönling und ich der Sympathieträger.
David hat zweimal eine Klasse übersprungen, ich nur einmal. Echt, der muss immer übertreiben. Aber seine Intelligenz ist kalt, und ich habe viel mehr Einfühlungsvermögen, sagt Oma immer. Er weiß ja noch nicht mal, wie der Frühling riecht. Wetten?!
Mama, die auf einer Waldorfschule war, sagt, die Antosopofen behaupten, man suche sich die Familie aus, in die man hineingeboren werden möchte. Das glaube ich nicht. Manchmal glaube ich nämlich, ich würde woanders viel besser reinpassen. Vielleicht ist ja bei mir ein Fehler passiert?
Mama sagt, sie und Papa hätten mit einem Hund geprobt. Es wäre ganz einfach gewesen, dem Hund »Toter Mann« beizubringen. Wenn das so leicht geht mit der Erziehung, dachten sie, kann man auch eine Tochter bekommen. Die Tochter war ein Sohn und machte alles, nur nie »Toter Mann«. Nach ein paar Jahren erinnerten sie sich nicht mehr an die Anstrengungen, sagt Mama. Sie wurde wieder schwanger, und David wurde von mir entthront, was er mir bis heute übel nimmt.
Ich weiß, es klingt ein bisschen komisch, aber nirgends kann ich hingehen, ohne dass ich etwas geschenkt bekomme. Lollis, Schokolade, Freitickets, Fußbälle. Ich lächele, und die Welt liegt mir zu Füßen. Is so.
David beobachtet das, klaut von meinen Süßigkeiten, kapiert aber nichts. Wozu dann zwei Klassen überspringen, wenn man so einfache Sachen nicht begreift? Wie kann man so schlau und gleichzeitig so blöd sein?
Gestern zum Beispiel war wieder Krieg beim Abendessen: Papa und David brüllen sich tierisch an wegen irgendwelcher Präsidenten. Mama schiebt die Gläser in die Mitte des Tisches, wir haben nicht mehr viele … Es gibt Kartoffelpüree, eins meiner Lieblingsessen, ich nehme mir unbemerkt das letzte Schnitzel, grinse zu meiner Mutter rüber, schon mal den Begriff Stratelogie gehört? David bräuchte nur zu lächeln und zu nicken, und wir wären beim Nachtisch und könnten schnell zurück an den Computer. Wieso kann er das nicht?
Papa hat gesagt, dass Mama, als ich noch ein Kleinkind war, jedem erzählt hat, ich müsse wohl behindert sein, so fröhlich, wie ich immer sei. Danach habe sie besonders laut hinzugefügt: »So etwas darf man in Deutschland aber nicht einmal denken, bei der Vergangenheit ist das ganz klar politisch inkoherrent.«
Ich bin einfach zufrieden. Ist das so schlimm?
Wenn wir schon dabei sind: Ja, ich mag Kirchen, noch lieber Kathedralen, Backen finde ich gut, und ich habe mich in der Schule freiwillig für Latein und Griechisch entschieden. Französisch ist komplett out. Außer in Afrika, aber da lebe ich ja nicht. Mein Zimmer ist ordentlich, meine T-Shirts sind gefaltet. David sagt: Peinlich! Was bitteschön ist daran peinlich? Warum soll es cool sein, wenn das Zimmer aussieht wie bei den Messies von RTL? Vor dem Schlafen lege ich meine Anziehsachen für den nächsten Tag raus. Reine Organisation, David. Dann geht’s morgens schneller, Penner! Im Grunewald spiele ich Hockey, in Wilmersdorf Geige, ich frage Mama, wie es ihr geht, und finde ihr Kleid hübsch. Allerdings werde ich nächste Woche von Geige auf Trompete wechseln, Big-Band statt Orchester, klingt cooler, oder?
Bin ich deutscher als David? Vielleicht mehr als fünfzig Prozent? Vertauscht bei der Geburt im Martin-Luther-Krankenhaus? Bin ich ein heimlicher Nachkomme der von Weizsäckers? Das waren nämlich die guten Deutschen, auch bei den Nazis – allerdings nicht ganz unumstritten –, machen wir gerade in Geschichte.
Keine Ahnung, ich hab’s einfach leichter. Ehrlich. David sagt, er hätte es sauschwer gehabt als Erstgeborener, er durfte erst nach der Einschulung sein erstes Kaugummi kauen. Bitter! Ich hatte schon eins, da wurde ich noch gestillt. Ähnlich war’s mit Fernsehgucken, Cola, Döner. Warte ab, sagen Mamas Freundinnen, noch ist Sammy klein, aber wenn er erst mal fünfzehn wird … Aber egal, wie ich werde, ich werde nie wie David, klar?!
Was ich aber eigentlich wirklich erzählen wollte, ist: Am allermeisten liebe ich Minigolf!
Ich kenne die Öffnungszeiten der Anlage auswendig. Heute ist Mama fällig, auch wenn es nicht ihr Lieblingssport ist. Sie kommt abgehetzt von ihrer Therapeutin, sie sagt, sie zahlt fünfundneunzig Euro die Stunde, und die Therapeutin würde die ganze Zeit schweigen. Dafür hat sie aber einen Doktortitel und ewig lange studiert. Mama ist entweder in der Therapie oder im Theater. Jedenfalls murmelt sie jetzt etwas von »ist heute nicht mein Tag«.
Ist es nie beim Minigolf. Ich treffe meistens mit ein bis drei Schlägen. Mama bekommt schon in der ersten Runde sieben Punkte, denn wenn man es mit sechs Schlägen nicht geschafft hat, gilt die Höchststrafe: sieben Punkte. Sie ist daran gewöhnt zu verlieren, auch bei Memory, Kicker und Billard.
Ich hasse es, wenn sie versucht, ein Loch auszulassen, wie jetzt schon wieder. Papa sagt, Mama sei regelresistent. »Mama! Wozu gibt es denn Regeln, wenn man sie nicht ernst nimmt?«
»Du bist deutscher als dein Vater. Ob das an Wagner liegt?«
»Mama, nicht schon wieder Wagner!«
»Nicht alles liegt an Wagner, so wichtig ist er auch nicht, aber deine germanische Ader ließe sich auf ihn zurückführen, du weißt doch, bei deiner Geburt …«
Nicht schon wieder diese Geschichte! Es ist nicht zu fassen. »Hab ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Als dein Bruder geboren wurde, musste ich das erste Mal notoperiert werden, er war vierzehn Tage überfällig und passte nicht durch, schließlich zog man ihn raus, ob er wollte oder nicht.«
Ich finde es ekelig, wenn Mama mir solche Sachen erzählt, und dann auch noch so laut, dass es bis Loch fünfzehn zu hören ist.
»Ich hatte ja schon immer den Verdacht, dass das mit dem natürlichen Gebären eine Farce ist. Kaiserschnitt ist in Deutschland verpönt, zumindest in bestimmten Kreisen. Eine deutsche Frau kann von klein auf Marmelade einkochen, Homöopathie und natürlich gebären. Ich kann nichts davon.«
Argh! Gleich wird sie in aller Ausführlichkeit vor allen anderen Minigolfspielern über meine Geburt sprechen. Wetten? Wie ich das hasse! »Mama! Du bist dran!«
»Nicht vor Monatsende rausholen, hatte meine Astrologin warnend bei dir verkündet. Erst ab dem Einunddreißigsten, zwölf Uhr, wird er zu einem glücklichen Menschen.«
Hab ich’s nicht gesagt?!
»Der Kreißsaal war vorbereitet, alle Anwesenden in lindgrünen OP-Kitteln, ich hatte schon das Plastikhäubchen auf, als ein Notfall hereingebracht wurde. Ich wurde mit meinem dicken Bauch zurück auf den Flur geschoben, wo ich festgezurrt auf der Liege warten sollte. Und jetzt kommt’s. Um mich abzulenken, fiel deinem Vater nichts Besseres ein, als mich über Wagner aufzuklären. Und ich schwör dir, das hat dich mehr geprägt als jedes meiner jüdischen Gene!«
Mama merkt gar nicht, dass ich schon drei Löcher Vorsprung habe … Sie redet einfach weiter, wahrscheinlich um zu überspielen, dass sie noch kein einziges Loch ohne Strafpunkte geschafft hat. Gleich wird sie wieder versuchen zu schummeln. Aber ich pass auf wie ein Luchs.
»Wagner war ein merkwürdiger Typ. Ein Genie wahrscheinlich, aber ganz sicher ein Riesenarschloch. Trotz seiner Begabung ein unsicherer Mensch. Konkurrenz konnte er nicht ertragen. Er wollte Erfolg haben wie Meyerbeer, wie Mendelssohn … dummerweise alles Juden. Aus dem Exil heraus arbeitete er zäh daran, sich eine Gemeinde zu schaffen. Seine Musik sollte man nicht nur hören und gut finden, man sollte an sie glauben. Als Gegenleistung würde er seine Anhänger mit seiner Kunst aus dem schnöden und gemeinen Leben herausführen, sie zu Höherem erlösen. Das kam den Deutschen in ihrer großen Sehnsucht nach Glauben und Erlösung sehr entgegen. Es gibt in seiner Musik Momente von großem Zauber. Der Mann hat halt komponiert wie niemand vor ihm …«
Mama brüllt inzwischen über vier Löcher hinweg, damit ich sie auch gut hören kann. Wenn es einen Guinness-Rekord für peinliche Mütter gäbe, wäre meine auf Platz 1: Germany’s Next Topmutti.
»Was hätte er für schöne Ensembles schreiben können! Stattdessen immer wieder unendlich lange Soli. Manisch. Monomanisch. Zutritt nur für Eingeweihte. Rudolf Steiner nicht unähnlich, mit Stefan George vergleichbar. Der Deutsche braucht Jüngerschaft, jedes rätselhafte Wort gibt ihm neue Nahrung: Die Führer und ihr ewiges Geheimnis. Darum darf es auch nicht allzu konkret werden. Woran man dabei glaubt, ist gar nicht mehr wichtig, der Glaube selbst ist der Inhalt. Übrigens gehört natürlich zu gebären auch zu diesen Glaubenssätzen …«
Ich bin fertig mit dem Parcours. Rekordergebnis. Ich könnte jetzt einfach den Vordruck für die Jahresdauerkarte ausfüllen, dann könnten wir so oft auf den Platz kommen, wie wir wollen. Mit etwas Glück redet Mama einfach weiter und merkt gar nicht, was sie unterschreibt.
»So viel wie über Wagner hatte ich deinen Vater in unserer bis dato zwölfjährigen Geschichte nie am Stück sprechen hören.«
»Mama! Spiel doch bitte einfach zu Ende.«
Wir sind hier nicht im Kreißsaal, sondern auf dem Minigolfplatz! Also mach endlich! Wahrscheinlich kann ich von Glück reden, dass ich nicht Richard heiße, Tristan oder Siegfried. Sie sind cool, meine Eltern, aber auch nicht wirklich normal. Wenn ich das nächste Mal auf die Welt komme, wäre ich gerne bei den Eltern meines Freundes Paul. Die sind beim Rechnungshof. Essen pünktlich, haben einen Leasing-Wagen mit Aircondition und reden nicht dauernd über Kunst.
unser mann aus dem münsterland
georg
»Wieso sagst du nichts? Willst du nicht auch mal was sagen? Hörst du mich? Ich habe dich was gefragt! Oder brauchst du ein Libretto, um zu antworten?«
Meine Frau deckt den Tisch zum gemeinsamen Abendessen, am day after.





























