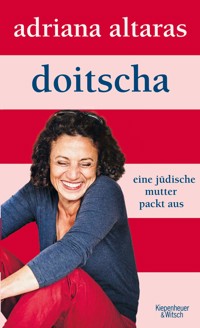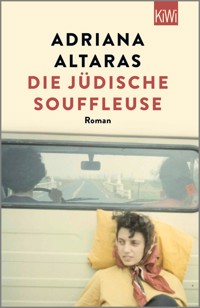
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Das Schicksal hat viel Humor.« Die Ich-Erzählerin dieses Romans heißt Adriana Altaras, und sie erzählt mit hinreißender Tragikomik von den Absurditäten des Theateralltags, von einer unverhofften Familienzusammenführung und davon, warum die Shoah, die Tragödie des 20. Jahrhunderts, das Epizentrum ihres Schaffens ist. Während der Proben zu Mozarts »Entführung aus dem Serail« entpuppt sich ausgerechnet die Souffleuse als größte Herausforderung. Susanne, genannt Sissele, hat Adrianas Bücher gelesen und ist davon überzeugt, dass nur sie ihr helfen kann. Jahrzehntelang hat Sissele vergeblich nach ihren Verwandten gesucht, die nach dem Zweiten Weltkrieg in alle Winde zerstreut wurden. Nun will sie einen letzten Versuch unternehmen – und Adriana Altaras muss mit! Auf einer abenteuerlichen Reise quer durch die Bundesrepublik verbinden sich Gegenwart und Vergangenheit, unvergessliche Geschichten vom Überleben mit jenen der Nachgeborenen. Ein mitreißendes und anrührendes Buch von tiefster Menschlichkeit. »›Die jüdische Souffleuse‹ erzählt mit Witz und Wärme von den Schatten der Vergangenheit.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Adriana Altaras
Die jüdische Souffleuse
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Adriana Altaras
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Adriana Altaras
Adriana Altaras wurde 1960 in Zagreb geboren, lebte ab 1964 in Italien, später in Deutschland. Sie studierte Schauspiel in Berlin und New York, spielte in Film- und Fernsehproduktionen und inszeniert seit den Neunzigerjahren an Schauspiel- und Opernhäusern. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Bundesfilmpreis, den Theaterpreis des Landes Nordrhein-Westfalen und den Silbernen Bären für schauspielerische Leistungen. 2012 erschien ihr Bestseller »Titos Brille«. 2014 folgte »Doitscha – Eine jüdische Mutter packt aus«, 2017 »Das Meer und ich waren im besten Alter«. Adriana Altaras lebt mit ihrer Familie in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Adriana Altaras, die Ich-Erzählerin dieses Romans, liebt es zu inszenieren – Opern, Theaterstücke, Komödien, Tragödien. Doch eines stellt sie immer wieder fest: Man muss Opfer dafür bringen. Wochenlang in der deutschen Einöde vor Anker gehen, das Heimweh in Süßsauer-Soße beim lokalen Chinesen ertränken, zweiundvierzig Namen und Lebensgeschichten binnen vierundzwanzig Stunden auswendig lernen, Zungenküsse auf der Bühne verbieten und gegebenenfalls sogar den Inspizienten aus dem Schnürboden befreien. Während der Proben zu Mozarts »Entführung aus dem Serail« entpuppt sich ausgerechnet die Souffleuse als größte Herausforderung. Susanne, genannt Sissele, hat Adrianas Bücher gelesen und ist davon überzeugt, dass nur sie ihr helfen kann. Jahrzehntelang hat Sissele vergeblich nach ihren Verwandten gesucht, die nach dem Zweiten Weltkrieg in alle Winde zerstreut wurden. Nun will sie einen letzten Versuch unternehmen – und Adriana Altaras muss mit! Auf einer abenteuerlichen Reise quer durch die Bundesrepublik verbinden sich Gegenwart und Vergangenheit. Ein mitreißendes und anrührendes Buch.
Inhaltsverzeichnis
Hinweise
Zum Buch
Widmung
Ich will mich nicht beklagen
Ich habe schlecht geschlafen
Immer lande ich in Städten
Als ich das Café betrete
Also: Die Konstanze aus ...
Susanne hat sich in eine Decke gewickelt
Ich habe die Abendprobe ausfallen lassen
Es regnet
Wie konnte das nur passieren?
Joggen statt schlafen heißt die Devise
Nach dem Joggen habe ich Robbi angerufen
Nicht nur im Leben, auch auf den Proben
Ungefähr eine Woche vor der Premiere
Premieren sind reine Nervensache
Für die Zeit nach einer Premiere
Ich bitte Sissele herein
Wir fahren in meinem Wagen
Die Nacht in Prag war anstrengend
Ich konnte Leben und Theater nie trennen
Seit Bayreuth stürmt es unaufhörlich
»Was denkst du?«
Etliche Monate sind seit Sisseles
»Tolstoi wollte nicht, dass Anna Karenina ...
Die Proben zu Anna Karenina
Nur mit Mühe habe ich Robbi dazu gebracht
Eine merkwürdige Melancholie
Sissele blieb verschollen
»Sie sieht aus wie Susanne!«
Die Aufregung um die beiden
Seit vierundzwanzig Stunden
Dank
Quellenverzeichnis
Adriana Altaras wurde während des Jahres 2017 für dieses Werk von der Guntram und Irene Rinke Stiftung im Rahmen des Projektes »TAGEWERK-Reihe« unterstützt.
Dieses Buch ist ein Roman. Einige seiner Charaktere haben Vor- und Urbilder in der Realität, doch ihre Beschreibungen und Handlungen sind fiktiv.
Meinen Kolleginnen und Kollegen und Sissele natürlich
Ich will mich nicht beklagen, aber wo immer ich mich gerade aufhalte, fangen die Menschen an, mir ihre Geschichten zu erzählen.
Es spielt keine Rolle, ob es regnet, ich mit vollen Einkaufstüten versuche, mein geparktes Auto zu erreichen, oder wie eine Irre renne, um das Flugzeug zu erwischen. Sie stellen sich mir fröhlich in den Weg und beginnen zu erzählen. Irgendwo habe ich mal gesagt, ich sei eine »Chronistin« unserer Zeit. Oder ich wäre gerne eine, oder etwas Ähnliches. Das hat sich herumgesprochen, jetzt bekomme ich Geschichten, ob ich will oder nicht.
Ich habe gelesen, im New Yorker Büro meines Idols, Isaac Bashevis Singer, seien täglich junge und alte Frauen oder Männer hereingeplatzt und hätten Ungeheuerliches auf Jiddisch berichtet, denn die meisten waren kürzlich aus dem Schtetl ausgewandert wie er. Ein Mann hatte sich auf der langen Überfahrt verliebt, aber ein Dybbuk hatte ihm die Braut gestohlen. Eine Frau hatte ihre Handtasche verloren, dann ihren Hut, ihre Schuhe, ihren Mantel und schließlich sich selbst.
Ich las die Berichte dieser gebeutelten Menschenkinder, die oft, aber nicht zwangsläufig unglücklich endeten, und fragte mich: Ist Bashevis ein genialer Erfinder oder haben ihm alle, wirklich alle ihre Lebensgeschichten erzählt?
Inzwischen glaube ich, alles ist wahr, er hat nur die Namen geändert, wegen der drohenden Klagen und der Anwälte, die es auch damals schon im Überfluss in New York gab. Ansonsten hat er bloß aufgeschrieben, was man ihm erzählte. Und je ehrlicher er war, desto absurder klangen seine Erzählungen.
Womit wir an einem heiklen Punkt wären, denn bei mir läuft das so: Wenn ich mich beim Schreiben bis ins kleinste Detail an die Wahrheit halte und nicht einen Funken hinzudichte, sind meine Leser überzeugt, ich würde fantasieren. Wenn ich etwas hinzuerfinde, zucken sie nicht mit der Wimper und halten es für die reine Wahrheit.
Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob das, was ich schreibe, soeben passiert ist oder ob es sich um Geschichten aus der vergangenen Welt handelt. Ob meine Protagonisten in einem ICE, in der Kantine des Opernhauses oder als Überlebende der Shoa um Mitternacht neben mir in einer Talkrunde sitzen. Je ehrlicher ich ihre Berichte wiedergebe, desto weniger glaubt mir irgendjemand. Sobald ich das eine oder andere oder sogar alles erfinde, sind meine Leser überzeugt, so, nur so könne die Wahrheit sein.
Deshalb habe ich beschlossen, mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Opern zu inszenieren, ist zum Beispiel sehr ehrenwert. Ich muss allerdings eine letzte Ausnahme machen, mein Freund Robbi hat mich darum gebeten. Er lebt in Israel und hat schon so ziemlich alles erlebt, aber etwas wie diese Geschichte noch nie. Ihm zuliebe mache ich eine allerletzte Ausnahme.
*
Ich habe schlecht geschlafen. Zwar war das Fenster die ganze Nacht offen, aber es bleibt stickig und schwül. Abends habe ich es mir notdürftig gemütlich gemacht, Musik und Kerzen, nur noch sechs Wochen, nur noch sechs Wochen, dann darfst du wieder nach Hause, habe ich als Mantra vor mich hin gemurmelt und dabei aus dem Fenster auf die Kfz-Werkstatt und den Aldi-Parkplatz geschaut.
Ich liebe meinen Beruf. Angefangen habe ich als Schauspielerin, dann wurde ich Theaterregisseurin, später kam die Oper dazu. Mein Vater sagte immer: »Alle guten Nutten werden irgendwann einmal Puffmütter.« Nun ja, sein spezieller Humor … Heute würde ihn dafür die Frauenbeauftragte zum Frühstück verspeisen.
Ich liebe es, Opern zu inszenieren. Es gibt nichts Schöneres als Musik. Die Oper ist das opulenteste Fach im Theater, eine Art Königsklasse. Aber es ist schon eine echte Prüfung, sonntagabends in einer mittelgroßen deutschen Stadt vor Anker gehen zu müssen. Leere. Einöde. Die Innenstadt: ein Konzentrat des Nachkriegsdeutschlands. Nur ein paar Heimatlose wie ich irren vom Bahnhof in die Fußgängerzone. Wenn man Glück hat, hat der Chinese geöffnet, und man kann sein Heimweh in Süß-Sauer-Soße ertränken.
Ich verstehe nicht, dass den Theatern Folgendes nicht klar ist: Wenn sie ihre Gastregisseure angenehm unterbrächten, wären diese glücklicher, würden bessere Leistungen vollbringen, die Produktionen bekämen durchschlagendes Format, das Publikum wäre begeistert, alle Vorstellungen wären ausverkauft, die Theater hätten mehr Einnahmen, ihre Bilanzen würden auch die kulturfeindlichsten Senatoren überzeugen, die viel beschworene Theaterkrise wäre ein für alle Mal vom Tisch. Stattdessen stellen sie einem die trostlosesten Unterkünfte zur Verfügung. Man sei doch sowieso die meiste Zeit im Theater.
Mein Buddha steht neben meiner Zahnbürste, er wird es schon richten, keine Zeit mehr für Larmoyanz. Theater ist zu vierzig Prozent Talent, der Rest sind Disziplin, Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen – die drei großen »Ds« des deutschen Theaters.
Diesmal hat man mich für Die Entführung aus dem Serail engagiert. Alle, denen ich in den letzten Wochen davon erzählt habe, haben verzückt gelächelt. Ach! Mozart! Ach! Die Entführung! Das Schönste auf Erden. Es ist mein erster Mozart, und noch hat keine Ekstase von mir Besitz ergriffen.
Die Handlung geht ungefähr so: Wir befinden uns mitten im 16. Jahrhundert. Die Spanierin Konstanze wird mitsamt ihrer englischen Zofe Blondchen und deren Freund, dem Diener Pedrillo, von Seeräubern entführt, von ihrem Verlobten, dem Edelmann Belmonte, getrennt und auf dem Sklavenmarkt verkauft. Zum Glück kauft sie der orientalische Herrscher Bassa Selim, ein gebürtiger Spanier und Christ, jetzt Muslim, und bringt sie in sein Serail, in dem er einen Harem hält. Das nenne ich mal ein konsequent globalisiertes Personal!
Dort werden sie vom perfiden Osmin bewacht – einem Diener Bassa Selims. Osmin verliebt sich in die Zofe Blondchen und Bassa Selim verliebt sich in Konstanze. Als gäbe es vor Ort, in ihrem Harem, keine anderen Frauen.
Endlich erfährt Belmonte durch einen Brief seines Dieners Pedrillo, wo die Entführten stecken, kommt angesegelt und ist fest entschlossen, sie zu befreien.
Zehn Uhr, Konzeptionsprobe im Probensaal A, drei Stockwerke unter Tage. Draußen sind es mittlerweile 27, im Keller 8 Grad, die Klimaanlage lässt sich nicht regulieren. Ich stelle mein Konzept in Schal und Mütze vor. Siebzig Augenpaare schauen mich an: Sänger und Sängerinnen, Dramaturgie, Regieassistenz, Schneiderei, Beleuchtung, Bühnentechnik, Requisite, Souffleuse, Ankleiderinnen. Ich hoffe, keinen Rest Joghurt an der Lippe zu haben.
Die Gewerke wirken müde, hängen schlaff auf ihren Stühlen, die Zeichnungen mit den Figurinen der einzelnen Rollen schief an der Wand. Ich rede um mein Leben. Vom Chor kein Lächeln, keine Reaktion, kein Lebenszeichen – ich finde, es ist eine beachtliche Leistung, so lange auszuhalten, ohne zu atmen.
Ich habe gelernt, mich davon nicht verunsichern zu lassen, atme und lächele für sie alle mit, frage mich gleichzeitig, warum ich noch gleich diesen Beruf ausüben wollte?
Die Solisten in der ersten Reihe nicken immerhin.
Meistens ist es so: Die große Blondine ist der Sopran, die rassige Dunkle der Mezzo, die Koreanerin hat die Hosenrolle, der kleine Koreaner ist Tenor, der Kräftige, Schläfrige der Bass, und der Einzige, der flirtet, ist der Bariton.
In der Entführung aus dem Serail gibt es keine Hosenrolle, keinen Mezzo und auch keinen Bariton, aber alle nicken sie brav. Erst im Laufe der nächsten Tage werde ich erfahren, ob irgendwer meinen Ausführungen annähernd folgen konnte.
Gott sei Dank bin ich nicht ganz alleine in der Fremde. Bühne und Kostüme sind die Gewerke, die ich selbst auswählen und mitbringen durfte. Darum sind Nora und Elio dabei. Wir sind eine verschworene Gemeinschaft, gehen gemeinsam unter oder steigen in den kreativen Götterhimmel auf. Über die Jahre sind wir schon in vielen Opernhäusern zusammengekommen, wir haben uns im Schlafanzug gesehen, betrunken oder verweint.
Elio ist aus Bordeaux, feinsinnig, ein begnadeter Bühnenbildner und daher sehr gefragt. Nora, Russin, geistreich, ebenfalls schwer begabt, eher der Typ Zarentochter. Die Kostümabteilung stöhnt unter ihren Ansprüchen.
Nach meinen Ausführungen haben Nora und Elio das Wort. Sie erklären, warum wir uns die Bühne und Kostüme so und nicht anders vorstellen. Die Solisten aber wollen gut aussehen, und die Bühne soll sich bitte sehr leise drehen. Wir nicken. Natürlich, natürlich …
In der Pause bleibe ich stoisch im Probenraum, obwohl ich meinen deutschen Pass für einen Espresso hergäbe, und plaudere mit den Damen und Herren des Chores. Mein Namensgedächtnis ist eine Katastrophe, aber ich lege mich ins Zeug, dem besten Tipp folgend, den mein Freund Uwe, seines Zeichens erfolgreicher Opernregisseur, mir je gegeben hat: Lern die Namen der Chormitglieder als Erstes!
Also frage ich Vessela und Borjana, Wilislawa, Nasko, Vesko und Jurij, was sie von Mozart halten und woher sie kommen. An diesem Haus stammen die meisten aus Moldawien, Mazedonien oder Albanien, Länder, die noch bis vor wenigen Jahren keine Autonomie besaßen und auf den Namen »Balkan« hören. Also spreche ich beherzt Serbokroatisch, wenn sie mein Deutsch nicht verstehen. Das Serbokroatische hat mit dem Rumänischen, also Moldawischen, genauso wenig zu tun wie das Deutsche, aber ich will ihnen zeigen, dass auch ich von »woanders« komme und »Marschall Tito« praktisch unser aller Patenonkel war. Vielleicht bleiben Dubrovka, Almerija, Ninoslava, Jossip, Ivica und Pjotr mir gegenüber deshalb so höflich. Ich habe den »Ostblock-Bonus«.
Nach der Pause weiß ich bereits, wer aus welchem Dorf kommt, wer Würste einmacht oder im Keller Sliwowitz brennt. »In meinem letzten Opernhaus kam der Chor größtenteils aus der Ukraine«, sage ich, »hier also aus Bulgarien. Hat einer von euch das restliche Dorf nachgeholt?« Mein Scherz kommt mäßig an, also wende ich mich den Koreanern zu.
Es gibt an jedem Opernhaus eine mehr oder weniger große Gruppe von Koreanern. Ich werde nie begreifen, wieso diese Menschen, auf der anderen Seite der Erde sozialisiert, meinen Humor verstehen. Ich mache einen Witz, in ihren Gesichtern keine Regung. Später bei den Proben jedoch werden sie jede Pointe, die ich ihnen erklärt habe, jede auch nur mögliche komische Wendung punktgenau erwischen. Korea – Land der getarnten Witzbolde!
Die Pause ist fast zu Ende, als eine Frau auf mich zukommt. »Ich bin die Souffleuse«, sagt sie leise nuschelnd, »ich heiße Susanne.« Wie kann ein Mensch mit einer kaum verständlichen Aussprache Souffleuse sein?, denke ich.
Sie muss um die sechzig sein – ihre blonden Locken gehen stellenweise in Grau über. Sie ist sehr gepflegt, auf ihrer hellen Haut tanzen Sommersprossen, ihre blassen grauen Augen schauen mich forschend an, sie war mal schön, denke ich, jetzt ist sie zu mager, jedenfalls für meinen Geschmack. Sie spürt meinen Blick, also sage ich schnell: »Freut mich, Susanne!« Sie sagt: »Mich auch!« Und dann lächelt sie gewinnend, um im nächsten Moment die Lippen aufeinanderzupressen und meine Hand mit erstaunlicher Kraft festzuhalten. »Ich müsste dann jetzt weitermachen.« Sie flüstert: »Natürlich«, lässt aber meine Hand nicht los. »Gleich ist der Chor zurück, und ich würde gerne eine kleine Szene anlegen, jetzt wo schon mal alle da sind, lernen wir uns direkt ein bisschen kennen.« – »Gute Idee!«, sagt sie und lässt meine Hand noch immer nicht los, schaut mich irgendwie traurig an. Ich sage: »Die Hand, Susanne, die Hand, die bräuchte ich dann jetzt …« – »Entschuldigung, Entschuldigung!«, murmelt sie, wird rot und lässt endlich los.
»Es ist doch erstaunlich, welche Leute im Theater Unterschlupf finden«, flüstert mir Nora zu. Ich strecke den Rücken durch und wende mich lächelnd wieder der Probe zu.
Der Chor hat sich derweil auf der gesamten Probebühne verteilt und gemütlich niedergelassen. Ich bitte alle aufzustehen, was sie sehr ungern tun, aber genau darum geht es: Ich muss meine Autorität gleich zu Beginn beweisen, sonst kann ich die nächsten Wochen komplett vergessen.
Sie alle haben Carmen,Maskenball und Barbier schon mindestens vier Mal gesungen, von der Entführung ganz zu schweigen. Sie kennen das Repertoire und die Materie sehr viel länger als ich und wollen austesten, was ich so draufhabe. Es ist eine Art Feuertaufe, manchmal auch Spießrutenlauf. Zimperlich sind sie nicht. Ich muss sie irgendwie überzeugen, meine Ideen zu probieren, entweder durch Qualität oder durch meine Person.
Mein Freund Uwe sagt auch, man könne nur sieben Menschen gleichzeitig richtig wahrnehmen. Da frage ich mich: Was passiert in der Zeit mit den restlichen dreiunddreißig? Unterhalten sie sich währenddessen mit dem Nachbarn, spielen auf dem Smartphone, schlafen, anstatt zu singen?
Deshalb bitte ich sie, gleich draufloszuspielen, zu improvisieren. Das Thema: Kündigung. Der Intendant plane, dem einen oder anderen von ihnen zu kündigen, das löse Unsicherheit und Unruhe aus, die würde ich jetzt gerne auf der Bühne sehen.
»Das funktioniert beim Chor anders, es gibt schließlich den Kündigungsschutz«, erklärt mir der Chorvorstand ernst und alarmiert. Ich sage, ja, das wisse ich, wir würden ja auch nur »so tun, als ob« und lächle angestrengt. Bei der Entführung seien sie im gesamten Stück ja leider nur sehr kurz auf der Bühne, umso wichtiger sei es mir, dass man jeden Einzelnen wahrnehme, die beiden kurzen Auftritte müssten perfekt sitzen. Also: Bassa Selim wolle dem einen oder anderen nicht gerade kündigen, ihn dafür jedoch mitunter köpfen. Nun müssten sie jeder einzeln dafür sorgen, dass es den Nachbarn erwische und nicht sie … Musik, bitte!
Sie haben mich verstanden, sofort ist eine Menge los auf der Bühne: Sasko hat Vesko fest im Würgegriff, Ninoslawa liest Borjana die Zukunft aus der Hand, zwei Kims haben ihre Handys ausgepackt und telefonieren mit der NSA. Ich bin begeistert. Sie sehen nicht so perfekt aus wie die jungen Schauspieler, die sich alle ein wenig gleichen: schlank, schön und ein bisschen frivol. Nein, hier sind Giganten am Werk, Gesichter, Typen. Zu klein, zu groß und fast alle zu dick, aber voller Fantasie. Jedes einzelne Chormitglied hat eine sehr spezielle Biografie, eine besondere Individualität oder einfach eine Macke. Chor ist ein Haufen Individualisten, gezwungen, miteinander zu singen, aneinandergekettet, vielleicht ein Leben lang, denke ich. Deshalb sind sie so anstrengend, aber auch so witzig und charmant.
Susanne, die Souffleuse, schiebt mir einen Zettel herüber. Ich zische »Nicht jetzt!«, aber sie insistiert, ich müsse den Zettel bitte lesen. Das tue ich, unwillig und schnell. Auf dem ausgerissenen Notenblatt steht allen Ernstes: »Ich kenne Sie aus dem Fernsehen. Sie sind toll.«
»Danke«, sage ich und nicke irritiert zu ihr rüber. Wenn das sechs Wochen so weitergeht, bin ich anschließend reif für die Psychiatrie. Der Chor hat es sich in der Zwischenzeit wieder bequem gemacht. Wenn man nicht aufpasst wie ein Luchs und sie durchgehend mit Aufgaben füttert, schalten sie automatisch in den Ruhemodus. Ich sage schnell: »Wir wiederholen das Ganze noch einmal, bitte!« Sie wiederholen lustlos, meckern übers Bühnenbild, die Stufen seien zu hoch, das Probenkostüm kratze, irgendwie ist die Luft raus. Nora bläht die Nüstern, Elio schüttelt den Kopf, ich lächle gewinnend: »Vielen Dank den Damen und Herren des Chores, dass Sie so voller Energie eingestiegen sind, das war toll. Die Bühne wirkt mit Ihnen und durch Sie großartig, und die Kostüme sind sehr vorteilhaft! Sie können jetzt gehen, die Solisten bleiben bitte noch kurz.«
Sofort kommt Bewegung in die Masse, alle springen auf und rennen davon, als wären sie zusätzlich im Import/Export tätig. Ich habe fünfzehn Minuten früher Schluss gemacht, reine Berechnung, so macht man sich Freunde, der Chor ist selig, vierzig Menschen schütteln mir die Hand.
Nach einer Chorprobe fühle ich mich immer, als wäre ich soeben von einem Traktor überfahren worden, einem dieser großen roten aus einer Kolchose. Ich habe stundenlang ein Fiepen im Ohr. Langsam drehe ich mich zu den Solisten. Sie wirken erleichtert, endlich ist es leer und still.
»Ich muss Sie unbedingt sprechen«, höre ich in die Stille hinein wieder diese Stimme. Susanne ist aufgestanden, sie ist wirklich spindeldürr, ihre blasse Haut ist durchzogen von Äderchen, die zu pulsieren scheinen.
Alle starren sie an, der Tenor kichert, Susanne wiederholt mit geschlossenen Augen ihre Bitte. Ich muss dringend versuchen, eine andere Souffleuse zu bekommen, so viel ist sicher, aber jetzt will ich – verdammt noch mal! – die Probe zu Ende bringen.
Im Zweifelsfalle atmen. Das war in der Schauspielschule die goldene Regel. Atmen. Also atme ich ein und aus und summe den Anfang von Blondchens Arie: »Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln …«
Die Solisten klatschen. Ich habe das Ruder wieder in der Hand.
»Wir schauen uns jetzt die einzelnen Figuren und ihre Motivationen noch einmal an. Wer will was und warum? Danach machen wir Schluss, ist das gut? Und wir, liebe Susanne, könnten doch morgen Nachmittag, nach der Probe, einen Kaffee trinken«, biete ich an, um für den Rest des Tages Ruhe zu haben.
*
Immer lande ich in Städten, in denen es aussieht, als wären die Alliierten erst am Vormittag abgezogen. Ich muss offenbar sehr schlechtes Karma aus dem vor- oder vorvorherigen Leben abarbeiten, etwas Wesentliches lernen, was mir nach wie vor verborgen ist.
Rolltreppe runter, Rolltreppe rauf, schwer bepackt verlasse ich das Einkaufsparadies. Von Seife bis Milch: Alles muss für die sechs Wochen neu besorgt werden. Und da fragt mich meine Steuerfachfrau im Finanzamt Mitte, wie ich, bitte schön, auf doppelte Haushaltskosten käme, das würde bei der Gage doch gar nicht gehen. Endlich benennt es jemand vom Fach: Ich sollte die dreifache Gage verlangen.
Eigentlich war es kein schlechter Probentag. Die Solisten waren ausgesprochen nett. Sie seien zwar müde, weil sie parallel zu Mozart noch Verdi und Puccini sängen, auch eine Gala im Auftrag von Daimler-Benz stehe an, aber zu den Proben würden sie natürlich gerne kommen, äh, falls sie Zeit hätten.
Ich habe mehrere Urlaubsscheine unterschrieben. Die jungen Sänger müssen sich ihren armseligen »NV Solo Vertrag« mit Nebenengagements aller Art aufbessern. Geburtstag, Hochzeit, Beerdigung, Eröffnung einer Sparkassenfiliale. Ich bin gespannt, wer neben diesen wirklich wesentlichen Beschäftigungen noch frei ist, um Die Entführung aus dem Serail zu proben.
Wenn man mich fragt: Ich bin grundsätzlich und definitiv gegen das Repertoiretheater! Ja, ich weiß, die Theater sind besonders stolz auf diese Erfindung, genauso wie auf das »Ensemble«. Man könne, ohne von den Unsicherheiten der Selbstständigkeit bedroht zu sein, gemeinsam über Jahre eine Sprache entwickeln, eine Spielweise … Aber es ist ähnlich wie im Sozialismus: Die Idee ist toll, bloß bei der Umsetzung gibt’s Probleme.
Jeden Abend steht ein anderes Werk auf dem Spielplan. Alle kramen dafür in ihrer Erinnerung, nach den Noten, dem Text, der Musik. Die Hälfte des Abends fließt zäh dahin in dem verzweifelten Versuch, sich an die Abläufe zu erinnern. Ist man endlich im Bilde und auf Stand, ist die Vorstellung leider vorbei.
Ein kleines Sängerensemble bestückt alle Arten von Opern, einen Abend Wagner, zwei Tage später Rossini, und auf Händel folgt wieder Wagner. Jeder muss ein »Spezialist für alles« sein. Nach wenigen Jahren sind die Stimmen kaputt gesungen, neue unverbrauchte Sänger werden engagiert, und der Verschleiß beginnt von vorne. Angeblich wolle der Abonnent ständig etwas Neues geboten bekommen. Ich glaube, dem Abonnenten würde etwas weniger Programm genauso gefallen, wenn es denn die Qualität hätte, die man in einem derartigen Massenbetrieb nur äußerst selten erreicht. Ein absurder Kreislauf. Aber Intendanten, Dramaturgen, Künstlerisches Betriebsbüro – alle teilen zwischen Hysterie, Panik und Größenwahn den Standpunkt: Viel hilft viel!
Gleich reißt meine Einkaufstüte vor lauter Ärger. Noch fünfhundert Meter bis zu meiner Zelle. Den deutschen Staatstheaterbetrieb verändern und reißfeste Papiertüten erfinden, muss ich dringend auf meiner To-do-Liste vermerken!
Ist das schwül! Ich sollte mich an Opernhäusern an der See bewerben. Endlich frischer Wind. Man könnte en suite spielen, sechs, acht Wochen ein Stück, dann wieder etwas Neues. Kein festes Ensemble, alle frei zusammengewürfelt und glücklich, dieses eine Stück in Ruhe proben und spielen zu können.
Vielleicht sollte man auch mit Chor und Orchester keine lebenslangen Verträge mehr abschließen. Ich bin mir sicher, dem Endergebnis täte es gut! Wenn der Chor und Orchestervorstand meine Pläne hören könnten, sie würden mich an einer Harfe gefesselt im Bühnengraben versenken.
Schweißgebadet schließe ich meine Klause auf. Morgen um zehn Uhr ist die nächste Probe, nur Solisten, der Chor hat seinen freien Tag. Ich dusche und mache mir etwas zu essen, der Fisch aus der Provinz sieht vielversprechend aus.
Hoffentlich fällt mir genug ein, Mozart kommt so harmlos daher, ist aber ganz schön doppelbödig, denke ich, während die Dorade in der Pfanne brutzelt. Wenn mir nichts einfällt: die Ratlosigkeit teilen! Damit bin ich bisher am besten gefahren. Wenn es jemand sowieso sofort merkt, dann der Chor, er lauert auf jede noch so kleine Schwäche.
Sicher, einen kurzen Moment der Verachtung muss man aushalten, mitleidige und abschätzige Blicke. Aber dann finden sich mindestens drei brauchbare Ideen aus den Chorreihen. Sie sind Künstler wie wir alle, es ist bloß irgendetwas dazwischengekommen, zwischen sie und ihre Solokarrieren. Mal die Liebe, mal eine Revolution.
Vierzig Jahre Teil derselben Truppe sein, das wäre nichts für mich. Sich nicht zu viel in den Vordergrund spielen, aber doch voll aussingen. Mal tragen vierzig Leute die gleichen Perücken, weil die Kostümbildnerin ihren Einfall genial findet, mal muss der gesamte Chor hinter einer Stellwand versteckt singen, weil der Regisseur eine Massenphobie hat. Dann wieder müssen sich alle als Hühner verkleiden oder als Steine.
Da braucht es schon eine ordentliche Portion Gewerkschaft, um sich zu schützen und gelegentlich zu rächen. Chor ist mehr als nur Chor. Chor ist Überlebensstrategie!
Fünf SMS aus Israel holen mich mit ihrem Piepsen in die Gegenwart. Mein Freund Robbi bombardiert mich mit neuen Studien über den aktuellen Antisemitismus in Europa. Führend sei derzeit Ungarn, dicht gefolgt von Polen, aber auch Frankreich sei nicht zu verachten.
Ich schreibe ihm rasch zurück, der Wettbewerb habe etwas Sportives, als ginge es um die Verteilung der Goldmedaillen, eine spezielle Art der Olympiade. Schlage vor, gemeinsam nach Portugal auszuwandern, auf den Azoren, habe ich gehört, soll es sehr schön sein und keinen Antisemitismus geben.
Ich habe Robbi geerbt, er ist der Bruder meines Freundes Aron, nach dessen Tod wir beide untröstlich waren. Über ihn zu sprechen, verschaffte uns beiden ein wenig Linderung, und nach und nach wurden auch wir Freunde.
Robbi ist Ende der Sechzigerjahre zum Studium nach Israel ausgewandert, und obwohl er sich wie ein Kibbuznik kleidet, blieb er doch im Herzen immer ein Jecke, ein deutscher Jude. Häufig erfahre ich zuerst von ihm, was in Deutschland passiert. Er muss Tag und Nacht deutsche Nachrichten verfolgen. Er weiß die Spielergebnisse der Fußballbundesliga, noch ehe die Tore überhaupt gefallen sind.
Seit Arons Tod sind wir Robbis »deutsche Familie«. Wir telefonieren regelmäßig und sehr lange. Am einfachsten ist es, wenn mein Mann Georg ans Telefon geht. Dann diskutieren die beiden stundenlang über den fatalen Aufstieg von Preußen zur Großmacht oder Heinrich Heine im Pariser Exil und dergleichen mehr. Auf mich wirken solche Gespräche wie ein richtig gutes Sedativ. Ebenso hilfreich ist es, wenn mein Sohn David da ist. Sie haben als gemeinsames Steckenpferd die bundesdeutsche Politik und können sich ewig darüber ereifern. Meine Theatergeschichten findet Robbi zwar amüsant, aber wirklich interessieren tun sie ihn nicht.
Der Fisch ist fertig und duftet ausgezeichnet, müde lasse ich das Denken sein, als das Telefon klingelt. Es ist Susanne, sie könne nicht bis morgen warten, ob ich jetzt gleich Zeit hätte, bitte, bitte, sie wolle nicht aufdringlich wirken, und wenn es nicht wirklich wichtig wäre, würde sie nicht anrufen.
Ich bleibe trotz ihrer Bitten standhaft, wenn ich schon am ersten Tag nachgebe, wie soll das erst in den nächsten Wochen werden? Wir verabreden uns für morgen früh vor der Probe, Punkt neun Uhr.