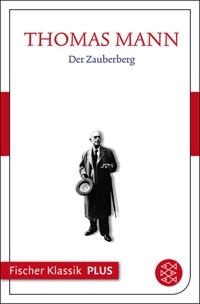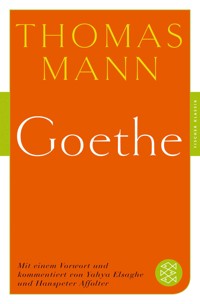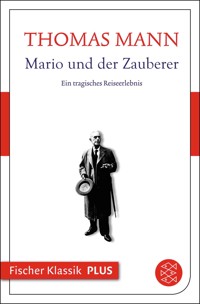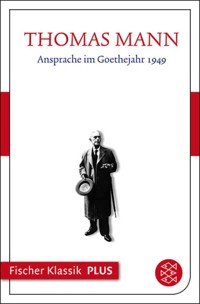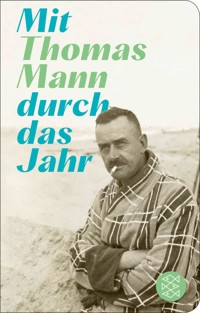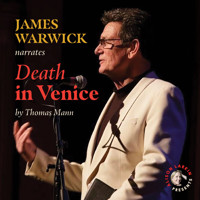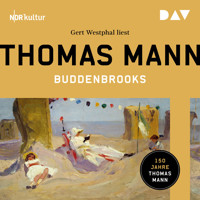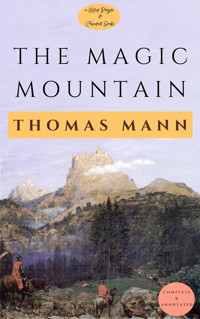11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Thomas Manns großes Debattenbuch ›Betrachtungen eines Unpolitischen‹ in der Textfassung der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe. Wie ein Monolith steht dieser gewaltige, 1918 erschienene Essay im Werk Thomas Manns. Die ›Betrachtungen eines Unpolitischen‹ werden gerne als konservatives Pamphlet, als Beleg für Thomas Manns reaktionäre Gesinnung während des Ersten Weltkriegs aufgefasst. Allerdings hat schon Thomas Mann selbst diese Einschätzung zurechtgerückt: »Die ›Betrachtungen‹ waren also eine Kampfschrift, aber doch zugleich schon ein leidenschaftliches Stück Arbeit der Selbsterforschung und der Revision meiner Grundlagen.« So sind die ›Betrachtungen‹ im Rückblick – trotz all ihrer Polemik gegen die Fundamente der westlichen Demokratie – eine bedeutende Grundlage für Thomas Manns späteres Bekenntnis zur Republik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 877
Ähnliche
Thomas Mann
Betrachtungen eines Unpolitischen
Essay/s
FISCHER E-Books
In der Textfassung der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe (GKFA) Mit Daten zu Leben und Werk
»Que diable allait-il faire dans cette galère?«
Molière, Les fourberies de scapin
»Vergleiche dich! Erkenne, was du bist!«
Goethe, Tasso
Vorrede
Als ich im Jahre 1915 das Büchlein »Friedrich und die große Koalition« dem Publikum übergeben hatte, glaubte ich, »dem Tag und der Stunde« meine Schuld entrichtet zu haben und mich den künstlerischen Unternehmungen, die ich vor Ausbruch des Krieges eingeleitet, auch im Toben der Zeit wieder widmen zu können. Das erwies sich als Irrtum. Wie Hunderttausenden, die durch den Krieg aus ihrer Bahn gerissen, »eingezogen«, auf lange Jahre ihrem eigentlichen Beruf und Geschäft entfremdet und ferngehalten wurden, so geschah es auch mir; und nicht Staat und Wehrmacht waren es, die mich »einzogen«, sondern die Zeit selbst: zu mehr als zweijährigem Gedankendienst mit der Waffe, – für welchen ich am Ende meiner geistigen Verfassung nach so wenig geschickt und geboren war, wie mancher Schicksalsgenosse nach seiner physischen für den wirklichen Front- oder Heimatdienst, und von welchem ich heute, nicht gerade im besten Wohlsein, ein Kriegsbeschädigter, wie ich wohl sagen muß, an den verwaisten Werktisch zurückkehre.
Die Frucht dieser Jahre – aber ich nenne das keine »Frucht«, ich rede besser von einem Residuum, einem Rückstand und Niederschlag oder auch einer Spur und zwar, die Wahrheit zu gestehen, einer Leidensspur – das Bleibsel dieser Jahre also, um den stolzen Begriff des Bleibens zu einem Substantiv nicht allzu stolzen Gepräges zurechtzubiegen, ist vorliegender Band: welchen ein Buch oder Werk zu nennen ich mich aus guten Gründen wiederum hüte. Denn eine zwanzigjährige, nicht ganz gedankenlose Kunstübung hat mich immerhin vor dem Begriff des Werkes, der Komposition zu viel Achtung gelehrt, als daß ich diesen Namen in Anspruch nehmen könnte für einen Erguß oder ein Memorandum, ein Inventar, ein Diarium oder eine Chronik. Um dergleichen aber, um ein Schreib- und Schichtwerk, handelt es sich hier, – obgleich der Band sich zuweilen, mit halbem Recht übrigens, als Komposition und Werk präsentiert. Mit halbem Recht: Ein organischer und immer gegenwärtiger Grundgedanke wäre aufzuweisen, – wenn es nicht eben nur das schwankende Gefühl eines solchen wäre, von dem allerdings das Ganze durchdrungen ist. Man könnte von »Variationen über ein Thema« sprechen, wenn dieses Thema nur eben präzisere Gestalt gewonnen hätte. Ein Buch? Nein, davon kann nicht die Rede sein. Dies Suchen, Ringen und Tasten nach dem Wesen, den Ursachen einer Pein, dies dialektische Fechten in den Nebel hinein gegen solche Ursachen, – es ergab natürlich kein Buch. Denn unter diese Ursachen zählte unzweifelhaft ein widerkünstlerischer und ungewohnter Mangel an Stoffbeherrschung, wovon auch das deutliche und beschämende Bewußtsein immerfort rege war und aus Instinkt durch eine leichte und souveräne Sprechweise verhehlt werden sollte … Trotzdem, wie ein Kunstwerk Form und Anschein einer Chronik haben kann (was ich aus Erfahrung weiß), so kann am Ende eine Chronik auch Form und Anschein eines Kunstwerkes haben; und so zeigt denn dies Konvolut, gelegentlich wenigstens, den Ehrgeiz und Habitus eines Werkes: es ist ein Mittelding zwischen Werk und Erguß, Komposition und Schreiberei, – wenn auch sein Existenzpunkt so wenig genau in der Mitte, in Wahrheit so viel mehr nach der Seite des Nicht-Künstlerischen liegt, daß man besser tut, es trotz seiner komponierten Kapitel als eine Art von Tagebuch zu nehmen, dessen frühe Teile aus den Anfängen des Krieges und dessen letzte Abschnitte etwa von der Jahreswende 1917/18 zu datieren sind.
Wenn aber diese Aufzeichnungen kein Kunstwerk sind, so sind sie es am Ende darum nicht, weil sie, als Aufzeichnungen und Betrachtungen, nur allzusehr Künstlerwerk, Werk eines Künstlertums sind, – denn das sind sie in der Tat auf mehr als eine Weise. Sie sind es zum Beispiel als Erzeugnis einer gewissen unbeschreiblichen Irritabilität gegen geistige Zeittendenzen, eine Reizbarkeit, Dünnhäutigkeit und Wahrnehmungsnervosität, die ich von jeher an mir kannte, und aus der ich als Künstler, wie ich glaube, zuweilen Nutzen gezogen habe. Sie zeitigte aber von jeher den bedenklichen Nebenhang, unmittelbar-schriftstellerisch, kritisch, polemisch auf solche Reize zu reagieren und zwar auch dann, ja gerade dann, wenn nicht nur ein äußerer Hautkitzel in Frage stand, sondern wenn ich von innen her in gewissem Grad an dem Wahrgenommenen teilhatte: eine rein literarische Streitbarkeit oder Streitsucht, beruhend auf dem Bedürfnis nach Gleichgewicht und darum ihrerseits wieder zur erbosten Einseitigkeit nur allzu entschlossen, – ohne daß bei alldem die kritische Erkenntnis hinlänglich bewußtseinsfähig, des Wortes, der Analyse fähig, intellektuell reif genug wäre, um auf essayistische Erledigung ernstlich hoffen zu können. So, meine ich, entstehen Künstlerschriften.
Künstlerwerk sind diese Abhandlungen ferner in ihrer Unselbständigkeit, ihrem Hilfs- und Anlehnungsbedürfnis, ihrem unendlichen Zitieren und Anrufen starker Eideshelfer und »Autoritäten«, – diesem Ausdruck schwelgender Dankbarkeit für empfangene Wohltat und des kindischen Triebes, dem Leser all das wörtlich aufzudrängen, was man sich zum Troste erlas, statt es den stummen und beruhigenden Untergrund der eigenen Rede bilden zu lassen. Übrigens scheint mir, daß bei aller Zügellosigkeit dieser Begierde ein gewisser musischer Takt und Geschmack in ihrer Befriedigung am Werke war: Das Zitieren wurde als eine Kunst empfunden, ähnlich derjenigen, den Dialog in die Erzählung zu spannen, und mit ähnlich rhythmischer Wirkung zu üben gesucht …
Künstlerwerk, Künstlerschrift: Es redet hier Einer, der, wie es im Texte heißt, nicht gewohnt ist, zu reden, sondern reden zu lassen, Menschen und Dinge, und der also reden »läßt« auch da noch, wo er unmittelbar selber zu reden scheint undmeint. Ein Rest von Rolle, Advokatentum, Spiel, Artisterei, Über der Sache stehen, ein Rest von Überzeugungslosigkeit und jener dichterischen Sophistik, welche Den Recht haben läßt, der eben redet, und der in diesem Falle ich selbst war, – ein solcher Rest blieb zweifellos überall, er hörte kaum auf, halb bewußt zu sein, – und doch war jeden Augenblick, was ich sagte, wahrhaftig meines Geistes Meinung, meines Herzens Gefühl. Es ist meine Sache nicht, die Paradoxie dieser Mischung von Dialektik und wirklich, redlich sich mühendem Wahrheitswillen zu lösen. Daß es mir ernst war, dafür bürgt zuletzt das Dasein selbst dieses Buches.
Denn ich wünschte wohl, sein feuilletonisierender Ton täuschte niemanden darüber, daß es die schwersten Jahre meines Lebens waren, in denen ich es aufhäufte. Künstlerwerk und kein Kunstwerk, ja; denn es entstammt einem in seinen Grundfesten erschütterten, in seiner Lebenswürde gefährdeten und in Frage gestellten Künstlertum, einem krisenhaft verstörten Zustande dieses Künstlertums, der sich zu jeder anderen Art von Hervorbringung als völlig ungeeignet erweisen mußte. Die Einsicht, aus der es erwuchs, die seine Herstellung als unumgänglich erscheinen ließ, war vor allem die, daß jedes Werk sonst intellektuell wäre überlastet worden, – eine zutreffende Erwägung, die aber der wahren Sachlage noch nicht gerecht wurde; denn in Wahrheit hätte ein Fortarbeiten an jenen Dingen sich als ganz unmöglich erwiesen und erwies sich, bei wiederholten Versuchen, als ganz unmöglich: dank nämlich den geistigen Zeitumständen, der Bewegtheit alles Ruhenden, der Erschütterung aller kulturellen Grundlagen, kraft eines künstlerisch heillosen Gedankentumultes, der nackten Unmöglichkeit auf Grund eines Seins etwas zu machen, der Auflösung und Problematisierung dieses Seins selbst durch die Zeit und ihre Krisis, der Notwendigkeit, dies in Frage gestellte, in Not gebrachte und nicht mehr als Kulturgrund fest, selbstverständlich und unbewußt ruhende Sein zu begreifen, klar zu stellen und zu verteidigen; der Unabweisbarkeit also einer Revision aller Grundlagen dieses Künstlertums selbst, seiner Selbsterforschung und Selbstbehauptung, ohne welche seine Betätigung, Auswirkung und heitere Erfüllung, jedes Tun und Machen fortan als ein Ding der Unmöglichkeit erschien.
Warum denn aber mußte es gerade mir so erscheinen? Warum mir die Galeere, während andere frei ausgingen? Ich weiß ja wohl, daß Künstler aller Art, soweit eben ihre physische Person vom Kriege verschont blieb, und auch, wenn die Krisis und Zeitwende sie auf ungefähr derselben Altersstufe betraf, wie mich, in ihrer Produktion durch sie überhaupt nicht oder nur ganz vorübergehend gehemmt wurden. Werke der Schönen Literatur wie der Musik und der bildenden Kunst sind in diesen vier Jahren geschaffen und veröffentlicht worden, haben ihren Urhebern Dank, Ruhm und Glück gebracht. Jugend kam an und wurde begrüßt. Aber auch Künstler auf höherer Lebensstufe, einer höheren sogar, als der meinen, regten sich fort, führten zu Ende, was sie unternommen, gaben das schon Gewohnte, für ihre Kultur, ihr Talent Charakteristische, und fast schien es, als wären ihre Erzeugnisse desto willkommener, je weniger sie von den Geschehnissen berührt erschienen und daran erinnerten. Denn die Nachfrage des Publikums nach Kunst war ja sogar gesteigert, seine Dankbarkeit für das freie Werk lebhafter als sonst, die Aussicht auf jede Art Lohn, auch den materiellen, besonders günstig. Was ich da sage, ist eine captatio benevolentiae, und ich mache kein Hehl daraus. Wirklich, ich trachte, mit diesem Buch zu versöhnen, indem ich darauf hinweise, wieviel Verzicht es umschließt. Meine liebsten Pläne, auf deren Verwirklichung viele – möge es ihnen nun zu Spott oder Ehre gereichen – nicht ohne Begierde und Ungeduld warteten, stellte ich zurück, um ein Schreibwerk zu bewältigen, von dessen innerer und äußerer Weitläufigkeit ich mir freilich, auch diesmal, eine nicht annähernd richtige Vorstellung machte, – ich hätte mich sonst, trotz allem, kaum darauf eingelassen. Ich erinnere mich wohl, daß mein Eifer anfangs bedeutend war, daß der Glaube mich trieb, ich hätte mir und anderen viel Gutes, Belangreiches zu sagen. Aber dann: welche wachsende Unruhe, welches Heimweh nach der »Freiheit in der Begrenzung«, welche Qual durch das unsäglich Kompromittierende und Desorganisierende alles Redens, welcher nagende Kummer über das Versäumnis der Monate, der Jahre! Ist aber der Punkt überschritten, an dem ein Zurück, ein Liegenlassen und Sichdavonmachen eben noch möglich war, so wird »Durchhalten« zu einem mehr noch ökonomischen als moralischen Imperativ, – wenn auch der Wille zum Fertigmachen unbedingt etwas Heroisches gewinnt in Fällen, wo an Fertigwerden garnicht zu denken ist. Für ein Treiben und Schreiben wie dieses gibt es immer nur einen Leitspruch, der seine Torheit, seinen Jammer erklärt, ohne es ganz zu verwerfen. Er steht in Thomas Carlyles »Französischer Revolution« und lautet: »Wisse, daß dies Universum das ist, was es zu sein vorgibt: ein Unendliches. Versuche nie im Vertrauen auf deine logische Verdauungskraft, es zu verschlingen; sei vielmehr dankbar, wenn du durch geschicktes Einrammen dieses oder jenes festen Pfeilers in das Chaos verhinderst, daß es dich verschlinge.«
Nochmals, warum mußte »mein Leib sich mühen an Stelle der Christenheit«, – mit Claudels Violaine zu reden? War meine seelische Situation denn besonders schwierig, – daß sie so sehr der Erörterung, Darlegung, Verteidigung zu bedürfen schien? Vierzig Jahre sind wohl ein kritisches Alter, man ist nicht mehr jung, man bemerkt, daß die eigene Zukunft nicht mehr die allgemeine ist, sondern nur noch – die eigene. Du hast dein Leben zu Ende zu führen, – ein vom Weltlauf schon überholtes Leben. Neues stieg über den Horizont, das dich verneint, ohne leugnen zu können, daß es nicht wäre, wie es ist, wenn du nicht gewesen wärest. Vierzig ist Lebenswende; und es ist nichts Geringes – ich wies wohl im Text darauf hin –, wenn die Wende des persönlichen Lebens von den Donnern einer Weltwende begleitet und dem Bewußtsein furchtbar gemacht wird. Aber auch andere waren vierzig und fuhren besser. War ich schwächer, verstörbarer, zerstörbarer? Mangelte es mir an Stolz und innerer Festigkeit, daß ich mich an das Neue polemisch verlor, auf die Gefahr, meine Selbstzerstörung damit zu betreiben? Oder muß ich mir ein besonders reizbares Solidaritätsgefühl mit meiner Epoche zuschreiben, eine besondere Zugespitztheit, Empfindlichkeit, Verletzlichkeit meiner Zeitbestimmtheit?
Sei dem wie ihm wolle, ich bringe den Ursprung dieser Blätter auf seinen einfachsten Namen, wenn ich ihn Gewissenhaftigkeit nenne, – eine Eigenschaft, die einen so wesentlichen Bestandteil meines Künstlertums ausmacht, daß man kurz sagen könnte, es bestehe daraus: Gewissenhaftigkeit, eine sittlich-artistische Eigenschaft, der ich jede mir je zuteil gewordene Wirkung verdanke, und die mir nun diesen Streich spielte. Denn ich weiß wohl, wie nahe sie an Pedanterie grenzt, und wer dieses ganze Buch als eine ungeheuere kindlich-hypochondrische Pedanterie erklären und bezeichnen wollte, der ginge kaum fehl; mir selbst erschien es in mancher Stunde nicht anders. Die Frage des Mottos drängte sich mehr als einmal, als hundertmal, mit einem Gelächter, wie es Unfaßbares begleitet, durch all meine Explorationen, Explikationen, Expektorationen, und nachträglich, betrachte ich etwa meine unbeholfenen Bemühungen um die politische Frage, mischt sich selbst etwas von jener Rührung darein, die nicht verfehlen wird, meine Leser anzuwandeln. »Was Teufel ging es ihn an?« Allein es ging mich an, es lag mir wahrhaft und leidenschaftlich am Herzen, und unbedingt nötig schien, mit diesen Fragen irgendwie nach meinem besten Wissen, Glauben und Vermögen ins reine zu kommen. Denn so war die Zeit geartet, daß kein Unterschied mehr kenntlich war zwischen dem, was den einzelnen anging und nicht anging; alles war aufgeregt, aufgewühlt, die Probleme brausten ineinander und waren nicht mehr zu trennen, es zeigte sich der Zusammenhang, die Einheit aller geistigen Dinge, die Frage des Menschen selbst stand da, und die Verantwortlichkeit vor ihr umfaßte auch die Notwendigkeit politischer Stellungnahme und Willensentschließung … Es war die Größe, Schwere und Schrankenlosigkeit der Zeit, daß es für den Gewissenhaften und irgendwie – ich weiß nicht wovor oder vor wem – Verantwortlichen, für den, der sich selber wichtig nahm, überhaupt nichts mehr gab, was er nicht wichtig zu nehmen brauchte. Alle Qual um die Dinge ist Selbstquälerei, und nur der quält sich, der sich wichtig nimmt. Man wird mir jede Pedanterie und Kindlichkeit dieser Blätter verzeihen, wenn man verziehen hat, daß ich mich selbst wichtig nehme, – ein Faktum, das augenfällig wird dort, wo ich unmittelbar von mir selber spreche, und freilich eine Eigenschaft, die man selbst als den Urgrund aller Pedanterie empfinden und belächeln mag. »Himmel, wie er sich wichtig nimmt!« – zu diesem Zwischenruf gibt mein Buch allerdings auf Schritt und Tritt Gelegenheit. Ich habe dem nichts entgegenzustellen als die Tatsache, daß ich ohne mich wichtig zu nehmen nie gelebt habe noch leben könnte; als das Wissen, daß alles, was mir gut und edel scheint, Geist, Kunst, Moral – menschlichem Sichwichtignehmen entstammt; als die klare Einsicht, daß alles, was ich je leistete und wirkte, und zwar der Reiz und Wert jedes kleinsten Bestandteiles davon, jeder Zeile und Wendung meines bisherigen Lebenswerkes – so viel und so wenig dies nun besagen möge – ausschließlich darauf zurückzuführen ist, daß ich mich wichtig nahm.
Nahe verwandt der Gewissenhaftigkeit aber ist Einsamkeit, – sie ist vielleicht nur ein anderer Name dafür: jene Einsamkeit nämlich, welche von der Öffentlichkeit zu unterscheiden für den Künstler so schwer ist. Sogar wird dieser im ganzen überhaupt nicht geneigt sein, zwischen beiden zu unterscheiden. Sein Lebenselement ist eine öffentliche Einsamkeit, eine einsame Öffentlichkeit, die geistiger Art ist, und deren Pathos und Würdebegriff sich von dem der bürgerlichen, sinnlich-gesellschaftlichen Öffentlichkeit vollkommen unterscheidet, obgleich in der Erfahrung beide Öffentlichkeiten gewissermaßen zusammenfallen. Ihre Einheit beruht in der literarischen Publizität, welche geistig und gesellschaftlich zugleich ist (wie das Theater), und in der das Einsamkeitspathos gesellschaftsfähig, bürgerlich möglich, sogar bürgerlich-verdienstlich wird. Die Rücksichtslosigkeit, der Radikalismus seiner mitteilenden Hingabe möge bis zur Prostituierung, bis zur Preisgabe der Biographie, bis zur vollständigen Jean-Jacqueshaften Schamlosigkeit gehen, – die Würde des Künstlers als Privatperson bleibt dadurch völlig unangefochten. Es ist möglich, es ist sogar natürlich, daß ein Künstler, der sich soeben im Werke menschlich geopfert und hingegeben, ja hingeworfen hat, im nächsten Augenblick unter die Leute tritt ohne den Anflug eines Gefühls, daß er seiner bürgerlichen Person das Geringste vergeben habe, – und eine gesellschaftliche Öffentlichkeit von Kultur, das heißt eine solche, die sich nach Möglichkeit mit der geistigen Öffentlichkeit gleichsetzt, wird ihm nicht nur recht geben, sondern die Verdienste, die er sich als ein Einsam-Öffentlicher erworben, mögen seiner bürgerlichen Ehre sogar zugute kommen.
Dies alles aber gilt nur bedingungsweise. Es gilt nur dann, und nur dann erweist sich das Menschliche durch literarische Publizität der sozialen Öffentlichkeit fähig, wenn es der geistigen Öffentlichkeit würdig ist, – andernfalls wird es durch Publizität zum Spott oder zum Skandal. Man muß an diesem Gesetz, diesem Kriterium festhalten. Ich aber habe mich nun zu fragen, ob die Veröffentlichung dieser Blätter, des Produkts einer Einsamkeit, welche gewohnt ist, öffentlich zu sein, zu Recht geschieht; das will sagen: ob sie sozialer Öffentlichkeit sich fähig erweisen mögen, weil sie der geistigen Öffentlichkeit würdig sind, – und da würde es mir denn wenig helfen, wenn ich ihre Publizierbarkeit, ihr Recht auf Öffentlichkeit oder das Recht, das die Öffentlichkeit darauf hat, nur mit menschlich-persönlichen Gründen verteidigen könnte. Allenfalls sind solche Gründe mitzunehmen. In Jahr und Tag stockte meine Produktion, angekündigte Arbeiten blieben aus, ich schien verstummt, gelähmt, schien ausgeschieden. War ich meinen Freunden nicht Rechenschaft schuldig darüber, wie ich die Jahre verbracht? Und wenn nicht von Schuldigkeit die Rede sein sollte, – vielleicht durfte die Rede sein von einem Recht? Denn am Ende hatte ich gekämpft und entsagt, hatte es mir sauer werden lassen, mich redlich um Erkenntnis gemüht, wenn auch mit unzulänglichen und dilettantischen Kräften, und es war menschlich, zu wünschen, daß all das nicht ganz »umsonst«, nicht in privater und unöffentlicher Einsamkeit getragen, geduldet und getan sein sollte. Ich sage, solche Gründe sind mitzunehmen, – den Ausschlag geben sie nicht. Von der Seite des Geistigen her muß die Publizierbarkeit dieser Blätter erwiesen, ihre Publikation gerechtfertigt werden; es handelt sich um ihr geistiges Recht auf Öffentlichkeit, – und wirklich, ich finde, daß ein solches besteht.
Diese Schrift, die die Hemmungslosigkeit privat-brieflicher Mitteilung besitzt, bietet in der Tat, nach meinem besten Wissen und Gewissen, die geistigen Grundlagen dessen, was ich als Künstler zu geben hatte, und was der Öffentlichkeit gehört. War dieses der geistigen Öffentlichkeit würdig, so mag auch der folgende Rechenschaftsbericht es sein. Und da es die Zeit war, die ihn mir, und zwar unweigerlich, abverlangte, so scheint es, daß die Zeit ein Anrecht darauf besitzt: Ein Dokument, scheint mir, liegt vor, nicht unwert, von Heutigen und sogar von Späteren gekannt zu sein, wenn auch allein um seines zeitlich symptomatischen Wertes willen, in der Unendlichkeit seiner geistigen Aufgeregtheit, in seinem Eifer, von allen Dingen auf einmal zu reden … Ob ich mich aber dabei nicht allein als schlechter Denker erwies, sondern auch durch die Enthüllung der geistigen Fundamente meines Künstlertums dieses mein Künstlertum selbst noch bloßstellte, diese Ungewißheit darf kein Grund für mich sein, die Schrift zu verschließen. Was wahr ist, komme an den hellen Tag. Nie habe ich mich besser gemacht, als ich bin, und will dies weder durch Reden noch auch durch kluges Schweigen tun. Nie fürchtete ich, mich zu zeigen. Der Wille, den Rousseau im ersten Satz seiner Bekenntnisse ausdrückt, und der zu jener Zeit neu und unerhört schien: »einen Menschen und zwar sich selbst in seiner ganzen Naturwahrheit zu zeigen«, dieser Wille, den Rousseau »bis heute beispiellos« nannte, und von dem er glaubte, daß seine Ausführung keine Nachahmer finden werde, – ist zur eingefleischten Selbstverständlichkeit, zum geistig-künstlerischen Grund-Ethos des Jahrhunderts geworden, dem ich wesentlich angehöre, des neunzehnten; und auch über meinem Leben, wie über dem so vieler Söhne dieser Bekenner-Epoche, stehen die Verse Platens:
»Noch bin ich nicht so bleich, daß ich der Schminke brauchte;
Es kenne mich die Welt, auf daß sie mir verzeihe!«
Ich wiederhole: Eine Fixierung problematischer Art, sei sie nun Bild oder Rede, ist der bürgerlichen Öffentlichkeit fähig, sofern sie der geistigen würdig ist. In diesem Falle bleibt die private Würde durchaus unberührt davon. Ich habe dabei ein menschlich-tragisches Element des Buches besonders im Auge, jenen intimen Konflikt, dem eine Reihe von Seiten besonders gewidmet sind, und der auch sonst vieler Orten mein Denken färbt und bestimmt. Auch von ihm, und von ihm namentlich, gilt, daß seine Preisgabe, soweit eine solche überall noch möglich war, geistig berechtigt ist und darum der Anstößigkeit entbehrt. Denn dieser intime Konflikt spielt im Geistigen, und er besitzt ohne allen Zweifel genug symbolische Würde, um ein Recht auf Öffentlichkeit zu haben und folglich, dargestellt, nicht schimpflich zu wirken. Eine gebildete bürgerliche Öffentlichkeit, d.h. eine solche, die sich mit der geistigen möglichst gleichsetzt, skandaliert sich nicht über die Preisgabe von Persönlichem, das der geistigen Öffentlichkeit würdig ist, und worauf diese ein Anrecht hat. Das Vertrauen, das in solcher Preisgabe sich ausdrückt, möge sich allzu »einsam« und optimistisch-gutgläubig erweisen: sein Zunichtewerden wird nicht dem zur Unehre gereichen, der es hegte.
Zeitdienst, sagte ich, hätte ich geleistet, indem ich dies Buch schrieb, indem ich gewissenhafter oder pedantischer Weise die von der Zeit aufgewühlten, aufgewirbelten Gründe meines Wesens in gebundenen Sätzen wieder »niederzulegen« suchte. Aber mancher, nachdem er von den folgenden Kapiteln Kenntnis genommen, wird urteilen, ich hätte der Zeit damit auf recht fragwürdige Art, ohne gesunde Liebe zu ihr, disziplinlos, obstinat, unter hundert Bekundungen feindseligen Ungehorsams und bösen Willens »gedient« und mich um ihre Erfüllung, Vollendung, Verwirklichung wenig verdient gemacht. Nicht sowohl oder nicht nur als schlechter Denker hätte ich mich erwiesen, sondern auch und vielmehr als ein schlecht Denkender, schlecht Gesinnter, als schlechter Charakter: indem ich nämlich Absterbendes, Hinfälliges zu stützen, zu verteidigen und dem Neuen und Notwendigen, der Zeit selbst zu wehren, zu schaden versucht hätte. – Ich will darauf erwidern, daß man der Zeit auf mehr als eine Weise dienen kann, und daß die meine nicht unbedingt die falsche, schlechte und unfruchtbare zu sein braucht. Ein zeitgenössischer Denker hat gesagt: »Die Richtung aufzufinden, in der eine Kultur sich fortbewegt, ist nicht so schwer, und mit Geheul sich ihr anzuschließen nicht so großartig, als die Viertelsköpfe rings im Land es sich denken. Die eigentliche Bahn des Lebens zu erkennen, die Rücksprünge, Widersprüche, Spannungen des Lebens, die Gegengewichte, die es braucht, die Widerkräfte, die es neu spannen, wo es sich im Verbrauch seiner Kräfte schwächt, die Gegenspieler, ohne die das Drama des Lebens nicht vorwärts geht, – alles dies zu sehen nicht nur, sondern lebendig in sich selbst wider einander angehen zu fühlen, das macht den Menschen, der ganz Mensch ist in seiner Zeit.« Ein schönes Wort, mir recht aus der Seele gesprochen. Ich glaube nicht, daß es Wesen und Pflicht des Schriftstellers sei, sich »mit Geheul« der Hauptrichtung anzuschließen, in der die Kultur sich eben fortbewegt. Ich glaube nicht und kann es meiner Natur nach nicht glauben, daß es dem Schriftsteller natürlich und notwendig sei, eine Entwicklung auf durchaus positive Weise, durch unmittelbare und gläubig-enthusiastische Fürsprache zu fördern, – als ein rechtschaffener Ritter der Zeit ohne Skrupel und Zweifel, geraden Sinnes, ungebrochenen Willens und Mutes zu ihr, seiner Göttin. Schriftstellertum selbst erschien mir vielmehr von jeher als ein Erzeugnis und Ausdruck der Problematik, des Da und Dort, des Ja und Nein, der zwei Seelen in einer Brust, des schlimmen Reichtums an inneren Konflikten, Gegensätzen und Widersprüchen. Wozu, woher überhaupt Schriftstellertum, wenn es nicht geistig-sittliche Bemühung ist um ein problematisches Ich? Nein, zugegeben, ich bin kein Ritter der Zeit, bin auch kein »Führer« und will es nicht sein. Ich liebe nicht »Führer«, und auch »Lehrer« liebe ich nicht, zum Beispiel »Lehrer der Demokratie«. Am wenigsten aber liebe und achte ich jene Kleinen, Nichtigen, Spürnäsigen, die davon leben, daß sie Bescheid wissen und Fährte haben, jenes Bedienten- und Läufergeschmeiß der Zeit, das unter unaufhörlichen Kundgebungen der Geringschätzung für alle weniger Mobilen und Behenden dem Neuen zur Seite trabt; oder auch die Stutzer und Zeitkorrekten, jene geistigen Swells und Elegants, welche die letzten Ideen und Worte tragen, wie sie ihr Monokel tragen: z.B. »Geist«, »Liebe«, »Demokratie«, – so daß es heute schon schwer ist, diesen Jargon ohne Ekel zu hören. Diese alle, die Heulenden sowohl wie die Snobs, genießen die Freiheit ihrer Nichtigkeit. Sie sind nichts, wie ich im Texte sagte, und also sind sie ganz frei zu meinen und zu urteilen und zwar immer nach neuestem Schnitt und à la mode. Ich verachte sie redlich. – Oder ist meine Verachtung nur verkappter Neid, da ich ihrer windigen Freiheit nicht teilhaft bin?
Inwiefern denn aber bin ich es nicht? Inwiefern bin ich gebunden und bestimmt? Wenn ich nicht nichts bin, wie sie, was bin ich denn also? – Es war diese Frage, die mich auf die »Galeere« zwang, und durch »Vergleichung« suchte ich ihr Antwort zu finden. Die Erkenntnis, die mehrfach hervortreten wollte, war schwankend, nebelhaft, unzulänglich, dialektisch-einseitig und durch Anstrengung verzerrt. Soll ich im letzten Augenblick noch einmal versuchen, sie zu leidlicher Beruhigung zu befestigen?
Ich bin, im geistig Wesentlichen, ein rechtes Kind des Jahrhunderts, in das die ersten 25 Jahre meines Lebens fallen: des neunzehnten. Ich finde wohl in mir artistisch-formale wie auch geistig-sittliche Elemente, Bedürfnisse, Instinkte, die nicht mehr dieser Epoche, sondern einer neueren angehören. Aber wie ich als Schriftsteller mich eigentlich als Abkömmling (natürlich nicht als Zugehörigen) der deutsch-bürgerlichen Erzählungskunst des neunzehnten Jahrhunderts fühle, die von Adalbert Stifter bis zum letzten Fontane reicht; wie, sage ich, meine Überlieferungen und artistischen Neigungen in diese heimatliche Welt deutscher Meisterlichkeit zurückweisen, die mich durch eine idealische Bestätigung meiner selbst entzückt und stärkt, sobald ich mit ihr in Berührung komme; so liegt auch mein geistiger Schwerpunkt jenseits der Jahrhundertwende. Romantik, Nationalismus, Bürgerlichkeit, Musik, Pessimismus, Humor, – diese Atmosphärilien des abgelaufenen Zeitalters bilden in der Hauptsache die unpersönlichen Bestandteile auch meines Seins. Es ist aber besonders eine Grundstimmung und seelische Veranlagung, ein Charakterzug, wodurch das neunzehnte Jahrhundert, ins Große gerechnet, sich von dem vorhergehenden und, wie immer deutlicher wird, auch von dem neuen, gegenwärtigen unterscheidet. Nietzsche war es, der diesen Charakter-Unterschied zuerst und am besten in kritische Worte gefaßt hat.
»Redlich, aber düster« nennt Nietzsche das neunzehnte Jahrhundert im Gegensatz zum achtzehnten, das er, ungefähr wie Carlyle, feminin und verlogen findet. Dieses habe jedoch, in seiner humanen Gesellschaftlichkeit, einen Geist im Dienste der Wünschbarkeit besessen, den das neunzehnte nicht kenne. Animalischer und häßlicher, ja pöbelhafter und eben deshalb »besser«, »ehrlicher«, als jenes, sei das neunzehnte Jahrhundert vor der Wirklichkeit jeder Art unterwürfiger, wahrer. Dabei freilich sei es willensschwach, traurig und dunkel begehrlich, fatalistisch. Weder vor der »Vernunft« noch vor dem »Herzen« habe es Scheu und Hochachtung an den Tag gelegt und, durch Schopenhauer, selbst die Moral auf einen Instinkt, nämlich das Mitleid, reduziert. Es habe sich, als das wissenschaftliche, im Wünschen bedürfnislose, losgemacht von der Domination der Ideale und überall triebmäßig nach Theorien gesucht, geeignet, eine fatalistische Unterwerfung unter das Tatsächliche zu rechtfertigen. Das achtzehnte suche zu vergessen, was man von der Natur des Menschen weiß, um ihn an seine Utopie anzupassen. Oberflächlich, weich, human, für »den Menschen« schwärmend, habe es mit der Kunst Propaganda für Reformen sozialer und politischer Natur getrieben. Dagegen habe etwa Hegel, mit seiner fatalistischen Denkweise, seinem Glauben an die größere Vernunft des Siegreichen, seiner Rechtfertigung des wirklichen »Staats« (an Stelle von »Menschheit« usw.) ganz wesentlich einen Erfolg gegen die Empfindsamkeit bedeutet. Und Nietzsche spricht von Goethes Antirevolutionarismus, von seinem »Willen zur Vergöttlichung des Alls und des Lebens, um in seinem Anschauen und Ergründen Ruhe und Glück zu finden«. Seine Kritik, überall nicht ohne Sympathie, wird höchst positiv, sie umschreibt in Wahrheit die Religiosität eines ganzen Zeitalters, indem sie Goethes Natur als einen »fast« freudigen und vertrauenden Fatalismus umschreibt, »der nicht revoltiert, der nicht ermattet, der aus sich eine Totalität zu bilden sucht, im Glauben, daß erst in der Totalität alles sich erlöst, als gut und gerechtfertigt erscheint.« –
Nietzsches Kritik des abgelaufenen Jahrhunderts, dieser gewaltigen, aber wenig »hochherzigen«, im Geistigen wenig galanten Epoche, erschien niemals großartiger zutreffend, als unter der Optik des Jetzt und Heute. Ich fand kürzlich gedruckt, Schopenhauer sei »sozial-altruistisch« gewesen und zwar, weil seine Sittlichkeit im Mitleid gegipfelt habe, – ich setzte ein dickes Fragezeichen dorthin, wo das stand. Die Willensphilosophie Schopenhauers (der niemals geneigt war zu vergessen, was man von der Natur des Menschen weiß), war ohne jeden Willen im Dienste der Wünschbarkeit, durchaus ohne jedes soziale und politische Interessement. Sein Mitleid war Erlösungsmittel, nicht Besserungsmittel in irgend einem der Wirklichkeit opponierenden, geistespolitischen Sinn. Schopenhauer war Christ hierin. Man hätte ihm von sozial-reformatorischen Aufgaben der Kunst reden sollen! – dem der ästhetische Zustand ein seliges Vorherrschen der reinen Anschauung, ein Stillstehen des Ixion-Rades, ein Loskommen vom Willen, Freiheit im Sinn der Erlösung und in keinem anderen Sinne war. – Da ist Flauberts harter Ästhetizismus, sein grenzenloser Zweifel mit dem nihil als Fazit, mit der höhnischen Resignation des »Hein, le progrès, quelle blague!« Da tritt Ibsens bürgerlich-böses Haupt hervor, ähnlich im Ausdruck dem Schopenhauers. Die Lüge als Bedingung des Lebens, der Träger der »sittlichen Forderung« als komische Figur, Hjalmar Ekdal als der Mensch wie er ist, sein plump realistisches Weib als die Rechtschaffene, der Zyniker als Räsonneur: da haben wir die Askese der Ehrlichkeit, – barsches neunzehntes Jahrhundert. Und wieviel von seinem brutalen und redlichen Pessimismus, von seinem besonderen strengen, maskulinen und »bedürfnislosen« Ethos waltet noch in Bismarcks »Realpolitik« und Anti-Ideologie!
Ich erkenne, daß diese vielfach variierende Tendenz und Grundstimmung des neunzehnten Jahrhunderts, seine wahrhaftige, un-schönrednerische und unempfindsame, dem Kult schöner Gefühle abholde Unterwürfigkeit vor dem Wirklichen und Tatsächlichen die entscheidende Mitgift ist, die ich von ihm empfing; daß sie es ist, die mein Wesen gegen gewisse neu hervortretende und meine Welt als ethoslos verneinende Strebungen einschränkt und bindet. Der Roman des Fünfundzwanzigjährigen, an der Schwelle des Jahrhunderts entstanden, war ein Werk ganz ohne jenen »Geist im Dienste der Wünschbarkeit«, ganz ohne sozialen »Willen«, ganz unpathetisch, unrednerisch, unsentimental, vielmehr pessimistisch, humoristisch und fatalistisch, wahrhaftig in seiner melancholischen Unterwürfigkeit als Studie des Verfalls. Eine einzige unscheinbare Anführung genügt, um den – man verzeihe mir doch das Wort – den geistesgeschichtlichen Platz des Buchs zu bezeichnen. Gegen den Schluß werden bittere und skurrile Schulgeschichten erzählt. »Wer«, heißt es, »unter diesen 25 jungen Leuten von rechtschaffener Konstitution, stark und tüchtig für das Leben war, wie es ist, der nahm in diesem Augenblick die Dinge völlig wie sie lagen, fühlte sich nicht durch sie beleidigt und fand, daß alles selbstverständlich und in der Ordnung sei. Aber es gab auch Augen, die sich in finsterer Nachdenklichkeit auf einen Punkt richteten …« Und diese Augen gehören dem durch Entartung sublimierten und nur noch musikalischen Spätling des Bürgergeschlechts, dem kleinen Johann. »Der kleine Johann starrte auf seines Vordermanns breiten Rücken, und seine goldbraunen, bläulich umschatteten Augen waren ganz voll von Abscheu, Widerstand und Furcht …« – Nun, die Widersetzlichkeit, die sensitiv-sittliche Revolte gegen »das Leben wie es ist«, gegen das Gegebene, die Wirklichkeit, die »Macht«, – diese Widersetzlichkeit als Merkmal des Verfalls, der biologischen Unzulänglichkeit; der Geist selbst (und die Kunst!) verstanden und dargestellt als das Merkmal hiervon, als Entartungsprodukt: das ist neunzehntes Jahrhundert, das ist das Verhältnis, in welchem dieses Jahrhundert den Geist zum Leben sieht, – aber freilich wiederum in einer besonderen und extremen Nuance, welche erst nach der Kulmination jener melancholisch-ehrlichen Tendenz in Nietzsche möglich war.
Nietzsche nämlich, der den Charakter der Epoche am schärfsten kritisch gekennzeichnet hat, bedeutete in gewissem Sinn eine solche Kulmination: Die Selbstverneinung des Geistes zugunsten des Lebens, des »starken« und namentlich »schönen« Lebens, das ist unzweifelhaft eine äußerste und letzte Losmachung von der »Domination der Ideale«, eine schon nicht mehr fatalistische, sondern begeisterte, erotisch berauschte Unterwerfung unter die »Macht«, eine Unterwerfung von schon nicht mehr recht maskuliner, sondern – wie sage ich – sentimentalisch-ästhetizistischer Art – und obendrein ein Fund für Künstler in noch ganz anderem Grade als Schopenhauers Philosophie! Es sind in geistig-dichterischer Hinsicht zwei brüderliche Möglichkeiten, die das Erlebnis Nietzsches zeitigt. Die eine ist jener Ruchlosigkeits- und Renaissance-Ästhetizismus, jener hysterische Macht-, Schönheits- und Lebenskult, worin eine gewisse Dichtung sich eine Weile gefiel. Die andere heißt Ironie, – und ich spreche damit von meinem Fall. In meinem Falle wurde das Erlebnis der Selbstverneinung des Geistes zugunsten des Lebens zur Ironie, – einer sittlichen Haltung, für die ich überhaupt keine andere Umschreibung und Bestimmung weiß, als eben diese: daß sie die Selbstverneinung, der Selbstverrat des Geistes zugunsten des Lebens ist, – wobei unter dem »Leben«, ganz wie beim Renaissance-Ästhetizismus, nur in einer anderen, leiseren und verschlageneren Gefühlsnüance, die Liebenswürdigkeit, das Glück, die Kraft, die Anmut, die angenehme Normalität der Geistlosigkeit, Ungeistigkeit verstanden wird. Nun ist Ironie freilich ein Ethos nicht durchaus leidender Art. Die Selbstverneinung des Geistes kann niemals ganz ernst, ganz vollkommen sein. Ironie wirbt, wenn auch heimlich, sie sucht für den Geist zu gewinnen, wenn auch ohne Hoffnung. Sie ist nicht animalisch, sondern intellektuell, nicht düster, sondern geistreich. Aber willensschwach und fatalistisch ist sie doch und jedenfalls weit entfernt, sich ernstlich und auf aktive Art in den Dienst der Wünschbarkeit und der Ideale zu stellen. Vor allem aber ist sie ein durchaus persönliches Ethos, kein soziales, genau so wenig, wie Schopenhauers »Mitleid« dies war; nicht Besserungsmittel im geistespolitischen Sinn, unpathetisch, weil ohne Glauben an die Möglichkeit, das Leben für den Geist zu gewinnen – und eben hierin eine Spielart (ich sage Spielart) der Mentalität des neunzehnten Jahrhunderts.
Selbst dem nun aber, der es nicht schon längst, seit zehn oder fünfzehn Jahren sah, kann heute nicht mehr verborgen bleiben, daß dieses junge Jahrhundert, das zwanzigste, aufs allerdeutlichste Miene macht, dem achtzehnten weit stärker nachzuarten, als seinem unmittelbaren Vorgänger. Das zwanzigste Jahrhundert erklärt den Charakter, die Tendenzen, die Grundstimmung des neunzehnten in Verruf, es diffamiert seine Art von Wahrhaftigkeit, seine Willensschwäche und Unterwürfigkeit, seinen melancholischen Unglauben. Es glaubt – oder es lehrt doch, man müsse glauben. Es sucht zu vergessen, »was man von der Natur des Menschen weiß«, – um ihn an seine Utopie anzupassen. Es schwärmt für »den Menschen« ganz im dix-huitième-Geschmack, es ist nicht pessimistisch, nicht skeptisch, nicht zynisch und nicht – dies sogar am wenigsten – ironisch. Jener »Geist im Dienste der Wünschbarkeit«, es ist offensichtlich der Geist, den es meint, es ist der seine, – ein Geist gesellschaftlicher Humanität. Die Vernunft und das Herz: sie stehen wieder obenan im Vokabular der Zeit, – jene als Mittel, das »Glück« zu bereiten, dieses als »Liebe«, als »Demokratie«. Wo wäre noch eine Spur von »Unterwürfigkeit vor dem Wirklichen«? Aktivismus vielmehr, Voluntarismus, Meliorismus, Politizismus, Expressionismus; mit einem Worte: die Domination der Ideale. Und die Kunst hat Propaganda zu treiben für Reformen sozialer und politischer Natur. Weigert sie sich, so ist ihr das Urteil gesprochen. Es lautet kritisch: Ästhetizismus; es lautet polemisch: Schmarotzertum. Die neue Empfindsamkeit ist kein Erzeugnis des Krieges; kein Zweifel aber, daß sie aufs mächtigste durch ihn gesteigert wurde. Nichts mehr von Hegels »Staat«: die »Menschheit« ist wieder an der Tagesordnung, nichts mehr von Schopenhauers Verneinung des Willens: der Geist sei Wille und er schaffe das Paradies. Nichts mehr von Goethes persönlichem Bildungsethos: Gesellschaft vielmehr! Politik, Politik! Und was den »Fortschritt« betrifft, über den Flauberts faustisches Heldenpaar zu einem so höhnischen Resultat gelangte: der Fortschritt ist Dogma – und keine blague, für den, der »in Betracht kommen« will … Dies alles zusammen ist das »Neue Pathos«. Es vereinigt Empfindsamkeit und Härte, es ist nicht »menschlich« in irgend einem pessimistisch-humoristischen Sinn, es verkündet »entschlossene Menschenliebe«. Unduldsam, ausschließlich, von einer französischen Bösartigkeit der Rhetorik, beleidigt es, indem es alle Sittlichkeit für sich in Anspruch nimmt, – obgleich auch andere Leute am Ende mit einer Art von Recht vermeinen, schon vor der Proklamation der Tugendherrschaft nicht gerade als Liederjahne, zum bloßen Spaß gelebt zu haben, und versucht sein mögen, zu antworten, was Goethe einem vorwurfsvollen Patriotismus zur Antwort gab: »Jeder tut sein Bestes, je nachdem Gott es ihm gegeben. Ich kann sagen, ich habe in den Dingen, die die Natur mir zum Tagewerk bestimmt, mir Tag und Nacht keine Ruhe gelassen und mir keine Erholung gegönnt, sondern immer gestrebt und geforscht und getan, so gut und soviel ich konnte. Wenn jeder von sich dasselbe sagen kann, so wird es um uns alle gut stehen.«
Was mich betrifft, so habe ich mir an verschiedenen Punkten der nachfolgenden Aufzeichnungen deutlich zu machen gesucht, inwiefern ich mit dem Neuen zu tun habe, inwiefern auch in mir etwas ist von jener »Entschlossenheit«, jener Absage an den »unanständigen Psychologismus« der abgelaufenen Epoche, an ihr laxes und formwidriges tout comprendre, – von einem Willen also, den man anti-naturalistisch, anti-impressionistisch, anti-relativistisch nennen möge, der aber, im Künstlerischen wie im Sittlichen, ein Wille jedenfalls, und nicht bloße »Unterwürfigkeit«, wiederum war. Dergleichen hat sich sichtbar genug bei mir kundgegeben, – nicht vermöge eines Anschlußbedürfnisses, sondern einfach, weil ich nur der eigenen inneren Stimme zu lauschen brauchte, um auch die Stimme der Zeit zu vernehmen. Warum mußte ich trotzdem in Feindschaft mit dem Neuen geraten, mich davon abgestoßen, verneint, beleidigt fühlen und in der Tat von ihm beschimpft und beleidigt werden, um so unerträglicher und vergiftender, als es mit dem höchsten literarischen Talent geschah, mit der reißendsten Schreibkunst, der geübtesten Leidenschaft, über die es verfügt? – Weil es mir, mir persönlich, in einer Gestalt entgegentritt, in der es das Tiefste und Gründlichste in mir, das Persönlich-Unpersönlichste, das Unwillkürlichste, Unveräußerlichste und Instinktivste, das nationale Grundelement meiner Natur und Bildung gegen sich aufbringen mußte: in politischer Gestalt.
Bei keiner Analyse des Neuen Pathos wird das Wort »Politik« je zu vermeiden sein. Es liegt durchaus in seiner optimistisch-melioristischen Natur, daß es von Politik immer nur zwei Schritte entfernt ist: ungefähr – und nicht nur ungefähr – in dem Sinne, worin ein Freimaurer- und Illuminatentum romanischer Färbung immer nur zwei Schritte davon entfernt ist und auch diese zwei Schritte niemals einhalten wird. Wer aber fragte, was für eine Politik es denn sei, die das Neue Pathos verfolge, der zeigte sich in dem Irrtum befangen, als gäbe es zweierlei oder gar vielerlei »Politik« und als sei nicht vielmehr die politische Einstellung immer nur eine: die demokratische. Wenn in den folgenden Abhandlungen die Identität der Begriffe »Politik« und »Demokratie« verfochten oder als selbstverständlich behandelt wird, so geschieht es mit einem ungewöhnlich klar erkannten Recht. Man ist nicht ein »demokratischer« oder etwa ein »konservativer« Politiker. Man ist Politiker oder man ist es nicht. Und ist man es, so ist man Demokrat. Die politische Geisteseinstellung ist die demokratische; der Glaube an die Politik der an die Demokratie, den contrat social. Seit mehr als anderthalb Jahrhunderten geht alles, was man in geistigerem Sinn unter Politik versteht, auf Jean Jacques Rousseau zurück: und er ist der Vater der Demokratie, indem er der Vater des politischen Geistes selbst, der politischen Menschlichkeit ist.
Als Demokratie also, als politische Aufklärung und Glücks-Philanthropie trat mir das Neue Pathos entgegen. Die Politisierung jedes Ethos begriff ich als sein Betreiben; in der Leugnung und Schmähung jedes nicht-politischen Ethos bestand – ich erfuhr es am eigenen Leibe – seine Aggressivität und doktrinäre Intoleranz. Die »Menschheit« als humanitärer Internationalismus; »Vernunft« und »Tugend« als die radikale Republik; der Geist als ein Ding zwischen Jakobinerklub und Großorient; die Kunst als Gesellschaftsliteratur und bösartig schmelzende Rhetorik im Dienste sozialer »Wünschbarkeit«: da haben wir das Neue Pathos in seiner politischen Reinkultur, wie ich es in der Nähe sah. Ich gebe zu, es ist eine besondere, extrem romanisierende Form davon. Mein Schicksal aber war es nun einmal, es so zu erleben; und dann, wie ich schon sagte, ist es immer und jeden Augenblick im Begriff, diese Form anzunehmen: »Tätiger Geist«, das heißt: ein Geist, der zugunsten aufklärerischer Weltbefreiung, Weltbesserung, Weltbeglückung tätig zu sein »entschlossen« ist, bleibt Politik nicht lange im weiteren und übertragenen Sinn, er ist es sofort auch im engeren, eigentlichen. Und was für eine – um noch einmal einfältig zu fragen? Deutschfeindliche Politik, das liegt auf der Hand. Der politische Geist, widerdeutsch als Geist, ist mit logischer Notwendigkeit deutschfeindlich als Politik.
Wenn ich auf den folgenden Blättern die Meinung vertrat, daß Demokratie, daß Politik selbst dem deutschen Wesen fremd und giftig sei; wenn ich Deutschlands Berufenheit zur Politik bezweifelte oder bestritt, so geschah es nicht in der – persönlich und sachlich genommen – lächerlichen Absicht, meinem Volk den Willen zur Realität zu verleiden, es im Glauben an die Gerechtigkeit seiner Weltansprüche wankend zu machen. Ich bekenne mich tief überzeugt, daß das deutsche Volk die politische Demokratie niemals wird lieben können, aus dem einfachen Grunde, weil es die Politik selbst nicht lieben kann, und daß der vielverschrieene »Obrigkeitsstaat« die dem deutschen Volke angemessene, zukömmliche und von ihm im Grunde gewollte Staatsform ist und bleibt. Dieser Überzeugung Ausdruck zu geben, dazu gehört heute ein gewisser Mut. Trotzdem wird damit nicht nur nicht dem deutschen Volke irgendwelche Geringschätzung im geistigen oder sittlichen Sinne ausgedrückt – das Gegenteil ist die Meinung –, sondern auch sein Wille zur Macht und Erdengröße (welcher weniger ein Wille als ein Schicksal und eine Weltnotwendigkeit ist) bleibt dadurch in seiner Rechtmäßigkeit und seinen Aussichten völlig unangefochten. Es gibt höchst »politische« Völker, – Völker, die aus der politischen An- und Aufgeregtheit überhaupt nicht herauskommen, und die es dennoch, kraft eines völligen Mangels an Staats- und Machtfähigkeit, auf Erden nie zu etwas gebracht haben, noch bringen werden. Ich nenne die Polen und die Iren. Andererseits ist die Geschichte ein einziger Preis der organisatorischen und staatsbildenden Kräfte des grund-unpolitischen, des deutschen Volkes. Sieht man, wohin Frankreich von seinen Politikern gebracht worden ist, so hat man, wie mir scheint, den Beweis in Händen, daß es mit »Politik« zuweilen durchaus nicht geht; was wiederum eine Art von Beweis dafür ist, daß es auch ohne Politik am Ende gehen möchte. Wenn also meinesgleichen den politischen Geist für einen in Deutschland landfremden und unmöglichen Geist erklärt, so sollte ein Mißverständnis nicht aufkommen können. Wogegen das Tiefste in mir, mein nationaler Instinkt sich erbittern mußte, war der Schrei nach »Politik« in der Bedeutung des Wortes, die ihm in geistiger Sphäre gebührt: Es ist die »Politisierung des Geistes«, die Umfälschung des Geist-Begriffes in den der besserischen Aufklärung, der revolutionären Philanthropie, was wie Gift und Operment auf mich wirkt; und ich weiß, daß dieser mein Abscheu und Protest nichts unbedeutend Persönliches und zeitlich Bestimmtes ist, sondern daß in ihm das nationale Wesen selbst aus mir wirkt. Geist ist nichtPolitik: man braucht, als Deutscher, nicht schlechtes neunzehntes Jahrhundert zu sein, um auf Leben und Tod für dieses »nicht« einzustehen. Der Unterschied von Geist und Politik enthält den von Kultur und Zivilisation, von Seele und Gesellschaft, von Freiheit und Stimmrecht, von Kunst und Literatur; und Deutschtum, das ist Kultur, Seele, Freiheit, Kunst und nicht Zivilisation, Gesellschaft, Stimmrecht, Literatur. Der Unterschied von Geist und Politik ist, zum weiteren Beispiel, der von kosmopolitisch und international. Jener Begriff entstammt der kulturellen Sphäre und ist deutsch; dieser entstammt der Sphäre der Zivilisation und Demokratie und ist – etwas ganz anderes. International ist der demokratische Bourgeois, möge er überall auch noch so national sich drapieren; der Bürger – und das ist ein Motiv dieses Buches – ist kosmopolitisch, denn er ist deutsch, deutscher als Fürsten und »Volk«: dieser Mensch der geographischen, sozialen und seelischen »Mitte« war immer und bleibt der Träger deutscher Geistigkeit, Menschlichkeit und Anti-Politik …
Im Nachlaß Nietzsches fand man eine unglaublich intuitionsvolle Bestimmung der »Meistersinger«. Sie lautet: »Meistersinger – Gegensatz zur Zivilisation, das Deutsche gegen das Französische.« Die Aufzeichnung ist unschätzbar. Im blendenden Blitzschein genialischer Kritik steht hier auf eine Sekunde der Gegensatz, um den dieses ganze Buch sich müht, – der aus Feigheit viel verleugnete, bestrittene und dennoch unsterblich wahre Gegensatz von Musik und Politik, von Deutschtum und Zivilisation. Dieser Gegensatz bleibt auf seiten des Deutschtums eine nur zögernd einzugestehende Tatsache des Gemütes, etwas Seelisches, nicht verstandesmäßig Erfaßtes und darum Unaggressives. Auf seiten der Zivilisation aber ist er politischer Haß: Wie könnte es anders sein? Sie ist Politik durch und durch, ist die Politik selbst, und auch ihr Haß kann immer nur und muß sofort politisch sein. Der politische Geist als demokratische Aufklärung und »menschliche Zivilisation« ist nicht nur psychisch widerdeutsch; er ist mit Notwendigkeit auch politisch deutschfeindlich, wo immer er walte. Und dies bestimmte die Haltung seines innerdeutschen Anhängers und Propheten, der unter dem Namen des Zivilisationsliteraten durch die Seiten dieses Buches spukt. Die Geschichtsforschung wird lehren, welche Rolle das internationale Illuminatentum, die Freimaurer-Weltloge, unter Ausschluß der ahnungslosen Deutschen natürlich, bei der geistigen Vorbereitung und wirklichen Entfesselung des Weltkrieges, des Krieges der »Zivilisation« gegen Deutschland, gespielt hat. Was mich betrifft, so hatte ich, bevor irgendwelches Material vorlag, meine genauen und unumstößlichen Überzeugungen in dieser Hinsicht. Heute braucht nicht mehr behauptet, geschweige bewiesen zu werden, daß etwa die französische Loge politisch ist bis zur Identität mit der radikalen Partei, – jener radikalen Partei, die in Frankreich recht eigentlich Pflanzstätte und Nährboden für den geistigen Haß auf Deutschland und deutsches Wesen bildet. Nicht der nouveau esprit des jungen Frankreich ist es, der eigentlich Deutschenhaß nährt; auch er liegt im Kriege heute mit uns, aber wir sind ihm ein Feind, den er ehrt. Deutschlands Feind im geistigsten, instinktmäßigsten, giftigsten, tödlichsten Sinn ist der »pazifistische«, »tugendhafte«, »republikanische« Rhetor-Bourgeois und fils de la Révolution, dieser geborene Drei-Punkte-Mann, – und er war es, mit dessen Wort und Willen der deutsche Vertreter des politischen Geistes, er, der das Neue Pathos im Sinne der »menschlichen Zivilisation« handhabt, im Jahre 1914 sofort sein eigenes Wort und seinen eigenen Willen vereinigen konnte, und dessen abscheulichen Argot er redete, wie er es schon immer getan hatte. Ich wiederhole: Nicht mit der anständigen, ritterlich respektvollen Feindschaft draußen, nicht mit dem nouveau esprit, welcher im Geistig-Sittlichen mit Deutschland im Grunde sympathisiert, war er im Einvernehmen, sondern mit dem politischen, dem giftigen Feinde, welcher ist Gründer und Aktionär d’un journal qui répand les lumières. Er war sein Held, seinen Sieg wünschte er, seine Invasion in Deutschland ersehnte er; und so war es billig. Der Triumph eines »Gesinnungsmilitarismus« (mit Max Scheler zu reden) über den anderen hätte wenig Sinn gehabt; erflehenswert war der Sieg des pazifistisch-bourgeoisen »Zweckmilitarismus« (mit schwarzen Armeen) über den »Gesinnungsmilitarismus«: Und hier nun, spätestens hier, gingen unsere Meinungen, die des politischen Neu-Pathetikers und die meine auseinander; der Gegensatz zwischen uns wurde im Drange der Zeit akut; denn irgendwelche Gebundenheiten meines Seins und Wesens bewirkten, daß ich Deutschlands Sieg wünschte.
Das ist ein Wunsch, den zu erklären, zu entschuldigen man sich unter Deutschen die erdenklichste Mühe geben muß. Es ist im Lande kantischer Ästhetik vor allem ratsam, hervorzuheben, daß einem Deutschlands Sieg »ohne Interesse« gefallen würde. Ich bin weder ein Machtjunker, noch ein Schwer-Industrieller, noch auch nur ein kapitalverbundener Sozialimperialist. Ich habe kein Lebens- und Sterbensinteresse an deutscher Handelsherrschaft und hege sogar meine oppositionellen Zweifel an Deutschlands Berufenheit zur Großen Politik und imperialen Existenz. Auch mir ist es am Ende um Geist zu tun, um »innere Politik«. Ich stehe mit meinem Herzen zu Deutschland, nicht sofern es Englands machtpolitischer Konkurrent, sondern sofern es sein geistiger Gegner ist; und was den deutschen Verfechter der »menschlichen Zivilisation« betrifft, so war es sehr bald nicht sowohl seine politische Deutschlandfeindlichkeit, als vielmehr seine seelische Widerdeutschheit, was mich kümmerte, mir Furcht, Haß und Widerstand erregte, – zumal auch auf seiner Seite sehr bald die »innere« Politik der »äußeren« wieder den Rang ablief, die Deutschfeindlichkeit hinter die Widerdeutschheit zurücktrat oder richtiger: von ihr abfiel und sie, als ihren Kern, zurück ließ. Seine Deutschfeindlichkeit hatte bald wenig mehr zu hoffen: Die militärische Invasion der Zivilisationstruppen in Deutschland mißglückte. Worauf er mit einem starken Schein von Recht seine Hoffnungen zu setzen fortfuhr, das war die geistige Invasion, die möglicherweise bei weitem stärkste und überwältigendste politische Invasion des Westens, die je deutsches Schicksal geworden. Deutschlands seelische Bekehrung (die eine wirkliche Verwandlung und Strukturveränderung sein müßte) zur Politik, zur Demokratie: sie ist es, worauf er hofft, – nein! die ihm, nicht ohne einen starken Schein von Recht, wie ich sagte, zur triumphierenden Gewißheit geworden ist und zwar in dem Grade, daß er es heute bereits für möglich hält, es nicht mehr für Raub an seiner Ehre erachtet, Deutschland und sich selbst in der ersten Person Pluralis zu vereinigen und über die Lippen bringt, was er all seiner Lebtage noch nicht darüber gebracht: das Wort »Wir Deutschen«. »Wir Deutschen«, heißt es in einem zivilisationsliterarischen Manifest, das um die Jahreswende 1917/18 erschien, »haben, nun wir zur Demokratie heranwachsen, vor uns das allergrößte Erleben. Ein Volk erlangt nicht die Selbstherrschaft, ohne über den Menschen viel zu lernen und mit reiferen Organen das Leben zu handhaben. Das Spiel der gesellschaftlichen Kräfte liegt in Völkern, die sich selbst regieren, allen Augen offen, und auch die einzelnen dort erziehen einander, öffentlich handelnd, zur Erkenntnis von ihresgleichen. Aber kommen wir nun innerlich in Bewegung, dann fallen alsbald auch die Schranken nach außen, die europäischen Entfernungen werden kleiner, und als Verwandte auf gleichen Wegen erblicken wir die Mitvölker. Solange wir im staatlichen Stillstand verharrten, erschienen sie uns als Feinde – todgeweiht, weil nicht auch sie verharrten. Kam nicht jede Umwälzung gleich vor dem Ende? War es nicht Verderbnis, in Kämpfen und Krisen die Verwirklichung von Ideen zu betreiben? Auch unser soll jetzt dies Los sein …«
Welch ein unsäglich peinvoller Widerstand hebt mein Inneres auf vor dieser feindseligen Milde, all dieser schön stilisierten Unannehmlichkeit? Sollte man denn nicht lachen? Ist denn nicht jeder Satz, jedes Wort darin falsch, übersetzt, grundirrtümlich, groteske Selbsttäuschung, – die Verwechslung der Wünsche, Instinkte, Bedürfnisse eines geistig in Frankreich naturalisierten romancier mit deutscher Wirklichkeit? »Auch unser soll jetzt dies Los sein!« Ein hohes und glänzendes, aber von Grund aus romanisiertes Literatentum, das sich längst jeder Fühlung mit dem besonderes Ethos seines Volkes begab, ja schon die Anerkennung eines solchen besonderen nationalen Ethos als bestialischen Nationalismus verpönt und ihm seinen humanitär-demokratischen Zivilisations- und »Gesellschafts«-Internationalismus entgegenstellt, – dieses Literatentum träumt: weil Deutschland damit umgeht, das Fundament der Auswahl für seine politische Führung zu verbreitern und dies »Demokratisierung« nennt, werde es bei »uns« nun so herrlich unterhaltsam wie in Frankreich zugehen! Es wirft, befangen in Wahn und Verwechslung, seinem Lande und Volke ein Los, das nie und immer das ihre wird sein können und dürfen – ist es nicht so? Ich lasse die Redewendung stehen von Deutschlands »Heranwachsen zur Demokratie« – einer Staats- und Gesellschaftsform also, zu welcher Paraguay und Portugal schon des längern »herangewachsen« waren. Noch weniger halte ich mich auf bei der Kammer-Tirade von den »sich selbst regierenden Völkern«. Worauf es ankommt, ist, daß nie, und lege er sich noch so viel »Demokratie« zu, daß niemals der deutsche Mensch das Leben mit den »reiferen Organen« eines Boulevard-Moralisten »handhaben« wird. Nie wird er unter dem »Leben« die Gesellschaft verstehen, nie das soziale Problem dem moralischen, dem inneren Erlebnis überordnen. Wir sind kein Gesellschaftsvolk und keine Fundgrube für Bummelpsychologen. Das Ich und die Welt sind die Gegenstände unseres Denkens und Dichtens, nicht die Rolle, welche ein Ich sich in der Gesellschaft spielen sieht, und nicht die mathematisch-rationalisierte Gesellschaftswelt, die den Gegenstand des französischen Romans und Theaters bildet – oder bis vorgestern bildete. Mit »Bewegung« – und gar »innerlicher« – immer nur gesellschaftskritisch-politische Bewegung meinen zu können und zu glauben, dem Deutschen gezieme es, »die fürchterliche Bewegung fortzuleiten, und auch zu wanken hierhin und dorthin« – eben dies ist es, was ich Entfremdung nenne: eine Entfremdung, durchaus geeignet, in kosmopolitischer Kunstsphäre Güter von bizarrer Kostbarkeit zu zeitigen, unleidlich aber von dem Augenblick an, wo sie als politische Prophetie das sittliche Leben der Nation zu richten, zu gängeln sich anmaßt. Da kommen Verwechslung und Verdrehung denn auf den Punkt, wo es heißt, wir hätten in den innerlich bewegten Mitvölkern (den lieben und guten!) ganz fälschlich Feinde erblickt. Will man uns denn verhöhnen? Wir hätten Feinde in ihnen erblickt? Wir haben es nur zu wenig getan! Unsere gutmütig unpolitische Menschlichkeit ließ uns beständig wähnen, »Verständigung«, Freundschaft, Friede, gutes Auskommen sei möglich, und wir ließen es uns nicht träumen, wir mußten es erst im Kriege mit Schrecken und Schauder erfahren, wie sehr sie uns (und nicht wir sie!) in all der Zeit gehaßt, gehaßt – und zwar nicht sowohl aus Gründen ökonomischer Macht, sondern – viel giftiger – uns politisch gehaßt hatten. Nicht geahnt hatten wir, daß, unter der Decke des friedsam internationalen Verkehrs, in Gottes weiter Welt der Haß, der unauslöschliche Todhaß der politischen Demokratie, des freimaurerisch-republikanischen Rhetor-Bourgeois von 1789 gegen uns, gegen unsere Staatseinrichtung, unseren seelischen Militarismus, den Geist der Ordnung, Autorität und Pflicht am verfluchten Werke war …
»Auch unser soll jetzt ihr Los sein«, – nämlich »in Kämpfen und Krisen die Verwirklichung von Ideen zu betreiben.« Welche Torheit! Nie kann und wird es die Sendung und Aufgabe, das »Los« Deutschlands sein, Ideen politisch zu verwirklichen. Die Politisierung des Geistes, wie der Zivilisationsliterat sie meint, stößt hier auf den tiefsten, triebhaftesten, unverbrüchlichsten Widerstand, denn die Überzeugung, daß sowohl die Politik wie der Geist dabei vor die Hunde kommen, daß es gleich gefährlich für beide ist, eine Philosophie zur Denkweise und Basis der Gesellschaft und des Staates zu machen, ist hier elementar, wesenhaft, ein Grundbestandteil des nationalen Ethos. Haltet Umfrage bei allen Wissenden, bei den Kennern der Völkerseelen: sie werden euch Aufschluß erteilen über das gehaltene Wesen der deutschen Demokratie. Sie werden euch überzeugen, daß nicht Mißachtung des Geistes, daß Ehrfurcht vor ihm der Grund dieser Gehaltenheit ist; denn Ehrfurcht vorm Geiste macht skeptisch gegen Aktionsprogramme zu seiner politischen »Verwirklichung«. Die deutsche Demokratie ist nicht echte Demokratie, denn sie ist nicht Politik, nicht Revolution. Ihre Politisierung, so, daß der Gegensatz Deutschlands zum Westen in diesem Punkt zum Verschwinden gebracht und ausgeglichen würde, ist Wahn. Ein solcher Umschwung, das leugnen auch seine Anhänger nicht, wäre durch Institutionen, Wahlrechtsreformen u. dgl. nicht zu bewirken: nur eine seelische Strukturveränderung, die völlige Umwandlung des Volkscharakters wäre vermögend, ihn herbeizuführen – und das ist es freilich, was der deutsche Sapadnik wünscht und woran er darum glaubt. Er schwärmt und irrt. Ökonomischer Ausgleich zur Freimachung individuell schöpferischer Kräfte; ein staatstechnisch-pädagogisches Mittel allenfalls zur Freimachung politischer Anlagen: nie wird die deutsche »Demokratie« etwas anderes sein, – solange sie eben deutsche Demokratie, d.h. mehr »deutsch« als »Demokratie« sein wird; und nicht wird ihr Wesen »politisierter Geist« sein, d.h. darin bestehen, »Ideen« politisch zu verwirklichen und geistsprühende Affären zwischen Säbel und Weihwedel einerseits und der »Gerechtigkeit« andererseits zu inszenieren … Ist denn das alles nicht wahr?
Und doch – welche triumphale, schon nicht mehr kämpferische, sondern in glückstrahlende Milde übergegangene Sicherheit spricht aus den angeführten Worten jenes Manifests! Ist es möglich, über soviel subjektives Siegesbewußtsein mit Achselzucken hinwegzugehen? Und sagte ich nicht selbst, daß seine Hoffnungen, sein Glaube, sein Triumph einen starken Anschein von Recht besäßen? Ist die geistig-politische Invasion des Westens so vollkommen vereitelt worden, wie die militärische? Das ist von vornherein unwahrscheinlich, denn der militärischen Widerstandskraft Deutschlands kommt diejenige seines nationalen Ethos – geben wir doch zu, was wir wissen! – bei weitem nicht gleich. Jene Invasion ist nicht vereitelt worden und konnte es nicht werden, denn sie traf nicht nur auf ethische Schwäche, sondern auch auf positives Entgegenkommen: die Wege waren ihr bereitet, nicht erst seit heute und gestern. Das nationale Ethos Deutschlands kann sich an Klarheit, Distinktheit nicht mit dem anderer Völker messen, es fehlt ihm, im eigentlichen und übertragenen Sinne des Wortes, an »Selbstbewußtsein«. Es ist nicht wohlumzirkt, es hat so »schlechte Grenzen« wie Deutschland selbst. Seine größte Schwäche aber ist seine Unbereitschaft zum Wort. Es spricht nicht gut; und faßt man es in Worte, so klingen sie meskin und negativ, wie der Satz, es sei nicht deutsche Angelegenheit, »Ideen zu verwirklichen«. Dagegen hat das politisch-zivilisatorische Ethos in seiner hochherzig-rhetorischen Literaturfähigkeit den schwer widerstehlichen Schmiß und Schwung einfallender Revolutionstruppen. Es hat Bewunderer, Freunde, Verbündete innerhalb der Mauern, Verräter aus Edelmut, die ihm die Tore öffnen. Bald sind es fünfzig Jahre, daß Dostojewskij, der Augen hatte zu sehen, fast ungläubig fragte: »Sollte es wahr sein, daß der kosmopolitische Radikalismus auch in Deutschland schon Wurzel gefaßt hat?« Das ist eine Art zu fragen, die einer verwunderten Feststellung gleichkommt, und der Begriff des kosmopolitischen oder, richtiger, internationalen Radikalismus selbst widerspricht der Versicherung, es sei ein »Trugbild« unserer gegenwärtigen Feinde, daß je die nationalen Demokratieen sich zu einer geistig einheitlichen europäischen oder Weltdemokratie zusammenschließen könnten. Was Dostojewskij den »kosmopolitischen Radikalismus« nennt, ist jene Geistesrichtung, welche die demokratische Zivilisationsgesellschaft der »Menschheit« zum Ziele hat; la république sociale, démocratique et universelle; empire of human civilization. Ein Trugbild unserer Feinde? Aber Trugbild oder nicht: Feinde Deutschlands müssen es unbedingt sein, denen dies »Trugbild« vorschwebt, denn soviel ist sicher, daß bei einem Zusammenschluß der nationalen Demokratien zu einer europäischen, einer Weltdemokratie von deutschem Wesen nichts übrig bleiben würde: die Weltdemokratie, das Imperium der Zivilisation, die »Gesellschaft der Menschheit« könnte einen mehr romanischen oder mehr angelsächsischen Charakter tragen, – der deutsche Geist würde aufgehen und verschwinden darin, er wäre ausgetilgt, es gäbe ihn nicht mehr. Richard Wagner erklärte einmal, vor der Musik vergehe die Zivilisation wie Nebel vor der Sonne. Daß eines Tages die Musik, sie ihrerseits, vor der Zivilisation, der Demokratie, wie Nebel vor der Sonne vergehen könnte, hat er sich nicht träumen lassen …
Dies Buch läßt sich davon träumen, – verworren und schwer und undeutlich, aber dies und nichts anderes ist der Inhalt seiner Ängste. »Finis musicae«: das Wort kommt irgendwo vor darin, und es ist nur ein Traumsymbol für die Demokratie. Der Fortschritt von der Musik zur Demokratie, – er ist es, den es überall meint, wo es von »Fortschritt« spricht. Wenn es aber behauptet und aufzuzeigen versucht, daß Deutschland sich wirklich rapide und unaufhaltsam in der Richtung dieses Fortschritts bewege, so ist das freilich zunächst ein rhetorisches Mittel der Abwehr. Denn es bekämpft ja offenbar diesen Fortschritt, es leistet ihm konservativen Widerstand. In der Tat ist all sein Konservativismus nur Opposition in dieser Beziehung; all seine Melancholie und halb geheuchelte Resignation, all sein Hinsinken an die Brust der Romantik und seine »Sympathie mit dem Tode« ist auch nichts anderes. Es verneint den Fortschritt überhaupt, um jedenfalls diesen Fortschritt zu verneinen; es argumentiert recht wahllos und geht selbst zweifelhafte Bündnisse ein; es rennt gegen die »Tugend« an, deckt den »Glauben« mit Zitaten zu, äußert sich herausfordernd über »Menschlichkeit«, – dies alles, um diesem Fortschritt zu opponieren, dem Fortschritt Deutschlands von der Musik zur Politik.
Aber wozu der Aufwand? Warum die schädliche und kompromittierende Galeerenfron dieses Buches, die niemand von mir verlangte noch erwartete, und für die ich nicht eine Spur von Dank und Ehre haben werde? Man kümmert sich nicht in diesem Maßstabe um etwas, was einen nicht zu kümmern braucht, was einen nicht angeht, weil man nichts davon weiß und nichts davon in sich selbst, im eigenen Blute hat. Ich sagte, Deutschland habe Feinde in seinen eigenen Mauern, d.h. Verbündete und Förderer der Weltdemokratie. Sollte sich das im Engeren wiederholen, und sollte ich Elemente, die dem »Fortschritt« Deutschlands Vorschub leisten, in meinem eigenen konservativen Innern hegen? Wäre es so, daß mein Sein und – soweit davon die Rede sein kann – auch mein Wirken durchaus nicht genau meinem Denken und Meinen entspricht, und daß ich selbst mit einem Teil meines Wesens den Fortschritt Deutschlands zu dem, was in diesen Blättern mit einem recht uneigentlichen Namen »Demokratie« genannt wird (und mit gleichem Wahlrecht nur oberflächlich zu tun hat), zu fördern bestimmt war und bin? Und was für ein Teil wäre denn das? Vielleicht das literarische? Denn die Literatur – sagen wir nur abermals, was wir wissen! – die Literatur ist demokratisch und zivilisatorisch von Grund aus; richtiger noch: sie ist dasselbe wie Demokratie und Zivilisation. Und mein Schriftstellertum also wäre es, was mich den »Fortschritt« Deutschlands an meinem Teile – noch fördern ließe, indem ich ihn konservativ bekämpfe? –
Mit dem, was ich da sagte und fragte, habe ich die Motive der folgenden Betrachtungen wie in einem musikalischen Vorspiel zusammengefaßt. Ich sagte zugleich, was sie sind. Sie sind das umständliche Erzeugnis einer Problematik, die Darstellung eines innerpersönlichen Zwiespaltes und Widerstreites. Daß sie es sind, das macht dies Buch, welches kein Buch und kein Kunstwerk ist, beinahe zu etwas anderem: beinahe zu einer Dichtung.
Der Protest
In seiner krankhaft leichten, unheimlich genialen Art, die immer ein wenig an das verkommene Schwatzen gewisser religiöser Personnagen in seinen Romanen erinnert, spricht Dostojewskij – 1877 – über die deutsche Weltfrage, über »Deutschland, das protestierende Reich«. Solange es überhaupt ein Deutschland gebe, sagt er, sei seine Aufgabe das Protestantentum gewesen: »Nicht allein jene Formel des Protestantismus, die sich zu Luthers Zeiten entwickelte, sondern sein ewiges Protestantentum, sein ewiger Protest, wie er einsetzte mit Armin gegen die römische Welt, gegen alles, was Rom und römische Aufgabe war, und darauf gegen alles, was vom alten Rom aufs neue Rom überging und auf all die Völker, die von Rom seine Idee, seine Formel und sein Element empfingen, der Protest gegen die Erben Roms und gegen alles, was dieses Erbe ausmacht.«
Er führt dann in großen Zügen die Geschichte der römischen Idee vorüber: angefangen beim alten Rom mit seinem Gedanken einer universalen Vereinigung der Menschheit, seinem Glauben an die praktische Verwirklichung dieses Gedankens in Gestalt einer Allerweltsmonarchie. Diese Formel, sagt er, sei gefallen, aber nicht die Idee; denn die Idee sei die Idee der europäischen Menschheit, aus ihr habe sich deren Zivilisation gebildet, für sie allein lebe sie überhaupt. Der Gedanke der römischen Universalmonarchie sei ersetzt worden durch den der Vereinigung in Christo; worauf jene Spaltung des neuen Ideals in das östliche, das Dostojewskij als das Ideal der durchaus geistigen Vereinigung der Menschen bezeichnet, und in das westeuropäische, römisch-katholische, päpstliche erfolgt sei, in welcher Gestalt die Idee ihren christlichen, geistigen Charakter zwar nicht aufgegeben, aber die altrömische, politisch-impe