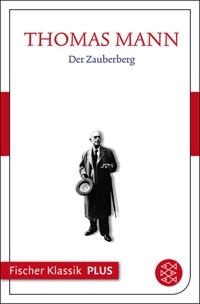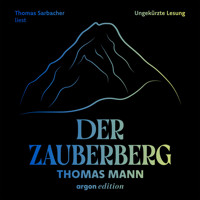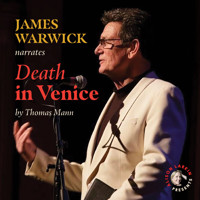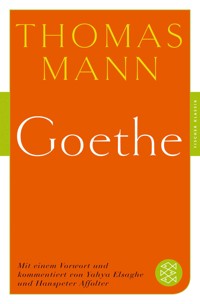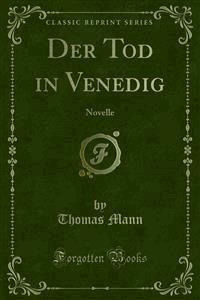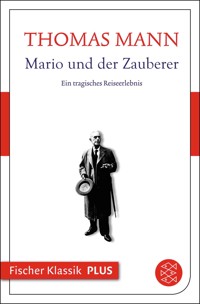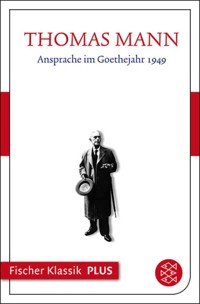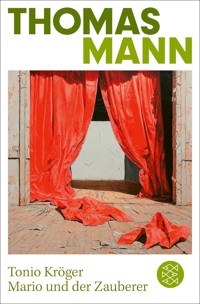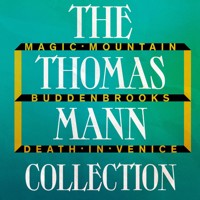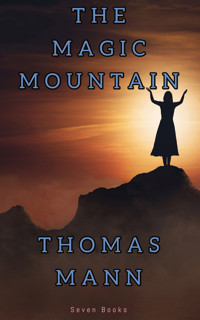3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Als Thomas Mann beim Schreiben über die beiden literarischen Denkmäler Goethe und Tolstoi klagte: »Das Bedürfnis und die Gewohnheit, mich ganz zu geben, ... lassen mich viel zu sehr ausladen.«, hatte er unwissentlich schon in Worte gefasst, worum es ihm bei dieser Arbeit eigentlich ging: um eine Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen und Koordinaten des eigenen Schaffens. Was für ihn selbst galt, attestierte er auch den beiden von ihm verehrten Schriftstellerkollegen: Ihr gesamtes Werk habe Bekenntnischarakter, der Antrieb ihrer literarischen Produktion sei die Liebe zu sich selbst – genauer noch die »Ehrfurcht vor sich selbst«, vor der eigenen Erwähltheit. Die große Essayfassung dieses Textes von 1925 (sie erschien in Thomas Manns Essayband ›Bemühungen‹) ist eine Weiterentwicklung des Vortrags mit gleichlautendem Titel von 1921 und ist noch um eine bild- und facettenreiche, wenn auch etwas konstruierte Gegenüberstellung ergänzt: Goethe und Tolstoi repräsentieren die »Ruhe, Bescheidenheit, Wahrheit und Kraft der Natur«, Schiller und Dostoevskij dagegen die »groteske, fieberhafte und diktatorische Kühnheit des Geistes«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Thomas Mann
Goethe und Tolstoi. Fragmente zum Problem der Humanität
Essay/s
Fischer e-books
In der Textfassung derGroßen kommentierten Frankfurter Ausgabe(GKFA)Mit Daten zu Leben und Werk
{809}Goethe und Tolstoi
FRAGMENTE ZUM PROBLEM DER HUMANITÄT
Stötzer
In Weimar lebte noch zu Anfang unseres Jahrhunderts ein Mann, Julius Stötzer mit Namen und Lehrer seines Zeichens, der, als er noch ein Schüler, ein Gymnasiast von sechzehn Jahren war, mit Dr. Eckermann unter demselben Dache wohnte, nur wenige Schritte vom Hause Goethes. An der Seite eines Schulkameraden, der mit ihm logierte, erhaschte Stötzer manchmal mit Herzklopfen einen Schimmer und Schatten von der Gestalt des Greises, wenn dieser an seinem Fenster saß. Aber beseelt von dem Wunsche, ihn einmal recht aus der Nähe und ganz genau zu sehen, wandten sich die Jungen an ihren Hausgenossen, den Famulus, und baten ihn sehr, ihnen eine solche Gunst doch irgendwie zu verschaffen. Eckermann war freundlich von Natur; er ließ die Knaben an einem Sommertage durch eine Hintertür in den Garten des berühmten Hauses ein, und da standen sie nun in ihrer Beklommenheit und warteten auf Goethe, der denn auch zu ihrem Schrecken wirklich daherkam: in einem hellen Hausrock – es wird wohl der Flanell-Schlafrock gewesen sein, von dem wir wissen – erging er sich hier um diese Stunde, und da er der Jünglinge ansichtig wurde, schritt er auf sie zu, blieb, nach Eau de Cologne duftend, natürlich die Hände auf dem Rücken, mit vorgeschobenem Unterleib und jener Miene eines Reichsstadt-Syndikus, hinter der er, wie glaubwürdig bezeugt ist, Verlegenheit verbarg, vor ihnen stehen und fragte sie nach Namen und Begehr – wahrscheinlich nach beidem zugleich, was, wenn es so geschah, wiederum sehr streng wirkte und kaum zu beantworten {810}war. Da sie denn etwas gestammelt hatten, empfahl ihnen der Alte, fleißig in ihren Studien zu sein, was sie sich dahin übersetzen mochten: rätlicher, als hier Maulaffen feilzuhalten, sei es für sie, sich hinter ihre Schulaufgaben zu setzen – und ging weiter.
So lief das ab – es war im Jahre 1828. – Dreiunddreißig Jahre später, eines Mittags um ein Uhr, wollte Stötzer, der unterdessen ein tüchtiger, seinem Berufe in Liebe ergebener Mittelschullehrer geworden war, eben den Unterricht in der zweiten Klasse beginnen, als ein Schüler des Seminars den Kopf durch die Tür steckte und meldete, ein Fremder wünsche Herrn Stötzer zu sehen. Dieser Fremde trat denn auch ohne weiteres ein, bedeutend jünger als der Lehrer, mit nicht sehr starkem Vollbart, vortretenden Backenknochen, kleinen, grauen Augen und einem Paar Falten zwischen den dunklen Brauen. Er unterließ es, sich auszuweisen oder vorzustellen, sondern fragte sofort, worin heute nachmittag unterrichtet werde; und als er erfuhr, daß erst Geschichte, dann deutsche Sprache daran sei, fand er das ausgezeichnet und sagte, er habe die Schulen von Süddeutschland, Frankreich und England besucht und möchte nun auch die von Norddeutschland kennenlernen. Er sprach wie ein Deutscher. Man mußte ihn für einen Lehrer halten, auf Grund der sachkundigen und interessierten Fragen und Äußerungen, die er tat, indem er beständig Aufzeichnungen in sein Notizbuch machte. Er wohnte der Schulstunde bei. Als die Kinder einen Aufsatz, einen Brief über irgendein Thema in ihre Hefte geschrieben hatten, verlangte der Fremde, die »Kompositionen« mitnehmen und behalten zu dürfen; sie seien für ihn von größtem Interesse. Das fand nun Stötzer denn doch naiv. Und wer entschädigte die Kinder für ihre Schreibhefte? Weimar war eine arme Stadt … Er äußerte sich höflich in diesem Sinn. Aber der Fremde erwiderte, da könne Rat geschaffen wer{811}den, und ging hinaus. Stötzer ließ den Direktor in die Klasse bitten. Etwas Ungewöhnliches, ließ er sagen, ereigne sich. Und da hatte er recht, wenn er es auch erst später so ganz begriff, wie recht er damals mit dieser Botschaft gehabt. Denn damals und auf der Stelle mochte es ihm nicht viel bedeuten, als der Fremde, der, ein Paket Schreibpapier unter dem Arm, zurückgekehrt war, dem Direktor und ihm seinen Namen nannte: »Graf Tolstoi aus Rußland«. – Der Lehrer Stötzer aber brachte es hoch zu Jahren und hatte folglich Zeit, gewahr zu werden, wessen Bekanntschaft er damals gemacht.
Rangfragen
Dieser Mann also, der von 1812 bis 1905 in Weimar lebte und dessen Leben sonst schlicht genug verlaufen sein mag, konnte sich des merkwürdigen Vorzugs rühmen, Goethe und Tolstoi persönlich gekannt zu haben – die beiden großen Männer, an deren Namen diese Betrachtung sich knüpft. Ja, Tolstoi war in Weimar! Dreiunddreißigjährig, geboren in dem Jahre, das dem jungen Stötzer seine Unterredung mit Goethe brachte, kam Graf Leo Nikolajewitsch von Brüssel, wo er erstens Proudhon gesehen und sich von diesem hatte überzeugen lassen, daß la propriété le vol sei, wo er aber zweitens die Erzählung »Polikuschka« geschrieben hatte, nach Deutschland und besuchte die Stadt Goethes. Als Fremder von Distinktion und Gast des russischen Gesandten hatte er Eintritt in das Wohnhaus am Frauenplan, das damals dem Publikum noch nicht offen stand. Es wird aber berichtet, daß er sich weit mehr für die Fröbelschen Kindergärten interessierte, die von einer Schülerin Fröbels selbst geführt wurden und deren pädagogisches System er mit großer Wißbegierde studierte.
Sie sehen wohl, warum ich Ihnen diese kleinen Geschichten erzählte. Es geschah, um Ihnen das »und« schmackhafter zu {812}machen, das meinem Vortrag zu Häupten steht und nicht verfehlt haben wird, beim ersten Anblick ein fragendes Steigen der Augenbrauen zu bewirken. Goethe und Tolstoi – ist das nicht eine im höchsten Grade wilde, willkürliche und ungebührliche Kopulation? Nietzsche hat gegen uns Deutsche einmal den Vorwurf besonderer Taktlosigkeit im Gebrauche des Wortes »und« erhoben: Wir sagten »Schopenhauer und Hartmann«, höhnte er; »Goethe und Schiller« sagten wir ebenfalls, und er fürchte sehr, wir sagten noch obendrein: »Schiller und Goethe«. – Schopenhauer und Hartmann bei Seite. Was Goethe und Schiller betrifft, so hätte Nietzsches äußerst subjektive Abneigung gegen den Theatraliker und Moralisten von beiden ihn nicht verleiten dürfen, eine Brüderlichkeit zu leugnen, die durch die ihr innewohnende exemplarische Gegensätzlichkeit keinerlei Einbuße erleidet und in dem angeblich beleidigten Teil ihren besten Schutzherrn fand. Es war eine Voreiligkeit und durch nichts gerechtfertigte Eigenmächtigkeit Nietzsches, durch seinen Spott über jenes Und eine Rangordnung auszurufen oder als selbstverständlich zu unterstellen, die höchst strittig, ja die strittigste Sache von der Welt ist und es bleiben mag. Voreiligkeit in der Entscheidung gerade dieser Frage ist im ganzen nicht deutsche Art. Instinktiv vermeidet der Deutsche es gerade hier, sich einseitig festzulegen, sondern bevorzugt eine »Politik der freien Hand«, zu deren strikter Befolgung übrigens die folgenden Betrachtungen allen Anlaß geben werden, ja zu deren Verherrlichung sie geradezu angestellt werden. Nichts anderes als eben diese Politik ist der Sinn der Kopula in der Verbindung »Goethe und Schiller«, wo sie für unser Bewußtsein einander entgegensetzt, was sie verbindet. Man müßte die Gedankenwelt des klassischen und umfassenden Essays der Deutschen, welcher eigentlich alle übrigen in sich enthält und überflüssig macht – ich meine Schillers Ab{813}handlung über naive und sentimentalische Dichtung –, ja niemals berührt haben, um dieses Und nicht als tief antithetisch zu empfinden. Ein anderes hat ähnlichen Sinn, ein fernes und fremdes: Das »und« zwischen Tolstoi und Dostojewski. Entzöge man aber der Kopula ihr Recht auf Antithetik, gestände man ihr ausschließlich die Aufgabe zu, Wesensverwandtschaft, Wesensgleichheit zu statuieren – wie dann? Vollzöge sich da in unserer Vorstellung nicht augenblicklich ein Tausch und Platzwechsel unter den großen Paaren, die ich nannte? Rückten da nicht alsbald, aus tiefen geistigen – nein, besser: aus tiefen natürlichen Gründen Schiller und Dostojewski zusammen und andererseits – Goethe und Tolstoi?
Sie sind offenbar weit entfernt, sich zufrieden zu geben. Sie antworten: Außer dem Wesen gibt es den Rang. Die Antithetik, sagen Sie, in Ehren, aber auch gegeneinander darf man nicht stellen, was verschiedenen Größenordnungen angehört. Daß der eine ein europäischer Humanist und ausgemachter Heide, der andere aber ein anarchistischer Urchrist des Ostens war, wollen wir hingehen lassen. Aber der deutsche Weltdichter, dessen Namen man mit den erhabensten nennt, mit Dantes, mit Shakespeares – und der naturalistische Romancier, der kürzlich, zu unseren eigenen Lebzeiten, sein problematisches Leben auf freilich ergreifend problematische Weise endigte: es geht nicht an, zugleich von ihnen zu reden, es verstößt gegen den aristokratischen Instinkt, es ist geschmacklos.
Stellen wir zurück, was Sie hingehen lassen wollten: das Heidentum des einen, die Christlichkeit des anderen! Vielleicht finden wir Zeit, darauf zurückzukommen. Was aber den »aristokratischen Instinkt« betrifft, wie Sie sich auszudrücken beliebten, so behaupte ich sofort, daß gerade er es ist, gegen den ich mit meiner Zusammenstellung nicht nur nicht verstoße, sondern der geradezu dadurch gefeiert werden soll. Die {814}Rang-, die Größenordnung? Sind Sie sicher, in diesem Punkte keiner perspektivischen oder anderen Täuschung zu unterliegen? Turgenjew, in seinem letzten Briefe an Tolstoi, jenem Brief, den er zu Paris auf dem Sterbebette schrieb und worin er den Freund beschwor, von den theologischen Selbstquälereien zur Kunst, zur Literatur zurückzukehren – Turgenjew war der erste, der ihm den Titel des »großen Schriftstellers des Russenlandes« verlieh, diesen Titel, der ihm seither zu eigen geblieben ist und der auszudrücken scheint, daß Tolstoi seinem Lande und Volk in der Tat ungefähr das bedeutet, was uns der Dichter des »Faust« und des »Wilhelm Meister«. Tolstoi selbst angehend, so war er Christ durch und durch, wie Sie bemerkten, aber nicht Christ genug, um an übertriebener Demut zu leiden und seinen Namen nicht kühn neben die größten, ja neben die mythisch großen zu setzen. Von »Krieg und Frieden« hat er gesagt: »Ohne falsche Bescheidenheit, es ist etwas wie die Ilias«. Andere haben ihn über sein Erstlingswerk, »Kindheit und Knabenalter«, dasselbe sagen hören. War das Größenwahn? In meinen Augen, lassen Sie mich das aussprechen, ist es nichts als die reine und schlichte Wahrheit. »Nur die Lumpe«, sagt Goethe, »sind bescheiden.« Eine heidnische Sentenz. Aber Tolstoi hielt es mit ihr; seine Optik auf sich selbst war immer von historischer Großartigkeit, und schon mit 37 Jahren reihte er in seinen Tagebüchern die eigenen Werke, die fertigen und die noch erst zu schreibenden, den berühmtesten Werken der Weltliteratur an.
Der »große Dichter des Russenlandes« also nach maßgeblichem Urteil; der Homer seiner Tage nach eigener Einschätzung – das ist nicht alles. Maxim Gorki hat nach Tolstois Tode ein kleines Buch der Erinnerung an ihn veröffentlicht – sein bestes Buch, wenn ich urteilen darf. Es schließt mit den Worten: »Und ich, der nicht an Gott glaubt, sah ihn aus einem {815}dunklen Grunde sehr vorsichtig und ein wenig schüchtern an, sah ihn an und dachte: ›Der Mann ist Gott gleich‹.« – Ist Gott gleich. Merkwürdig! Nie hat das jemand von Dostojewski gedacht und gesagt, noch hätte es je jemand von ihm denken und sagen können. Man hat ihn einen Heiligen genannt, und auch Schiller kann man aus wahrer Empfindung so nennen – wenn auch in einem weniger byzantinisch christlichen Sinn, so doch in dem christlichen Sinn, den dieses Wort auf jeden Fall besitzt. Aber Goethe und Tolstoi, diese beiden, hat man als göttlich empfunden. Die Redensart vom »Olympier« ist Gemeinplatz. Aber nicht erst den weltberühmten und geistig gebietenden Greis hat man göttlich genannt, schon als Mann, als Jüngling mit zaubernden Augen voll Götterblicken, wie Wieland sang, hat er tausendmal von den Mitlebenden dies Attribut empfangen, und Riemer erzählt, wie der Sechzigjährige sich bei Gelegenheit bitter darüber lustig gemacht und gerufen habe: »Ich habe den Teufel vom Göttlichen! Was hilft’s mir, daß man mir nachsagt: das ist ein göttlicher Mann, wenn man nur nach eigenem Willen tut und mich hintergeht. Göttlich heißt den Leuten nur der, der sie gewähren läßt, wie ein jeder Lust hat.« – Was Tolstoi betrifft, so war er nicht eben ein Olympier – kein Humanistengott, natürlich. Er war, sagt Gorki, eher so eine Art von russischem Gott, der »auf einem Ahornthron unter einer goldenen Linde sitzt« – heidnisch also auf andere Art als der Jupiter von Weimar, aber heidnisch eben doch, denn Götter sind heidnisch. Warum? Weil sie naturhaft sind. Weil man nicht Spinozist zu sein braucht wie Goethe, der wußte, warum er es war, um Gott und Natur als Eines und den Adel, den die Natur verleiht, als göttlich zu empfinden. »Seine über menschliches Maß hinausgewachsene Individualität ist ein monströses Phänomen, beinahe häßlich, und er hat etwas vom Recken Swiatogor, den die Erde nicht fassen kann.« So Gorki über {816}Tolstoi. Und ich führe es an, weil wir von Größenordnungen sprachen. Gorki sagt zum Beispiel noch: »Es ist etwas in ihm, was mir immer das Verlangen erregte, laut zu rufen: ›Seht doch, was für ein wundervoller Mensch auf der Erde lebt!‹ Denn er ist, sozusagen, ganz allgemein und zu allererst ein Mensch, ein menschheitlicher Mensch.« – Das erweckt Erinnerungen; an wen? –
Nein, die Rangordnung, die »aristokratische« Frage, die Frage der Vornehmheit also, ist gar kein Problem innerhalb meiner Zusammenstellung. Sie wird es erst bei anderer Anordnung der Figuren, erst dann, wenn wir das heilige Menschentum heranziehen und es vermittelst des antithetischen Und gegen das göttliche stellen, wenn wir »Goethe und Schiller«, »Tolstoi und Dostojewski« sagen. Erst dann, meine ich, steht das Problem der Vornehmheit, die ästhetisch-moralische Frage »Was ist vornehmer? Wer ist vornehmer?« da. Wir werden sie gemeinsam nicht beantworten. Dem einzelnen muß es überlassen bleiben, nach seinem Geschmack, oder weniger leichtfertig ausgedrückt, nach der Art seines Humanitätsbegriffs, über die Wertfrage zu befinden – eines Humanitätsbegriffs, der freilich, wie wir mit halber Stimme hinzufügen, notwendig unvollkommen und einseitig sein muß, um zu solchen Entscheidungen zu ermutigen.
Rousseau
Berührt es nicht sonderbar zu hören, daß ein Mann sie beide gekannt hat, den Dichter des »Faust« und den »großen Schriftsteller des Russenlandes«? Denn sie gehörten ja verschiedenen Jahrhunderten an. Das Leben Tolstois erfüllt den größten Teil des neunzehnten. Er ist dessen Sohn, unbedingt, zumal als Künstler weist er alle Merkmale dieser Epoche auf, und zwar ihrer zweiten Hälfte. Was Goethe betrifft, so hat das 18. Jahrhundert ihn hervorgebracht, und wichtige, ja entscheidende {817}Bestandteile seines Wesens und seiner Bildung gehören diesem an – das wäre leicht zu belegen. Nun ließe sich freilich sagen, daß in Tolstoi ebensoviel vom 18., von Goethes Jahrhundert, lebendig war wie in Goethe vom 19., von demjenigen Tolstois. Tolstois rationales Christentum hat mit dem Deismus des 18. Jahrhunderts mehr zu schaffen als mit der mystisch-gewaltigen Religiosität Dostojewskis, die ganz 19. Jahrhundert war. Sein Moralismus, der wesentlich in einer zersetzenden, alle menschlichen und göttlichen Einrichtungen unterminierenden Verstandeskraft bestand, war der Gesellschaftskritik des 18. Jahrhunderts verwandter als dem viel, viel tieferen und wiederum religiöseren Moralistentum Dostojewskis. Und sein Hang zur Utopie, sein Haß auf die Zivilisation, seine Passion für die Ländlichkeit, den bukolischen Frieden der Seele – eine noble Passion, die Passion eines adligen Herrn – kann ebenfalls als 18., und zwar als französisches 18. Jahrhundert angesprochen werden. Goethe andererseits: Sein Alterswerk, der soziale Roman »Wilhelm Meisters Wanderjahre«, gibt namentlich dadurch Anlaß zum Erstaunen, daß darin mit einer Intuition, einem Scharf- und Weitblick, die okkult, seherisch anmuten, aber nur der Ausdruck feinerer Organisation, Ergebnis der Sensitivität, des Spürsinnes sind, die ganze gesellschaftlich-ökonomische Entwicklung des 19. Jahrhunderts: die Industrialisierung der alten Kultur- und Agrarländer, die Herrschaft der Maschine, der Aufstieg der organisierten Arbeiterschaft, die Klassenkonflikte, die Demokratie, der Sozialismus, der Amerikanismus selbst, nebst sämtlichen aus diesen Veränderungen erwachsenden geistigen und erzieherischen Konsequenzen vorweggenommen ist.
Immerhin, und wie es nun mit der säkularen Zugehörigkeit der beiden großen Männer stehe – man kann sie nicht Zeitgenossen nennen. Nur vier Jahre lang haben sie die Zeitlichkeit {818}geteilt: von 1828, dem Geburtsjahr des Russen, bis 1832, da Goethe starb. Und doch hindert dies nicht, daß mindestens ein Bildungsfaktor – und zwar ein moderner, aktueller (von den uralt-allmenschlichen, von Homer und der Bibel hier ganz zu schweigen) –, daß also wenigstens ein Element ihres seelisch-geistigen Aufbaues ihnen beiden gemeinsam ist. Es ist das Element Rousseau.
»Ich habe den ganzen Rousseau gelesen, die ganzen zwanzig Bände, das Lexikon der Musik inbegriffen. Ich empfand für ihn mehr als Enthusiasmus, ich betete ihn an. Mit fünfzehn Jahren trug ich an Stelle des gewohnten Kreuzes ein Medaillon mit seinem Bilde um den Hals. Ich bin mit einigen seiner Stellen so vertraut, daß es mir ist, als hätte ich sie selbst geschrieben.« Das sind die Worte Tolstois aus seinen »Bekenntnissen«. Und sicher, er war Rousseauist auf eine intimere, persönlichere und bedenklichere Weise als Goethe, der als Mensch mit der nicht immer gewinnenden Problematik des armen Jean Jacques so gar nichts zu schaffen hatte. Wenn aber Goethe, um irgendein Beispiel anzuführen, in einer frühen Rezension sich äußert: »Die Verhältnisse der Religion, die mit ihnen auf das engste verbundenen bürgerlichen Beziehungen, der Druck der Gesetze, der noch größere Druck gesellschaftlicher Verbindungen und tausend andere Dinge lassen den polierten Menschen und die polierte Nation nie ein eigenes Geschöpf sein, betäuben den Wink der Natur und verwischen jeden Zug, aus dem ein charakteristisches Bild gemacht werden könnte« – so ist das, literarisch gesprochen, »Sturm und Drang«, allgemein geistesgeschichtlich gesprochen aber ist es Rousseauismus, mit seinem Einschlag von Revolution, von Anarchismus sogar, der bei dem russischen Gottsucher religiös-urchristlich-bildungsfeindliches Gepräge annimmt, während bei Goethe schon hier ein Einlenken ins Humanistische, das Durchscheinen eines {819}Bildungs- und Selbstausbildungs-Individualismus zu bemerken ist, den Tolstoi als unchristlich-egoistisch verpönt haben würde, obgleich er es nicht ist, obgleich er Arbeit am Menschen, am Menschentum, an der Menschheit bedeutet und, wie die »Wanderjahre« zeigen, in die Welt des Sozialen mündet …
Erziehung und Bekenntis
Welche beiden Assoziationen sind es, meine Damen und Herren, die anklingen, wenn der Name Rousseau ausgesprochen wird – abgesehen von der Assoziation »Natur«, die selbstverständlich zuallererst sich meldet? Es sind die Ideenverbindungen »Pädagogik« und »Autobiographie«. Denn J. J. Rousseau ist ja der Verfasser des »Emile« und der »Confessions«. Beide Elemente, das pädagogische und das autobiographische, tun sich aufs stärkste hervor bei Goethe wie bei Tolstoi, sie sind aus beider Werk und Leben überhaupt nicht wegzudenken. Das Motiv der Erziehung angehend, so habe ich Tolstoi heute sofort als pädagogischen Amateur in unser Gespräch eingeführt, und Sie erinnern sich, daß er jahrelang nichts anderes getrieben, die ganze Macht der ihm innewohnenden Leidenschaft in dieses Bett geworfen und theoretisch und praktisch mit dem Problem der russischen Volksschule bis zur Erschöpfung gerungen hat. Unnötig, darauf hinzuweisen, daß Goethe ein erzieherischer Mensch in des Wortes vollkommenster Bedeutung war. Die beiden großen Denkmale seines Lebens, das poetische und das prosaische, der »Faust« und der »Wilhelm Meister«, sind Erziehungsgedichte, Darstellung menschlicher Ausbildung; und wenn in den »Lehrjahren« noch die Idee der individualistischen Selbstformung vorherrscht – »denn mich selbst, ganz wie ich da bin, auszubilden, das war dunkel von Jugend auf mein Wunsch und meine Absicht,« sagt Wilhelm Meister –, so wendet sich in den »Wanderjahren« der Erzie{820}hungsgedanke nach außen, ins Objektive, ins Soziale, ja ins Staatsmännische, und im Zentrum des Werkes steht, wie Sie wissen, die strenge und schöne Utopie der pädagogischen Provinz.
Das zweite Motiv, das bekennerisch-autobiographische, bei beiden nachzuweisen ist ebenfalls leicht. Daß alle Werke Goethes nur »Bruchstücke einer großen Konfession« darstellen, wüßten wir auch dann, wenn wir es nicht von ihm selbst wüßten; und außerdem hat er ja »Dichtung und Wahrheit«, neben Augustins und Rousseaus Bekenntnissen die berühmteste Autobiographie der Welt, geschrieben. Bekenntnisse nun hat auch Tolstoi verfaßt – ich meine zunächst ein Buch dieses Titels, gelegen durchaus auf der großen Linie der Lebens- und Seelenbeichten, die von dem afrikanischen Heiligen bis zu Strindberg, dem Sohn der Magd, heraufführt. Aber es ist wie bei Goethe: nicht durch ein Buch ist Tolstoi Autobiograph. Er ist es, angefangen bei dem Jugendroman »Kindheit und Knabenalter«, durch sein gesamtes Lebenswerk in dem Grade, daß Mereshkowski, der große russische Kritiker, sagen konnte: »Die künstlerischen Werke L. Tolstois sind im Grunde nichts anderes als ein mächtiges, durch fünfzig Lebensjahre hindurch geführtes Tagebuch, eine endlose, ausführliche Beichte.« Ja, dieser Beurteiler setzt hinzu: »In der Literatur aller Zeiten und aller Völker wird sich wohl kaum ein zweiter Schriftsteller finden, der sein persönliches Privatleben, ja oft die intimsten Seiten desselben, mit einer so großherzigen Aufrichtigkeit enthüllt, wie Tolstoi.« – »Großherzig« – ich merke an, daß das ein etwas euphemistisches Beiwort ist. Man könnte, wollte man gehässig sein, dieser Aufrichtigkeit der berühmten Autobiographen auch andere Beiwörter geben, schlimmere, des Sinnes etwa, wie Turgenjew einmal ironisch von »Fehlern« sprach, die einem großen Schriftsteller unentbehrlich seien – womit of{821}fenbar das »Fehlen« gewisser Hemmungen gemeint ist, einer gewissen, sonst geforderten Schamhaftigkeit, Diskretion, Keuschheit, Bescheidenheit, oder, ins Positiv-Fehlerhafte gewendet, die Herrschaft eines gewissen Liebesanspruchs an die Welt, und zwar eines unbedingten Liebesanspruchs, insofern, als es bei der Selbstentblößung gleich viel gilt, ob Vorzüge oder Laster entblößt werden: man will gekannt und geliebt sein – geliebt, weil gekannt, oder geliebt, obwohl gekannt, das ist es, was ich »unbedingten« Anspruch auf Liebe nenne. Das Merkwürdige ist, daß die Welt diesen Anspruch bestätigt und erfüllt.
Es gibt ein gutes Wort, das lautet: »Liebe zu sich selbst ist immer der Anfang eines romanhaften Lebens.« Liebe zu sich selbst, so kann man hinzufügen, ist auch der Anfang aller Autobiographie. Denn der Trieb eines Menschen, sein Leben zu fixieren, sein Werden aufzuzeigen, sein Schicksal literarisch zu feiern und die Teilnahme der Mit- und Nachwelt leidenschaftlich dafür in Anspruch zu nehmen, hat dieselbe ungewöhnliche Lebhaftigkeit des Ichgefühls zur Voraussetzung, die, nach jenem klugen Wort, ein Leben »romanhaft« macht – subjektiv, für den Erlebenden, aber auch objektiv, für die anderen, die Welt. Selbstverständlich ist diese »Liebe zu sich selbst« etwas anderes, etwas Stärkeres, Tieferes und Produktiveres als gemeine »Selbstgefälligkeit«, »Selbstverliebtheit«. Sie ist in den schönsten Fällen das, was Goethe in den »Wanderjahren« »die Ehrfurcht vor sich selbst« nennt und als die oberste Ehrfurcht feiert. Sie ist das dankbar-ehrfürchtige Erfülltsein der Götterlieblinge von sich selbst, wie es mit unvergleichlich innigem Nachdruck aus den Zeilen spricht:
»Alles geben die Götter, die unendlichen,
Ihren Lieblingen ganz:
{822}Alle Freuden, die unendlichen,
Alle Schmerzen, die unendlichen, ganz.«