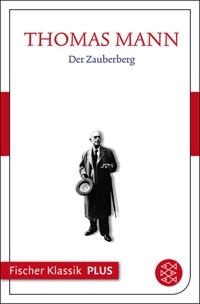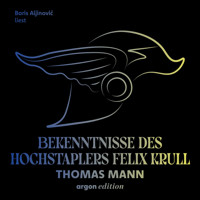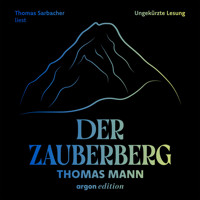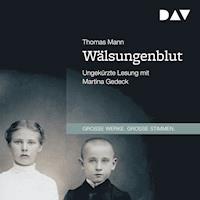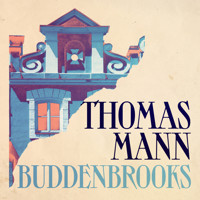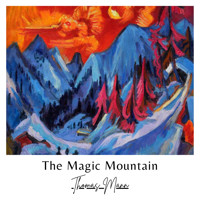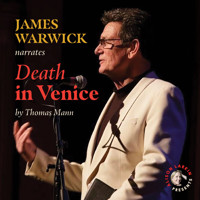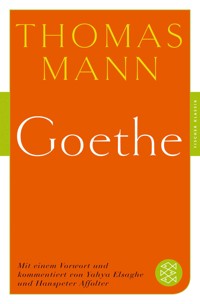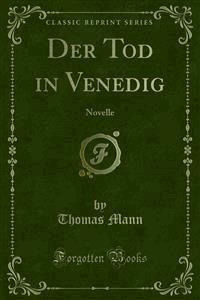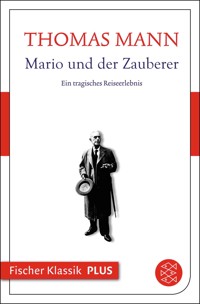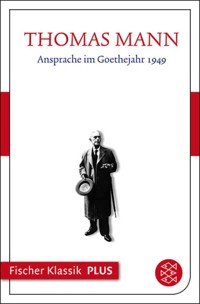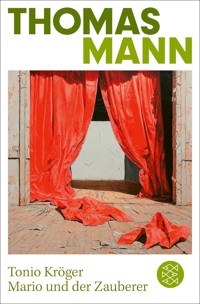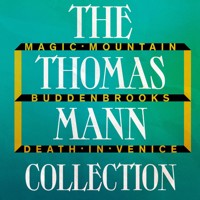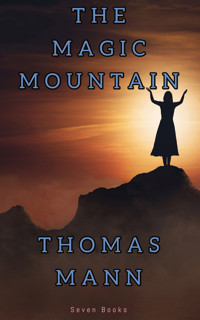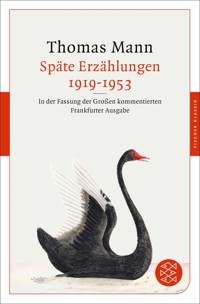12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Thomas Manns wichtigste Schriften zur Demokratie »Es ist mit der Selbstverständlichkeit der Demokratie in aller Welt eine zweifelhafte Sache geworden.« Dieser Hinweis stammt nicht etwa aus einem Kommentar zur politischen Lage der Gegenwart, sondern aus Thomas Manns Vortrag »Vom zukünftigen Sieg der Demokratie« aus dem Jahr 1938. Nicht zufällig wird Thomas Mann in der Gegenwart als leidenschaftlicher Verteidiger der Demokratie wiederentdeckt. Wie wenig selbstverständlich diese Staatsform und die damit verbundene Kultur ist, hat er durch die Zerstörung der Weimarer Republik am eigenen Leib erfahren. Versammelt werden im vorliegenden Band erstmals alle einschlägigen Reden, Essays und Ansprachen zur Demokratie. Verblüffend aktuell ist Thomas Mann nicht zuletzt deshalb, weil er Demokratie auch als Lebensstil versteht: als Einübung in den gelassenen Umgang mit Pluralität. Mit einem Nachwort von Matthias Löwe und Kai Sina
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Thomas Mann
Zur Verteidigung der Demokratie
Politische Schriften
Über dieses Buch
»Es ist mit der Selbstverständlichkeit der Demokratie in aller Welt eine zweifelhafte Sache geworden.« Dieser Hinweis stammt nicht etwa aus einem Kommentar zur politischen Lage der Gegenwart, sondern aus Thomas Manns Vortrag »Vom zukünftigen Sieg der Demokratie« aus dem Jahr 1938. Nicht zufällig wird Thomas Mann in der Gegenwart als leidenschaftlicher Verteidiger der Demokratie wiederentdeckt. Wie wenig selbstverständlich diese Staatsform und die damit verbundene Kultur ist, hat er durch die Zerstörung der Weimarer Republik am eigenen Leib erfahren. Versammelt werden im vorliegenden Band erstmals alle einschlägigen Reden, Essays und Ansprachen zur Demokratie. Verblüffend aktuell ist Thomas Mann nicht zuletzt deshalb, weil er Demokratie auch als Lebensstil versteht: als Einübung in den gelassenen Umgang mit Pluralität.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Thomas Mann, 1875–1955, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Mit ihm erreichte der moderne deutsche Roman den Anschluss an die Weltliteratur. Manns vielschichtiges Werk hat eine weltweit kaum zu übertreffende positive Resonanz gefunden. Ab 1933 lebte er im Exil, zuerst in der Schweiz, dann in den USA. Erst 1952 kehrte Mann nach Europa zurück, wo er 1955 in Zürich verstarb.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Für diese Ausgabe:
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH,
Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Kosmos Design, Münster
Coverabbildung: Kosmos Design, Münster, unter Verwendung einer KI-generierten Abbildung
ISBN 978-3-10-492143-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Kaiserreich
[Demokratisierung] (1918)
Weimarer Republik
Von deutscher Republik (1922)
[Der Film, die demokratische Macht] (1923)
Rettet die Demokratie! (1925)
Deutschland und die Demokratie (1925)
Deutsche Ansprache (1930)
[Rede vor Arbeitern in Wien] (1932)
Emigration und Nachkriegszeit
Vom zukünftigen Sieg der Demokratie (1938)
Das Problem der Freiheit (1939)
The Dangers Facing Democracy (1940)
[Zur Erklärung des Council for a Democratic Germany] (1944)
Franklin Delano Roosevelt (1945)
Gespenster von 1938 (1948)
Goethe und die Demokratie (1949)
Quellenverzeichnis
Daten zu Leben und Werk
Was wir gut zu machen haben
Kaiserreich
[Demokratisierung] (1918)
Ich werde mich hüten, auf Ihre Frage nach den Beziehungen zwischen Demokratie und Kunst, nach den Wirkungen, welche die bevorstehende oder schon vollzogene Demokratisierung Deutschlands auf die deutsche Kunst ausüben wird, mich ernstlich einzulassen. Das gäbe ein Buch – vielleicht hat es in der Stille schon eins gegeben. Demokratisierung, das bedeutet für mich ganz einfach Politisierung – es sind zwei Worte für eine und dieselbe Sache –, und von der Politisierung der Kunst ist ja jetzt viel und schwunghaft die Rede. Es war auch schon die Rede davon in einem Gespräch zwischen Goethe und Eckermann, bei welchem dieser meinte, dass die großen kriegerischen Ereignisse der letzten Jahre den Geist doch eigentlich mächtig aufregen sollten. »Mehr Wollen«, sagte Goethe, »haben sie aufgeregt als Geist, und mehr politischen Geist als künstlerischen, und alle Naivität und Sinnlichkeit ist dagegen gänzlich verloren gegangen. Wie will aber ein Künstler ohne diese beiden großen Erfordernisse etwas machen, woran man Freude haben könnte?« Ja, das war Goethe, der Quietist und Ästhet, der sich darüber beklagte, dass »Franztum« (das heißt: Politik) »ruhige Bildung« zurückdränge. Wir wollen nun also den sozialen Kontrakt verbessern. Hoffentlich blamieren wir uns nicht …
Weimarer Republik
Von deutscher Republik (1922)
Gerhart Hauptmann zum sechzigsten Geburtstag
Sie waren unter meinen Zuhörern, Gerhart Hauptmann, darf ich Sie erinnern?, als ich an einem Tage der Goethe-Woche zu Frankfurt in der Universität über Bekenntnis und Erziehung, über Humanität also, sprechen durfte; in erster Reihe saßen Sie vor mir, und hinter Ihnen war das Festauditorium bis zur Empore hinauf voll akademischer Jugend. Das war schön; und so sei es heute wieder. Noch einmal, kraft meiner Einbildung, will ich Sie vor mir haben, wie damals, dass ich Sie anspreche zu Ihrem Geburtstag, werter Mann; und wenn ich den Kopf ein wenig höher hebe, soll deutsche Jugend da sein und ihre Ohren spitzen, denn auch zu ihr will ich, über Ihre Person hinweg, heute wieder reden, auch mit ihr, wie die Wendung lautet, wenn der Sinn jenes Hühnchens darin liegen soll, das zu pflücken ist, habe ich zu reden: über Sie, den wir feiern, und über Anderes und Weiteres, alles in allem aber wiederum über Dinge der Humanität – Dinge also, für welche deutsche Jugend nie und nimmer sich unempfänglich erweisen kann, sie wäre denn eben nicht deutsche Jugend mehr. Dennoch ist leicht möglich, dass sie scharrt. Aber das macht nichts, ich werde zu Ende reden und Herz und Geist daran setzen, sie zu gewinnen. Denn gewonnen muss sie werden, soviel ist sicher, und ist auch zu gewinnen, da sie nicht schlecht ist, sondern nur stolz und vertrotzt in ihren scharrenden Teilen.
Um noch einmal anzuheben, so ist nicht verwunderlich, dass ich mich jener Frankfurter Umstände gern erinnere und sie im Geist wieder herstelle: unzweifelhaft, wie ich nachträglich gewahr wurde, (denn die Gegenwart findet uns immer undankbar) bedeuteten sie einen Höhepunkt meines Schriftstellerlebens. Rechts vorn, wie gesagt, saßen Sie, Gerhart Hauptmann, und linkerseits der Vater Ebert. Vor König und vor Reich also, wie Lohengrin singt, enthüllte mein Geheimnis ich in Treuen – wobei mit dem »Reiche«, versteht sich, der Vater Ebert gemeint ist, mit dem König aber Sie. Denn ein König sind Sie heute, wer wollte es leugnen, ein Volkskönig wahrhaft, wie Sie da vor mir sitzen – der König der Republik. Das wäre ein Widerspruch? So rufe ich Novalis an, einen Royalisten besonderer Art, der gesagt hat, man werde bald allgemein überzeugt sein, dass kein König ohne Republik und keine Republik ohne König bestehen könne – ein demokratisches Wort auf jeden Fall und zu der Ergänzung auffordernd, dass immer noch viel eher eine Republik ohne König bestehen könne, als das Umgekehrte (Scharren im Hintergrunde) und man sich keineswegs wundern dürfte, wenn Sie, in Ihrer Eigenschaft als König, durchdrungener Republikaner wären, da Ihr Königtum durch unsere Republikanisierung so außerordentlich verstärkt und verdeutlicht worden – nach einem kurzen Schwanken Ihrer Stellung während des Prozesses der Umwälzung selbst.
Wir leben rasch, die Beleuchtung, worin der Einzelne steht, wechselt mit Lidschlagschnelle, heute tot, heißt es, und morgen, bis auf weiteres, wieder rot; es ist unterhaltend, wenn auch freilich nicht mehr, das Auge ans Kaleidoskop der öffentlichen Umstände und Geltungen zu halten, selbst insofern unsere eigenen Tagesschicksale im Spiele sind. Der intellektualistische Radikalismus, der in literarischer Sphäre die Revolution begleitete, war Ihrem Wesen nicht hold. »Der Geist« war wider Sie. Das ist schon vorbei. Die scharfen Knabenstimmen, die Sie »ungeistig« nannten, sind verstummt, die Welle trägt Sie, die sozialen sowohl wie die demokratischen Tendenzen der Zeit kommen Ihrer Größe zustatten. Der Sozialismus dieser Zeit ehrt in Ihnen den mitleidigen Dichter der »Weber« und des »Hannele«, den Dichter der Armen; und nachdem man der Demokratie alles nachgesagt hat, was ihr nachgesagt werden kann, ist festzustellen, dass sie des Landes geistige Spitzen, nach Wegfall der dynastisch-feudalen, der Nation sichtbarer macht: Das unmittelbare Ansehen des Schriftstellers steigt im republikanischen Staat, seine unmittelbare Verantwortlichkeit gleichermaßen – ganz einerlei, ob er persönlich dies je zu den Wünschbarkeiten zählte oder nicht.
Wodurch Sie aber namentlich siegten, Gerhart Hauptmann, war Ihr Deutschtum, das heißt Ihre echte Popularität – um nochmals Novalis zu zitieren, der das Ideal der Deutschheit eben hierdurch, als »echte Popularität«, bestimmt – eine Volkstümlichkeit des humansten Gepräges, wie man nicht säumen darf hinzuzufügen, um rohe und hausbackene Vorstellungen abzuwehren: human bereits im Punkte ihrer historischen Ursprünge. Kommilitonen! (»Nanu?«) Ich rede euch an, akademische Jugend, namentlich soweit ihr mit scharrender Unruhe meine Worte zu begleiten euch schon mehrmals bemüßigt fandet. Die letzte stark internationalistische Befruchtung unserer Literatur ereignete sich in den achtziger und neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, als Ibsen, Zola und die großen Russen bei uns ihren Einzug hielten; sie fiel zusammen mit dem Durchbruch des Naturalismus, der Lufterneuerung durch das jüngste Deutschland. Und welches ist die Dichterpersönlichkeit, die diese künstlerisch kosmopolitische Bewegung zeitigte? Welche bleibende Gestalt ließ sie zurück? Nun, sie bildete das deutscheste Angesicht, das Gerhart Hauptmanns, sie führte diesen Meister empor, der kraft echter Popularität heute zu fürstlich repräsentativer Stellung aufgerückt ist, und in dem In- und Ausland das geistige Haupt des nachkaiserlichen Reiches ehrt. Es lohnt, darüber nachzudenken. Es lohnt, das zu tun auch im Falle Stefan Georges, aus dessen Frühzeit die Propheten Baudelaire und den französischen Parnass nicht wegstilisieren sollten, dessen Leben, Gestalt und Wirkung aber heute eine hoch und rein nationale Angelegenheit ist. Wo irgend Größe waltet, da setzt das Physiognomisch-Nationale sich aller kosmopolitischen Hingabe ungeachtet unfehlbar durch, und unter uns Deutschen wenigstens scheint Grundgesetz, dass, wer sich verliert, sich bewahren wird, wer sich aber zu bewahren trachtet, sich verlieren, das heißt der Barbarei oder biederer Unbeträchtlichkeit anheimfallen wird. (Verbreitete Unruhe.)
Human, sage ich, und nicht roh oder hausbacken, ist dieses Mannes dichterische Deutschheit ihrer literarischen Geschichte nach. Human, setze ich hinzu, weder völkisch simpel noch völkisch ungeschlacht und randalierend, sondern liberal im menschlichsten Sinn, kulturmilde, würdig-friedfertig stellen sein Deutschtum, seine hohe Echtheit, seine Popularität sich überhaupt und durchaus unserer Verehrung dar. Wie hätte er freilich in Kriegsnot und –drang sich ihrer nicht schmerzvoll innig bewusst werden sollen! Er prahlte nicht mit Philanthropie. Er benahm sich nicht literatenhaft, ging nicht nach Zürich, um von dort aus sein Land und Volk pazifistisch zu begeifern. Mit Herz und Mund stand er zu Deutschland, tat es noch eben jetzt wieder, als es galt, Grenzgebiete des Reichs, deren Abtrennung die zweifelhafte Weisheit der Sieger verfügt, in Trauer zu grüßen – und aus dem Saal auf die Straße drängte die Menge dem hohen, väterlichen Manne nach, unwillig, ihn zu lassen, unersättlich in Liebesbekundungen. Wäre es aber so, könnte er von einem Volk, in dessen Wesenstiefe organisch-unbewusst und sein Gewissen doch unverleugbar bestimmend, große Kulturüberlieferungen lebendig sind – könnte er, sage ich, von diesem seinem Volke solchermaßen als Vater und Fürsprecher empfunden werden, wenn seine Popularität von völkisch enger, plump aggressiver und humanitätloser Art wäre? So kann wirkliche und echte deutsche Popularität niemals sein. Was Europa auch sagen möge: humanitas als Idee, Gefühl und sittlich-geistiges Regulativ, das stille Bewusstsein, dass Staat nur »eine besondere Verbindung mehrerer Menschen in dem großen Staate ist, den die Menschheit für sich selbst schon ausmacht«, um wieder ein bereites Wort des Dichters einzusetzen, der, wie es scheint, bei dem, was ich heute zu sagen habe, mein Eideshelfer sein soll, ist unserm Volke niemals abhandengekommen, und kein anderer hat die Werte des Nationellen und des Universellen in Gewissenstiefen und Geisteshöhn bedachtvoller gegeneinander abgewogen.
Am geistreichsten geschah das in jener wundervollen Sphäre, der Friedrich von Hardenberg angehörte, und deren Kunstsinn für das Völkisch-Pittoreske so stark war, dass er sich ins Human-Umfassende steigerte, dass Nationalismus und Universalismus hier glücklich beieinander wohnten. »Alles Nationale«, sagt Novalis, »alles Temporelle, Lokale, Individuelle lässt sich universalisieren und so kanonisieren und allgemein machen. Christus ist ein so veredelter Landsmann.« Und er fährt fort: »Dieses individuelle Colorit des Universellen ist sein romantisches Element. So ist jeder national und selbst der persönliche Gott ein romantisiertes Universum. Die Persönlichkeit ist das romantische Element des Ich.« – Hier herrscht Gerechtigkeit. Hier ist anerkannt, dass das Kanonisch-Universelle nicht windige Nationalisierung, sondern »Veredelung« bedeutet; zugleich aber ist das Individuelle und Nationale als das romantische Persönlichkeitselement des Universellen und damit als Lebenspoesie gekennzeichnet. Was ist das Höhere? Wer will es sagen. Möge die höhere und geistigere Sphäre die »kanonische« sein, so ist die der Persönlichkeit vielleicht die innigere, vielleicht selbst die wirklichere. Sie ist zugleich seit Jahrhunderten die kriegerische. Ja, die Sphäre des Bluts ist auch auf schreckliche Art die blutige Sphäre – es gehört das, scheint es, zum »Colorit«. Krieg ist Romantik. Niemand hat je das mystisch-poetische Element geleugnet, das ihm innewohnt. Zu leugnen, dass er heute spottschlechte Romantik, ekelhaft verhunzte Poesie ist, wäre Verstocktheit. Und um das Nationale nicht völlig in Verruf kommen, es nicht gänzlich zum Fluche werden zu lassen, wird nötig sein, dass es, statt als Inbegriff alles Kriegsgeistes und Geräufes, vielmehr, seiner künstlerischen und fast schwärmerischen Natur durchaus entsprechend, immer unbedingter als Gegenstand eines Friedenskultus verstanden werde. (Man scharrt.)
Jungmannschaft – nicht diese Töne! Ich bin kein Pazifist, weder von der geifernden noch von der öligen Observanz. Der Pazifismus als Weltanschauung, als seelisches Vegetariertum und bürgerlich-rationale Glücksphilanthropie ist nicht meine Sache. Aber er war auch eines Goethe Sache nicht, oder wäre es nicht gewesen, und dennoch war er ein Mann des Friedens. Ich bin kein Goethe; aber ein wenig, irgendwie, von weither, bin ich, mit Adalbert Stifter zu reden, »von seiner Familie«, und auch mein Teil ist der Friede, denn er ist das Reich der Kultur, der Kunst und des Gedankens, während im Kriege die Rohheit triumphiert … nicht sie allein, seid still, ich weiß es, aber wie der Mensch ist, wie es heute um unsere Welt steht, fast nur noch sie. Die Welt, die Völker sind alt und klug heute, die episch-heroische Lebensstufe liegt für jedes von ihnen weit dahinten, der Versuch, auf sie zurückzutreten, bedeutet wüste Auflehnung gegen das Gesetz der Zeit, eine seelische Unwahrheit, der Krieg ist Lüge, selbst seine Ergebnisse sind Lügen, er ist, wie viel Ehre der Einzelne in ihn hineinzutragen willens sein möge, selbst heute aller Ehre bloß, und darum stellt er dem Auge, das nicht sich selbst betrügt, als Triumph aller brutalen und gemeinen, der Kultur und dem Gedanken erzfeindlich gesinnten Volkselemente, als eine Blutorgie von Egoismus, Verderbnis und Schlechtigkeit fast restlos sich dar.
Gesteht euch die Wahrheit, es ist so. Ich sage es nicht aus politischer Bosheit, nicht, um diejenigen unter euch, die im Kriege waren, die ihr Blut vergossen und das Blut von Kameraden hinströmen sahen, in Erinnerungen zu kränken, die ihnen heilig sein müssen, heilig bleiben sollen. Ich bin kein Vernunft-Thersites, kein hämischer Parteimensch, der sich in Machtwollust an der Schmach, der seelischen Heimatlosigkeit des Gegners weidet, dessen Ideale zuschanden wurden. Ich weiß, was das Blut ist, was der Tod, was Kameradschaft ist. Gebt zu, dass nie ein Laut jenes armseligen Gänsefüßchen-Hohnes auf die »Große Zeit« von meinen Lippen gegangen ist! Dieser Hohn kommt nicht aus geschändetem Gefühl – es gab kein Gefühl zu schänden dort, wo er laut zu werden pflegt. Aber der männlichste selbst unter heutigen Geistern, er, dessen Dichtung ganz ein herber Kultus des Männlichen ist, und der uns noch gestern das in Ehrliebe bebende Lied von »Der Toten Zurückkunft«, den Hymnus an »Die Hehren, die Helden« sang – auch er hat in der Wirklichkeit des Krieges von heute »nur viele Untergänge ohne Würde« gesehen.
»Des Schöpfers Hand entwischt, rast eigenmächtig
Unform von Blei und Blech, Gestäng und Rohr.
Der selbst lacht Grimm, wenn falsche Heldenreden
Von vormals klingen, der als Brei und Klumpen
Den Bruder sinken sah, der in der schandbar
Zerwühlten Erde hauste wie Geziefer …
Der alte Gott der Schlachten ist nicht mehr.«
Er ist nicht mehr. Der Gott ist zur abscheulichen Götzenfratze entartet, und etwas wie obskurantistische Donquixoterie ist es geworden, ihm Opfer zu bringen. Anstand und Menschenwürde gebieten, diesen roten Lumpenkönig vom Weltenthron zu stoßen und Europa zur Republik zu erklären – sofern die Idee der Republik mit derjenigen nationaler Friedenskultur verbunden ist.
Die Republik … wie gefällt euch das Wort in meinem Munde? Übel – bestimmten Geräuschen nach zu urteilen, die man wohl leider als Scharren zu deuten genötigt ist. Und doch ist mir jenes Wort, anders als den meisten von euch, von jung auf vertraut und geläufig. Meine Heimat war ein republikanischer Bundesstaat des Reiches, wie diejenigen, aus denen es heute durchaus besteht. Dennoch war ich niemals ein Republikaner vom Verrina-Stamm, kein Mann der lehrhaften Tugendstarre, kein Revolutionär dieses Sinnes, ihr wisst es. »Diejenigen«, sagte und sage ich mit Novalis, »die in unsern Tagen gegen Fürsten als solche deklamieren und nirgends Heil statuieren, als in der neuen französischen Manier, auch die Republik nur unter der repräsentativen Form erkennen und apodiktisch behaupten, dass nur da Republik sei, wo es Primär- und Wahlversammlungen, Direktorium und Räte, Munizipalitäten und Freiheitsbäume gäbe, die sind armselige Philister, leer an Geist und arm an Herzen, Buchstäbler, die ihre Seichtigkeit und innerliche Blöße hinter den bunten Fahnen der triumphierenden Mode, unter der imposanten Maske des Kosmopolitismus zu verstecken suchen, und die Gegner, wie die Obskuranten, verdienen, damit der Frosch- und Mäusekrieg vollkommen versinnlicht werde.« – So spricht ein Romantiker. Denn das Niveau deutscher Romantik, möge es gewiss ein anderes sein, als das der politischen Aufklärung, ist eben darum auch so hoch über allem Obskurantentum, dass, da echte Opposition nur auf gleicher Ebene möglich ist, schon dessen Gegnerschaft von hier aus als letzte Schande empfunden wird. Obskurantismus, mit seinem politischen Namen Reaktion geheißen, ist Rohheit – sentimentale Rohheit, insofern sie, sich selbst betrügend, ihre brutale und unvernünftige Physiognomie »unter der imposanten Maske« des Gemütes, der Germanentreue etwa, zu verstecken sucht; und sentimentale Rohheit verdient so wenig den edlen und geisteszarten Namen der Romantik, dass der eingefleischteste Romantiker für den vorübergehenden Notfall zum politischen Aufklärer werden könnte, um behilflich zu sein, so unverschämte Ansprüche ihr kräftigst zu verwehren. Wenn sentimentaler Obskurantismus sich zum Terror organisiert und das Land durch ekelhafte und hirnverbrannte Mordtaten schändet, dann ist der Eintritt solchen Notfalles nicht länger zu leugnen, und die Stille, die sich, wie ich feststelle, bei dieser Anspielung im Saale verbreitet – ich weiß, junge Leute, was ich, der fürchten muss, aus geistigem Freiheitsbedürfnis dem Obskurantentum Waffen geliefert zu haben – was, sage ich, gerade ich dieser jetzt herrschenden Stille schuldig bin.
Mein Vorsatz ist, ich sage es offen heraus, euch, sofern das nötig ist, für die Republik zu gewinnen und für das, was Demokratie genannt wird, und was ich Humanität nenne, aus Abneigung gegen die humbughaften Nebengeräusche, die jenem anderen Worte anhaften, (eine Abneigung, die ich mit euch teile) – dafür zu werben bei euch im Angesicht dieses Mannes und Dichters hier vor mir, dessen echte Popularität auf der würdigsten Vereinigung volkhafter und menschheitlicher Elemente beruht. Denn ich möchte, dass das deutsche Antlitz, jetzt leidvoll verzerrt und entstellt, dem seinen wieder gliche – diesem Künstlerhaupt, das so viel Züge aufweist des Bildes hoher Biederkeit, das sich für uns mit dem deutschen Namen verbindet.
Wie eigentümlich und menschlich regelwidrig liegen bei uns zu Lande heute die Dinge! »Republik«, schrieb Novalis, »ist das Fluidum deferens der Jugend. Wo junge Leute sind, da ist Republik.« Und ist es nicht wahr, dass Freiheitsdurst, Liebe zur Veränderung, hochherziger Revolutionsdrang immer ein natürliches Vorrecht der Jugend gewesen ist, hier wie anderwärts? Unserem Studententum, unserer Burschenschaft fehlt es ja keineswegs an demokratischer Überlieferung. Es gab Zeiten, wo das Nationale und das Monarchisch-Dynastische, weit entfernt, in der Idee zusammenzufallen, vielmehr in unversöhnlicher Opposition zueinander standen; wo Patriotismus und Republik nicht nur keinen Gegensatz bildeten, sondern als ein und dieselbe Sache erschienen, und wo alle Leidenschaft edlerer Jugend zu ihr, der Sache des Vaterlandes und der Freiheit stand. Heute scheint die Jugend, scheinen wenigstens lebenswichtige Teile unserer Jugend gegen die Republik zu ewigem Hass verschworen, ohne Erinnerung daran, was einst sein konnte – denn schon eine solche Erinnerung müsste auf die Unbedingtheit dieses Hasses leise einschränkend wirken. »Völlig andere Umstände«, werdet ihr mir antworten, »waren das damals; wir jungen Menschen aber sind uns im Wandel der Zeiten treu geblieben, und brüderlich erkennen wir uns wieder in den Märtyrern von damals, den hochherzigen Opfern der Demagogenverfolgungen. Die Geschichte wiederholt sich nicht, und unser Hass ist Leben.« – Das ist er wahrscheinlich nicht, muss ich erwidern, und nur zu wahr ist, dass die Geschichte sich nicht wiederholt, dass es höchst lebenswidrig sein kann, in historischen Analogien zu denken und zu fühlen! Mir graut zuweilen vor den Irrtumsgefahren solches Spiels: denn ein Spiel von Knaben ist es möglicherweise, heute die geheime militärische Wiederherstellung Preußens nach Jena und Tilsit zu kopieren – und wie, wenn in unseren Tagen die Republik, indem sie notgedrungen euere monarchistischen Geheimorganisationen aushebt, die Wahrheit und das Leben für sich hätte, wie ihr sie einst für euch hattet gegen die Spitzel und Häscher der Reaktion?
»Was ist eigentlich Alt? Was Jung?«, fragt Novalis. »Jung«, antwortet er, »wo die Zukunft vorwaltet; Alt, wo die Vergangenheit die Übermacht hat.« – Leben wir denn in der verkehrten Welt? Jugend ist heute die hitzige Parteigängerin der Vergangenheit, und auf mechanische Restauration des Alten ist all ihr Sinnen gerichtet. Demagogenverfolgungen? Ja, um solche möchte es sich handeln bei der hinlänglich unbeholfenen Selbstverteidigung eines Neuen, das selbstverständlich das wahre und echte Neue noch nicht sein kann, sondern nur die notdürftig allgemeinste Vorbedingung und Grundlage dazu: denn was wäre Demagogentum, wenn nicht der platte Trick, das gegenwärtige äußre und innere Elend des Landes zur Verherrlichung des Abgewirtschafteten auszunutzen, ohne übrigens im mindesten Mittel und Wege zu wissen, wie denn die vormalige Pracht wieder herzustellen sei, noch auch nur für den verlassenen Thron, um den man sich schützend schart, einen Prätendenten aufweisen zu können?
Es ist löblich, ist ein Zeichen von Geist, äußere Tatsachen zu bekämpfen, sofern sie mit den inneren nicht übereinstimmen und also zwar Wirklichkeit, aber nicht Wahrheit sind. Es ist dagegen absurd und nichts weiter, Tatsachen zu leugnen und sich im Wirklichen nicht ausprägen lassen zu wollen, die es für jedermann innerlich sind, auch für die Leugner und Opponenten. Studentenschaft! Bürgertum, eingesprenkelt in die Reihen der akademischen Jugend! Die Republik, die Demokratie sind heute solche inneren Tatsachen, sind es für uns alle, jeden Einzelnen, und sie leugnen heißt lügen. Mächte, geweiht von Historie, ausgestattet mit so zwingender Autorität ererbten Ruhmeszaubers, dass es menschlich war, sie bestehen und gewähren zu lassen, auch als ihre Entartung ins banal Theatralische längst jede Pietät in Verlegenheit setzte, thronten über uns bis vor kurzem, und sie waren der Staat, in ihrer Hand lag er, er war ihre Sache – die sie offenbar nicht mehr gut machten, während wir, abgewandt, die unsrige, die Sache der Nation und der Kultur, möglichst gut zu machen suchten. Ja, eine Scheidung des nationalen und des staatlichen Lebens hatte sich hergestellt, wie sie in dieser Schärfe und Vollständigkeit niemals statthaft sein kann und sich an beiden Teilen rächen muss. Wir widmeten uns dem Gewerbefleiß, der Kunst, dem absoluten Gedanken – ich will nicht sagen: mit Gemütsruhe, denn unsere politische Enthaltsamkeit war zu fatalistischen Wesens, als dass sie eigentlich Vertrauen zu nennen gewesen wäre; aber die Miene gab sie uns doch, als wüssten wir die staatlichen Dinge in den besten Händen – während wir schon gar nichts davon hätten wissen müssen, um nicht zu wissen, dass sie in sehr zweifelhaften lagen. Das war menschlich, wie alles gekommen war, ich wiederhole es. Aber es ist vorbei. Jene Mächte sind nicht mehr. Das Schicksal hat sie – wir wollen nicht triumphierend rufen: »hinweggefegt«, wir wollen sachlich aussprechen: Es hat sie beseitigt, sie sind nicht mehr über uns, werden es, nach allem, was geschehen, auch nie wieder sein, und der Staat, ob wir wollten oder nicht – er ist uns zugefallen. In unsere Hände ist er gelegt, in die jedes Einzelnen; er ist unsere Sache geworden, die wir gut zu machen haben, und das eben ist die Republik – etwas anderes ist sie nicht.
Die Republik ist ein Schicksal und zwar eines, zu dem »amor fati« das einzig richtige Verhalten ist. Das ist kein zu feierliches Wort für die Sache, denn es handelt sich um keine Kleinigkeit von Schicksal: die sogenannte Freiheit ist kein Spaß und Vergnügen, nicht das ist es, was ich behaupte. Ihr anderer Name lautet Verantwortlichkeit – und damit wird deutlicher, dass sie vielmehr eine schwere Belastung ist: und zwar namentlich für das geistige Talent. Man hat Grund zu bezweifeln, dass alle, die nach ihr riefen oder selbst schrien, bevor sie unser Schicksal wurde, sich hinlänglich geprüft hatten, ob sie ihr denn gewachsen seien; denn das ist bestimmt nicht durchweg der Fall, und was Republik und sogenannte Freiheit an innerer Tragik mit sich bringen, wird sich erst zeigen. Ein russischer Schriftsteller, Sohn eines Landes also, wo lange vor allen äußeren Umwälzungen Republik tiefer herrschte, als irgendwo, sprach uns neulich vom Schicksal des geistigen Talentes in seiner Heimat, das spannungsvoll und gefährlich sei auf eine Weise, von der wir im Westen uns schwer eine Vorstellung machten. »Das Bedürfnis«, sagte er, »angespannt ins Leben zu blicken, und der Verzicht auf ein Schaffen des Lebens« (er meinte wohl: auf reine Gestaltung) »hat dahin geführt, dass man weniger eigentliche ›Literatur‹ in der russischen Literatur findet, als dies in den Sprachen unserer westlichen Nachbarn der Fall ist … Im Westen gibt es eine Art literarischer Kultur, ein – wenn man so sagen darf – in sich selber beruhendes Literaturreich … Bei uns kann der Schriftsteller sich nicht auf formale, ästhetische oder psychologische Aufgaben beschränken. Diese Aufgaben vermitteln ihm nicht jene Spannung, die er für sein Schaffen braucht. Er will höher hinaus. Er ist bemüht, den ganzen Lebenskreis zu fassen und ihn auf seine Weise zu beleuchten. Leo Tolstoi ist nicht nur Künstler; er ist auch Historiker, Publizist, Ästhet, Philosoph; alle diese Seiten seines Talents sind Pfade, die ewiglich zum Tempel der Wahrheit führen und doch nimmermehr zu ihm hinführen … In den russischen Dichtern lebt die Erkenntnis, dass Literatur keineswegs Spiegelbild des Lebens zu sein habe – wie man wohl zu sagen pflegt –, sondern ein heroisches Tun, ein geheiligtes Leben, ein Überwinden menschlicher Schwachheit, ein Verzicht auf alles Konventionelle und ein Kampf dagegen. Unter der Last dieser Aufgaben werden die Starken stark und schmieden so ihr Gewissen und ihr Talent; die Schwachen aber brechen zusammen. Eine Reihe bedeutender russischer Schriftsteller sind unterwegs zusammengebrochen und haben ihrer Literatur weniger gegeben, als sie hätten geben können – erdrückt von der Last übergroßer Aufgaben, die ihre Tragkraft überstiegen …«– Habe ich durch diese fragmentarische Anführung besser zu verstehen gegeben, welches Schicksal für das geistige Talent die Republik als innere Tatsache bedeutet, und warum ich meine, dass manches Talent bei uns recht leichtsinnigerweise nach ihr gerufen hat?
Jedoch haben wir sie nun. Die »Mächte« sind fort, der Staat ist unser aller Angelegenheit geworden, wir sind der Staat, und dieser Zustand ist wichtigen Teilen der Jugend und des Bürgertums in tiefster Seele verhasst, sie wollen nichts von ihm wissen, sie leugnen ihn nach Möglichkeit und zwar hauptsächlich, weil er sich nicht auf dem Wege des Sieges, des freien Willens, der nationalen Erhebung, sondern auf dem der Niederlage und des Kollapsus hergestellt hat und mit Ohnmacht, Fremdherrschaft, Schande unlöslich verbunden scheint. »Wir sind nicht die Republik«, sagen mir diese abgewandten Patrioten. »Die Republik ist Fremdherrschaft – sofern (warum sollten nicht auch wir den Novalis zitieren?) Schwäche nichts anderes ist, als überhandnehmende, verwaltende, charakterisierende fremde Kraft.« – Wahr, wahr. Aber erstens ist ja auch wahr, was der Dichter sagt, dass »ein Mensch alles dadurch adeln, seiner würdig machen kann, dass er es will« – (sehr wahr ist das, sehr schön und außerdem beinahe schlau, ein Ausdruck von Lebensdexterität); und zweitens ist nicht wahr, es ist, um das streitbar zu wiederholen, keineswegs und durchaus nicht wahr, dass die Republik als innere Tatsache (ich rede jetzt nicht von staatsrechtlichen Fixierungen) ein Geschöpf der Niederlage und der Schande ist. Sie ist eines der Erhebung und der Ehre. Sie ist, junge Leute, das Geschöpf eben der Stunde, die ihr nicht verleugnet und mit schlechtem Hohne geschändet wissen wollt, der Stunde begeistert totbereiten Aufbruchs – damals stellte sie in euerer Brust sich her. »Heiliges Heimatland«, begann Gerhart Hauptmann ein Gedicht jener Stunde, »wie erbleichtest du mit einem Mal!« Was aber damals eigentlich erbleichte, was zurücktrat und zusehends vernebelte, das waren die Mächte, die bis dahin der Staat gewesen waren, und in euch erstand er, in eurer flammenden Gemeinschaft beruhte sein Leben, ihr wart die Republik, und wenn sie heute in Schande liegt (was ich nicht leugne), so wäre es Feigheit, sie im Stiche zu lassen, und, statt Hand anzulegen, statt ihr zu helfen, und sie wieder »eurer würdig zu machen« – ihr widerspenstig die erdenklichsten Schwierigkeiten zu bereiten, wie Greise, die das Leben nicht mehr verstehen und der guten alten Zeit eine weinerliche Treue wahren! Nochmals gefragt: Hat es Vernunft und Ehre, innere Wahrheiten zu leugnen? Die Republik ist eine solche noch in ihrem gehässigsten Opponenten, in wütenden Tätlichkeiten noch, die ihr Ende bezwecken, offenbart sie sich, und die unseligen Burschen, die eben jetzt das zarte, kluge Haupt ihres urbansten Dieners zertrümmerten, bedachten wohl nicht, dass, Minister zu erschießen, eine hervorragend republikanische Handlungsweise ist.
Jugend und Bürgertum, euer Widerstand gegen die Republik, die Demokratie ist Wortscheu – ja, ihr bockt und scheut vor diesen Worten wie unruhige Pferde, abergläubische Nervosität raubt euch die Vernunft, sobald sie nur ausgesprochen werden. Aber es sind Worte, Relativitäten, zeitbestimmte Formen, notwendige Werkzeuge, und zu glauben, es müsse landfremder Humbug sein, was sie bedeuten, ist nichts als Kinderei. Die Republik – als ob das nicht immer noch Deutschland wäre! Die Demokratie – als ob das nicht heimlichere Heimat sein könnte, als irgendein strahlendes, rasselndes, fuchtelndes Empire! Hörtet ihr kürzlich die »Meistersinger«? Nun, Nietzsche äußert zwar sprühender Weise, sie seien »gegen die Zivilisation« gerichtet, sie setzten »das Deutsche gegen das Französische«. Unterdessen aber sind sie Demokratie, durch und durch, demokratisch in dem Grade und auf so beispielhafte Art, wie etwa Shakespeares »Coriolan« aristokratisch ist – sie sind, sage ich, deutsche Demokratie, und beweisen mit biederstem Pomp, auf romantisch innigste Art, dass diese Wortverbindung, weit entfernt naturwidrig zu sein oder die Logik des hölzernen Eisens zu verraten, vielmehr so organisch richtig gefügt ist, wie außer ihr vielleicht nur noch die andere: »Deutsches Volk«.
Fasst endlich Vertrauen – ein allgemeines Vertrauen, das für den Anfang nur im Fahrenlassen des Vorurteils zu bestehen braucht, als sei deutsche Republik ein Popanz und Widersinn, als müsse sie das sein, was Novalis als »verwaltende und charakterisierende fremde Kraft« bestimmt, nämlich Schwäche! Scheidung des nationalen und des staatlichen Lebens, sagte ich vorhin, sei krankhaft. Aber was sich nicht scheiden darf, das darf doch unterschieden werden, und dass das Nationale weit mächtiger und lebensbestimmender bleibt, als der staatsrechtliche Buchstabe, als jede positive Form – das ist eine Gewissheit, die uns zur Beruhigung diene. »Deutsche Republik« – die Wortverbindung ist sehr stark im Beiwort; und sollte jenes Pergament von Weimar nicht völlig das sein, was man eine ideale und vollkommene Verfassung nennt, das heißt die restlos-wirkliche Bestimmung des Staatskörpers, der Staatsseele, des Staatsgeistes – wo wäre denn auch eine Konstitution das jemals gewesen! Man sollte Geschriebenes nicht allzu wichtig nehmen. Das wirkliche nationale Leben ragt, immer und überall, nach allen Seiten weit darüber hinaus.
Ich bitte nochmals: Erwehrt euch der Kopfscheu! Es ist in aller Welt kein Grund, die Republik als eine Angelegenheit scharfer Judenjungen zu empfinden. Überlasst sie ihnen nicht! Nehmt ihnen, wie die beliebte politische Redensart lautet, »den Wind aus den Segeln« – den republikanischen Wind! Die Wendung ist abgeschmackt, aber sie ist die Formel für ein Verhalten, das, allseitig angewandt, zu den schönsten Ergebnissen führen muss. Denn um was geht der Streit der Parteien? Nun, um das Wohl des Staates. Nicht kommt es darauf an, dass eine Partei gute Fahrt hat, sondern dass der Staat sie hat; und wenn jede Partei klüglich den Wind benutzt, mit dem die andere segelt, so werden sie alle gut segeln, das heißt die Republik wird gut segeln – was zu erreichen war. Darum ist anzuraten, dass auch die »Republikaner« bedacht seien, den »Monarchisten« den Wind aus den Segeln zu nehmen: den nationalen nämlich, und sie nicht allein damit segeln lassen – nicht ihnen allein das Wort lassen sollten sie, wenn es um Ehre und Schande geht, um Liebe und auch um Zorn; das Lied aus dem Munde nehmen sollten sie ihnen, wie eben herzlich und schlau der Vater Ebert getan in seinem Erlass zum Verfassungstage, worin er den Völkischen das »Deutschland über alles« aus dem Munde nahm und erklärte, es sei gar nicht ihr Lied, es sei mindestens ebenso sehr das seine, und nunmehr stimme er es an aus gewölbter Brust. Das ist ein neuer Sängerstreit, der um dies Lied, und ein vortrefflicher Streit! Denn selbstverständlich werden auch die Nationalisten nicht aufhören wollen, es zu singen, und wenn denn also alle unisono »Deutschland, Deutschland über alles« singen, so wird das ganz einfach die Republik und ihre Wohlfahrt mit vollen Segeln sein.
Diese Männer an der Spitze des Staates – sind es denn Ungleichartige, feindwillige Fremde, mit denen es keine Verständigung über das Erste und Letzte gäbe, und die euch von der Republik ausschließen wollten? Ach, sie wären froh genug, wenn ihr kämet, ihnen zu helfen, und es sind deutsche Menschen, webend in der Sphäre unserer Sprache, geborgen, wie ihr, in deutschen Überlieferungen und Denkgesetzen. Einige von ihnen kenne ich; der Vater Ebert zum Beispiel ist mir bekannt. Ein grundangenehmer Mann, bescheiden-würdig, nicht ohne Schalkheit, gelassen und menschlich fest. In seinem schwarzen Röcklein sah ich ihn ein paarmal, das begabte und unwahrscheinlich hoch verschlagene Glückskind, ein Bürger unter Bürgern, bei Festlichkeiten ruhig-freundlich sein hohes Amt darstellen; und da ich auch dem verwichenen Großherrn, einem dekorativen Talent ohne Zweifel, bei solchem Geschäft das ein oder andere Mal hatte zusehen können, so gewann ich die Einsicht, für die ich Teilnehmer werben möchte, dass Demokratie etwas Deutscheres sein kann, als imperiale Gala-Oper. Kinder, Mitbürger, es ist besser jetzt – die Hand aufs Herz, uns ist im Grunde wohler, bei allem Elend, aller äußeren Unwürde, als zu den Glanzzeiten, da jenes Talent Deutschland repräsentierte. Das war amüsant, aber es war eine Verlegenheit – wir bissen uns lächelnd auf die Lippen, wenn wir hinblickten, wir sahen uns nach den Mienen der anderen um in Europa, wir suchten darin zu lesen, dass sie uns nicht für das Lustspiel verantwortlich machten, was sie aber doch taten; wir wollten hoffen, dass sie zwischen Deutschland und seiner Repräsentation unterschieden, wozu sie von weitem schwer imstande waren – und wandten uns den kulturellen Dingen wieder zu, melancholisch durchdrungen von der Gottgewolltheit des Hergebrachten, des beziehungslosen Auseinanderfallens von politischem und nationalem Leben. Einheitskultur! Dämmert uns heute nicht, in allem Jammer, die Möglichkeit der Harmonie? Ist nicht Republik nur ein Name für das volkstümliche Glück der Einheit von Staat und Kultur?
Was ihr mir jetzt versetzen werdet, weiß ich genau. Ihr werdet sagen: Nein doch! Das eben nicht! Der deutsche Geist – was hat er zu schaffen mit Demokratie, Republik, Sozialismus, Marxismus gar? Dieser, Wirtschaftsmaterialismus mit seinem schnöden Gerede vom »ideologischen Überbau«, Gerümpel aus dem 19. Jahrhundert, wurde nachgerade zum Kinderspott. Sein Unglück, wenn er zur Verwirklichung in der Stunde gedeiht, die seiner geistigen Erledigung folgt! Und steht es mit den anderen Herrlichkeiten, für die du deutsche Jugend befremdlicherweise zur Begeisterung entzünden möchtest, nicht ebenso? Siehst du die Sterne über uns? Kennst und ehrst du unsere Götter? Weißt von den Kündern deutscher Zukunft? Goethe und Nietzsche waren wohl Liberale? Hölderlin und George sind am Ende gar demokratische Geister, deiner schnurrigen Meinung nach? – Nein, das nicht. Freilich, freilich, da seid ihr im Rechte. Liebe Freunde, wie betreten ich bin. Ich habe nicht an Goethe und Nietzsche, Hölderlin und George gedacht. Oder habe ich etwa im Stillen dennoch ihrer gedacht und frage ich mich nur, ob es absurder ist, der Republik das Wort zu reden in ihrem Namen, als die Restauration zu predigen um ihretwillen? Ja, ich will mir zu helfen suchen in meiner großen Betretenheit, indem ich dies frage. Ich will weiter gehen und die Frage aufwerfen, ob wir nicht alle (ich auch! ich auch!) die Widerstände unterschätzt haben, welche die alten staatlichen Mächte der Verwirklichung deutscher Schönheit entgegensetzten; ob nicht die neue Menschlichkeit, deren Propheten jene Geister sind, und die euch im sehnsüchtig stolzen Sinn liegt, wenn ihr über Demokratie die Achseln zuckt, auf ihrem Boden, auf dem Boden der Republik, glücklichere Möglichkeiten der Verlebendigung finden mag, als auf dem Grunde des alten Staates …
Jetzt werdet ihr böse! Ja, wenn nicht die Gegenwart hochgestellter Personen eure Lebhaftigkeit einschränkte, würdet ihr mir zurufen: »Wie? Und dein Buch? Deine antipolitisch-antidemokratischen Betrachtungen von anno 18?! Renegat! Überläufer! Gesinnungslump! Der du dir selber aufs Maul schlägst, Umfallsüchtiger, steige ab vom Podium und wage nicht, gewinnende Kraft in Anspruch zu nehmen für das Wort des charakterlosesten Selbstverleugners!«