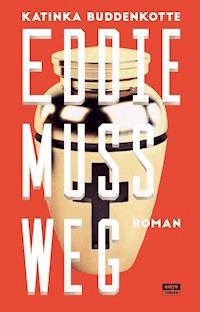8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Auch wer zwischen allen Stühlen sitzt, kann noch vom Barhocker fallen
Doris Kindermann, Anfang dreißig, arbeitet in einem Kölner Jugendzentrum (für Doris »das Brüssel für Diplomsozialarbeiter«). In dem gibt es nichts außer überangepassten Teenagern und Ärger über die Kollegen. Als Ausgleich kehrt Doris immer öfter in ihrer Stammkneipe »Dead Horst« ein, um sich den schwer erziehbaren Erwachsenen zu widmen: dem stets genervten Barkeeper Toddy, dem schwermütigen russischen Ex-Olympioniken Vladimir und nicht zuletzt ihrer besten Freundin Katja sowie ihrem Noch-Ex-Freund Gunnar. Doris will allen helfen – und scheitert gnadenlos. Endlich mal kein fröhlich-frecher Frauenroman, sondern eine mit brillantem Witz erzählte Achterbahnfahrt zwischen Schwerenötern, Schwermut und Schwermetall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Ähnliche
1. AuflageCopyright © 2012 beim Albrecht Knaus Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-08835-4
Die Veröffentlichung dieses Werkserfolgt auf Vermittlung der literarischen Agenturfür Autoren und Verlage Peter Molden, Köln.
www.knaus-verlag.de
»Now I know people changeAnd sometimes that’s goodBut some people don’tWhen maybe they should.«
The Supersuckers, Pretty fucked up
I
Frau-Kinder-Mann?«, fragt eine Roboterstimme aus dem Hörer, aber das darauffolgende Kichern klingt sehr menschlich. Es wirkt sogar ganz aufmunternd, und ich begreife langsam, dass ich wieder einer unterbezahlten Minijobberin den Tag gerettet habe. Sie hat den Witz meines Lebens verstanden.
»Ja, hier ist Doris Kindermann, was gibt es denn?«, blaffe ich zurück, und das junge Ding am anderen Ende der Leitung erschrickt nur kurz, bevor sie mir mit abgehackter Stimme verkündet: »Frau Kindermann, herzlichen Glückwunsch, die Two-be-Two-Media AG hat Ihre Nummer aus zehntausend Hauptgewinnen … nä, warten Sie mal, Entschuldigung, ich bin in der Zeile verrutscht, also: Sie wollen doch ein Auto gewinnen, oder, Frau-Kinder-Mann?«
»Nein«, antworte ich, denn obwohl ich mich keineswegs als wunschlos glücklich bezeichnen möchte, will ich weder Autos, Frauen, Kinder oder Männer gewinnen. Nicht um halb acht am Samstagmorgen. Ich würde viel lieber etwas verlieren, meine Beherrschung zum Beispiel. Aber das Mädchen am anderen Ende der Leitung, das wahrscheinlich in einem sehr tristen Großraumbüro in Neubrandenburg sitzt und am gestrigen Abend ausnahmsweise auf die Einnahme eines halben Dutzend Wodkamischgetränke verzichtet hat, nur um pünktlich und nüchtern bei ihrer Frühschicht zu erscheinen, gibt mir keine Chance dazu:
»Warum denn nicht?«, fragt das Mädchen kläglich, und in echter, tiefer Enttäuschung hakt es nach: »Warum wollen Sie denn bloß kein Auto gewinnen?«
Ich seufze. Man kann mich leicht einwickeln, wenn ich noch fast schlafe:
»Ich brauche kein Auto, da, wo ich wohne«, behaupte ich und hoffe, sehr weise geklungen zu haben. Aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein:
»Echt nicht? Glaub ich nicht. Krass. Wo wohnen Sie denn? Hier geht ohne Auto gar nichts, das kannste mir aber glauben, ich meine, Sie können das mal glauben, hier gibt es echt gar nichts. Ich will ein Auto, und dann weg hier.«
Die Telefonkraft der Two-be-Two-Media AG schnieft hörbar, und ich sehe mich reflexartig nach einem Papiertaschentuch um. Da auch mir nach ein paar Sekunden einfällt, dass die Technik noch nicht soweit ist, dass ich ein Tempo in die ehemalige Ostzone rüberfaxen könnte, schaue ich alternativ nach meinen Kippen, finde sie unter dem Nachttischchen und zünde mir eine an.
Untermalt wird diese Aktion vom Jammern des Mädchens, das ich zwischenzeitlich »Loreen« getauft habe. Erstens passt der Name zu ihrer Stimme, zweitens duzt sie mich nun so konsequent weiter, dass ich mir auch keinen Nachnamen für sie ausdenken muss.
Loreen berichtet: »Ey, weißte, hier ist alles echt doof, ne, und ich will hier weg. Letztes Jahr wollte ich auch schon weg, da habe ich mich bei DSDS bewerben wollen, aber da kam ich gar nicht hin mit dem blöden Bus, der fuhr nur bis Angermünde, und da hat es voll geregnet, mein Make-up war fratze, und so wollte ich da schon mal gar nicht hin, weil, du musst da schon auch geil aussehen, wegen Gesamtpaket und so, klar.«
Ich ziehe an meiner Kippe und bestätige: »Hmmm, ist klar.«
Klar, Loreen hat verstanden, wie es in der Welt läuft, und obwohl ich sie noch nicht so gut kenne, spüre ich, dass ihre Talente bei der Two-be-Two-Media AG verkümmern werden.
Aber es ist auch ganz klar, dass mir schon vor dem ersten Kaffee jemand, der mir eigentlich nur meine Kontodaten aus den Rippen leiern sollte, seine Lebensgeschichte erzählt. Unaufgefordert, am Telefon. Soweit ist es also gekommen. Ich sehe nicht nur aus wie eine typische Sozialarbeiterin, ich klinge schon so. Mag daran liegen, dass ich eine bin, aber gerade im Moment denke ich wieder daran, umzusatteln.
Vielleicht können die jemanden wie mich beim FBI gebrauchen. Doris Kindermann, sanfte und ganzheitliche Verhörmethoden, garantiert ohne Tierversuche, jetzt auch telefonisch. Loreen holt mich aus meinen Tagträumen zurück: »Falls das mit dem Superstar nicht klappt – meinst du, ich habe das Zeug zum Model?«, fragt sie, ganz ernsthaft, und ich schließe die Augen. Dieser zugegebenermaßen nicht völlig vorurteilsfreie Visualisierungsversuch meiner Gesprächspartnerin will mich ganz eindeutig »Nein, auf keinen Fall!« in den Hörer rufen lassen, aber obwohl ich noch gar nicht im Dienst bin, kann ich nicht aus meiner Haut. Also sage ich, in therapeutischster Stimmlage: »Loreen, ich bin sicher, du kannst alles schaffen, was du dir vornimmst.«
»Wer ist Loreen?«, fragt Loreen irritiert, dann scheint sie ein Geistesblitz zu durchzucken, und sie schwenkt unerwartet wieder ins Semiprofessionelle über:
»Jedenfalls, es geht ja um Ihre Daten, ich meine, um Ihren Gewinn, Ihr Auto, Ihre Chance! Wo darf ich denn das Sonderlos hinschicken, Frau Kindermann?«
Ich lege auf.
Und fühle mich sofort schlecht. Wieder einmal völlig verantwortungslos gehandelt, ein Vertrauensverhältnis schändlich missbraucht, einen jungen Menschen schwer enttäuscht. Und zwei Kippen vor dem Frühstück geraucht. So sollte kein Tag beginnen, aus dem noch ein guter werden soll.
Vielleicht kann ich das irgendwie wieder hinbiegen. Ich tippe auf den Tasten meines Telefons herum, um Loreen zurückzurufen. Das funktioniert nicht, da die Two-be-Two-Media AG natürlich mit unterdrückter Nummer bei ihren Opfern anruft. Wie dumm von denen. Ich gehe in die Küche, stelle erfreut fest, dass ich tatsächlich noch über eine kleine Kaffeereserve verfüge und setze Wasser auf. Müde starre ich in den Topf und beschließe, eine Runde »Wär’ ich Millionär« zu spielen, bis das Wasser kocht.
Wär’ ich Millionär, überlege ich, würde ich als Erstes herausfinden, wo die Two-be-Two-Media AG ihr Büro hat, und dort würde ich ein Auto hinbestellen. Nichts Großes, eher einen praktischen Kleinwagen, mit dem Loreen einfach einparken kann. Aber mit einer riesigen rosafarbenen Schleife drumherum und einer Karte, wo nur draufsteht: »Für Loreen, lebe deinen Traum!«
Ja, es hat einen Grund, warum meine finanziellen Mittel begrenzt sind. Bei meinem Glück würde irgendeine Kollegin von Loreen tatsächlich Loreen heißen, und die würde sich den Twingo unter den Nagel reißen und direkt verscheuern. Der Traum der echten Loreen wäre nämlich der, sich eine großflächige Tätowierung auf den Rücken meißeln zu lassen, wahrscheinlich das Thor-Steinar-Logo.
Aber es gibt auch Beruhigendes von mir zu berichten: Ganz gleich, wie krank meine Fantasien auch sein mögen, ich hänge ihnen nur so lange nach, bis der Kaffee fertig ist. Meistens.
Mein Telefon klingelt erneut, und ich renne zurück ins Schlafzimmer.
»Loreen?«, keuche ich in den Hörer, und eine verdutzte Stimme antwortet mir:
»Äh, Loreen. Hier ist die Katja, könnte ich die Doki sprechen, also die Doris?«
»Am Apparat«, gebe ich zu, obwohl ich gerade gar keine Lust habe, mit Katja zu telefonieren. Katja ruft nämlich nur an, wenn der Weltuntergang bevorsteht, eine Veranstaltung, die in ihrer Wahrnehmung im Schnitt dreimal pro Woche stattfindet. So auch jetzt: »Boah, Doki, gut dass ich dich erreiche, ey, mein Auto ist kaputt. Totalschaden, da geht nichts mehr!«
»Oh Gott, was ist passiert? Bist du okay?«, frage ich so aufgeregt wie möglich, weil ich weiß, dass Katja es liebt, wenn ich bei ihren Dramen so lange mitspiele, bis sie genug davon hat.
»Nee, bei mir ist alles in Ordnung, der Andi saß ja nur da drin, als es passiert ist.«
Andi ist Katjas Freund. Jedenfalls leben sie seit acht Jahren zusammen, und alle fragen sich: Warum? Aufgrund der hohen Dichte an »Andis« in unserem Freundeskreis ist mittlerweile jeder dazu übergegangen, Katjas Andi nur noch als »Katjas Andi« zu bezeichnen. Sogar in seinem Beisein. Nur Katja nennt ihren Andi wahlweise »Dummbatz« oder in einem zusammenhängenden Satz auch gerne nur »der Andi«.
»Geht’s deinem Andi denn gut?«, frage ich höflich nach und sehe bildlich vor mir, wie Katja an ihrer albernen Frisierkommode sitzt und ärgerlich abwinkt, als würde sie eine Fliege verscheuchen:
»Ach der, ja, der hat sich noch aufgeregt, dass die Karre nicht ansprang, weil er ja sooo dringend zu seiner wichtigen Arbeit musste …«
Ich unterbreche: »Katja, du sagtest was von Totalschaden, was ist denn nun mit deinem Wagen?«
Katja schnalzt ungeduldig mit der Zunge: »Also, für mich ist das ein Totalschaden, wenn ein Auto nicht mehr fährt, oder? Ich meine, Autos sollten fahren, oder?«
Ich stimme zu und stelle mir vor, wie meine Freundin Katja und die falsche Loreen ausschweifende, wenn auch wenig fachkundige Gespräche über Kraftfahrzeuge miteinander führen würden. Aber aus irgendeinem Grunde wollen beide lieber mit mir telefonieren.
»Also, was tun wir?«, fragt Katja mich nun, »ich meine, wegen heute Abend?«
»Hä?«, sage ich, um Zeit zu schinden, und das bringt Katja in Höchstform.
»Hallo, Doki, heute Abend, das Konzert, im »Deee Aitsch«! Wie soll ich denn dahin kommen, mit der Bahn vielleicht?«
»Zum Beispiel«, rege ich an und verziehe das Gesicht. Ich hasse es, wenn jemand, und besonders Katja, unsere Kneipe »Deee Aitsch« nennt. Sie heißt immer noch »Dead Horst«, meinetwegen auch »Horst«, oder für mich ganz einfach: Zuhause.
»Doki, ich hasse Bahn fahren. Das dauert ewig, und die letzte Bahn fährt schon um eins zurück, da habe ich gar keine Lust drauf!«, mault Katja, und ich weiß, was von mir erwartet wird. Zähne zusammenbeißen und die Frage aller Fragen stellen:
»Willst du bei mir übernachten?«
»Hmm. Okay, wenn’s sein muss«, seufzt Katja, und bevor ich mein Angebot zurückziehen kann, macht mein zukünftiger Gast ein paar unverbindliche Vorschläge: »Doki, wenn ich bei dir übernachten soll, dann möchte ich aber an der Wandseite schlafen, okay? Und kannst du mal die Bücher raussuchen, die ich dir geliehen habe, die kann ich ja dann direkt mitnehmen. Und du kannst mir auch gleich das eine Kleid leihen, oder? Ach weißt du, dass wird vielleicht sogar ganz lustig, dann komme ich vorher zu dir, und wir trinken einen Sekt. Hast du Pfirsichsirup im Haus? Und dann spiele ich dir noch vor, was wir mit der Band aufgenommen haben, und morgen frühstücken wir schön … Weißte was, Doki, vielleicht bestellst du jetzt schon mal das leckere Baguette vor, nicht, dass die morgen zum Frühstück wieder ausverkauft sind.«
»Ist gut«, kann ich hervorpressen, obwohl ich dabei auf mein Kopfkissen beiße. Katja ist meine beste Freundin und ich liebe sie. Ich liebe auch den Ozean, aber auch den muss ich nicht unbedingt in meiner Wohnung haben. Obwohl der wahrscheinlich wesentlich anspruchsloser und somit einfacher zu beherbergen wäre als Katja.
»Warte mal Doki, da ist nur der Andi am Handy«, dann höre ich sie brüllen: »WAS WILLST DU DENN JETZT?«
Seine Antwort kann ich nicht hören, aber sie erschließt sich durch Katjas Folgegebrüll:
»NA TOLL, DER TANK WAR NUR LEER, SUPER! ABER JETZT SCHLAF ICH EH BEI DOKI, TSCHÜSS!«
Nach dieser eindrucksvollen Unterweisung ihres Liebsten wendet sich Katja wieder mir zu: »So, da bin ich wieder. Andi, der Spacken, hatte nur vergessen zu tanken. Aber dann schlafe ich trotzdem heute bei dir, oder? Ich meine, dann können wir auch mal wieder ordentlich einen trinken, wenn ich nicht zurückfahren muss. Also, bis später, tschüss!«
Katja legt auf, bevor ich mich verabschieden kann. Ich nehme ihr das nicht übel. Wenn ich bei ihr auch noch solche kleinen Delikte ahnden würde, käme ich zu gar nichts mehr.
Als ich wieder in der Küche stehe, fällt mir auf, dass mein Kaffee kalt ist. Der Kaffee, den ich aus meinen letzten Pulverresten gekocht habe. »Kein Grund, sich aufzuregen«, mahne ich mich selbst, als ich in den Kühlschrank blicke: »Alles halb so wild, es wäre eh keine Milch mehr da gewesen.«
Bei einer vierten Zigarette gehe ich im Kopf meinen Tagesplan durch. Wahrscheinlich sollte ich als Erstes die Wohnung aufräumen, und zwar gründlich, das ganze Programm. Küche wischen, Bad putzen. Den Fernsehbildschirm mit Glasreiniger bearbeiten, sonst schreibt Katja sofort wieder mit dem Finger »Du Ferkel« auf den Bildschirm. Das bleibt dann wieder wochenlang da stehen und macht mir schlechte Laune. Außerdem sollte ich Katjas Lieblingsbettwäsche aufziehen, die ich erst waschen und in den Trockner meiner Nachbarin bringen müsste. Vorher sollte ich aber unbedingt das Kleid, das Katja sich von mir leihen möchte, in die Wäsche werfen. Es steht ihr absolut nicht, und wenn es klitschnass ist, wird sie es kaum ausleihen wollen. Andererseits weiß Katja von meinem Trockner-Arrangement mit der Nachbarin. Sie hätte keine Skrupel, dort auch noch spät am Abend zu klingeln, um das Kleid dort zum Trocknen abzuliefern. Was wiederum bedeuten würde, dass ich in den nächsten Wochen zweimal die mordlustige Katze meiner Nachbarin füttern muss, worauf ich überhaupt keine Lust habe. Vielleicht wäre es also wesentlich sinnvoller, ganz viel Alkohol zu kaufen, Katja am Bahnhof abzugreifen und sie ein bisschen aufzuheitern, bevor sie überhaupt meine Wohnung betritt.
Ab dem ersten Bier ist Katja meist gnädiger, was mein Chaos angeht. Nach dem zweiten Bier wird sie allerdings erst recht das Kleid anziehen wollen, weil sie danach sicher ist, dass es ihre Oberweite schön betont. »Betont« kann ich noch zustimmen, aber schön geht anders. Wenn Katja diesen Fummel trägt, kann ich sicher sein, dass wir den ganzen Abend kein vernünftiges Wort miteinander wechseln werden, weil dauernd irgendein Kerl in ihrem Ausschnitt steckt.
Ich drücke die Kippe aus und stelle fest, dass ich eine enorm vielbeschäftigte Frau bin. Kaum zu glauben, dass ich mit einem 24-Stunden-Tag auskomme. Eine nüchterne Katja von meiner Wohnung und eine angeschickerte Katja von dem Brustquetschkleid fernzuhalten sind ja nur zwei Tagesordnungspunkte, andere Notwendigkeiten wie Nahrungsaufnahme, Hygiene und Kosmetik sind dabei noch gar nicht berücksichtigt. Und da war noch etwas.
Richtig, Arbeit. Meine Schicht fängt um zehn Uhr an, also jede Menge Zeit, um zu duschen und zu frühstücken. Theoretisch. Rein praktisch ist heute aber Samstag und meine Arbeit fängt um neun Uhr an.
Geistesgegenwärtig schlüpfe ich in das besagte Kleid, das meine kärgliche Oberweite einfach verschluckt, und hoffe, dass Katja es nicht mehr ausborgen möchte, wenn ich den ganzen Tag darin herumgelaufen bin. Ich werfe meinen Schlüssel und mein Handy in die Handtasche, sause die Treppen hinab, strample auf dem Fahrrad wie eine Irre bis zur nächsten Straßenecke, wo ich mich frage, ob ich die Zigarette ausgemacht habe. Falls nicht, wäre die Sache mit dem ungewollten Übernachtungsbesuch wenigstens geklärt.
Ich beschließe, nicht umzudrehen.
Zu meinen vielen guten Eigenschaften gehört unter anderem die Fähigkeit, dass ich auch in Stresssituationen immer den Überblick behalte. So steht es jedenfalls in meinen Bewerbungsunterlagen, also muss etwas dran sein.
II
Völlig aus der Puste erreiche ich meine Arbeitsstelle, den Anker Jugendtreff e. V., sofort steigt leichte Panik in mir auf. Mein Baum ist zugeparkt. Ein schlechtes Omen. Ortskundige lehnen ihre Fahrräder normalerweise nicht an diese prächtige Linde auf der Verkehrsinsel, da sie dort binnen einer Stunde geklaut werden. Auch total verrostete, uralte und offensichtlich kaputte Räder werden hier blitzschnell gestohlen. Nur meines nicht. Obwohl die Kette und die Schaltung neu sind und ich es nicht einmal mehr abschließe: Keiner will mein Fahrrad. Ich auch nicht.
Benno, mein Exfreund, hat es mir geschenkt. Vor kurzem hat er angerufen und mich gefragt, ob er das Fahrrad wiederhaben könne, um es seiner neuen Flamme zu vermachen. Ich empfand diese Forderung als so dreist, dass ich behauptet habe, das Rad sei mir geklaut worden.
Nun hoffe ich seit über drei Wochen, dass meine Lüge zur Wahrheit wird, schon, weil ich kurz nach dem Telefonat eine Fahrradversicherung abgeschlossen habe. Aber dieses verdammte Rad verhöhnt mich. Tag für Tag strahlt es mir wieder ungeklaut entgegen – langsam fürchte ich, dass es sich bei diesem nicht stattfinden wollenden Fahrraddiebstahl um eine Verschwörung handelt, in die sowohl Benno, die Zweirad-Mafia als auch irdische und überirdische Hüter der Moral verstrickt sind.
Ich wuchte das Teufelsrad also in den Ständer, gleich darauf spricht eine grollende Stimme aus dem Himmel zu mir: »Doris, kommst du dann auch langsam?«
Ich richte meinen Blick nach oben. Das Haupt meiner Chefin Margret, hängt aus dem Fenster des vierten Stocks. Trotzdem kann ich die sanfte Enttäuschung in ihrem Blick von hier unten aus erkennen: »Bin sofort bei euch!«, rufe ich und stürme los, Margret kreischt. »Doris, du musst dein Rad doch abschließen! So viel Zeit ist jetzt auch noch!«
Wie gut sind die Augen meiner Chefin? Wird sie von da oben aus bemerken, wenn ich das Kettenschloss nur lose um den Hinterreifen drapiere und den Schlüssel aufreizend darin stecken lasse? »Sicher ist sicher«, denke ich, und verknote das Schloss artig zwischen Speichen und Fahrradständer. Als ich damit fertig bin, gucke ich wieder nach oben, mit einem Kleinmädchenblick, der ausdrücken soll: »Guck mal, Mama, hab ich ganz alleine gemacht!«
Aber Margrets Kopf ist gar nicht mehr am Fenster.
Ich haste zum Eingang und meine, das Fahrrad dämonisch lachen zu hören. Wenn ich nicht ganz bald etwas zwischen die Zähne bekomme, kann das noch ein recht interessanter Arbeitstag werden. Und die sind im Anker rar gesät.
Anker – der Name ist schon zum Abgewöhnen, aber wahrscheinlich auch nicht schlechter oder besser gewählt als jeder andere Name. Aber hier übertreiben sie es gerne mit dem Wortwitz: Die Mannschaft muss trotz allgemeinem Anglizismen-verzicht neuerdings Crew genannt werden, weil sie zu sechzig Prozent aus Frauen besteht; die Jugendlichen heißen Jugendliche, weil sie nicht gestrandet sind. Und das dem Laden angeschlossene Café heißt Kommbüse. Ja, natürlich mit Doppel-M. Wegen der Kommunikation. Wenn ich den finde, der sich das ausgedacht hat, lasse ich ihn über die Planke laufen, ernsthaft.
Als ich die Kommbüse betrete, steigt meine Laune. Hier herrscht gähnende Leere, weder die Kollegen noch zu betreuende Jugendliche sind zu sehen, also bin ich theoretisch gar nicht schon wieder zu spät. Doch nun bemerke ich ein Leuchten hinter der Bar, ein roter Kopf strahlt mir entgegen, natürlich ist eine doch schon da.
»Oh, hi Doki, schönes Kleid«, begrüßt mich Kira, und ihre Gesichtsfarbe wird um eine weitere Nuance gesünder. Sie starrt mich diese vier Sekunden zu lange an, mit großen Augen, als wäre sie ein Kaninchen und ich die Schlange. Eine große, alte Boa constrictor, die sich in einen rot-schwarz gemusterten Fummel geworfen hat, der durchaus als angemessene Arbeitskleidung durchginge, wenn ich in einem Western Saloon tanzen würde.
»Äh, tja, danke Kira, ich habe das nur angezogen, weil ich nach der Arbeit noch ausgehen wollte«, rechtfertige ich meinen Aufzug, während ich mich an Kira vorbei hinter die Theke quetsche. Kira ist nicht dick, nur blockig. Sie verfügt über die Gabe, immer im Weg zu stehen, überall. Dabei sieht man nie, dass sich ihr gesamter Körper durch den Raum bewegt, sie scheint nur den Kopf hin und her zu drehen und dem geschäftigen Treiben um sich herum erstaunt zu folgen. »Es steht dir aber wirklich gut«, kommentiert sie meine Garderobe erneut, wobei ihr Blick meinen Brustkorb durchbohrt, woraufhin ich mich gezwungen sehe, diesem zu folgen. Mein BH ist deutlich zu sehen, also schließe ich die obersten Knöpfe nachträglich und wechsle das Thema: »Tut mir leid, dass ich zu spät komme, ich hoffe, du bist mit dem Ansturm alleine fertig geworden?«
Und obwohl ich Kira enorm zuzwinkere, weiß ich, was jetzt kommt. Kira fehlt irgendein Enzym. Sie kann keine Ironie vertragen, geschweige denn verstehen. Wahrscheinlich dachte sie tatsächlich bis vor einer Minute, dass mein Kleid so getragen werden müsste, dass die Unterwäsche zu sehen ist. Und fand es toll, weil sie alles toll findet, was ich trage, tue oder sage. Ich werde von einer Statue verehrt, die hier sonderbarerweise als Praktikantin angestellt ist.
»Oh, es ging schon irgendwie«, berichtet Kira jetzt, »aber wir haben keine Holunderbrause mehr. Auch nicht im Lager. Das war ziemlich unangenehm, weil der Ludi eine haben wollte und fast wieder gegangen wäre, als es keine gab, dabei hatte ich schon einen Strich gemacht, und das wäre blöd gewesen, wegen der Statistik, oder, Doki?«
Ich nicke langsam. Kiras größte Sorge gilt unserer Statistik, und mit dieser Einstellung steht sie nicht alleine da. Denn für jeden Jugendlichen, der unsere Einrichtung betritt, muss der zuständige Sozialarbeiter einen Strich in der Anwesenheitsliste verzeichnen. Und was sich zunächst läppisch anhört, erfordert ein Höchstmaß an Konzentration, Geschäftssinn und Weitsicht. Es will genau überlegt sein, wo auf unserem Formblatt dieser Strich verzeichnet wird, denn die Rubriken sind vielfältig: männlich, weiblich, unter fünfzehn Jahre, über fünfzehn, fünfzehn, Scheidungskind, Migrationshintergrund, Justin-Bieber-Frisur oder sonstige psychische Auffälligkeiten. Am Ende des Tages soll die Statistikliste möglichst bunt aussehen, damit wir uns alle gegenseitig auf die Schulter klopfen können, denn angeblich leisten wir ja Integrationsarbeit hier.
Außerdem kann es immer sein, dass die Stadt Einblick in unsere Statistik haben möchte, damit auch die Politiker sich auf die Schulter klopfen und uns Gelder bewilligen können.
»Der Ludi ist ja enorm wichtig, für die …«, ich falle Kira ins Wort:
»Statistik, schon klar. Wo steckt er denn jetzt?«
Kiras Kopf gleicht jetzt einem prallen Luftballon, aber er platzt nicht, sondern lässt etwas Luft entweichen, durch die winzige Mundöffnung: »Der ist im Medienraum, den hab ich ihm aufgeschlossen«, piepst sie.
Ich atme durch und stelle fest, dass ich viel zu hungrig bin, um Kira eine Standpauke zu halten. Aber ich bin sauer genug, um mich mit Ludi anzulegen, also gehe ich ohne ein weiteres Wort in den ersten Stock, reiße die Tür zum Medienraum auf und donnere los: »Ludolf Schwenke-Großmann, du weißt sehr wohl, dass du den Computer nicht für Ballerspiele nutzen sollst, oder?« Ludi macht sich nicht die Mühe, sich dem Monitor ab- und mir zuzuwenden, aber immerhin spricht er mit mir:
»Ey, Doki, hast du jetzt grade echt ›Ballerspiel‹ gesagt? Voll peinlich, echt.«
Er schüttelt den Kopf und erschießt ein Dutzend Terroristen mit einer Panzerfaust, was ihm offenbar ein Extra-Leben beschert. Ich werde richtig wütend. Bis zu diesem Level habe ich es bisher nie geschafft. Also muss ich den Jugendlichen auf einer Ebene treffen, auf der ich ihm überlegen bin – der pädagogischen. Ich stelle mich neben Ludi und drücke den verbotenen Knopf am Rechner. Der Bildschirm vor Ludi wird schwarz. Für jemanden, der es bis zum virtuellen General der US Marines geschafft hat, ist Ludis Reaktionszeit erstaunlich lang. Es dauert eine Schrecksekunde, bis er mich anschreit: »Ey, Doki, bist du gestört, oder was? So gehen die Computer kaputt, das sage ich Margret, echt, ich sage ihr das!«
Er springt vom Stuhl auf, sieht mich an und – lacht schallend: »Ha, Doki, willste dir doch noch einen aufreißen, oder hast du ’nen Zweitjob auf dem Straßenstrich angenommen? Geiles Outfit, echt …«
In solchen Momenten geschieht immer etwas – in mir. Man hört ja oft von Leuten, die nach einer Nahtoderfahrung berichten, dass ihr gesamtes Leben im Schnelldurchlauf an ihnen vorüberlief in dem Augenblick, in dem sie sicher waren, zu sterben. Wenn ich spüre, dass meine Karriere in Lebensgefahr ist, läuft mein gesamtes Studium im Zeitraffer durch meinen Kopf. Es ertönen die Schlüsselsätze aus den Seminaren und den Praktika, die goldenen Regeln wie: »Man muss sich abgrenzen«, »Immer die Kontrolle behalten«, oder auch »Bei Konflikten stets die Ruhe bewahren und zuhören, die Situation nie eskalieren lassen«.
Also halte ich mich davor zurück, Ludolf Schwenke-Großmann am Schlafittchen zu packen, um ihn aus dem Anker zu werfen. Ich nutze auch nicht mein Wissen über seine Biografie, um ihn psychologisch fertigzumachen, sondern greife nur nach seiner Hand und sage: »Komm, Ludi, ist gut jetzt. Lass uns eine rauchen gehen.«
Ludi grinst: »Dachte, du fragst nie.«
Er legt seinen Arm um meine Taille, und wir beide hüpfen die Treppen hinab, raus in den Hinterhof, denn, so Ludi: »Ey, Doki, auf der Straße lass ich mich nicht mit dir blicken, sonst denken die Leute noch, ich wär’ dein Zuhälter!«
Ich sauge Teer, Nikotin und hundert andere Zusatzgiftstoffe ein und bin erleichtert, dass ich wieder einmal eine heikle Situation meistern konnte. Der zu betreuende Minderjährige lehnt entspannt neben mir an der Hauswand, er bläst den Rauch brav in die Kellerfenster hinein, damit Margret die verräterischen Wölkchen nicht sehen kann, falls sie durch das Hinterzimmer ihres Büros zufällig auf den Innenhof schaut.
Ludi kann ein Rabenaas sein, aber wenn es drauf ankommt, handelt er instinktiv richtig. Und ganz im Vertrauen: Wenn Ludi nur Unfug anstellen würde, würde ich ihn immer noch gernhaben, und wenn wir ganz ehrlich sind, könnte der Anker gar nicht ohne ihn. Denn Ludi ist unser geschummelter Ausländeranteil. Er ist als Baby aus Korea adoptiert worden, und Gott allein weiß, was das Ehepaar Schwenke-Großmann geritten hat, das arme Ding »Ludolf« zu nennen. Natürlich wurde er dadurch schon im Kindergarten zum Gespött der anderen, und eine der Erzieherinnen dachte tatsächlich bis zu seiner Einschulung, der Junge hieße »Rudolf«, könne aber dank seiner »asiatischen Vorbelastung« den Buchstaben »R« nicht aussprechen. Umso erstaunlicher, dass Ludi in den Anker kommt, um sich freiwillig weiter von sogenannten Pädagogen betreuen zu lassen, aber wenn man ihn besser kennenlernt, weiß man, warum: Hier kann man umsonst Kickern und Tee trinken, außerdem finden die Mädels ihn süß. Alle Mädels, die Sozialarbeiterinnen eingeschlossen. Und Ludi weiß um seine Herzensbrecherqualitäten. Jetzt gerade zieht er seine Johnny-Depp-Nummer ab, stellt den Kragen seiner Lederjacke hoch und schenkt mir den Blick, der Praktikantinnen dazu bringt, Computerräume aufzuschließen: »Doki, sag mal ehrlich«, hebt mein indirekter, fünfzehnjähriger Arbeitgeber nun an, »wenn ich zehn Jahre älter wäre, dann hätte ich doch eine Chance bei dir, oder?«
Ich schüttle energisch den Kopf, um so mein Lächeln zu verwischen: »Mindestens zwölf Jahre älter, und zwanzig Zentimeter größer müsstest du auch sein.«
Bevor Ludi mich nach dieser Steilvorlage unterbrechen kann (»Ey, Doki, ich hab’ locker zwanzig Zentimeter«), führe ich weiter aus, warum es nie etwas zwischen mir und meinem Schutzbefohlenen werden wird: »Außerdem solltest du jede Menge Kohle verdienen, und zwar auf ehrliche Weise. Abgesehen davon hängst du mir zuviel vor dem Computer rum und bist mir eindeutig zu wehleidig. Du suchst die Schuld für deine Fehler immer bei anderen, und …«
Ludi sieht mich an, als wäre ich nicht ganz dicht, und mir wird schlagartig klar, dass ich jetzt gerade eine Grenze überschritten habe, wahrscheinlich aufgrund akuter Unterzuckerung, also füge ich nur noch hinzu: »Du bist einfach nicht mein Typ, sorry.«
Ludi nickt langsam, und klopft mir beruhigend auf die Schulter: »Äh, Doki, war nur ein Scherz, okay?«
Ich nicke, noch langsamer, Ludis Ton bereitet mir Sorge:
»Und, hey, falls du mal reden möchtest, so über deine Gefühle oder deinen idiotischen Exfreund, ich bin immer da, das weißt du, oder?« Das anschließende Zwinkern hätte er sich sparen können, aber das Weglaufen im selben Moment war ein schlauer Schachzug von ihm.
»Du Arschloch«, rufe ich ihm hinterher, »ich erteile dir Hausverbot, echt!«
»Danke für die Kippe«, höre ich Ludi noch durchs Treppenhaus rufen, und will ihm schon zum Café folgen, aber da höre ich wieder die Stimme einer höheren Macht:
« Doris, kannst du mal bitte zu mir hochkommen?«
»Klar, Margret, klar«, nuschle ich, drücke die Zigarette aus und laufe so rot an, wie Kira es wahrscheinlich im selben Moment im Café tut, denn als ich die Treppe hochflitze, kann ich noch hören, wie Ludi zu ihr sagt: »Wenn ich nur fünf Jahre älter wäre, wie wäre es dann mit uns?«
Hoffentlich arbeite ich noch so lange hier, bis ich ihm tatsächlich Hausverbot erteilen kann. Wegen Altersdiskriminierung.
Mein Plan von heute Morgen hat halbwegs hingehauen. Ich bin leicht angetrunken, habe aber weder Baguette vorbestellt noch Katjas Lieblingsbettwäsche gewaschen. Dazu hätte ich ja von der Arbeit aus erst einmal wieder zu mir nach Hause gehen müssen, aber ich habe es nur bis zu meinem Therapeuten geschafft. Der sitzt auf einem Barhocker hinter der Theke und poliert Gläser, während ich ihm mein Herz ausschütte:
»Ich weiß nicht, Toddy, irgendwie kommt es mir so vor, als würden die mich bei der Arbeit verarschen«, vertraue ich ihm an, und Toddy nickt mit düsterer Miene: »Ja, Raphael hat sich neulich geweigert, mir das Taxi zu bezahlen.«
Toddy hat keine klassische Ausbildung genossen, weder als Barkeeper noch als Psychotherapeut. Dafür ist sein Honorar bescheiden, allerdings bekommt er das mit dem Zuhören noch nicht so richtig hin. Wenn man ihm ein Stichwort gibt, redet er die meiste Zeit selber, so auch jetzt: »Doki, ich meine, es war fünf Uhr morgens, keine Bahn fuhr mehr, und ich war stockbesoffen. Und als ich Raffi dann geweckt habe, meinte er, es gibt kein Taxigeld! Was stellt der sich vor, dass ich in der Küche schlafe?«
Toddy schmettert das Glas wütend auf das Regal hinter ihm, ich überlege, wie ich möglichst elegant vom Thema ablenken kann. Toddy arbeitet seit über dreizehn Jahren hier, seit dem Tag, an dem er seinen Rückflug nach Schottland verpasst hat und er seinen Deckel nicht zahlen konnte. Raphael, der Besitzer des »Dead Horst« hat ihm den Job verschafft, ihm deutsch beigebracht, ihn beherbergt, er hat Toddy quasi adoptiert, aber wie es scheint, durchläuft Raffis Mündel gerade eine pubertäre Trotzphase. Toddy betrinkt sich bei jeder Schicht und schläft oft schon während der Arbeit in der Küche ein. Ich erwähne das lieber nicht, sondern erzähle wieder von meinem Tag: »Nein, Toddy, bei mir ist das anders: Meine Chefin nimmt mich immer in Schutz, egal, was ich tue oder lasse, dieses bescheuerte Jugendzentrum ist nur ein Prestigeobjekt für die Stadt, und ich komme mir vollkommen fehl am Platze vor. Es ist so …«, ich suche nach einem passenden Vergleich, Toddy mustert mich mit zusammengekniffenen Augen: »… als wäre ich ein Politiker, der nach Brüssel weggelobt wurde. Damit er nicht mehr stört, verstehst du? Ich bin wie Edmund Stoiber, verdammt!«
Auf diese Erkenntnis muss ich noch ein Bier trinken, Toddy knallt es mir vor die Nase und grunzt: »Doki, ich weiß nicht, warum du ein ›Stoiber‹ bist, aber was du da sagst ist eindeutig Luxusgejammer!« Toddy nickt zufrieden.
»Luxusgejammer« ist sein Lieblingswort. Seine Freundin hat es ihm beigebracht, und Toddy nutzt es als eine Art Zauberformel, wenn Gäste sich ungefragt bei ihm aufdrängen. Wenn Toddy »Luxusgejammer« sagt, ist die Therapiestunde beendet, und der Patient fühlt sich in der Regel so schlecht, dass er eine Menge Trinkgeld dalässt.
Wenn Toddy gehobener Stimmung ist und einen Gast nicht mag, hält er nach der Eröffnung »Luxusgejammer« auch gerne noch einen Monolog über das karge Leben im dörflichen Schottland, das er nie geführt hat, zu dem er aber stets neue Einzelheiten erfindet. Je nach Tagesform hatte Toddy drei bis siebzehn jüngere Geschwister, die allesamt an der Schwindsucht und dem schrecklichen Essen gestorben sind, sodass er ganz allein ein Ochsenjoch über die steinigen Felder ziehen musste, im Sommer wie im Winter.
Dem gebildeteren Publikum fällt schnell auf, dass Toddys erfundene Lebensgeschichte auf einem Sketch von Monty Python basiert, aber um drei Uhr nachts gibt es nicht mehr so viele Schlauköpfe an der Bar. Erst letzte Woche hat einer einen Zwanziger in das Sparschwein für Toddys vierfach amputierte Großmutter gesteckt, das wir vor Jahren zum Scherz aufgestellt haben.
»Doki, trink mal aus, ich muss die Bar gleich aufmachen«, belehrt Toddy mich nun, und ich nehme einen letzten Schluck. Zwischen Toddy und mir herrscht das geheime Abkommen, dass ich Biere, die ich vor der Kneipenöffnung trinke, nicht bezahlen muss. Zum einen, weil Toddy damit Raffi ärgern kann, zum anderen, weil Toddy und ich mal eine kleine Tändelei hatten, bevor die Liebe seines Lebens, Linda mit dem Luxusgejammer, auf der Bildfläche erschienen ist. Lang ist’s her.
»Okay, die Konzertkarten habe ich, dann hole ich jetzt Katja vom Bahnhof ab und wir sehen uns später. Bis dann, Toddy!«, rufe ich, und Toddy’s Augen blitzen:»Oh, Sexy-Katja gibt sich heute die Ehre, wie schön!«, sagt er verträumt, dann mustert er mich:»Doki, warum hast du dann das Kleid an, das ihr so gut steht? An dir ist es …«, Toddy wedelt mit den Händen und sucht in seinem Kopf nach dem Wort, das Linda wählen würde, findet es und spricht es eine Spur zu stolz aus: »verschwendet!«
»Danke, Toddy«, murmle ich und stapfe Richtung Tür, in den Sonnenuntergang hinaus.
Dabei krame ich in meiner Tasche nach Kleingeld und hoffe, dass es genug ist, um einen Zaubertrank zu kaufen, der Prinzessin Katja milde stimmen möge.
»Frau Kindermann«, herrscht meine beste Freundin mich schon aus der Ferne an, »warum warte ich hier, mutterseelenallein auf dem Bahnsteig, ohne einen Schluck zu trinken oder sonstige Unterhaltung? Warum?«
»Weil du die großmütigste, atemberaubendste und fabelhafteste Person der Welt bist, Frau Alpert«, beende ich unsere Begrüßungsformel, und wir umarmen uns. Ich spüre, dass es ein guter Abend wird, weil Katjas Umarmung ehrliche Freude ausdrückt. Aber als sie mich wieder loslässt, ein Stück von sich wegstupst, um mein Outfit zu kommentieren, fange ich mir natürlich einen Rüffel ein: »Doki, warum hast du das Kleid an? Ich wollte es mir doch leihen. Nicht, dass es nicht auch gut an dir aussieht, mit den langen Beinen, aber so oben rum?«
»Verschwendet, ich weiß«, wiederhole ich Toddys Urteil reumütig, aber Katja schaut mich verwirrt an: »Ich wollte sagen: etwas anbiedernd – die obersten Knöpfe sind offen.«
Es wird ein guter Abend: Wenn meine nicht vorhandenen Brüste einen Ausschnitt sprengen können, der an manchen Tagen selbst Katjas wogende Oberweite trägt, liegt doch eine gewisse Magie in der Luft. Katja holt mich auf den Boden der Tatsachen zurück:
»Ich glaube, es ist auch kürzer geworden. Viel kürzer. Scheiße, Doki, hast du es vielleicht bei sechzig Grad gewaschen? Da passe ich doch nie wieder rein, verdammt.«
Katja zündet sich eine Zigarette an und schnauft entrüstet.
»Tschuldige, war keine Absicht«, nuschle ich, aber ich weiß, dass diese Entschuldigung sie nicht über den Verlust ihres Lieblingskleides hinwegtrösten wird, auch wenn es meins ist:
»Ich habe gar nicht gemerkt, dass es enger ist, vielleicht habe ich seit dem letzten Mal, an dem ich es getragen habe, abgenommen.«
Katja knurrt mich an. »Mach es nicht noch schlimmer, Bohnenstange.«
Aber dann lächelt sie, als wäre ihr gerade etwas ganz Großartiges eingefallen, die Lösung aller Probleme, die Weltformel für das ewige Glück.
»Da ich ja weiß«, hebt sie an, »wie überaus dusselig und unordentlich meine beste Freundin ist, habe ich selbstverständlich vorgesorgt. Ich habe mir – ausnahmsweise – das perfekte Ensemble für den Anlass zugelegt. Du wirst Augen machen, garantiert. Also, auf in die Bat-Höhle, Quasselwasser kippen und Cellulitis wegschminken!«, befiehlt sie, packt mich am Arm und zieht mich Richtung Treppe.
Ich füge mich meinem Schicksal. Die Billigsektflasche klappert in meiner Handtasche, und ich spüre die neidischen Blicke der Passanten. Die meisten von ihnen würden auch gerne von einem resoluten Schneewittchen im Leopardenmantel abgeschleppt werden, obwohl auch sie unter Garantie berechtigte Zweifel hegen, ob diese Märchenbraut noch zusätzliches Quasselwasser benötigt.
III
Katja liest gerne, vor allem laut, und grundsätzlich das, was in meiner Wohnung herumliegt:
»… so ist der Schrecken, der in der Gemeinde Twin Peaks geschieht, viel mehr im Alltäglichen (Sägewerk, High School) zu suchen, die angeblich mysteriösen Morde sind eher als Ventil/Erlösung zu sehen, die das wahre Grauen an die Oberfläche holen …«, Katja sieht erschrocken zu mir hoch: »Um Gottes Willen, Doki, was sollte das denn werden?«
Ich versuche, ihr das Papier zu entreißen, und grummle: »War vor deiner Zeit. Kurz vor deiner Zeit, genauer gesagt …«
Tatsächlich habe ich, bevor ich Sozialarbeiterin wurde, von einer völlig anderen Karriere geträumt. Zwei Semester lang habe ich Theater- und Filmwissenschaften studiert, um später etwas mit Filmen zu machen. Filme schauen, zum Beispiel. Okay, ich wollte mit der Aufnahme dieses Studiums meiner Mutter beweisen, dass ich doch ihre Tochter bin.
Als ich geboren wurde, kamen ihr schon aufgrund der Optik Zweifel; ich sah nämlich aus wie alle anderen Babys, die im Kreiskrankenhaus Lengerich zu Welt kommen: kahl, rosig, blauäugig und gesund wie ein Stierkalb. Angeblich hatte ich auch riesige Hände und Füße, selbst in meine Ohren musste ich noch reinwachsen, so die Legende.
An jedem Geburtstag bekomme ich, nach einem knappen Glückwunsch, unaufgefordert von meiner Mutter den Satz zu hören: »Und deswegen haben wir dich Doris genannt, meine Große, weil du einfach aussahst wie eine typische westfälische Buchhalterin!«
Klingt wenig schmeichelhaft, aber der Subtext ist noch bitterer: Mein älterer Bruder heißt Mattis, was damals kein verwegener, sondern ein nahezu unmöglicher Name war. Die bucklige Verwandtschaft war schon irritiert genug, als er, kaum von der Nabelschnur befreit, ausgestattet mit voller, dunkler Haarpracht und ausgeprägten Augenbrauen an der Brust trank. Aber als die Mama dann noch voller Stolz rief: »Er heißt eben nicht Matthias, sondern Mattis! Der Name ist mir im Traum erschienen, der wird mal ganz modern!«, sind sie fast hintenüber gefallen.
Zwei Jahre später kam dann das Buch Ronja Räubertochter raus, genau wie ich. Dass der Räuberhauptmann aus dem Kinderbuchklassiker wirklich und wahrhaftig Mattis hieß, hat meine Mutter wohl darüber hinweggetröstet, dass ihre erste Tochter wie ein Soloprojekt ihres Mannes, meines Vaters, aussah. Oder zumindest nicht wie eine Ronja.
Also taufte sie mich Doris. Doris Johanna, was überhaupt nicht zusammenpasst, aber auch die zweite Erbtante musste bedacht werden. Meine Namensgebung war das Unterpfand, das es meiner Familie ermöglichte, ein altes Fachwerkhaus zu beziehen.
Überflüssig zu erwähnen, dass dieses Thema viele, viele Therapieminuten verbraucht hat, alle an einem Stück abgesessen bei einer etymologisch sehr interessierten Dame, die ständig nachhakte:
»Moment: Ihr älterer Bruder, also der Beschützer, wurde nach einer Astrid-Lindgren-Figur benannt, Mattis, dem Räuber. Und ihre kleine Schwester, die heißt tatsächlich …«
»Lovis, wie die Räuberhauptmannsfrau. Oder Räuberhauptfrau, wie auch immer«, bestätigte ich, zusammengesunken auf einem unbequemen Rattansessel, und die Augen der Psychologin sprangen fast über ihren Brillenrand:
»Ihre Geschwister sind also nach einem literarischen Liebespaar benannt worden, das ist ja ungeheuer interessant! Wie gehen die denn mit dieser Last um?«
Das war so ein Schlüsselmoment in meiner einstündigen Profi-Therapie. Mit einem Mal wurde mir klar, dass meine Geschwister andere Sorgen hatten, als sich über ihre Astrid-Lindgren-Namen zu beklagen, inzestuös tätig zu werden oder Räuberbanden zu gründen. Sorgen, die vielleicht wirklich interessanter waren als meine Probleme, aber das musste die Psychologin ja nicht so raushängen lassen. Und wenn jemand wie sie auf so eine Art Geld verdienen konnte, konnte ich das bestimmt auch.
Also verabschiedete ich mich von ihr und ihren Rattanmöbeln und ging zum ersten Mal ins »Dead Horst«. Elf Stunden später lag ich mit Toddy im Bett und beschwerte mich nicht mehr über meinen Namen, da ich mich gar nicht mehr daran erinnern konnte, wie der lautete.
Zu dieser Zeit schwor Toddy noch auf die extrem körperbetonte Konfrontationstherapie, und das Konzept überzeugte mich sechs Wochen lang. Bis ich zufällig eine Frau traf, die ebenfalls seine Patientin war. Zumindest stand sie unter seiner Dusche, zusammen mit Toddy.
Rotz und Wasser habe ich damals geheult, in meiner winzigen Wohnung, ein Häuflein Elend, das vor einem halben Jahr in die große Stadt gezogen war, weil man dort so exotische Dinge tun konnte wie etwas zu studieren, das einen nicht Buchhalterin werden lassen würde. Meine total erwachsene Romanze mit einem schottischen Nymphomanen war ebenso dahin wie mein Ehrgeiz, eine Hausaufgabe über »Die Symbolhaftigkeit der anonymen Stadt im frühen Film Noir im Vergleich zur beklemmenden Bedrohung der Ländlichkeit im Werke von David Lynch« zu verfassen.
Tatsächlich bin ich mit dem Werk nicht viel weiter gekommen als bis zu der Stelle, über die Katja sich gerade königlich amüsiert. Sie liegt auf meiner Couch und strampelt mit den Beinen in der Luft, als sie die mir nur allzu bekannten Zeilen vorträgt: »Klaustrophobie und Fremdbestimmung bedrohen den modernen Menschen zwar auch in der Anonymität der Metropole, aber viel mehr noch im scheinbaren Idyll der Dörflichkeit. Siehe auch ›Nichts macht dich so fertig wie deine Heimatstadt‹, Spruch auf Postkarte, circa 1990‹.Was ist das? Ist das deine Quellenangabe, Doki?«, kreischt meine beste Freundin und verfällt in ein Crescendo fiesen Gackerns.
»Das wollte ich noch genauer recherchieren«, behaupte ich. Dabei weiß ich noch genau, dass ich an dieser Stelle meiner Hausarbeit den Computer aus- und die Realität eingeschaltet hatte. Ich entschied, nicht ins scheinbare Idyll zurückzukehren, sondern der bedrohlichen Metropole die Stirn zu bieten. Statt arbeitslose Filmwissenschaftlerin zu werden, wollte ich etwas Sinnvolles tun, Menschen helfen, die unverschuldet in Not geraten waren. Drogen und Prostitution den Kampf ansagen. Und da die Fachhochschule den Studiengang ›Batmanwerden in acht Semestern‹ nicht anbot, schrieb ich mich für Sozialarbeit ein. Eine gute Wahl, die mich vom Frustfressen und Twin-Peaks-Schauen abhielt. Ich nahm zehn Kilo ab und jede Menge Selbstbewusstsein zu.
Als ich mich Monate später erstmals wieder ins »Dead Horst« wagte, um Toddy meinen neuen, verbesserten Körper zu präsentieren, fand ich den Kerl auch dort, selig lächelnd in den Armen einer überirdisch schönen Schwarzhaarigen. Und Toddy zwinkerte mir anerkennend zu, leichtsinnigerweise. Die Schönheit schüttete ihm daraufhin einen Wodka Lemon ins Gesicht, und zwar in einem so ungünstig gewählten Winkel, dass Glas und Toddys Nase brachen. Er fluchte heftig, die Schwarzhaarige weinte heftiger.
Als künftige Sozialarbeiterin schwang ich mich selbstredend zu Ersthelferin auf und brachte die beiden ins nächstgelegene Krankenhaus. Während Toddy verarztet wurde, kam ich mit der temperamentvollen Attentäterin ins Gespräch, und tatsächlich fanden wir noch eine Menge weitere Gemeinsamkeiten als die, von Toddy als Zweitfreundin ausgenutzt worden zu sein.
So lernte ich Katja kennen.
Heute ist unser zehnter Jahrestag, und da wir keine zwanzig mehr sind, wollen wir diesen nicht mit Aschenbecherweitwurf oder im Krankenhaus verbringen, sondern stilvoller.
Natürlich im »Dead Horst« , wo alles begann, aber nicht zu nostalgisch, und auf keinen Fall wollen wir den alten Zeiten mit Toddy nachtrauern. Sanft entreiße ich Katja also den Entwurf meiner ersten Hausaufgabe, um auf ein Thema überzuleiten, das immer Leben in die Bude bringt: Luxusgejammer-Linda.
»Ich habe dem Mann vielleicht die Nase gebrochen, aber die Frau hat den Mann kastriert«, empört sich Katja und trinkt einen von den Schnäpsen, die wir eigentlich heute auslassen wollten. Ich trinke auch einen, damit mein Mund voll ist. Das hält mich davor zurück, reflexartig etwas zu erwidern wie: »Ja, gibt ja nix Schlimmeres als einen Mann, der unterm Pantoffel steht. Wie geht’s eigentlich deinem Andi?«
Ich schlucke und nicke fleißig, Katja schaut sich missbilligend in meiner Wohnung um: »Doki, wie kann man so leben? Hast du in den letzten zehn Jahren eigentlich mal irgendetwas hier gemacht wie … staubsaugen oder so?«
Ich gieße uns beiden noch einen nach. Katja übertreibt maßlos. Bis vor drei Monaten besaß ich einen Staubsauger, den ich auch durchaus benutzt habe. Es ist nicht wirklich dreckig bei mir, eher – trostlos. Mit viel gutem Willen könnte man meinen Einrichtungsstil auch als »puristisch« bezeichnen, Katja nennt es »Knastcharme«.
Bei wenig Möbeln sieht man den Staub halt deutlicher, und wenn die Möbel aus Sperrmüllfunden bestehen, fügt es sich zu einem Gesamtbild, das »… einfach nicht altersgemäß ist, Doris Kindermann! Ich glaube, das Hauptproblem ist der Boden«, orakelt die selbsternannte Innenarchitektin und nippt zur Abwechslung am Sekt. Ich zünde mir eine Zigarette an und bedauere still, dass aus alten Freundinnen meist keine neuen Weisheiten fließen.
Der Boden war schon immer das Problem.
Als ich einzog, bestand er aus fleckigblauem Linoleum.
»Leg doch ein paar schöne Teppiche über die schlimmsten Stellen«, empfahl meine Schwester, deren Lebensprinzip es ist, schlimme Stellen hübsch zu verdecken. Ihre selbstgebackenen Kuchen sind mit Vorsicht zu genießen, denn unter der Zuckerglasur beißt man immer auf Verbranntes.
»Mietminderung, mindestens dreißig Prozent«, grummelte mein Bruder, der damals gerade in einem Maklerbüro arbeitete.
»Na, entweder bleibst du hier sowieso nicht lange wohnen, oder du machst hier einen vernünftigen Boden rein, wenn du Geld verdienst«, sagte meine Mutter, und so wird es wohl auch eines Tages kommen. Irgendwann werde ich mir genug Geld auf die Seite legen können, um davon vierundvierzig Quadratmeter Parkettboden zu kaufen. Das wird ein großer Tag.
»Erde an Doki, Erde an Doki!«, Katja schnippt mit ihren Fingern dicht vor meinem Gesicht.
»Hey, Fräulein, wir hatten etwas verabredet: Wenn wir heute in der Vergangenheit schwelgen, denken wir nur an die guten Dinge, richtig? Du guckst gerade, als würdest du in Gedanken den Leidensweg Christi abgehen, mit zwei Kreuzen auf dem Buckel.«
Ich schiebe Katjas Finger sanft aus meinem Gesichtsfeld und gönne mir den Luxus, noch ein wenig nachzugrummeln. Schließlich hat Katja mit dem Fußboden angefangen, jetzt soll sie auch die ganze Geschichte hören: »Weißt du eigentlich, dass sich meine Jugendliebe wegen dieses Fußbodens von mir getrennt hat?«, frage ich wehmütig, und Katja verschluckt sich fast: »Das ist die dümmste Ausrede, die ich je gehört habe, Frau Kindermann. Wer war denn der Idiot?«
»Gunnar natürlich!«, winsele ich, weil ich Katja doch schon öfter von meinem ersten Freund erzählt habe. Von der elften Klasse bis kurz nach dem Abitur waren wir das Traumpaar der Schule. Beziehungsweise waren alle anderen Mädchen neidisch, dass der schöne Gunnar mich erwählt hatte. Diese Schnepfen hätten sich bestimmt diebisch gefreut, wenn sie von dem kläglichen Ende dieser großen Romanze gehört hätten. Ein Grund für mich, niemals ein Klassentreffen zu besuchen, aber meiner besten Freundin schildere ich nun in knappen Worten, wie es damals lief: »Also, es ging mehr um die gesamte Situation, die Stadt und meinen Entschluss, nicht mit ihm nach Leipzig zu ziehen, als die Schule vorbei war. Gunnar und ich standen hier, wo du gerade sitzt, und er hat rumgeschrien:
›In Leipzig liegt überall echtes, altes Holzparkett, die Mieten sind supergünstig, das ist eine tolle, aufregende Stadt!‹ Da habe ich ihn gefragt: ›Was soll ich denn machen in Leipzig?‹ Und weißt du, was mein toller, erster Freund daraufhin gesagt hat?« Natürlich kann Katja das nicht wissen, deswegen erzähle ich es ihr, in einer Stimmlage, die eher der der Supernanny als der meines Exfreundes ähnelt: »›Und, was willst du in dieser Stadt tun? Was macht man denn mit Theaterwissenschaften, du warst doch erst dreimal im Leben im Theater, Doris!‹
Und da habe ich ihn rausgeworfen. Aus Spaß, weil ich dachte, er käme wieder, mit einer Pizza unterm Arm und einer Entschuldigung. Aber er kam nicht wieder. Statt Pizza holen zu gehen ist er nach Leipzig gezogen. Dort hat er sofort eine günstige neue Freundin gefunden, die schon auf tollem alten Parkett wohnte, eine, die nur auf ihn gewartet hat. Wie ich auf meine Pizza.«
Katja schaut mich betroffen an: »Doki, darf ich einen Song daraus machen? Ich habe da schon eine Idee: I’m still waiting for my pizza and the love of my life …!«
Das Tolle an Katja ist, dass ich in ihrer Gegenwart immer wieder zum Teenager werden kann.
Ich schnappe mir ein Kissen und verprügle sie damit, sie kichert. Fehlt nur noch, dass wir Girls just wanna have fun auflegen und uns gegenseitig Lockenwickler eindrehen. Letzteres erweist sich schon aus dem Grunde als unmachbar, da Katja mich nun im Schwitzkasten hält. Ich winsele um Gnade: »Aufhören, aufhören, wir müssen los«, röchle ich listig, und Katja lässt meinen Kopf unsanft auf die Sofalehne knallen: »Du hast vollkommen recht, ich sollte mich schnell fertig machen.« Im selben Moment ist Katja aufgesprungen und in mein Badezimmer entwischt.
Sorgenvoll blicke ich auf die Uhr. Kurz nach neun. Das Konzert fängt gegen zehn an. Bei Katjas Kosmetiktempo haben wir eine gute Chance, die letzten drei Songs mitzubekommen.
»Kannst du dich ein bisschen beeilen?«, rufe ich zaghaft Richtung Bad, und meine beste Freundin antwortet: »Ich beeile mich immer! Wenn dir langweilig wird, kannst du ja solange die Gläser spülen.«
»Jaaaa, Mutter«, rufe ich genervt, aber stattdessen rauche ich noch eine. Vielleicht könnte ich in der Zeit, in der Katja mein Bad okkupiert, auch meine Hausarbeit über bedrohliche Käffer im Film vernichten. Oder sie zu Ende schreiben. Vielleicht bestelle ich auch einfach schon mal ein Taxi.
IV
Na, die Damen, erst zum Flughafen und dann ab nach Hollywood?«, witzelt der Taxifahrer, obwohl er erst ein Drittel von Katja gesehen hat. In anderen Städten beschweren sie sich über unfreundliche Busfahrer, hier kann man froh sein, wenn der Taxifahrer einem nicht schon beim Einsteigen einen Heiratsantrag macht. Katja steigt formvollendet durch die Hintertür ein und tut etwas, wofür ich sie besonders liebe. Sie bricht Stil.
Zuerst wirft sie kokett ihre Mähne über die Schulter, gibt dadurch einen Blick auf ihre dicht tätowierte Schulter frei, alsdann entfährt ein lauter Rülpser ihrem Kirschmund: »Nä, heute mal lieber gemütlich. Fahren sie uns in die Platenstraße, Ecke Dingsring. Kennen Sie das »Dead Horst«? Setzen Sie uns einfach an der Ampel davor ab.«
Der Fahrer nickt düster, und ich kann sehen, was er kopfschüttelnd denkt: »So ein hübsches Ding, und dann muss es sich so verunstalten.«
Ich grinse, während Katja es auf die Spitze treibt: »Ach ja, Frau Kindermann, so lange können wir heute nicht bleiben, ich habe am Montag Vorstandssitzung, da muss ich noch die Präsentation vorbereiten.«
Ich nicke, um einen ernsten Gesichtsausdruck bemüht. Der Fahrer verpasst die Abfahrt.
»Rechts ab wäre jetzt günstig gewesen«, kommentiert die Vorstandsvorsitzende des Kleingartenvereins »Wilde Ranken e. V. von 1999«, und fügt geistreich hinzu: »Zeit ist Geld, aber bestimmt nicht meins, klar?«
Unser Chauffeur sieht mich hilflos an, ich schaue so strafend, wie ich kann.
»Entschuldigung, Sie haben natürlich recht«, knurrt er, Katja rückt ihre Brüste zurecht. Der Fahrer schaltet die Uhr aus.
»Was geht denn heute im »Horst«?, fragt er dann, bemüht um einen Ton, der ausdrücken soll, dass er dort jeden zweiten Freitag die Tanzfläche zu rocken pflegt.
»Och, so das Übliche«, behaupte ich, »gemischtes Publikum, Live-Band aus Finnland, danach eine gepflegte Orgie mit Jungfrauenopfern.«
Der Fahrer schaltet die Uhr wieder an. Ich muss noch viel lernen von der Meisterin. »So ein Quatsch«, meldet die sich wieder zu Wort, »Frau Kindermann beliebt zu Scherzen. Solcherlei Amüsements sind dort gar nicht üblich, werter Herr.«
Der Fahrer lächelt schelmisch: »Schon klar, Lady, würde ja aus gewissen Gründen schon schwierig.«
»Welche?«, frage ich, jetzt ernsthaft interessiert.
»Keine Jungfrauen da«, bemerkt er knapp und entlockt Katja damit ein Lachen, das im Tonstudio unter »erkältete Elchkuh« archiviert ist. Der Fahrer gibt den röhrenden Hirsch dazu, ich mache auf Bambi, indem ich verwundert aus der Wäsche schaue. Katjas Begeisterung für den ungepflegten Herrenwitz wird mir immer ein Rätsel bleiben.
Der Fahrer blinkt und fährt hinter der Ampel rechts ran.
»So Mädels, vielen Dank für die gute Unterhaltung, sagen wir fünf Euro.«
Er schaut mich herausfordernd an, aber Katja hält ihm schon einen zusammengerollten Zehner entgegen: »Stimmt so«, flötet sie, »die Freude war ganz auf unserer Seite.«
Sie entsteigt dem Fahrzeug wie die junge Grace Kelly, ich muss mich erst aus meinem Gurt winden. Der letzte Blick des Taxifahrers sagt mir: »Was für ein Klasseweib, hast du ein Glück.«
Das weiß ich doch.
Kaum stehe ich auf der Straße, grunzt Katja: »Mein Gott, ist das Raphael?«
Sie deutet in die Richtung, von der aus uns die Lichter unseres Heimathafens entgegenleuchten; ungefähr zwanzig Gestalten stehen vor der Kneipe. Sie schnattern und grölen, lachen und stoßen mit ihren Bieren an, aber aus der ganzen Geräuschkulisse hört man einen tiefen Bass heraus, der verkündet: »Mach dich vom Acker, du Gesichtswurst, aber flott.«
»Natürlich ist er das«, bestätige ich, während wir auf die Stimme zugehen.
»Gesichtswurst ist neu, oder?«, erkundigt sich Katja, und ich muss gestehen: »Jau. Passt aber.«
Wir sind endlich da.
Raphael schwitzt. Sogar stärker als gewöhnlich, sein Haar klebt klitschnass an seinem Kopf, und wenn er statt eines Unterhemdes ein T-Shirt anhätte, würde man jetzt fladenbrotgroße Ringe unter seinen Achseln sehen. Aber sowohl seine Ausdünstungen als auch sein gefährliches Aussehen ist in seinem Job durchaus von Vorteil, zumindest in Momenten wie diesen: »Sagt mal, seid ihr taub oder nur vollkommen bescheuert?«, schreit er ein Rudel Skinheads an, das sich vor seinem Laden versammelt hat. Tatsächlich weichen die Burschen einen Meter zurück und kratzen sich unisono an den kahlen Köpfen. Raphael schnauft: »Aha, also beides. Zum letzten Mal: Das ist nicht der Adlerhorsthier, sondern das »Dead Horst«! Ihr wollt hier gar nicht rein, Jungs, und falls ihr es doch versucht, rufe ich die Bullen!«
Die Glatzen schauen betreten zu Boden, die übrigen Umstehenden senken ebenfalls den Blick, damit man ihre grinsenden Gesichter nicht sieht. Nur Raphael kann sich so eine Show erlauben, ohne dabei lächerlich oder todessehnsüchtig zu wirken. Sein Geheimnis liegt darin, dass er sich tatsächlich so maßlos über dieses Missverständnis aufregt, dass er es durchaus mit sieben Skinheads aufnehmen würde, um seinen Standpunkt klarzumachen. Und es funktioniert. Die Jungs drehen ab, und Raffi spuckt verächtlich auf den Boden. Die kleinen Punkermädchen, die auf dem Stromkasten den Logenplatz eingenommen haben, klatschen Beifall, den großen Sozialarbeiterinnen an der Straßenecke wird ganz warm ums Herz.
Raffi sieht aus wie Robert de Niro in Wie ein wilder Stier und riecht entsprechend. Aber einem Helden wie ihm lässt man das durchgehen.
Raffi seufzt auf, winkt mir zu, aber zeitgleich haben seine Adleraugen auch schon eine zweite Gruppe von Feierwütigen auf der anderen Straßenseite erspäht, denen er die Etikette seiner Kneipe hinüberschreit: »Und ihr, ihr kleinen Tussis, bevor ihr rüberkommt: Es ist auch nicht das »Crazy Horse«, das ist in der Innenstadt. Geht da eure Jugend versauen, aber bleibt mir vom Leibe!«
Die bunte Mädchengang, die sich angetan in lustigen Kostümen an die Kneipe pirschen wollte, bleibt erstarrt stehen. Ihre Anführerin, die ein rosa Tutu über fetten Schenkeln und einen Bauchladen vor sich trägt, keift zurück: »Ey, Alter, mach’ mich nicht an, ich heirate morgen!«
Ihr Hofstaat schnattert wenig damenhaft zu uns herüber, die kleinen Punkermädchen werfen leere Bierflaschen nach dem Junggesellinnenabschied. Ich überlege, was ich zur Deeskalation beitragen könnte, aber Raffi ist schneller: Mit einem Besen bewaffnet stürmt er über die Straße und scheucht die Braut damit bis vor den Altkleidercontainer. Ihr wildes Quieken, zusammen mit dem Tüllrock, unterstützt den Eindruck, dass Raphael eine Sau ums Dorf jagt, und das Publikum beginnt, laut zu johlen.
Raffi schafft es, Miss Piggy mit dem Besen vor dem Container in die Enge zu treiben, wir hören, wie er sie anbrüllt: »So, pass auf: Ich gebe dir jetzt einen Zwanziger, dafür bekomme ich alle Schnäpse aus deinem Bauchladen, und ihr verkrümelt euch in die Innenstadt, okay?«
»Okay«, quiekt die Braut, und ehe sie es sich versieht, bekommt sie von Raffi einen dicken Schmatzer ins Gesicht: »Dann mal herzlichen Glückwunsch, du Schmuckstück«, sagt er, lässt sie frei und wirft den Punkermädels lässig den Besen zu: »Und ihr Zecken macht das jetzt mal sauber, sonst gibt’s Hausverbot!«
So ist er, unser Chef. Binnen Minuten hat er es vollbracht, dass sich ein Dutzend Zwanzigjährige unsterblich in ihn verliebt hat, und sein Laden einem exklusiven Publikum vorbehalten bleibt. Wieder vor der Kneipentür angekommen, öffnet er das erste Schnapsfläschchen mit den Zähnen und knurrt: »Irgendwann benenne ich den Laden um, ich bin zu alt für so was.«
»›Dead Horst‹ bleibt ›Dead Horst‹«, unterbrechen wir seine Überlegungen mit Kampfgebrüll, und Raffi reckt die Faust nach oben, um den Gruß zu vollenden:
»›Und Horst bleibt Dead!‹ Hallo, Doki. Oh, hallo Kaaatjaaa!«
Wenn die Königin aus dem Exil heimkehrt, wird auch der Haushofmeister brünstig. Geübt wirft die Regentin den Kopf in den Nacken, öffnet den Mund, Raffi schüttet den Schnaps hinein. Die Umstehenden lachen. Nicht so laut, wie sie gelacht haben, als Raffi diesen Trick mal mit mir als Partnerin versucht hat. Er musste ziemlich hoch springen, und wir sind beide auf dem Fahrradständer gelandet. Die vielen blauen Flecken waren nicht ganz so schlimm wie der Umstand, dass ich den ganzen Abend nach Raffis Schweiß roch.
»Habt ihr Karten? Ist nämlich ausverkauft«, lässt der Chef uns nun wissen, ein wenig Stolz schwingt in seiner Stimme mit.
»Echt, ausverkauft? Ich kannte die Band gar nicht, sind die famous in Finland, oder was?«, will Katja wissen, wobei sie diesen schlecht gefälschten amerikanischen Akzent aufsetzt, den man ihr wieder ausspülen sollte beizeiten.
»Ja, schon, und wir haben ein paar Karten im Radio verlost«, gibt Raphael kleinlaut zu und stellt fest: »Aber ausverkauft ist ausverkauft.«
»Das ist von der Idee her sehr schön, aber vielleicht sollte man dieses Gedankenkonstrukt noch einmal in Frage stellen«, meldet sich die Sozialarbeiterin zu Wort, zum Glück nur murmelnd, aber mich hat sowieso keiner gehört, weil Marie im selben Moment von der Theke aus brüllt: »Raphael, halte die Frauen nicht auf, ich brauche Gesellschaft hier!«
Wir entschuldigen uns beim Chef und treten ein.
V
Ich wähle meine Freundinnen sehr sorgfältig aus. Viel sorgfältiger als meine Freunde in jedem Fall. Wenn Katja eine Königin ist, ist Marie eine Göttin. Marie schwebt hinter der Theke her, sie ist bezaubernd, schlichtweg elfengleich. Eine herbe Elfe, die immer in schwarzes Leder gehüllt ist und deren Haar vom vielen Hin- und Herschwirren stets verstrubbelt ist. Aber es ist perfekt zerzaust, so als würde eine unsichtbare Stylistin stets hinter ihr herfliegen, und Marie hat den schönsten Mund der Welt.
»Marie sieht aus wie der Sänger von Aerosmith, nur mit noch weniger Titten«, hat einst eine schwer betrunkene Frau behauptet. Und ich wünschte, es wäre nicht Katja gewesen. Das Schlimmste an diesem Kommentar war aber nicht seine Quelle, sondern dessen Wahrheitsgehalt. Marie strahlt, genau wie Steve Tyler, reinen, puren Sex aus. Aber anders als der Rock-Uropa weiß Marie gar nicht, wie unwiderstehlich sie auf beiderlei Geschlechter wirkt. Sie ist tatsächlich der Meinung, dass ihr alle Männer und viele Frauen nur hinterhersabbern, weil sie ihnen Getränke ausschenkt. Ich denke manchmal, dass wir im »Dead Horst« nur aus dem Grunde eine Theke haben, damit Marie ihre Fans auf Abstand halten kann und nicht von ihnen aufgefressen wird.
»Mädels, schön, dass ihr endlich da seid!«, grölt Marie nun, »ich habe mich zu Tode gelangweilt.«
Die acht erwachsenen Männer an der Theke kichern wie eine Ladung Cheerleader, ein baumlanger Kerl mit Armen wie Presslufthämmer schlägt errötend die Augen nieder. »Guten Abend, Stefanie Tyler«, nuschelt Katja leise, ich boxe ihr unsanft in die Rippen. Katja mag Marie prinzipiell schon, aber eben eher auf einem mittelalterlichen Niveau. Als Herrscherin der irdischen Welt zweifelt sie manchmal an der Macht der Göttlichen, und ich stehe mahnend dazwischen, ich alte Gegenpäpstin.
»Doris Kindermann, du siehst bezaubernd aus«, flüstert Marie, als sie ihre Arme um mich schlingt. Der doppelte Presslufthammer fällt vom Hocker, Katja stöckelt höflich über ihn hinweg, um Marie mit ein paar Luftküsschen ihre Aufwartung zu machen.
»Hey, Katja, tolles Make-up,« lächelt Marie meiner besten Freundin zu, und ich ducke mich instinktiv, sehe Katja dabei flehend an: »Bitte, nicht zurückzicken, es ist unser Abend, bitte, bitte, bitte!«
Wenigstens das letzte »Bitte« konnte Katja wohl in meinen Gedanken lesen, denn sie vollführt eine halbe Pirouette und stellt fest: »Mensch, Marie, wo sind denn die ganzen Leute? Raphael meinte, es sei ausverkauft. Wo ist die Band? Und wo ist Toddy?«
Marie stellt uns unsere favorisierten Getränke auf die Deckel, ignoriert geflissentlich die ersten Teile von Katjas Frage und informiert uns trocken: »Unsere Köchin hat gekündigt. Deswegen mussten wir die Band zur Frittenbude schicken, die sollten aber gleich wieder kommen. Und euer Freund Theodore …«, als Marie Toddys echten Namen ausspricht, zwinkert sie mir zu, »… der kommt erst um elf wieder. Angeblich hat er eine spontane Bandprobe, aber wenn ihr mich fragt, hatte der Angst vor euch. Ihr habt Zehnjähriges, richtig?«
Katja und ich nicken wie zwei abgerichtete Dalmatiner. Der gefallene Mann ist derweil wieder vom Boden aufgestanden, er schaut uns an, als hätten wir gerade sein Herz mit äußerst stumpfen Messern herausgeschnitten: »Ey, Mädels, tut mir das nicht an! Die Barfrau ein eiskalter Engel, und ihr zwei – lesbisch?«
»Um Gottes Willen, nein!«, kreischt Katja, und zwar so entsetzt, dass die restliche Barbesetzung dreckig lacht. Es ist erst halb zehn, aber sie geifern wie ein Rudel Schakale, das seit Stunden hungrig an der Wasserstelle gelauert hat. Aber wer will ihnen ihr instinktives Verhalten verdenken, wenn Katja sich auf die Lichtung stellt und ruft: »Hallo, ich bin eine Gazelle, hier bin ich, ich schmecke gut!«