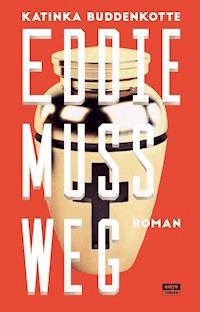11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Der Roman über die "Generation Unentschlossen".
Maike und Matthias, genannt Hummel, sind zwei durchschnittliche Mittdreissiger an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Er arbeitet als Informatiker, sie schwankt zwischen Dissertation und Jobben. Da wäre es doch durchaus an der Zeit, die Reproduktionsphase einzuläuten. Aber die Wochen des Spaßvögelns verstreichen schnell und ergebnislos. Und auch nach Monaten wächst zwar kein neues Leben in Maike heran, dafür jedoch Zweifel und Panik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Ähnliche
KATINKA BUDDENKOTTE
FORTPFLANZUNG NACH TAGESFORM
Roman
Knaus
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. 1. Auflage
Copyright © 2015 beim Albrecht Knaus Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-12326-0V002
www.knaus-verlag.de
1
Wir können immer noch umkehren«, schlägt Hummel vor. So ist er, mein Freund: Hat immer die besten Ideen, leider meist eine Viertelstunde zu spät. Ich schaffe es, die Worte »Unfug, wir sitzen ja schon in der Bahn« hervorzupressen. Hummel nickt zustimmend, obwohl von Sitzen in meinem Fall nicht die Rede sein kann. Ich stehe auch nicht, sonst hätten meine Füße ja Bodenkontakt. Haben sie aber nicht, weil ich aufgrund meines ungewohnten Formates zwischen den Sitzreihen im Mittelgang eingeklemmt bin. Euphemistisch ausgedrückt schwebe ich also in der U-Bahn, und das sieht man offenbar auch nicht alle Tage. Gut, dass mich sämtliche Fahrgäste ununterbrochen anglotzen, ist wohl doch eher meiner Verkleidung geschuldet. Hummel und ich haben die Kostüme in letzter Minute zusammengeschustert, weil wir beide den Termin verpeilt hatten. Wir dachten, die Party mit dem Motto »Verkleide dich als dein Hauptfach« fände nächste Woche am 11.11. statt. Das wäre logisch gewesen, zumindest in dieser Stadt. Dann guckt dich hier keiner blöd an, wenn du als Hobbit, Sensenmann, Lady Gaga oder eben wie ich als Reichstagsgebäude verkleidet bist. Dabei sehe ich in meinen schlampig bepinselten Pappkartons eher aus wie ein Transformer für ganz arme Kinder.
»Ich finde, für die knappe Zeit ist es toll geworden«, will Hummel mich aufmuntern. Er spürt sofort, wenn ich mich unsicher fühle. Andererseits würde auch ein Komapatient bemerken, dass ich in einer mit Gaffern gefüllten U-Bahn nicht in Partystimmung bin. Da hilft es wenig, dass der Typ, der seit mehreren Minuten meine Brust fixiert, nun auch noch die Augen zusammenkneift und seinen Kopf nach vorn reckt. Bevor ich ausflippen oder im Boden versinken kann, rettet mein Freund meine Ehre auf die ihm eigene Weise. Statt dem Lüstling Prügel anzudrohen, klärt er den Fremden auf: »Meine Freundin hat Geschichte und Politologie studiert. Ihr Zweitstudium.«
»Ah ja«, hüstelt der Mann und wendet sich ab. Hummel könnte zumindest auf den ersten Blick als vollkommen normal durchgehen: schlecht sitzende Jeans, schwarzer Rollkragenpullover, randlose Brille. Erst wenn man näher hinschaut, bemerkt man, dass sein grauer Dreitagebart angemalt ist. Aber wenn die Leute hier spitzkriegten, dass ich diese jetzt schon bröckelnde Maske aus Deckweiß und Asche angerührt habe – sie würden uns an der nächsten Haltestelle von der Polizei abführen lassen. Nicht die allerschlechteste Perspektive für die weitere Abendgestaltung, schießt es mir durch den Kopf. Aber ich verscheuche den Gedanken flugs, weil ich weiß, wie Hummel sich auf die Party freut – eben wie ein kleines Kind, das sich als Steve Jobs verkleidet hat.
»Ich glaube, wir haben es den anderen zu einfach gemacht. Ich wette, die erraten alle ganz schnell, dass ich Informatiker bin«, murmelt mein Freund etwas mutlos. Dafür könnte ich ihn küssen, wenn ich es denn könnte. Aber die Kartons sind mir im Weg, und deshalb lächle ich ihn nur an. Abgesehen davon, dass jeder, der Hummel kennt, weiß, dass er Informatiker ist, würde jeder, der ihn nicht kennt, sofort erraten, dass er diesen Beruf ausübt, nicht wegen, sondern trotz seiner Maskerade. Alltags trägt Hummel etwas besser sitzende Jeans, schwarze Kapuzenshirts und oft eine Hornbrille, meist auch einen Dreitagebart, der allerdings eher rötlich braun ist. Er hat sich heute Morgen nur frisch rasiert, weil er bei einem wichtigen Kundengespräch dabei sein musste.
»Vielleicht hätten wir doch die Sache mit dem Toilettenpapier und dem endlosen binären Code darauf durchziehen sollen, das war irgendwie origineller, und vom Aufwand her ja auch nicht so groß …«, plappert Hummel ungewohnt aufgeregt, bis ich unterbreche: »Sei froh, dass wir das nicht gemacht haben. So kannst du dich wenigstens frei bewegen.« Dabei drehe ich meinen Oberkörper, so gut es geht, nach links und rechts, höre daraufhin ein Scheppern, und Hummel ruft: »Vorsicht, Baby, deine Kuppel!«
Er hebt die silberne Salatschüssel vom Boden auf, will sie mir wieder auf den Kopf setzen. Als er vor mir aufsteht und sein Gesicht direkt vor meinem erscheint, bekommen wir einen furchtbaren Lachkrampf. Ich versuche mich zu beruhigen, um mein Kostüm nicht zu zerstören, aber sobald ich Hummel wieder in die Augen sehe, geht es von vorn los. Sein Deckweiß-Asche-Bart ist von Schlieren durchzogen, die die Lachtränen hinterlassen haben, die Brille hängt nur noch an einem Ohr, und er röchelt gackernd: »Hör auf, Maike, hör auf … du bebst!« Daraufhin muss ich nur noch mehr beben, die Seitenflügel an meinen ausgestreckten Armen drohen abzufallen, Hummel kreischt begeistert auf: »Jetzt siehst du aus wie der billigste Katastrophenfilm aller Zeiten!« Er stellt sich auf die Zehenspitzen, beugt sich über mein Atrium und küsst mich. Wir knutschen wie hormongeputschte Teenager. Äußerlich höre ich auf zu beben. Aber innerlich bleibe ich eine Mittdreißigerin, deren Langzeitbeziehung sich nach vielen Jahren in einer leidenschaftlichen Liebesbekundung äußert. Und obwohl ich noch nie darauf stand, in der Öffentlichkeit aggressiv herumzuturteln, kann ich nur denken: Endlich. Endlich mal wieder. Und ganz ohne Alkohol. Wahnsinn. Dabei soll man beim Küssen nicht denken, sondern genießen.
Hummels Zunge verschwindet aus meinem Mund, er fragt leise: »Wollen wir vielleicht doch lieber wieder nach Hause?« Ich schüttle den Kopf. Die Entscheidung pro Party ist doch schon längst gefallen. Wir beide ziehen unsere gemeinsamen Pläne durch, auch wenn wir sie erst am späten Nachmittag gefasst haben und sie zudem beinhalten, dass ich stundenlang als Regierungssitz herumlaufen muss. Hummel küsst mich noch einmal: »Das wird bestimmt lustig. Und wenn ich es mir richtig überlege, ist es ja auch eher so gedacht, dass die anderen möglichst schnell erraten sollen, was man darstellt, sonst würden die Leute ja absichtlich blöde Kostüme anziehen, und …« Ich schiele angespannt gen U-Bahn-Decke, das geht noch ganz gut in meinem Kartonagengefängnis. Hummel würde das nie zugeben, aber er ist ein ehrgeiziger Typ, wenn es um Spiel und Spaß geht. Beruflich eher nicht so. Aber jetzt ist Feierabend, und er strahlt: »Ich habe auch noch eine Überraschung für dich!« Hummel sieht nicht mehr im Entferntesten aus wie der Gründer von Apple. Eher wie ein etwas aus dem Leim gegangener Ewan McGregor, der aus unerfindlichen Gründen sein Gesicht in Taubenkacke gewälzt hat. Muss man mögen, und das tue ich. Aber vielleicht sollte ich ihm den Bartschatten renovieren, bevor wir den Ballsaal stürmen. Künstlerparty hin oder her, die Leute sollen nicht denken, ich hätte meinen Freund mit Vogelexkrementen dekoriert. »Wir müssen an der nächsten Haltestelle raus«, reißt Hummel mich aus meinen Gedanken, »willst du dich schon mal, äh, auf den Weg zur Tür machen?«
Will ich schon, klappt nur nicht.
»Kannst du das vielleicht übernehmen?« Ich hebe die Arme, so weit es geht, nach oben. Mein Held umfasst meinen Mitteltrakt und bugsiert mich durch die Bahn. Die Leute glotzen, schon wieder, oder vielleicht haben sie nie damit aufgehört. Aber es macht mir nichts mehr aus. Ich bin in Feierlaune, fühle mich umsorgt und sexy, obwohl ich in einer Ladung Altpapier gefangen bin und eine Salatschüssel auf dem Kopf trage. Ich vermute es oft, aber in diesem Augenblick bin ich mir sicher: Das ist Liebe.
***
Ehrlich gesagt: Ich fühle mich schon ein wenig gebauchpinselt, dass Verena uns zu dieser Feier an der Fachhochschule für Design eingeladen hat. Die Party ist eigentlich nur für die Dozenten, also Verenas Kollegen, und die Abschlussklasse dieses Jahrgangs gedacht. Eine Feier als Generalprobe für die Werkschau sozusagen. Und um für die Studenten den Druck aus der Veranstaltung zu nehmen, haben sie eben beschlossen, das Ganze als Kostümparty aufzuziehen, denn, so Verena: »Zwischen Halloween und Spießerkarneval, da haben doch alle Beteiligten ein Kostüm griffbereit, und da haben wir gedacht, diesem Wiederverwertungswahn mal mit einem Augenzwinkern zu begegnen.«
Genau so redet meine ehemalige Klassenkameradin, und deshalb habe ich wohl auch eher auf dieses beeindruckende Satzkonstrukt geachtet als auf den darin versteckten Termin. Bei Verena war immer klar, dass sie sich für eine Künstlerlaufbahn entscheiden würde, und jetzt ist sie eine der jüngsten Professorinnen landesweit.
»Tja, wer’s selbst nicht schafft, zeigt den anderen, wie’s gehen soll«, bemerkte Hummel grinsend, als ich ihm von der Einladung berichtete. Dabei ist er wirklich kein Zyniker. Er hat nur etwas gegen unbegründete Ehrfurcht. Einmal sagte er den schönen Satz: »Maike, alle kochen nur mit Wasser. Und die, die es nicht tun, frittieren eben alles und sterben jämmerlich an Herzkranzverfettung.«
Hummel ist gut darin, mich aufzubauen. Noch besser ist er allerdings darin, mich in letzter Sekunde in Panik zu versetzen. Wir sind jetzt nur noch eine Straßenecke von der Fachhochschule entfernt, und er überlegt laut: »Ist schon ein merkwürdiges Motto: Verkleide dich als dein Hauptfach, oder?«
Ja, fand ich auch, und wir haben das auch schon besprochen, also werde ich schnippisch:
»Tja, Künstler. So sind sie eben.«
»Eben«, wiederholt Hummel trocken.
Ich bleibe stehen, um den Groschen auch noch fallen hören zu können.
»Scheiße. Die haben ja alle Kunst studiert. Obwohl: Vielleicht sind dann einige so als Bildhauer verkleidet, andere als … Aktionskünstler?«
Meine Argumentation ist so schwach wie meine Beine.
»Das ergibt keinen Sinn, Maike. Die kennen sich doch alle gegenseitig, die wissen doch, wer was macht beziehungsweise gemacht hat, wenn wir mal von den Dozenten ausgehen.«
Ich erwähnte Hummels Timing-Problem? Nun, unter dem leide ich auch.
»Maike, ey, jetzt raste nicht aus. Nicht heulen, bitte. Und fummle nicht an deinem Kostüm rum! Wir gehen jetzt da rein. Du hast dich so darauf gefreut. Hey, du hast mich so weit gebracht, dass ich mich drauf freue.«
Ich schniefe, noch nicht völlig überzeugt.
Hummel gurrt: »Überleg doch mal, heute sind wir die Exoten. Auf einer Künstlerparty. Das soll uns mal einer nachmachen.«
Stimmt. Damit hat er mich überzeugt. Was soll schon passieren? Abgesehen von Verena kennt mich dort ja niemand. Zusätzlich bin ich verdammt gut getarnt. Hummel nimmt meine Hand, wir setzen uns wieder in Bewegung, auf die heiligen Hallen zu.
»Außerdem bin ich gespannt, wie das echte Motto lautet«, murmelt Hummel, und je näher wir dem Eingangsportal kommen, desto sicherer bin ich, es erraten zu haben. Das Treppengeländer ist mit Filmspulen dekoriert, an die Seitenwände werden Filmausschnitte projiziert, von jenseits der Schwingtür vernehme ich das Titelthema aus James Bond. Allerdings auf der Blockflöte gespielt. Künstler eben.
»Irgendwas mit Kino vielleicht?«, löse ich auf.
Hummel grinst: »Gut mitgedacht, Watson. Bleibt nur noch das andere große Rätsel, nämlich wie du das Thema ›Irgendwas mit Kino‹ mit ›Verkleide dich als dein Studium‹ verwechseln konntest.«
Ich weiß es nicht, fürchte aber, es lag wieder an Verenas Ausdrucksweise und Satzbau. Wenn ich jetzt über ihren Anruf heute Nachmittag nachdenke, hat sie vielleicht etwas gesagt wie: »Wegen heute Abend, Maike … blablabla … Die Überlegung ist die, das Ganze mit Kritik an Kultur und Massenmedien zu verbinden … blabla … doch, heute Abend, das hatte ich doch gesagt, jedenfalls … jeder soll sich als Hauptakteur aus einem Film, der einen während des Studiums begeistert hat, kostümieren, … gleichzeitig eine Klanginstallation … Persiflage … blabla … Mainstream … Relevanz … blabla, also, bis später, um neun geht’s los, ich freue mich.«
Ja, so wäre ein Schuh draus geworden. Bei mir vielleicht der Schuh des Manitu. Ich patsche mir mit der flachen Hand auf die Stirn, was dazu führt, dass meine Kuppel wieder ins Wanken gerät.
»Kann ich die wenigstens abnehmen?«, frage ich Hummel. Der ist absolut dagegen: »Ganz oder gar nicht, Schatz. Oh, da fällt mir ein: Die Überraschung!« Hummel zaubert zwei Zahnstocher aus seiner Tasche, an deren Ende Miniatur-Deutschlandflaggen kleben. Er befestigt sie an meinen Schultern und befindet: »Perfekt.«
Ein Rudel Gäste schiebt sich an uns vorbei zur Eingangstür hin, ein auf mittelalt getrimmter John Travolta deutet auf mich und flüstert seiner Begleitung, einer magersüchtigen Giraffe mit schwarzem Pagenschnitt, etwas ins Ohr, sie lacht so exaltiert, dass in mir spontan der Wunsch wächst, ihr eine Adrenalinspritze in ihr Herz zu rammen. Ja, mein Leben ist auch manchmal wie Pulp Fiction: Eine Kette von Missverständnissen und coolen Sprüchen zur falschen Zeit bringt auch ganz sanfte Gemüter dazu, ihre Gewaltfantasien endlich auszuleben.
»Künstler eben«, sagt Hummel, formt Daumen und Zeigefinger zu einer Pistole und drückt zweimal mit dem Mittelfinger ab.
»Ach, es sind bloß Designer«, gebe ich zurück und umgreife die Hand meines Freundes fester, wild entschlossen, mich auf einer Party zu amüsieren, deren Gäste ich nie wiedersehen werde.
Betonung auf »wild«.
***
Der Weg zum Festsaal im obersten Stock ist mit Ausstellungsstücken geschmückt, größtenteils absurd große Bildschirme, auf denen es schwarz-weiß flackert. Aber auch der eine oder andere Ausbrecher macht mich ratlos, so wie der Kunstrasen, der den kompletten Gang im zweiten Stock belegt und auf dessen Mitte ein einsames Gänseblümchen steht. Im dritten Stock erneut die beliebten Bildschirme, auf einem ist das Gänseblümchen wieder zu sehen, darunter ist ein Wort zu lesen: »WHY?« Das frage ich mich auch. Hummel hingegen weiß die Antwort schon: »Das machen also die Leute, die behaupten, sie wollen irgendwas mit Medien machen. Sie machen irgendwas mit Medien. Cool.«
Die doppelflügelige Tür zum großen Werkraum/Festsaal ist etwa so hoch und breit wie unser Haus. Und sie ist geschlossen. Trotzdem scheint sie der einzige Eingang zum Ort des Geschehens zu sein. Nicht die geringste Chance, dass wir uns unauffällig hineinmogeln können. Natürlich quietscht die Pforte zur Hölle auch noch erbärmlich, als Hummel die Klinke herunterdrückt. »Wenn der Hausmeister verhindert ist, sollte sich vielleicht mal jemand vom Produktdesign darum kümmern«, ist mein letzter Gedanke, bevor ich mir ein Lächeln ins Gesicht tackere, das auf die anwesende Gesellschaft sympathisch bis ironisch wirken soll. Nur ist da gar keine Gesellschaft im volkstümlichen Sinne. Nicht mal ein paar verstreute Gäste, nur vier missmutig dreinblickende Mädchen hinter der Bar, die entweder alle denselben Friseur besuchen oder ebenfalls von Pulp Fiction inspiriert wurden. »Hallo«, grüßt Hummel und winkt den Mia-Wallace-Klonen, von denen keine halb so überzeugend aussieht wie das Modell, das sich über mein Kostüm erheitert hat. Die Damen winken nicht zurück, mein Freund zieht mich trotzdem zum improvisierten Tresen hin und fragt: »Was trinkt man denn hier?« Die direkt Angesprochene kann offenbar nicht antworten, bevor sie nicht mit einem Zug ihre halbe Kippe weggezogen hat. Sie bläst uns sehr gekonnt den Rauch ins Gesicht: »Das kommt drauf an. Ohne Einladung – gar nichts.«
Bevor es richtig peinlich wird, will ich aufklären: »Also, äh, wir sind von einer Freundin eingeladen worden, Frau Doktor … Professor Stein …«
Da gibt Hummel ein Lachen von sich, von dem ich nie geahnt hätte, dass es in ihm steckt. Er klopft der kleinen Möchtegerngangsterbraut jovial auf die Schulter und dröhnt: »Na, da führt die Kollegin Steinhoff ja ein hartes Regiment hier. Achtet sehr darauf, dass sich keiner reinschleicht, was? Immer an die Kosten denken, sauber, sauber. Na, junges Fräulein, da wir die Einladung tatsächlich auf der anderen Rheinseite haben liegen lassen, können meine Gattin und ich wohl nur wieder durstig nach Hause fahren, aber wenn ich die Geschichte dem Kollegium in Düsseldorf erzähle: köstlich!«
Die Barkeeperin sieht jetzt aus, als hätte sie tatsächlich die falschen Drogen konsumiert. Sie wird bleich, dann rot, schließlich presst sie hervor: »Professor Süderkamp, das ist mir …« Tja, offenbar so peinlich, dass sie nicht weitersprechen kann. Aber diese Pause gibt mir Gelegenheit, eine weitere Eigenschaft meines Freundes zu bewundern: Hummel lügt nie. Nicht, weil er Skrupel hat, sondern weil es ihm viel zu viel Spaß macht, die Wahrheit so weit zu dehnen, wie er kann.
Statt also der Studentin »Ja, Süderkamp! Wer denn sonst?« entgegenzublaffen, tätschelt er ihre Hand und zwinkert: »Matthias, bitte. Wir sind, oder werden, doch alle Kollegen, oder? Und das ist hier doch eine Fete, nicht?«
Hummel heißt tatsächlich Matthias mit Vornamen, genau wie der berühmte Leiter einer noch berühmteren Kunstakademie einer hier sehr berüchtigten Stadt. Der Mann ist bestimmt dreißig Jahre älter als mein Freund und sieht ihm nicht im Mindesten ähnlich. Aber Klein-Mia hinter ihrer Bar ist überzeugt, dass es jetzt nur noch einen Weg gibt, wie sie ihre Karriere retten kann. Sie greift sich die Schampusflasche, die schlecht versteckt hinter einer Batterie Billigprosecco im Kühlschrank steht, entkorkt sie zitternd und schenkt uns ein.
Aber Hummel ist noch nicht fertig mit ihr: »Ach ja, Plastik-Sektflöten, das nenne ich ›Nachhaltigkeit mit Augenzwinkern‹, was?«
Das Mädchen ist fix und fertig. »Entschuldigen Sie bitte«, piepst das arme Ding und sucht den Blick ihrer Kolleginnen, die am anderen Ende des Raumes tuscheln.
Aber bevor Hummel sein Spiel noch weitertreiben kann, kommt plötzlich Leben in die Bude, ein ganzer Tross von Menschen, darunter viele weitere Uma Thurmans (eine von ihnen wenigstens im gelben Kunstleder-Einteiler, Marke Kill Bill) strömt in die Halle. Anhand der Wortfetzen kann ich erschließen, dass sie unter Verenas Leitung wohl einen kommentierten Rundgang durch die Ausstellung genossen haben, denn sie haben das Gänseblümchen interpretiert: »Eine geniale Persiflage auf das Soldatenmotiv, wenn du mich fragst«, sagt ein Captain James Sparrow zu einer frühen Rita Hayworth, die das Objekt allerdings anders verstanden haben will: »Oh, ich dachte, das sollte die Einsamkeit von zeitloser Schönheit an sich symbolisieren.« Vielleicht ist sie nicht Rita Hayworth, sondern doch eher Jessica Rabbit, wer weiß. Verena hat sich verkleidungsmäßig jedenfalls für zeitlose Schönheit entschieden: Perfekt gestylt als Romy Schneider, stakst sie auf Hummel und mich zu. Sogar dieses traurige Lächeln gelingt ihr zum Niederknien, aber das hat sie ewig geübt. Wie gesagt, schon in der sechsten Klasse wussten wir alle: Aus Verena wird mal eine ganz Große, muss ja, so wie die aussieht.
»Schau, die Sissi«, murmelt Hummel, er weiß, dass ich ihm nicht in die Seite boxen kann, weil sonst mein Seitenflügel abfällt, aber er zuckt trotzdem automatisch weg. Nach über sieben Jahren Beziehung spürt der Partner eben auch ein Phantomknuffen.
»Du siehst ja wahnsinnig aus«, kommentiert Dr. Verena Steinhoff mein Outfit. An dieser Stelle schließt sich jetzt normalerweise das Bussi links und rechts an, aber Verena findet keinen Zugang zu meiner Wange. Also hält Hummel brav den Kopf hin, Verena luftküsst ihn dankbar und quiekt dabei schön laut: »Mein Gott, Matthias, ewig nicht gesehen.«
Im Hintergrund zerschellen ein paar Gläser am Boden. Ich möchte wetten, dass die von der kleinen Fetten fallen gelassen wurden. Macht nichts, ich trinke auch gern aus dem Plastikkelch weiter, den Hummel mir netterweise so unters Kinn gesteckt hat, dass ich die Flüssigkeit rausschlürfen kann. Verena bemerkt gar nicht, dass ich meine Hand wegen der Kartons nicht zum Mund führen kann, sie ist so überdreht, die braucht gar nichts mehr zu trinken. Hummel fragt das Naheliegende: »Und, Verena, bist du Die Spaziergängerin von Sans-Souci oder ein Drittel des Trio Infernale?«
Ich weiß nicht, wie mein Kerl dieses ganze unnütze Wissen speichern kann, aber regelmäßig vergisst, den Müll mit runterzunehmen. Verena blickt Hummel bewundernd an und gibt romylächelnd zu: »Ach, da war ich unentschlossen, es war mehr so das gesamte Schaffen von Ruffio, der hat ja neue Maßstäbe … blablabla … die ganze Ästhetik damals umgekrempelt … blablala … nicht nur cineastisch.«
Verena hat aufgehört zu lächeln. Und zu sprechen. Das merke ich vor allem daran, dass Hummel mir in den Hintern gekniffen hat. Sein Geheimzeichen dafür, dass ich damit aufhören sollte, so zu nicken, als würde ich interessiert zuhören. Schlimmer noch, ich soll auf Verenas Frage antworten, die ich nicht mitbekommen habe: »Ja, was denkst du denn?«, sage ich also, denn mit diesem Trick geht man zu neunzig Prozent sicher, dass das Gegenüber die Frage wiederholt. In diesem Fall bin ich mir sogar zu neunundneunzig Prozent sicher, exzellent reagiert zu haben, denn wahrscheinlich hat Verena doch gefragt, was ich darstelle. Hummel schluckt sein Grinsen mit einem Schluck Champagner herunter.
Verena schaut mich verdattert an und spricht zum ersten Mal seit Jahren nicht dozierend: »Äh, ja, also, ich meine … man selbst kann das nie so einschätzen, oder? Also, früher, vielleicht …« Verena ist verwirrter als ich. Auf ihrer eigenen Party. Das soll nicht sein, ich muss ihr helfen: »Also, ich kann das schon noch einschätzen. Ich bin der Reichstag.«
Hummel prustet »Entschuldigt mich« und rennt Richtung Flügeltür. Fast will ich ihm nachrufen »Darf man mitlachen?«, aber da fällt mir ein, dass ich mich ja in einem Gespräch befinde, das höchstwahrscheinlich noch nicht beendet war.
Verena ist immer noch verunsichert: »Entschuldige, aber wer hat den Film denn gemacht? Den kenne ich gar nicht. Von wann ist denn Der Reichstag?«
»Oh, von 1884, Paul Wallot«, flöte ich, was für mich ganz untypisch ist. Ich pflege mein Wissen nicht herauszuflöten, aber Verena nimmt es mir nicht krumm. Sie lacht schon wieder: »Ach, Maike, ich vergesse das immer, dass du ja auch mal Architektur studiert hast. Oder studieren wolltest?« Da hat es sich auch schon ausgeflötet meinerseits.
»Habe«, grummle ich, »aber nur ein Semester. Dann habe ich auf Biologie umgesattelt, aber jetzt gerade meinen Master in Politologie und Neuer Geschichte fertig.« Ich beiße mir auf die Zunge, um nicht »Mit Auszeichnung, beides« hinzuzufügen.
Der junge Woody Allen kommt auf uns zugeschossen und springt Verena ins Gesicht: »Professor Steinhoff, Professor Steinhoff, jemand hat meine Blume gepflückt!« Und Verena schaut ganz ernst, nimmt ihren Schützling an der Hand und sagt noch: »Ganz ruhig, Bijan, nicht sofort von Sabotage ausgehen. Vielleicht ist sie ja nur weggeweht«, bevor sie mit Blümchen-Bijan und einem Pulk Sensationslüsterner von dannen eilt. Ich muss sagen: Nach einem Glas Champagner sind so Designerpartys echt der Brüller, allein die Gespräche, zum Piepen.
Alles wäre perfekt, wenn Hummel nicht abgehauen wäre. Zum Glück wird mir ein Tablett vor die Nase gehalten, die pummelige Kellnerin deutet sogar so etwas wie eine Verbeugung an und fragt: »Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?«
Wie gerne würde ich jetzt Hummels Scharade ohne ihn weiterspielen und so gespreizt, wie ich es der Ehefrau von Professor Matthias Süderkamp zutrauen würde, entgegnen: »Ach, Kindchen, rein theoretisch schon, aber ich fürchte, es liegt nicht in Ihrer Macht, jetzt und hier dem Nikotingenuss abzuschwören, also vergiften Sie Ihren Körper nur weiter, ich war ja in Ihrem Alter nicht anders. Außerdem würde ein Strohhalm, der etwa Ihre Größe hat, mir helfen, ein weiteres Glas Puffbrause zu mir zu nehmen.«
Aber ich bin da einfach anders gestrickt als Hummel, beziehungsweise aktuell anders geklebt, also sage ich nur: »Wo ist denn die nächste Toilette? Ich müsste mich mal kernsanieren.«
Die Augen der Aushilfskellnerin weiten sich, jetzt bricht sie zusammen. Na, fast, und das auch nur vor Lachen: »Kernsanieren, hihi, also, Frau Süderkamp, Sie sind ja ziemlich … darf ich sagen: krass drauf?«
Mein belämmerter Gesichtsausdruck genügt ihr als Erlaubnis, mich »krass drauf« zu nennen. Sie deutet mit ihrer Kippe Richtung Tür und sagt: »Links rum, den Gang lang. Kernsanieren, haha!« Ist doch immer schön, wenn man bei einem jungen Menschen wider Erwarten doch noch Sympathien wecken kann. Steifbeinig mache ich mich auf den Weg, und eines muss ich meiner Verkleidung lassen: Sie eignet sich dazu, eine Bresche durch das Partyvolk zu schlagen. Allein die schwere Flügeltür lässt sich nicht durch einen entschlossenen Blick öffnen, und an die Klinke komme ich mit meinen verkürzten Armen nicht dran.
»Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«, fragt eine Männerstimme. Alle so hilfsbereit hier, wir sind offenbar gar nicht bei den Designern, sondern bei den Samaritern gelandet.
»Wenn Sie eine Hand frei haben, wären Sie der Richtige für den Auftrag.«
Ein Lachen ertönt neben meiner Hüfte: »Ha, ja, eine Hand hätte ich zufällig dabei«, sagt der Mann, zu dem ich nun runterschiele. Er ist um die fünfzig, trägt drei Kinne unterm Gesicht, ist aber ansonsten für die Jahreszeit ziemlich luftig angezogen. Obenrum schmückt ihn eine Girlande aus Barbie-Puppen, die allesamt so nackend wie sein Oberkörper sind. Damit seine riesige Windel, gefertigt aus dem Sternenbanner, besser zur Geltung kommt, hat er ebenfalls auf zusätzliches Beinkleid verzichtet. Seine extrem dünnen Oberschenkel sagen mir, dass der Rollstuhl kein Teil der Kostümierung ist. Aber eine Hand hat er tatsächlich frei. In der anderen schwingt er eine Wodkaflasche.
»Sie könnten die Klinke runterdrücken«, stelle ich fest.
Und der Mann ist nicht nur so nett, dies umgehend zu tun, sondern bietet mir auch Gelegenheit, mich zu revanchieren: »Wenn Sie jetzt so reizend wären, sich gegen die Tür zu lehnen, könnte ich auch nach draußen rollen.« Zwei Behinderte schaffen es gemeinsam durch die Tür, während die körperlich Intakten im Halbkreis um sie herumstehen, wie herzergreifend. Der Mann im Rollstuhl spricht aus, was ich denke: »Hey, das wäre doch mal ein realistischer Werbespot für die Fernsehlotterie gewesen, oder?«
Er zwinkert mir zu. Dabei entstehen in seinem Augenwinkel so tiefe Falten, dass ich davon ausgehen kann, dass Zwinkern ein großes Hobby von ihm ist. Ziemlich sexy für einen alten Sack in Windeln. Das denke ich nicht wirklich, sage ich mir, das ist nur der Champagner. Trotzdem sollte ich dieses neckische Zwinkern mit einem harmlosen Gesprächsstoff unterbinden: »Auch auf dem Weg zum Klo?«, frage ich also.
Der Mann schaut gespielt erschrocken zu mir auf: »Na, Sie gehen aber ran, junge Frau! Ich wollte bloß eine rauchen.«
Mein Kopf glüht, ich fürchte, dass meine Kuppel an den Ohren anschmilzt. Körperfunktionen sind kein gutes Small-Talk-Thema, das sollte ich mir endlich mal merken. Stattdessen immer gut bei Partys: über das Motto plaudern: »Sie sind Larry Flynt, der Hustler-Verleger«, kombiniere ich. Der Mann nickt und seufzt leise, genau wie ich, wenn jemand das Offensichtliche ausspricht. Diese unerwartete Gemeinsamkeit lässt mich mutiger werden: »Also, in der Verkleidung erwartet man doch, dass Sie im Saal rauchen, oder? Am besten kubanische Zigarren.«
Der Windelmann greift meine Hand, drückt sie fest und jauchzt: »Wenn ich etwas an einer Dame schätze, dann einen scharfen Blick, Hingabe und Konsequenz. Ich kann also davon ausgehen, dass Sie nichts mit diesem Institut zu tun haben?«
Wir grinsen uns an, das Klebeband-Scharnier, welches den Ostflügel mit dem Mittelschiff verbindet, reißt. »Ich muss jetzt aber wirklich«, sage ich.
Larry Flynt zieht den Mundwinkel hoch und bestimmt: »Ich komme mit! Wir können ja so tun, als würden wir auf der Toilette Crack rauchen, um meinen Ruf wiederherzustellen, Frau Reichstagsgebäude.«
Das Angebot kann ich nicht ablehnen, schon weil es auch an der Toilettentür eine Klinke gibt. Nach bewährtem Konzept überwinden der Pornokönig und ich auch dieses Hindernis. Im Inneren des Waschraums angekommen, schaffe ich es, das gestreckte Bein auf das Waschbecken zu wuchten, ziehe so mit einem kleinen Rückwärtshüpfer meinen linken Schuh aus, greife mit den bestrumpften Zehen nach dem Tesafilm-Zipfel an meinem Rücken, und ziehe, bis der Ostflügel zu Boden fällt.
Larry Flynt pfeift anerkennend. »Berufsstripperin?«, fragt er.
»Ich hatte mir mal gleichzeitig beide Ellenbogen gebrochen, vor zehn Jahren«, vertraue ich ihm an.
»Oh, das ist lästig. Mir ist so ein Malheur mit meiner Wirbelsäule passiert, heilt aber seit zwanzig Jahren nicht ».
Er lacht. Ich schaffe es nicht, mir auch nur ein gequältes Grinsen abzuringen. Ist einfach nicht mein Humor.
»Ist nicht Ihr Humor, was? Meiner normalerweise auch nicht. Ich dachte nur, ich labere mal ein bisschen blöd daher, damit Sie sich nicht zu bescheuert vorkommen.«
Verstehe ich, jetzt wo mein Blick den Spiegel trifft. Nicht nur, dass ich unter mein Kostüm mein ältestes, labbrigstes T-Shirt angezogen habe, auf dem man jetzt deutlich die Achselchweißflecken sieht, nein, meine Arme sind auch noch über und über mit »Prinzessin-Lily-Fee«-Klebe-Tatoos versehen, den Überresten des gestrigen Kindergeburtstags. Außerdem will ich wirklich nicht wissen, wie lange mein Hosenstall schon offen stand. Larry Flynt kichert: »Also, unter diesen Umständen: Ich bin der Claus, mit C. Und du?«
»Maike«, gebe ich meine Identität preis, »mit a-i.«
Ich überlege, ob es möglich ist, durch das Toilettenfenster abzuhauen, aber da passe ich so nicht durch. Schon will ich mich komplett abreißen und flüchten, aber Claus ruft: »Halt, das kriegen wir wieder hin!«
Kriegen wir? Vielleicht unter seiner Anleitung: »Also, erst mal würde ich die Hose …« Gute Idee.
»Maike, du hast Glück, du bist zwar mit einem gottlosen Pornoverleger hier, aber an eine Sache glaube ich doch: Gaffa-Tape!«
Aus der an der Rückenlehne seines Rollstuhls befestigten Tasche holt er das silberne Zauberband hervor. Mit ein paar geübten Griffen zurrt er Streifen von der Rolle, bastelt flugs ein neues, haltbar aussehendes Scharnier, und gemeinsam versuchen wir, das Seitenschiff wieder an seinen Bestimmungsort anzubringen. Claus’ Hand reicht nicht bis zu meinen Schultern, und wenn ich mich bücke, falle ich vorneüber und lande mit dem Gesicht in seinem Schritt. Aufstehen ist leichter gesagt als getan, denn Claus und ich haben unsere Hälse in die Barbie-Girlande verheddert. Wäre schon peinlich, wenn jetzt irgendjemand hier reinkäme.
Glücklicherweise ist es nicht irgendjemand, der da die Tür aufreißt, sondern Hummel: »Das nenne ich wahre Kunst«, höre ich ihn seufzen, und als er sich zu mir runterbückt, ist da kein Zeichen von Argwohn, unbegründeter Eifersucht oder auch nur Erstaunen in seinem Gesicht zu erkennen. Er könnte trotzdem aufhören zu grinsen.
»Es ist nicht das, wonach es aussieht«, röchelt Claus in meinem Nacken, Hummel patscht ihm auf die Schulter: »Da enttäuschen Sie mich aber, Mister Flynt. Soll ich euch entknoten?«
Sekunden später sind wir befreit, ich stehe auf den Füßen, Claus schnappatmet, und Hummel hat immer noch nicht aufgehört zu grinsen: »Deine Säulen stehen schief, Süße«, informiert er mich, und Claus meint: »Machen wir gleich, erst mal machen wir die Flügel wieder dran. Hier ist das Gaffa, junger Mann, zeig mal, ob du mehr draufhast als nur den aufrechten Gang.«
Hummel rollt mit den Augen, aber unter Claus’ Regie verklebt er meinen Arm neu, während der meine Säulen richtet. So sähe wahrscheinlich ein flotter Dreier für alternative Heimwerk-Fetischisten aus, aber ich kann dem nichts Erotisches abgewinnen, wenn zwei Kerle an mir rumfummeln und dabei Dinge sagen wie »Welcher Penner hat das denn konstruiert?« und »Verdammt, halt doch mal still, Baby«.
Höchste Zeit, mal wieder etwas Unverfängliches zu sagen: »Äh, Hummel, das ist Claus, Claus, das ist mein Freund, Matthias.«
»Schön«, sagen beide, ich gebe auf, hier etwas zur Unterhaltung beitragen zu wollen, und lasse mich weiter renovieren. Als die Herren fertig sind, betrachten sie mich so kritisch, dass es selbst die Seele eines Gebäudes kränken würde. »Für den Rest des Abends wird es schon halten, oder?« Ich nicke, ohne dass die Kuppel fällt. Hummel hat sie mir an den Ohren festgeklebt.
»Bei ihr wird’s gehen«, gibt Claus zu, »aber jetzt muss ich tatsächlich mal – dringend.«
Er schaut Hummel auffordernd an, also ist der am Zug, das neue, inoffizielle Motto der Party auszusprechen: »Kann ich helfen?«
Claus stöhnt ungeduldig: »Gern. Du weißt ja bestimmt, wie es geht, oder? Wie du aussiehst, hast du ja nicht gedient, sondern bist Zivi gewesen, richtig?«
Keine von den Kabinen ist mit dem Rollstuhl-Symbol gekennzeichnet. »Junger Mann, da kommen wir nicht durch. Wir werden bei offener Tür operieren müssen.« Hummel geht in die Knie und hebt Claus aus seinem Gefährt, mühelos, wie ich nicht ohne Stolz feststelle, Claus jault dazu: »And I will always love youuuuu…«
»Schnauze«, brummt Hummel genervt. »Maike, stell dich mal in den Flur, damit keiner reinkommt. Schaffst du das?«
Dank verbesserter Scharniere kann ich die Klinke selbst drücken. Niemand zu sehen im Treppenhaus, offenbar hat der Suchtrupp rund um Verena es aufgegeben, nach dem Gänseblümchen zu fahnden. Ich kann nur vermuten, dass die Designer-Partygäste sich hinter der Flügeltür nun wie ganz normale Partygäste benehmen und zu der schlimmen Musik, deren Bässe durchs Gemäuer wummern, noch schlimmer tanzen. Es ist zugig hier im Treppenhaus, und draußen herrschen bestimmt Minusgrade, aber weil ich jetzt viel besser abgedichtet bin, friere ich nicht in meinen Kartons. Vielmehr wird mir ganz warm ums Herz, als ich die Klospülung höre: Mein Freund hat es geschafft. Er ist so unheimlich cool. Na ja, meistens ist er eher heimlich cool, so wie Batman, nur dass er tagsüber kein trübsinniger Milliardär ist, sondern ein Nerd mit überraschend trainiertem Bizeps. Also ist er doch eher wie Superman …
Von der anderen Seite der Wand höre ich Hummel fluchen, Claus ruft: »Junge, pass auf, willst du mich umbringen?« Hummel raunzt zurück: »Vielleicht.«
Ich denke, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Die Tür öffnet sich, Claus strahlt so zufrieden, wie es nur jemand vermag, der gerade frisch gewickelt wurde. Hummel hingegen sieht aus wie jemand, der gerade einem Elefanten Thrombosestrümpfe angezogen hat: verschwitzt, ramponiert, aber auch ein kleines bisschen stolz darauf, dass es bei der Mission keine Toten gab. »Was gibt es da zu grinsen?«, fragen mich beide.
Ich kann jetzt schlecht sagen, dass ich meinen Freund für meinen privaten Superhelden halte, das käme etwas kitschig rüber. Daher warte ich mit einer anderen, höchst erfreulichen Information auf: »Ich glaube, ich muss die halbe Ecstasy gar nicht mehr nehmen.«
Claus mustert mich kurz und diagnostiziert: »Ne, glaube ich auch nicht.«
Aber Hummel ist begeistert: »Prima, dann streichen wir das. Meinst du, wir können Jenny das Zeug zurückgeben? Ist ja noch originalverpackt.«
»Ihr seid schräg. Ich mag euch«, gesteht Claus, ich gehe nicht darauf ein, weil ich Wichtigeres mit meinem Partner zu klären habe: »Ne, lass uns die Pille mal behalten, vielleicht brauchen wir die ja noch. Wenn wir Weihnachten meine Eltern besuchen, wahrscheinlich.«
Claus meldet sich erneut zu Wort: »Ich muss mich korrigieren, Leute: Ich liebe euch.«
Aber den Zahn zieht Hummel ihm schnell wieder, indem er anmerkt: »Ne, Maike, das können wir nicht bringen. Warum sollten wir auch?«
»Buh, Spielverderber, Angsthase!«, krakeelt Claus und wirft seinen Oberkörper mit solchem Schwung in die Lehne, dass die Reifen seines Rollstuhls die Bodenhaftung verlieren. Hummel und ich schauen strafend auf ihn herab. Funktioniert großartig, Claus mault: »Oh, bitte nicht dieser Blick! Ihr habt bestimmt Kinder, oder?«
»Noch nicht«, sagen wir beide gleichzeitig und lächeln uns an. Auch Claus ringt sich eine Grimasse ab: »Oh, na dann, Glückwunsch. Wann ist es denn so weit?«
»Hoffentlich bald«, verraten wir abermals mit einer Stimme. Wenn ich nicht in Kartons verpackt wäre, würde Hummel mir wahrscheinlich seinen Arm um die Taille legen, und wir würden uns einen neckischen kleinen Kuss geben, um das soeben amtlich geplante Wunder zu besiegeln.
Claus lässt sich nicht so richtig von unserer Stimmung anstecken: »Äh, ja, entschuldigt mich, bitte, aber ich glaube, ich muss kotzen.«
Mit dramatischem Schwung wendet er seinen Rollstuhl, winkt royal und steuert auf den Fahrstuhl zu. Hummel sieht ihm kopfschüttelnd hinterher und murmelt: »Schade, irgendwie mochte ich ihn. Kann aber auch am Alkohol liegen.« Ich begnüge mich damit, milde zu lächeln. Obwohl ich gerade die ganze Welt umarmen könnte, würde ich Claus vielleicht doch außen vor lassen wollen. So viel negative Energie könnte sich bestimmt schon auf ein ungezeugtes Kind übertragen. Die veraltete Fahrstuhltür öffnet sich mit einem Quietschen und schließt sich Sekunden später mit einem dramatischen Knall. Vielleicht fährt Claus direkt in die Hölle hinab, aber Hummel und ich, wir sind im Himmel. Der Mann, mit dem ich seit fast acht Jahren Tisch, Bett und in fast jedem Punkt dieselben Ansichten teile, hakt nach: »Du bist also wirklich sicher, dass du bereit bist, ja? Ich meine, ich bin es, aber wir hatten ja noch einiges auf der Liste, was wir vorher erledigen wollten.«
Stimmt, die Liste. Die hatte ich ganz vergessen, schon seit einer halben Stunde habe ich gar nicht daran gedacht. Somit habe ich einen völlig neuen Grad an Entspanntheit erlangt, der mich ganz verwegen werden lässt: »Also, ich will nicht unbedingt auf der Stelle ein Baby machen – meinetwegen können wir ruhig vorher nach Hause gehen.«
Hummel zieht die Brauen hoch: »Maike Wilmers, du überraschst mich doch immer wieder. Na, dann aber nichts wie weg hier. Es sei denn, du bist hier noch nicht durch. Wer weiß, vielleicht ist es das letzte Mal in vielen, vielen Monaten, dass wir gemeinsam trinken können. Andererseits: Wenn wir jetzt loslaufen, kriegen wir noch die Bahn um halb elf.«
Guter Punkt, aber ich kann nicht laufen in meinem Kostüm. »Wir können aber auch ganz gemütlich nach Hause gehen und unterwegs die hier austrinken.« Hummel zieht eine weitere Champagnerflasche aus seiner Tasche hervor. »Haben mir die Mädels von der Theke geschenkt. Als Entschuldigung dafür, dass sie mich nicht erkannt haben.«
Es ist ein langer Weg, aber die Flasche reicht bis vor unsere Haustür. Endlich in der Wohnung angekommen, befreit mich Hummel von großen Teilen meiner Verkleidung, aber keiner von uns hat Lust, die Überreste noch fachgerecht im Altpapier zu entsorgen. Wir widmen uns lieber einem weiteren, sehr auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Projekt. Wir feiern wild, wie geplant.
2
Ich könnte schwören, dass ich in meinem Bett liege. Das nähere Umfeld sieht unserem Schlafzimmer verblüffend ähnlich. Aber irgendetwas stimmt nicht. Zwar stehen alle Möbel an ihrem angestammten Platz, aber der Nachttischlampe fehlt der halbe Schirm, und auch da, wo sich der Hals der Wasserflasche befinden sollte, sehe ich nur einen glitzernden Rahmen. Es sieht aus wie ein Silberstreif am Horizont, fühlt sich aber gar nicht so an. Ich fasse mir an den Kopf, um zu verifizieren: Das ist mal ein Mordsschädel. Im Umfang mindestens viermal so groß wie befürchtet, außerdem ist meine Kopfhaut eiskalt und offenbar kahl. »Neiiiin!«, schreie ich gellend. Erst vor zwei Wochen hatte ich die eine Frisur gefunden, die mir stand, und nun ist sie weg.
»Ebenfalls einen guten Morgen, Königin der Nacht«, flötet Hummel ekelhaft gut gelaunt aus der Richtung, aus der es nach Kaffee riecht. Aller Erfahrung nach muss das die Küche sein, und das auf meinem Kopf ist wohl eine Salatschüssel. Der Lampe und der Wasserflasche fehlt also nichts, dafür mir ein paar Stunden. Mein Freund kommt mit zwei dampfenden Tassen ans Bett, mein Magen dreht sich angewidert um und reißt meinen kompletten Oberkörper mit sich. »Zu früh für Kaffee?« Mehr eine Feststellung als eine Frage, also reicht es aus, wenn ich darauf nur dumpf grunze. Ich kann schon schreien, aber zum Sprechen ganzer Sätze bin ich zu verkatert. Dabei habe ich nur zwei Gläser Champagner getrunken, oder?
»Es wird die Morgenübelkeit sein«, bringe ich schließlich hervor. Selbst über diesen dummen Spruch muss Hummel lachen. Wir sind auf einem guten Weg, wenn wir innerhalb der nächsten Monate zu sehr schlichten Geistern mutieren wollen. Wenn ich mir die Eltern in meiner näheren Umgebung anschaue, ist das unglaublich hilfreich bei der Kindererziehung, wenn nicht gar unabdingbar. Da fällt mir etwas ein: »Oh, Shit. Wir müssen zur Arbeit.«
Hummel lässt seine Tasse sinken: »Ach ja. Stimmt. Mist. Müssen wir wirklich? Ich meine, wir haben doch irgendwie schon … vorgearbeitet.« Ich ziehe ein Gesicht, das hervorragend zu meinem übersäuerten Magen passt. Dumme Witze über Morgenübelkeit sind eine Sache, den Akt der Liebe »Arbeit« zu nennen eine ganz andere. Hummel küsst mich und sagt: »Du hast recht, wir sollten langsam mal los. War ja schon unglaublich nett von meinem Chef, dass ich den halben Tag freibekommen habe. Und die Kabel tragen sich ja auch nicht von alleine, oder?«
Nichts kann so ernüchternd sein wie die Feststellung, dass das eigene Leben nicht halb so glamourös ist wie eine lahme Künstlerparty. Hummel arbeitet bei einer ausbeuterischen Software-Firma, ich stehe mir bei einem Privatsender die Füße platt, wenn ich nicht gerade dem Kameramann hinterherhechte. Was man eben so macht, wenn man zwei Studiengänge abgeschlossen hat. Hummel reißt mich aus meinen Gedanken: »Dann geh ich als Erster duschen. Soll ich dich vorher noch aus der Schüssel befreien, oder kriegst du das alleine hin?«
»Das schaffe ich schon. Geh ruhig, und beeil dich.«
Ich winke, der brave Mann schlappt ins Bad. Vielleicht bin ich wirklich schon schwanger. Zyklusmäßig käme das durchaus hin, und die warmen Gefühle, die mich überkommen, sprechen ebenfalls dafür. Nein, das ist nur die Scham, die langsam in mir hochkriecht. Unsere Nachbarn zur Linken haben einen sehr leichten Schlaf. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir sie gestern aus diesem geweckt haben könnten. Aber sie werden mich bestimmt nicht darauf ansprechen, sondern einfach nur noch knapper grüßen, wenn wir uns im Hausflur begegnen. Was sollen sie auch sagen? »Hallo, Frau Wilmers, schön, dass Ihr Freund und Sie sich noch so liebhaben, aber müssen Sie wirklich einen Helm im Bett tragen?«
Was für ein Quatsch. Die Wände sind zwar sehr dünn, aber durchsehen kann man nun auch nicht. Aber konnte man uns hören? Von Neugier überwältigt, dötsche ich meinen Kopf gegen die Wand. Ach, das klingelt ja nur ganz zart wie ein Glöckchen, als wäre eine Elfe durchs Zimmer geschwebt. Ich poche meinen Kopf erneut an die Wand. Und noch einmal und noch einmal insgesamt zehn Wiederholungen. Ich hole aus, und wemse meinen Schädel mit Schwung gegen die Wand, im Sinne der Wissenschaft. Das war schon eher eine ausgewachsene Turmglocke, ausreichender Lärm, um auch die indirekten Nachbarn aufzuschrecken: »Hört, Bürger von Rom, ein neuer Kaiser wird euch geboren werden.« Ich höre auf mit Wemsen. Das Geräusch dröhnt wirklich unangenehm nach, vor allem, wenn der eigene Kopf der Glockenschlägel ist.
»Was treibst du da, Maike?«, brüllt Hummel aus dem Bad.
Ich antworte nicht sofort. »Ich rekonstruiere die letzte Nacht?«, kann ich schlecht sagen. Ich entscheide mich schließlich für: »Nichts!«
Mein Freund scheint das zu glauben, oder er ist damit beschäftigt, die Wassertemperatur zu regulieren. Wird unser Kind auch so ein wissenshungriges Wesen wie seine Eltern werden? Wird es eines Tages fragen: »Mama, wie bin ich eigentlich entstanden? Ich meine, wie genau?« Und ich werde sagen müssen: »Keine Ahnung. Man muss wohl dabei gewesen sein.« Mit einem beherzten Ruck reiße ich mir die Schüssel vom Kopf. Es schmerzt weniger als der Blick in das Innere meiner ehemaligen Kuppel. Haarbüschel an Gaffa-Tape, auch nicht unbedingt das, was man in das Album: »Unser Baby« kleben möchte. Ich archiviere das Beweisstück trotzdem in der Nachttischschublade.
Am liebsten würde ich Hummel jetzt aus der Dusche holen, um ihm zu sagen, dass wir – nein, nicht »noch nacharbeiten« sollten. Wir den Tathergang nachstellen sollten, für mein Seelenheil? Und dabei aus romantischen Gründen vielleicht noch ein paar Kerzen anzünden und Musik auflegen sollten? Vielleicht reicht es aus, nachträglich Rosenblätter zu verstreuen? Ich stehe auf und stelle fest, dass etwas mit meinem BH nicht in Ordnung ist, abgesehen davon, dass ich ihn noch anhabe. Da lugt ein Zettel heraus, konkreter, eine Visitenkarte. Wer steckt mir seine Visitenkarte in die Unterwäsche, und vor allem: wann? Ein Blick auf die Karte könnte darüber Aufschluss geben: »Professor Claus H. Hartwig« steht da.