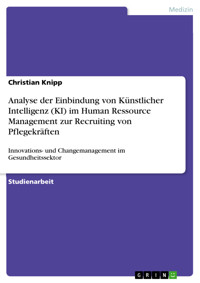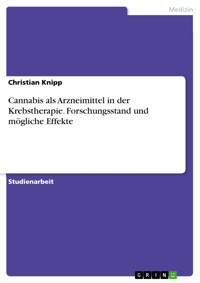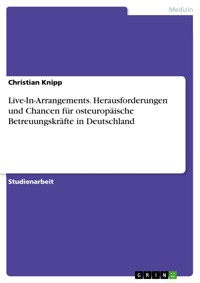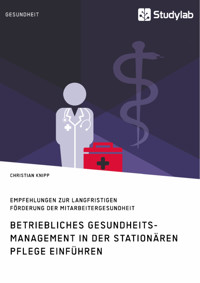
Betriebliches Gesundheitsmanagement in der stationären Pflege einführen. Empfehlungen zur langfristigen Förderung der Mitarbeitergesundheit E-Book
Christian Knipp
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Durch den demografischen Wandel steigt die Nachfrage an Fachpersonal in der Pflege, doch dieses bleibt weiterhin knapp. Die Konsequenzen für das Gesundheitssystem sind eindeutig. Die steigende Pflegebedürftigkeit und die knappen personellen Ressourcen führen zu hohen Arbeitsbelastungen und beeinflussen die Gesundheit der Beschäftigten. Das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) bietet einen Ansatz zur Problemlösung, indem es Einfluss auf den Gesundheitszustand der Beschäftigten nehmen kann. Christian Knipp untersucht, inwieweit die Implementierung von betrieblichem Gesundheitsmanagement als Steuerungstool in der stationären Pflege Effekte erzielen kann, um die Gesundheit der Mitarbeiter langfristig zu fördern und zu erhalten. Dabei analysiert er den Status Quo und sichtet Optimierungspotenziale. Für die pflegerische Praxis gibt er konkrete Handlungsempfehlungen. Aus dem Inhalt: - Gesundheitsförderung; - Eingliederungsmanagement; - Arbeitsschutz; - stationäre Pflege; - Langzeitpflege; - Pflegemanagement
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 73
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1... Einleitung
2... Methodik
3... Betriebliches Gesundheitsmanagement
3.1 Rechtliche Grundlagen
3.2 Vorteile des betrieblichen Gesundheitsmanagement
3.3 Kosten-Nutzen-Analyse
4... Betriebliche Gesundheitsförderung
4.1 Bedeutung für die Pflege und Best Practice Modelle
4.2 Hindernisse der Implementierung in die Pflegebranche
5... Betriebliches Eingliederungsmanagement
5.1 Welche Vorteile bietet BEM?
5.2 BEM aus Sicht des Pflegepersonals
6... Arbeits- & Gesundheitsschutz
6.1 Gefährdungsbeurteilung in Pflege (Gefährdungsanalyse)
6.2 „GDA-Projekt“ - Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Pflege
7... Betriebliches Gesundheitsmanagement in der Pflege
7.1 Fehlzeiten
7.2 spezifische Arbeitsbelastungen in pflegenden Berufen
8... Controlling: Steuerung und Qualitätssicherung
8.1 Qualitätssicherung: DIN SPEC 91020
8.2 Skizze: „7-Schritte-Modell“ zur BGM - Einführung
9... Handlungsempfehlungen für die Pflegepraxis
9.1 Supervision
9.2 Psychosoziale Beratungsgespräche
9.3 Mitarbeiter*innen-Pool
9.4 Interaktives Training für Führungskräfte – „Stress-Rekord“
10.
Zusammenfassung
Die Betreuung und Versorgung von Pflegebedürftigen stellt sich als Herausforderung für das Pflegepersonal dar. Die hohen physischen und psychischen Arbeitsbelastungen führen zu Fehlzeiten, fördern Präsentismus und erhöhen die Fluktuation. Bedeutsamer denn je sind nun betriebliche Präventions- und Schutzmaßnahmen, um die Beschäftigten vor Krankheit zu schützen und die Arbeitskraft langfristig zu erhalten. Die Maßnahmen und Ziele zum Erhalt und Förderung der Gesundheit werden durch das betriebliche Gesundheitsmanagement gesteuert und überprüft.
Diese Arbeit untersucht, inwieweit das betriebliche Gesundheitsmanagement als Steuerungstool zum Erhalt und zur Förderung der Gesundheit des Pflegepersonals beitragen kann und in welcher Form Handlungsansätze zur Instrumentalisierung und Etablierung vorliegen.
Die zentralen Untersuchungsergebnisse stellen heraus, dass die konzeptionelle Durchführung des betrieblichen Gesundheitsmanagements, Einfluss auf die Gesundheit und die Arbeitsgestaltung nimmt. Der Einsatz von gesundheitsfördernden Maßnahmen erzielt Effekte seitens weicher und harter Faktoren („Hard- und Soft-Facts“). Außerdem lassen sich Handlungsansätze zur Instrumentalisierung und Etablierung identifizieren. Insbesondere in den gesetzlich verpflichtenden Teilbereichen zeigt sich die Evidenz.
Optimierungspotential besteht in der Erhöhung von freiwillig zu erbringenden Leistungen und Aktionen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung. Die Bereitschaft der Handlungsbevollmächtigten zu Change-Management-Prozessen ist daher essenziell.
Zukünftiger Forschungsbedarf entsteht in der Auswahl und Erhebung von Kennzahlen hinsichtlich des Controllings, das die Signifikanz einzelner gesundheitsförderlicher Maßnahmen eindeutiger hervorhebt. Der Wissenstransfer zwischen Theorie und Praxis ist daher zweckmäßig, um den Nutzen des betrieblichen Gesundheitsmanagements zu etablieren.
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 BGM - Betriebliches Gesundheitsmanagement
Abbildung 2 Gründe für die Einführung von betrieblichem Gesundheitsmanagement
Abbildung 3 Maßnahmen zum Thema "Gesundheit im Betrieb" zu den Themenfeldern
Abbildung 4 Gefährdungsbeurteilung
Abbildung 5 Gefährdungsbeurteilung durch Risikoeinschätzung
Abbildung 6 Fehlzeiten
Abbildung 7 Physische Belastungen in Pflege
Abbildung 8 psychische Belastungen von Pflege
Abbildung 9 AU-Tage von Pflegekräften
Abbildung 10 Treiber- Indikatoren Modell
Abbildung 11 Betriebliches Gesundheitsmanagement DIN SPEC 91020
Abbildung 12 Evaluation: Wer ist in Ihrem Unternehmen an der Evaluation beteiligt?
Abbildung 13 Evaluation von BGM
Abbildung 14 Instrumente zur Steuerung von BGM: Wenn Ja, welche Instrumente zur Analyse angewandt?
Abbildung 15 "Stress-Rekord" - Virtuelles Dienstzimmer
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Vorteile von BGM für die Beschäftigten und Organisation
Tabelle 2 Vorteile Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen von BGF
Abkürzungsverzeichnis
ASG Arbeits- und Gesundheitsschutz
AU Arbeitsunfähigkeit
ArbSchG Arbeitsschutzgesetz
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
BMAS Bundesministerium für Arbeit und Soziales
BMG Bundesministerium für Gesundheit
BGF Betriebliche Gesundheitsförderung
BGM Betriebliches Gesundheitsmanagement
BEM Betriebliches Eingliederungsmanagement
BGW Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrt
DAK Deutsche Angestellten Krankenkasse
EAP Employee Assistance Program
IAG Institut für Gesundheit und Arbeit der Deutschen Unfallversicherung
ICD Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
IGA Initiative Gesundheit und Arbeit
IWK Institut der Deutschen Wirtschaft
MA Mitarbeiter*innen
MSE Muskel-Skelett-Erkrankungen
PrävG Präventionsgesetz
ROI Return on Investment
SGB Sozialgesetzbuch
Vdek Verband der Ersatzkassen e.V.
1 Einleitung
„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“ – Arthur Schopenhauer (1788 – 1860)
Die Verschiebung der Altersstruktur in Deutschland wird mithilfe des demografischen Wandels dargestellt, der die Entwicklung von Pflegebedürftigkeit prognostiziert. Das Statistische Bundesamt ermittelte im Jahr 2017 eine Zahl von 3,4 Millionen Pflegebedürftigen. Das entspricht einem Zuwachs von 19 % (ca. 554.000 Menschen) seit 2015. Dem stehen im Jahr 2019 1,7 Millionen Menschen in einem pflegerischen Beruf gegenüber. (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2020, S. 4 f.) Der Trend zu immer älter werdenden, beruflich Pflegenden im Vergleich zum Nachwuchs ist dadurch kritisch zu betrachten. Von diesem Phänomen ist insbesondere die Altenpflege betroffen. (vgl. Kliner et al. 2017, S. 33)
Aktuell befinden sich ca. 71.300 Menschen in einer pflegerischen Berufsausbildung. Das entspricht einem Zuwachs von 39 % an Pflegeanfänger*innen seit 2009. (vgl. Statistisches Bundesamt 2020) Die steigende Nachfrage an Fachpersonal kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht vollständig abgedeckt werden. (vgl. Institut der Deutschen Wirtschaft (IWK) 2018, S. 5)
Die Konsequenzen auf das Pflege- und Gesundheitssystem sind eindeutig. Die steigende Pflegebedürftigkeit und die knappen personellen Ressourcen führen zu hohen Arbeitsbelastungen und beeinflussen die Gesundheit der Beschäftigten. (vgl. Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) 2014, S. 7 ff.) Die chronisch werdenden Gesundheitsschädigungen zeigen sich im Präsentismus – „Krank“ zur Arbeit und den krankheitsbedingten Fehlzeiten (Absentismus). (vgl. Oster, Mücklich 2019, S. 2 f.) Diesbezüglich beläuft sich die durchschnittliche Verweildauer im Pflegeberuf auf ca. 8 Jahre. (vgl. Ver.di 2014, S. 7) Die Gründe für vorzeitiges Ausscheiden liefert die Studie von Hackmann (2009). Im Rahmen der Befragung verneinten mehr als 70 % der Pflegekräfte die Frage, ob der erlernte Beruf ohne gesundheitliche Einschränkungen unter den aktuellen Arbeitsanforderungen bis zum Renteneintritt möglich sei. (ebd. S. 3)
Die beschriebenen Problemstellungen für das Pflege- und Gesundheitssystem erfordern daher kreative, lösungsorientierte Handlungskonzepte und Change-Management-Prozesse.
Das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) bietet einen Ansatz zur Problemlösung, indem es Einfluss auf den Gesundheitszustand der Beschäftigten nehmen kann.
Der vorherrschende Pflegekräftemangel und die Fluktuationszahlen unterstreichen den zusätzlichen Mehrbedarf an betrieblicher Gesundheitsförderung. Das BGM fördert langfristig die Gewinnung von potenziellen Bewerber*innen und vermindert die Fluktuation. (vgl. Stockinger 2014, S. 5)
Auf politischer Ebene betreibt das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) das Projekt „Konzertierte Aktion Pflege 2018“. Innerhalb einer Arbeitsgruppe wurden Lösungsansätze zur Verbesserung der Rahmenbedingungen von Pflege diskutiert und Handlungsempfehlungen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement formuliert. Das zweijährig angelegte Projekt soll zur Aufwertung des Berufsbildes und zum Ausbau der betrieblichen Gesundheitsförderung in die Prozessstrukturen der Organisationen beitragen, um so das Image des Berufsbildes zu verbessern und Wiedereinsteiger*innen zurückzugewinnen. Das Maßnahmenpaket betrifft außerdem die tarifgebundene Vergütung und einen bedarfsgerechten Personalschlüssel. (vgl. BMG 2019, S. 41 f.)
Anhand der genannten Problemstellungen in der Einleitung wird die Aktualität und Relevanz zum Forschungsfeld deutlich. Die vorliegende Arbeit untersucht daher:
Inwieweit die Implementierung von betrieblichem Gesundheitsmanagement als Steuerungstool in der stationären Pflege Effekte erzielen kann, um die Gesundheit der Mitarbeiter*innen langfristig zu fördern und zu erhalten?
In diesem Kontext ergibt sich die sekundäre Fragestellung:
Welche Handlungsansätze der Pflegeeinrichtungen werden bereits zur Implementierung, Durchführung und Instrumentalisierung im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagement genutzt und besteht Optimierungspotenzial?
Das Ziel der Arbeit verfolgt neben Beantwortung der Forschungsfragen die Wissensvermittlung der Grundlagen und den Anreiz zur Implementierung und Weiterentwicklung des betrieblichen Gesundheitsmanagements in den Pflegeeinrichtungen.
Kapitelübersicht
Im zweiten Kapitel wird die systematische Herangehensweise und Methodik beschrieben. Anschließend werden Begriffsbestimmungen vorgenommen und in das Themenfeld eingeführt. Die darauffolgenden Kapitel stellen die einzelnen Teilbereiche des Themenfeldes vor und erläutern diese differenzierter. In Hinblick zum Theorie-Praxis-Transferwerden praktische Beispiele mit einbezogen.
2 Methodik
Im Vorfeld der Arbeit wurden diverse Herangehensweisen verfolgt, um eine Übersicht des Forschungsfeldes zu erlangen und praxisbezogene Hintergrundinformationen zu erfassen. Die anfängliche Informationsgewinnung wurde in Form von Beratungsgesprächen mit Expert*innen der Krankenkassen, Pflege- und Leitungskräften aus dem Gesundheits- und Pflegesystem sowie Unternehmensberater*innen geführt. Innerhalb der Gespräche mit Mitarbeiter*innen und Führungskräften aus dem Pflege- und Gesundheitssystem stellte sich die Tendenz heraus, dass wenig fundiertes Know-how über das Themenfeld vorhanden ist. Der Informationsaustausch mit Expert*innen der Krankenkassen und den Unternehmensberater*innen bestätigte den ausbaufähigen Wissensstand und die geringe Anzahl an Best Practice Modellen. Anhand der Auswertung und Interpretation der Gespräche wurde eine eigene quantitative und qualitative Forschung ausgeschlossen und sich für die Literaturarbeit entschieden. Die, der Pandemie (Covid-19) geschuldeten Kontaktbeschränkungen, bestärkten die Entscheidung.
Auswahlkriterien
Die Literaturrecherche wurde in Form der sensitiven Recherche und des Schneeballsystems durchgeführt. Die Suche beschränkte sich dabei auf die letzten 20 Jahre. Ausnahmen gab es nur innerhalb der Begriffsbestimmungen und eines Beitrages von Badura aus dem Jahr 1999.
Literaturrecherche
Aufgrund der aktuellen Lage wurde die Literaturrecherche zum größten Teil online durchgeführt. Als primäre Suchhilfen der sensitiven Recherche wurden der Fernzugriff der Alice Salomon Hochschule und die Datenbanken MEDLine (PubMed), CareLit, Hogrefe Verlag und Springer Link verwendet.