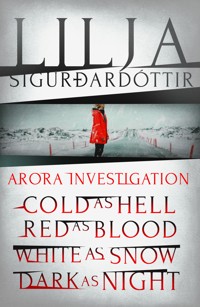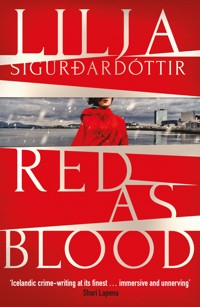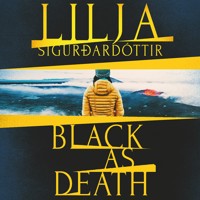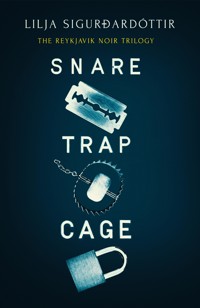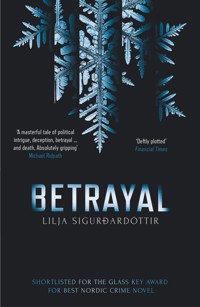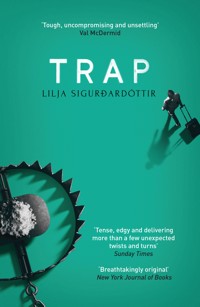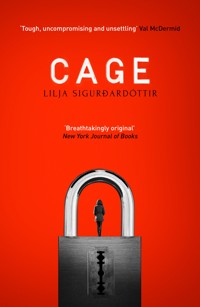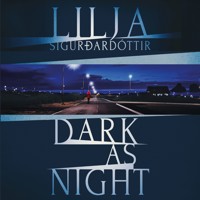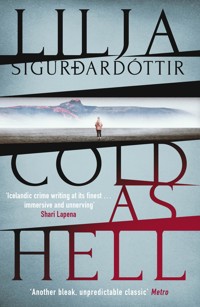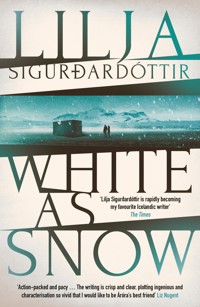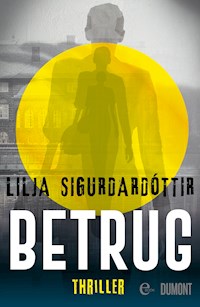
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jahrelang hat Úrsúla Aradóttir für Hilfsorganisationen in den Krisenregionen der Welt gearbeitet – zuletzt in Liberia und Syrien. Als sie nach Island zurückkehrt, um endlich mehr Zeit für ihre Familie zu haben, fühlt sie sich ausgebrannt, leer und apathisch. Sie braucht eine neue Aufgabe. Da kommt ihr das Angebot gerade recht, übergangsweise als Parteilose den Posten der Innenministerin zu übernehmen. In der Hoffnung, ihren inneren Dämonen zu entkommen und zugleich politisch etwas bewirken zu können, stürzt sie sich in die Arbeit. Doch bald muss sie feststellen, dass das politische Machtpoker skrupellos und mit toxischer Hinterlist gespielt wird. Als die Mutter eines Mädchens, das von einem Polizisten vergewaltigt wurde, sie um Unterstützung bittet, verspricht Úrsúla zu helfen. Aber es gibt Kräfte, die um jeden Preis verhindern wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Ihr Kampf um Gerechtigkeit führt die Innenministerin tief in ihre eigene Vergangenheit und zu einem grausamen Verbrechen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Jahrelang hat Úrsúla Aradóttir für Hilfsorganisationen in den Krisenregionen der Welt gearbeitet – zuletzt in Liberia und Syrien. Als sie nach Island zurückkehrt, um endlich mehr Zeit für ihre Familie zu haben, fühlt sie sich ausgebrannt, leer und apathisch. Sie braucht eine neue Aufgabe. Da kommt ihr das Angebot gerade recht, übergangsweise als Parteilose den Posten der Innenministerin zu übernehmen. In der Hoffnung, ihren inneren Dämonen zu entkommen und zugleich politisch etwas bewirken zu können, stürzt sie sich in die Arbeit. Doch bald muss sie feststellen, dass das politische Machtpoker skrupellos und mit toxischer Hinterlist gespielt wird. Als die Mutter eines Mädchens, das von einem Polizisten vergewaltigt wurde, sie um Unterstützung bittet, verspricht Úrsúla zu helfen. Aber es gibt Kräfte, die um jeden Preis verhindern wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Ihr Kampf um Gerechtigkeit führt die Innenministerin tief in ihre eigene Vergangenheit und zu einem grausamen Verbrechen.
© Gunnlöð
LILJA SIGURDARDÓTTIR wurde 1972 in der isländischen Kleinstadt Akranes geboren und wuchs in Mexiko, Spanien und Island auf. Bereits mehrfach ausgezeichnet für ihre Theaterstücke, wurde sie mit ihrer Reykjavík-Trilogie auch einem internationalen Publikum bekannt. Der erste Band der Reihe, ›Das Netz‹, erschien 2020 bei DuMont, gefolgt von ›Die Schlinge‹ und ›Der Käfig‹ (2021).
BETTY WAHL, geboren 1965, ist seit zwanzig Jahren als freiberufliche Literaturübersetzerin für Isländisch und Norwegisch und als Dozentin an der Uni Frankfurt tätig. Sie hat u.a. die Romane von Sjón, Gyrðir Elíasson und Jón Gnarr sowie die Lyrik der Norwegerin Marte Huke ins Deutsche übertragen. Betty Wahl lebt und arbeitet in Reykjavík und Frankfurt am Main.
LiljaSigurðardóttir
BETRUG
THRILLER
Aus dem Isländischenvon Betty Wahl
Von Lilja Sigurðardóttir sind bei DuMont außerdem erschienen:
Das Netz (Island-Trilogie 1)
Die Schlinge (Island-Trilogie 2)
Der Käfig (Island-Trilogie 3)
Dieses Buch wurde übersetzt mit finanzieller Unterstützung von:
Die isländische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel ›Svík‹ bei Forlagið, Reykjavík.
© Lilja Sigurðardóttir 2018
This translation was published by arrangement with Forlagið.
eBook 2022
© 2022 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Betty Wahl
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildungen: © shutterstock
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8234-2
www.dumont-buchverlag.de
Rückblickend betrachtet war es das Versprechen an ihrem ersten Tag im neuen Amt, das Úrsúla zum Verhängnis wurde. Doch gleichzeitig hatte es ihr dabei geholfen, die Rüstung zu sprengen, in der ihr Herz schon viel zu lange eingeschlossen war.
In der Nacht, nachdem ihr die Schlüssel ausgehändigt worden waren, hatte sie schlecht geträumt. Von fieberglühenden, mit Pusteln bedeckten Körpern, von der Verzweiflung in den Augen der Angehörigen, die die Kranken in die Notaufnahmelager brachten, von einer endlosen Reihe von Bombenexplosionen, als seien ihre vorherigen Jobs in Liberia und Syrien zu einem einzigen, entsetzlichen Albtraum verschmolzen.
Der Traum hatte ihr noch in den Knochen gesteckt, als sie am nächsten Morgen das Ministerium betrat, doch gleichzeitig war sie bestens gelaunt und nach dem Empfang noch immer voller Stolz gewesen. Blumen und Glückwunschkarten, die ihr bei der feierlichen Schlüsselübergabe am Vortag überreicht worden waren, füllten ihr Büro, sodass sie sich dort völlig unvorbereitet einer verzweifelten Frau gegenüber sah, die sie anflehte, einen Polizisten, der zu Hause in Selfoss ihre Tochter vergewaltigt hatte, seiner gerechten Strafe zuzuführen. Das Mädchen hatte seitdem kaum ein Wort gesagt. Weigerte sich, das Haus zu verlassen. Hatte sich völlig in ihr Schneckenhaus verkrochen, erklärte die Mutter, während ihr die Tränen übers Gesicht liefen. Sie trocknete sich die Augen und fragte verärgert, wo im System der Fall denn eigentlich hängen geblieben sei. Sie habe bereits bei der Polizei nachgefragt, bei der Staatsanwaltschaft vorgesprochen und ihren Anwalt um Unterstützung gebeten, aber niemand schien irgendetwas zu wissen. Also hatte Úrsúla versprochen, sich persönlich der Sache anzunehmen. Sie hatte der Mutter die Hand gegeben, die diese verzweifelt umklammert hielt, ihr in die Augen sah und dem Herrgott dafür dankte, dass der Innenminister eine Frau war.
FREITAG
1
Er war noch satt von der heißen Hafergrütze, die er am Morgen in der Gemeindetafel bekommen hatte. Deshalb, und weil die Straße nicht geräumt war und der Schnee ihm bis zu den Waden reichte, schlurfte er mehr, als dass er ging. Es schneite immer noch in dicken Flocken, und er beschloss, seinen Spaziergang für heute abzukürzen. Er würde nur eine kleine Runde drehen, nicht bis hinunter in den alten Stadtkern. Sonst müsste er hinterher denselben Weg wieder bergauf stapfen. Er startete am ehemaligen Busbahnhof Hlemmur. Immer am Hlemmur. Die nette Frau dort in der Bäckerei steckte ihm jedes Mal irgendein süßes Gebäck zu, das er gewöhnlich als Proviant für später in der Manteltasche verstaute. Wenn es drauf ankam. Manchmal überfiel ihn der Hunger und er machte sich noch am selben Tag über die Leckereien her, dann wieder sparte er seine Vorräte auf und griff erst ein paar Tage später darauf zurück. Süßes Backwerk hielt sich lange. Normalerweise schmeckte es auch nach mehreren Tagen noch wie frisch. Heute hatte er eine kleina, einen isländischen Schmalzkrapfen, und irgendein leckeres Plunderteilchen mit Nüssen in der Tasche, und er genoss das wohlige Gefühl, mit reichlich Proviant ausgestattet zu sein. Für den Fall, dass er es nicht bis zurück zur Gemeindetafel schaffen würde und schon auf dem Weg dorthin Hunger bekam. Wie in dem Sommer, als er sich den Fuß gebrochen hatte. Das war eine verdammt harte Zeit gewesen, als er sich oben im Gestrüpp auf dem Öskjuhlíð eingenistet hatte und nicht in der Lage gewesen war, aufzustehen und sich eine Magenfüllung zu besorgen. Da wäre er froh gewesen, etwas in der Manteltasche gehabt zu haben.
Seine nächste Station war der Spielhallenkiosk. Manchmal bekam er dort Kaffee, manchmal Kleingeld. Je nachdem, wer gerade arbeitete.
»Einen wunderschönen guten Morgen!«, sagte er beim Eintreten, und die muntere Antwort auf seinen Gruß deutete darauf hin, dass heute ein Kleingeldtag war. Dann hätte er auch nichts dagegen, den ganzen Weg hinunter in die Altstadt zu latschen. Ins Alkoholmonopol, um die Münzen gegen Bier einzutauschen.
»Na, wie geht’s, Alter«, sagte der sympathische junge Mann, der ein paarmal in der Woche im Kiosk aushalf. »Was hat der feine Herr denn heute zu berichten?«
»Es schneit.«
»Allerdings«, nickte der junge Kerl.
»Allerdings. Naja, wir haben schließlich Winter«, antwortete er mit einem Augenzwinkern. »Du hast nicht vielleicht eine Kleinigkeit für mich, mein Freund?« Die Kassenschublade sprang mit einem Klingelgeräusch auf, der Junge griff hinein und holte eine Handvoll Hundert-Kronen-Münzen heraus.
»Bitte sehr, mein Lieber«, sagte er. »Und kauf dir was Schönes zu essen davon.«
»Jajaja. Einen Hamburger«, log er. Die Miene des jungen Mannes zeigte deutlich, dass er ihm kein Wort glaubte, aber das war ihm egal. »Wie heißt du noch mal, Jungchen?«
»Ich heiße Steinn«, sagte der Junge lachend. »Und das sag ich dir jedes Mal, wenn du vorbeikommst.«
»Namen spielen keine Rolle«, brummte er beim Hinausgehen. »Nur die Augen. Die Augen sagen alles, was es über einen Menschen zu sagen gibt.« Und dieser Steinn hatte gute Augen. Ein wenig schelmisch. Schelmisch und rebellisch genug für einen Mann, der Geld aus der Ladenkasse klaut. Aber freundlich und sanft genug, um einen alten Penner mit Kleingeld zu versorgen. Er schlenderte weiter, den Laugavegur hinunter. Auf seinem Kopf sammelte sich eine Mütze aus nassem Schnee, die schmolz und in seine dünnen Haare hineinsickerte, sodass ihm kalte Schauer über den Rücken liefen. An der Ecke zur Snorrabraut überquerte er die Straße und schlüpfte in einen der Souvenirläden. In diesem arbeitete der hagere, unfreundliche Typ, der ihn immer sofort wieder hinausjagte. Er stammelte etwas davon, dass er sich bloß einen Moment aufwärmen wolle, aber damit stieß er auf taube Ohren. Der Hagere beharrte darauf, dass hier kein Platz für ihn sei, und fixierte ihn mit seinem trüben Blick, während er damit drohte, die Polizei zu rufen. Worauf das hinauslief, war klar, die Bullen würden ihn mitnehmen, so nüchtern und zivilisiert wie er war, aufgegriffen in einem Souvenirgeschäft am helllichten Tag, und damit wären eine Dienstfahrt und ein Zellenplatz für die Nacht verschwendet. Also beeilte er sich, wieder nach draußen zu kommen, und stapfte mit festem Schritt in Richtung Bónus-Supermarkt, denn die Schneeschmelze auf diesem Abschnitt des Bürgersteigs hatte schon ziemliche Fortschritte gemacht, und bevor er wusste, was los war, saß er drinnen und hatte einen Pappbecher mit Kaffee vor sich, für den er nichts von seinen Münzen hatte hergeben müssen. Die Asiatin, die an der Nudelbar bediente, hatte ihm einfach diesen Becher gereicht und ihm einen Sitzplatz zugewiesen. Sie redete laut, und er verstand kein Wort von dem, was sie sagte, aber sie hatte einen warmherzigen Blick. Er sah ihr an, dass sie ihre Eltern vermisste, in irgendeinem fernen Land, und deshalb einem alten Obdachlosen einen Gefallen tat.
Er schlürfte seinen Kaffee, der ihn gleich von innen wärmte, und blätterte in einer Zeitung, die vor ihm auf dem Tisch lag. Die erste Doppelseite zeigte sie, Úrsúla Aradóttir, und der zugehörige Artikel berichtete, dass sie einen Ministerposten bekommen hatte. Es irritierte ihn, dass sie auf dem Foto älter aussah, als sie nach seiner Berechnung sein musste, aber es bestand kein Zweifel: Sie war es. Wieder durchströmte ihn das sonderbare Gefühl, das sich immer dann einstellte, wenn er fand, dass das Leben anderer in geradlinigen Bahnen verlief, während sich sein eigenes im Kreis drehte. Er zog sein Notizbuch hervor, um sich diesen Gedanken zu notieren, als sein Blick noch einmal auf das Foto und den Mann an Úrsúlas Seite fiel. Beide schauten lächelnd in die Kamera. Ihre Augen blitzten lebhaft und verschmitzt, aber sein Blick war eiskalt. Der kälteste Blick der Welt. Er starrte auf das Foto und konnte nicht verstehen, weshalb Úrsúla, inzwischen Ministerin und was sonst noch alles, dort stand und strahlend ihre Hand in die dieses Mannes legte. Verdammt.
2
Am vergangenen Montag waren sie gerade aus dem Sprechzimmer des Paartherapeuten gekommen, als Úrsúlas Handy klingelte und der Premierminister ihr genau zwei Stunden Zeit gab zu überlegen, ob sie sich vorstellen könne, für ein Jahr das Amt des Innenministers zu übernehmen. Sie war noch ganz verheult, nachdem sie Nonni drinnen beim Paartherapeuten so gründlich zusammengeschrien hatte, dass sie am Telefon wohl etwas verschnupft klang, als sie dem Premierminister antwortete, sie werde ihn innerhalb der vereinbarten Zeit zurückrufen. Doch sie brauchte keine zwei Stunden, und sie brauchte sich auch nicht mit Nonni zu beraten, um die Entscheidung zu treffen. Sie wusste sofort, dass sie noch vor Ablauf dieser zwei Stunden zurückrufen und dem Premier mitteilen würde, dass sie den Job annehmen wollte.
Nonni war merkwürdig aufgekratzt, dämpfte plötzlich seine Stimme, flüsterte beinahe, so als sei er in irgendein Staatsgeheimnis eingeweiht worden, während er, seine Hand an Úrsúlas Ellenbogen, sie im Einkaufszentrum Skeifan in ein Café dirigierte und dort einen Tisch am Fenster hinten in der Ecke ansteuerte.
»Was genau hat der Premierminister denn gesagt?«, flüsterte er und setzte sich Úrsúla gegenüber.
»Nichts weiter, nur, dass der Job auf ein Jahr begrenzt ist, weil der amtierende Innenminister wegen Krankheit ausfällt.«
»Wow.«
»Ja. Das kommt alles ein bisschen plötzlich«, sagte Úrsúla. »Dass sie eine außerparlamentarische und überparteiliche Ministerin haben wollen, riecht jedenfalls stark danach, dass die beiden Parteien sich nicht einigen konnten, welche von ihnen den Innenminister stellen sollte.«
In so einem Fall ist es schlau, den Dritten Weg zu gehen«, erklärte Nonni und verstummte, als die Kellnerin kam. Úrsúla bestellte sich einen Kaffee, Nonni nahm ein Bier, was mitten am Tag ungewöhnlich war. Er schien in Wahrheit noch viel aufgeregter zu sein, als man ihm von außen ansah. »Du machst das schon«, sagte er. »Vielleicht ist das genau das, was du jetzt brauchst. Was du brauchst, um hier zu Hause wieder Wurzeln zu schlagen. Vielleicht ist dieser Job ja spannend genug für dich.« Úrsúla nickte, und sie schwiegen für ein paar Minuten. Die Kellnerin kam mit dem Kaffee, in den Úrsúla Milch goss, und Nonni leerte sein Bier in einem Zug zur Hälfte.
Vermutlich hatte er recht. Seit sie nach Island zurückgekommen war, war sie unzufrieden. Sie fand keine Bodenhaftung, und ihr Leben floss dumpf und taub vor sich hin. Sie hatte ihr Leben noch nie so als Ganzes vor sich gesehen, sondern war immer davon ausgegangen, es in humanitärer Freiwilligenarbeit zu verbringen, irgendwo schweißüberströmt im heißen Sand, irgendwo, wo sie in ihrem glühenden Körper klar und deutlich spürte, dass ihre Anwesenheit wichtig war.
»Und was ist mit den Kindern?«, fragte Úrsúla. Nicht, weil sie dachte, dass es im Leben der Kinder eine Rolle spielte, ob sie Ministerin würde oder nicht. In den letzten Jahren hatte sich hauptsächlich Nonni um die beiden gekümmert und würde das auch weiterhin tun.
»Ich habe zurzeit nur Lehraufträge und werde zusehen, dass ich den Unterricht größtenteils zu Hause vorbereiten kann. Es ist also kein schlechter Zeitpunkt.«
»Ich könnte mich aber sicherlich auch nützlich machen«, sagte Úrsúla und sah gedankenverloren aus dem Fenster. Es hatte wieder zu schneien begonnen, und eine frische weiße Schneeschicht bedeckte nach und nach den gräulichen Altschnee. Das war genau das, wonach sie sich sehnte. Sich nützlich machen, Unordnung durch Ordnung ersetzen, für irgendjemanden wichtig sein, egal wo. Nonni lehnte sich über den Tisch und legte seine Hand auf ihre.
»Das wird auch uns guttun«, sagte er leise und schaute ihr in die Augen. Der Streit beim Paartherapeuten war vergessen und sein humorvolles Augenzwinkern zurückgekehrt. »Eine glückliche Úrsúla bedeutet glückliche Kinder und einen glücklichen Nonni.«
»Bist du sicher?«, fragte sie. Sie wollte die angedeutete Unterstützung laut ausgesprochen hören. Wollte, dass er seine Gedanken in Worte fasste, seine Entscheidung, zu ihr zu stehen – in der Hoffnung, dass sie nicht wieder im selben Schlamassel landeten. Wollte, dass er nicht wieder anfing, ihr ihren anspruchsvollen Job vorzuhalten, sich wegen mangelnder Beachtung selber zu bemitleiden und ihr schließlich den Laufpass gab.
»Todsicher«, antwortete er. »Es ist kein Zufall, dass diese Chance ausgerechnet jetzt kommt. Das hier soll so sein. Ich stehe in diesem Job hundert Prozent hinter dir, mein Schatz.« Úrsúla erwiderte seinen Händedruck. Es war ein beruhigendes Gefühl, dass er sie bedingungslos unterstützen wollte, auch wenn es nicht den Ausschlag gab. Sie hatte sich entschieden, bevor ihr Telefonat mit dem Premierminister zu Ende war. Dieser Job war genau das, was sie sich immer gewünscht hatte. Etwas, das tief in ihrem Inneren einen Sehnsuchtsfunken entfachte. Etwas, das sie aus der Taubheit erweckte, in der sie gefangen war, seitdem sie Liberia, nach einem Umweg über ein syrisches Flüchtlingslager, verlassen hatte.
3
Das erste Treffen mit Staatssekretär Óðinn war nach den steifen Formalitäten in der Kabinettssitzung am Vormittag eine wahre Erleichterung. Ihr war es schwergefallen stillzusitzen, während ein Minister nach dem anderen sich erhob und seine parlamentarischen Errungenschaften in Richtung des Präsidenten herunterbetete, dem es erstaunlich gut gelang, echtes Interesse an diesen Aufzählungen vorzutäuschen. Úrsúla hatte inzwischen handfeste Entzugserscheinungen und qualmte zwei Zigaretten durchs offene Autofenster, während sie ins Ministerium zurückkurvte, um Óðinn zu treffen.
Óðinn war elegant gekleidet, trug eine geknöpfte Weste unter seinem Jackett und eine Krawatte, die bis zum Hals festgezurrt war. Doch während sich die Tür hinter ihnen schloss, schlüpfte er aus seinem Jackett und hängte es über die Stuhllehne, sodass Úrsúla sich etwas entspannte und sich erlaubte, unter dem Tisch ihre High Heels abzustreifen, und einen Fuß unter sich auf den Stuhl zog. Als erstes reichte Óðinn Úrsúla ein Fläschchen mit Hand-Desinfektionsmittel.
»Dieses Zeug hier benutzt du, so oft du kannst«, sagte er. »Du wirst in den nächsten Monaten mehr Leuten die Hand schütteln als je zuvor, und die Grippesaison läuft sich gerade erst warm.« Sie lachte und griff nach dem Fläschchen, spritzte sich ein paar Tropfen auf die Handflächen und reichte es an ihn weiter, der sich ebenfalls bediente. Dann saßen sie einander am Sitzungstisch gegenüber und rieben sich die Hände ein. Der mentholartige Duft, der von ihren Handflächen direkt in ihre Nase stieg, war wohltuend und erinnerte Úrsúla daran, wie sicher sie hier war. Hier gab es keine Krankheitserreger, gegen die gewöhnliche Desinfektionsmittel nichts ausrichten konnten. In Liberia hatten sie ihre Hände mit Chlor gewaschen.
Óðinn knetete gewissenhaft seine Finger, die genauso groß waren wie alles andere an ihm. Er war garantiert einen Meter neunzig und hatte einen muskulösen Brustkorb bei anonsten schlankem Körperbau, was darauf hindeutete, dass er entweder schwere Arbeit tat oder Sport trieb. Als er mit seiner sorgfältigen Handmassage fertig war, wedelte er mit den Händen in der Luft, um sie zu trocknen, und Úrsúla hätte laut loslachen können. Wie er da saß, glich er einem riesengroßen, tollpatschigen Vogel.
»Krank werden kommt nicht infrage, außer du liegst mit akutem Blinddarm im Krankenhaus.« Sie nickte. Er hatte sich an diesem Thema derart festgebissen, dass sie sich fragte, ob er wohl schlechte Erfahrungen mit erkrankten Ministern gemacht hatte. Ihr Vorgänger Rúnar war aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden, aber sie war davon ausgegangen, dass es sich um ein Herzproblem oder eine andere ernste Erkrankung handelte. »Hast du eigentlich einen übersäuerten Magen?«, fragte Óðinn dann mit derart besorgtem Blick, dass sie sich nicht mehr beherrschen konnte und losprustete.
»Nein. Warum fragst du?«
»Sehr gut. Dann rate ich dir: Iss zu allen Mahlzeiten so viele Chillies, wie du kannst, um Magen-Darm-Infekten vorzubeugen. Eine Ministerin, der es ständig übel ist, hat uns gerade noch gefehlt.«
»Verstehe«, sagte sie. »Ich werde meinen Teil dazu beitragen, gesund zu bleiben. Sollen wir uns jetzt mal die Liste vornehmen?« Sie zeigte auf das eng bedruckte Blatt zwischen ihnen auf dem Tisch, das die Themen auflistete, mit denen sie sich befassen mussten, und Óðinn nickte, rückte seinen Stuhl zurecht und fing an, den ersten Punkt auf der Liste zu besprechen. Gepflogenheiten zwischen den außerparlamentarischen Ministern und dem Parlament. Sie nickte und hörte mit einem Ohr zu, während sie sein Gesicht studierte. Er ging vermutlich auf die sechzig zu, hatte ergraute Schläfen und feine Fältchen um die Augen, was darauf hindeutete, dass er oft lächelte. Seine momentane Ernsthaftigkeit kam gewiss von der großen Verantwortung, eine neue Ministerin einzuarbeiten.
»Dann sind da deine Assistenten und die Arbeitsaufteilung unter ihnen. Manche wollen einen politischen und einen privaten Assistenten, in dem Fall wäre es gut, wenn diese beiden sich eine Stelle teilen würden, aus Budgetgründen. Hast du schon über Namen nachgedacht?«
»Ich habe noch keine Zeit gehabt, mich mit solchen Fragen näher zu beschäftigen, aber ein paar Meinungen dazu habe ich schon gehört, und zwar aus beiden Parteien. Ich denke, eine Person ist ausreichend«, schloss sie. Das stimmte. Sie hatte nicht mal Zeit gehabt, auch nur zu atmen, seit der Premierminister sie am Montag angerufen und sie gefragt hatte, ob sie Innenministerin werden wollte.
»Dann sind da der Wagen und der Chauffeur …«
»Nein danke«, sagte sie bestimmt, und Óðinn sah erstaunt auf.
»Wie meinst du das?«
»Ganz einfach, ich chauffiere mich selbst«, erklärte sie. Sie war schon immer skeptisch gegenüber Ministern und ihren Dienstwagen gewesen. Natürlich brachte diese Regelung gewisse Annehmlichkeiten mit sich, und zeitsparend war es auch, aber es hatte etwas Wichtigtuerisches, in einer schicken, glänzenden Luxuskarre mit einem Chauffeur zwischen den isländischen Einwohnern herumzukurven, die letztlich dafür zur Kasse gebeten wurden. Das war einfach nicht ihr Stil. Óðinn legte die Liste beiseite und lehnte sich mit nachdenklicher Miene in seinem Stuhl zurück.
»Wie du sicher weißt, ist das einzige, was die scheidenden Minister nach Beendigung ihrer Amtszeit vermissen, ihr Chauffeur. Du kannst auf dem Weg zur und von der Arbeit E-Mails beantworten und ihn Besorgungen machen lassen. Und dann ist er natürlich für deine Sicherheit zuständig. Schaufelt den Schnee von der Treppe, wechselt Glühbirnen und dergleichen.«
»Ich bin übrigens verheiratet«, bemerkte sie, und jetzt musste auch Óðinn grinsen.
»Das können wir später noch besprechen«, sagte er, und obwohl sie nicht vorhatte, dieses Thema weiter auszuführen, nickte sie zustimmend, damit sie auf ihrer Liste weiterkamen. Inzwischen konnte sie ihre Gier nach einer Zigarette kaum noch im Zaum halten und wollte dieses Treffen so schnell wie möglich beenden.
Trotzdem dauerte es noch eine knappe Stunde, bis Óðinn den letzten Punkt auf der Liste abgehakt hatte und aufstand. Er wirkte geradezu hünenhaft, wie er vor ihr aufragte und ihr die Hand reichte. Úrsúla war durch den Nikotinentzug schon ganz benebelt.
»Willkommen im Job«, sagte er. »Zunächst mal sollst du wissen, ich bin immer für dich da, egal um was es geht. Und ich spreche im Namen von uns allen hier im Ministerium, wenn ich sage, dass wir tun werden, was wir können, damit es dir auf diesem Posten gut geht.« Sie erhob sich und griff nach seiner warmen Hand.
»Danke. Tausend Dank«, sagte sie. Mit ihm würde sie gut klarkommen. Sie hatte das im Gefühl. Er lächelte, und sie sah, wie sich die Lachfältchen um seine Augen vertieften. Für einen Moment erinnerte er sie an ihren Vater. Nicht, wie er zuletzt gewesen war, sondern an den, der mit ihr gespielt hatte, als sie noch ein kleines Mädchen war.
»Ach ja, eins noch!«, rief sie ihm hinterher, als er den Sitzungsraum verlassen wollte. »Da war heute morgen so eine Frau hier, die wollte beantragen, dass das Ministerium einer bestimmten Angelegenheit nachgehen soll. Eine Anzeige wegen Vergewaltigung, die offenbar irgendwo im System verschleppt worden ist. Meine Sekretärin hat das als ›formale Angelegenheit‹ eingeordnet. Würdest du da mal einen Blick drauf werfen und mir einen Rat geben, wie ich damit verfahren soll?«
»Selbstverständlich«, antwortete er schon im Türrahmen. »Ich schau’s mir mal an.« Úrsúla sah ihm nach, wie er auf den Gang hinaustrat und auf sein Büro zusteuerte, und während sie angestrengt nach ihrer Zugangskarte zum Ministertrakt wühlte, fiel ihr Blick auf eine blutjunge, dunkelhäutige Frau, die einen Karren mit Reinigungsutensilien vor sich herschob.
»Hi«, grüßte Úrsúla und reichte ihr die Hand. »Ich bin die neue Ministerin. Du weißt nicht zufällig, wo man hier unauffällig nach draußen verschwinden und eine qualmen kann?«
4
Den ganzen gestrigen Tag hatte eine merkwürdige Spannung in der Luft gelegen, die auch heute noch nicht ganz verflogen war. Alles schien irgendwie leiser vor sich zu gehen, und um das Gebäude schwirrten Kuriere und Journalisten. Die Empfangssekretärin unten im Erdgeschoss hatte Stella gebeten, den Eingangsbereich besonders gründlich von dem Schnee zu befreien, den die Leute mit ihren Schuhen und Mänteln hereintrugen, wo er dann schmutzige Wasserlachen bildete. Sie tat ihr Bestes, hastete immer wieder mit ihrem Mopp nach unten und wischte den Fußboden trocken. Sie wollte sich nicht dabei erwischen lassen, ihr Soll nicht zu erfüllen, denn das würde todsicher damit enden, dass der Staatssekretär hinzugerufen wurde, der hier der Oberbefehlshaber zu sein schien und ein Typ war, den Stella verabscheute. Vor ein paar Monaten, als sie hier gerade angefangen hatte, war sie ihm einmal begegnet, da hatte er sie begrüßt und sie freundlich lächelnd willkommen geheißen. Aber Stella hätte am liebsten auf dem Absatz kehrtgemacht und so schnell sie konnte Reißaus genommen, denn die Schwingungen, die von seinem warmen Händedruck ausgingen, bedeuteten nichts als Unglück. Sie war erschreckt zusammengefahren, denn sie hatte ihn für den Typ gehalten, dem das Leben die Sonnenseite zeigt, groß, gut aussehend und mit einem coolen Job, wozu diese dumpfe Traurigkeit, die von ihm auszugehen schien, überhaupt nicht passte. Aber vielleicht waren ihre Antennen in diesem Punkt auch außer Kontrolle geraten. Ihre Mutter hatte immer gesagt, das Geschenk, das ihre Großmutter ihr vererbt hatte, enthalte eine gehörige Portion Fantasie.
»Das ist immer so, wenn ein neuer Minister ins Haus steht. Nichts als Stress, sinnloses Getue und überall Angst und Unsicherheit. Und jedes Mal stellt sich heraus, dass der neue Minister die Freundlichkeit in Person ist«, sagte die Empfangssekretärin. »Ich habe sie gesehen, als sie gestern zur Schlüsselübergabe hier war, und sie schien mir locker und ungezwungen.«
Stella zuckte mit den Schultern. Mit dem scheidenden Minister hatte sie wenig zu tun gehabt, ihn höchstens ab und zu auf dem Gang gesehen, wo er mit dem Handy am Ohr eilig auf und ab schritt. Er hatte sie nie angesprochen, und die neue Ministerin würde das sicher auch nicht tun. Bei der Empfangssekretärin war das etwas anderes. Alle grüßten sie, wenn sie das Gebäude betraten. Nur die Reinigungskräfte waren unsichtbar.
»Ja, sie scheint schon da zu sein«, oder »Hast du sie schon gesehen?«, wurde überall geflüstert, während sie dabei war, die Mülleimer zu leeren. Aber obwohl die Ministerin bereits eingezogen war und ihre Arbeit aufgenommen hatte, schien sie bisher niemand zu Gesicht bekommen zu haben. Natürlich würde sie erst morgen das Wort an die Bediensteten des Ministeriums richten, aber diese gingen wohl davon aus, dass sie sie zumindest wiedererkennen würden, nachdem die gestrigen Abendnachrichten mit einem kurzen Video von der Ministerin und der Schlüsselübergabe berichtet hatten. Manche wollten sie aus der Studierendenpolitik wiedererkennen, andere sagten, sie habe irgendwas im Ausland und mit Geflüchteten gemacht und Aktionen in den Katastrophengebieten organisiert oder so. Aber Stella schaute weder Nachrichten noch las sie die Zeitung, und so hatte sie den Namen dieser Frau nie gehört und ihr Gesicht nie gesehen.
Obwohl Stella schon jetzt wusste, dass sie nicht lange bleiben würde, fand sie es angenehm, hier zu arbeiten. Der Job war ein spezielles, zeitlich begrenztes Programm für Jugendliche, die auf die schiefe Bahn geraten waren, und das Sozialamt übernahm die Hälfte des Gehalts. Dadurch sollten die Leute irgendwie wieder auf die richtige Spur gebracht werden, damit sie dann bei den feineren Adressen der Stadt putzen durften. Die Angestellten im Ministerium hatten sie jedenfalls supernett aufgenommen. Sie waren es zweifellos gewöhnt, Leute im Haus zu haben, die irgendetwas werkelten, von dem niemand etwas verstand, und nach der ersten Woche war sie mit der täglichen Routine im Ministerium so gut wie verschmolzen, und niemand nahm mehr Notiz von ihr. Sie mochte das. Sie mochte es auch, dass während sie unten den Eingangsbereich trocken wischte oder im Dritten und Vierten die Mülleimer leerte, niemand mitkriegte, ob sie anwesend war oder nicht, solange sie sich morgens ein- und nachmittags wieder ausstempelte. Nachmittags kam sowieso ein Putztrupp von einer großen Gebäudereinigungsfirma vorbei und schrubbte das Ministerium von oben bis unten, sodass es eigentlich völlig egal war, was Stella tat und was nicht. Es war der lockerste Job, den sie je gehabt hatte, und Stella hatte den Vergleich, denn sie hatte in ihrem neunzehnjährigen Leben auf dem Arbeitsmarkt schon ausgiebig Erfahrungen gesammelt.
Sie legte den Wischmopp beiseite und schaute auf ihr Handy. Heute Abend bei uns große Party!, lautete Annas Nachricht. Sie sparte sich einen zweiten Blick auf das Display. Es war egal, um welche Anna es sich handelte. Sie waren ein Paar, hießen beide Anna und wurden überall nur »Die Annas« genannt. Und sie schmissen ausufernde Partys und luden nur hübsche oder interessante Mädels dazu ein. Stella wusste genau, dass sie allein wegen ihrer Hautfarbe zu dieser Zielgruppe gehörte. Ihre goldbraune Haut schien auf viele Frauen wie ein Magnet zu wirken, und sie hatte grundsätzlich nichts dagegen, sich einen der wenigen Vorteile zunutze zu machen, die die Zugehörigkeit zu der verschwindend kleinen Minderheit Schwarzer Isländerinnen mit sich brachte. Nach dem letzten Gelage bei den Annas hatte sie sich geschworen, nie wieder hinzugehen, denn sie hatte danach eine ganze Woche gebraucht, um wieder ins Lot zu kommen. Aber jetzt war wieder Freitag, sie war komplett pleite und hatte nichts anderes zu tun, als zu Hause abzuhängen und sich auf Netflix ein paar Serien reinzuziehen, da schien diese Alternative gar nicht mehr so abwegig. Wozu waren Wochenenden schließlich da?
Hab noch was vor und komme später, falls ich komme, schrieb sie zurück. Es konnte nichts schaden, sich ein wenig rar zu machen, indem man so tat, als sei man noch in anderen Kreisen unterwegs. Außerdem kam sie sowieso lieber später, wenn die Party in Gang gekommen war und alle anderen schon ein paar Drinks intus hatten. Dann brauchte sie wenigstens keine zähen Gespräche mehr anzuleiern und aufrechtzuerhalten. Sie hatte das Gefühl, sich dann mehr unter Kontrolle zu haben, obwohl sie tief drinnen genau wusste, dass sie, sobald sie sich bei den großzügig ausgegebenen »Erfrischungen« bedient hatte, im Grunde völlig zügellos war. Erst recht, wenn die Annas Smarties anboten.
Sie strich über ihr neues Ægishjálmur-Tattoo auf dem Unterarm, das sie sich erst vor Kurzem hatte stechen lassen, und hoffte, diese alte Zauberrune, der Helm des Schreckens, würde sie wenigstens davor bewahren, sich sinnlos zu besaufen und mit einer Person nach Hause zu gehen, an der ihr überhaupt nichts lag. Wie zum Beispiel die Nachrichtensprecherin, die bei den Annas immer eingeladen war und die durch ihren Bekanntheitsgrad im Fernsehen zweifellos in die Rubrik interessant fiel, denn hübsch war sie mit Sicherheit nicht. Sie hatte den leisen Verdacht, dass die Annas sie miteinander verkuppeln wollten, aber das Interesse von Stellas Seite war gleich Null. Sie schob ihre Karre mit den Putzutensilien wieder an und hätte beinahe eine Frau über den Haufen gefahren, die sich lachend am Wagen festhielt und ihr dann die Hand entgegenstreckte.
»Ich bin die neue Ministerin«, sagte die Frau und flüsterte dann: »Du weißt nicht zufällig, wo man hier unauffällig nach draußen verschwinden und eine qualmen kann?« Der Vortrag von Staatssekretär Óðinn am Vormittag kam ihr wieder in den Sinn: dass alle Bediensteten, wo immer sie politisch zu verorten seien, allein deshalb hier arbeiteten, um der Ministerin zu helfen, ihre große Verantwortung zu schultern. Weshalb Stella die Ministerin auf den Balkon im Vierten bugsierte, wohin sie sich selbst meist zum Rauchen verzog. Wie sollte die Ministerin schließlich ihre große Verantwortung schultern, wenn sie nicht zwischendurch mal eine rauchen konnte.
5
Gunnar mobilisierte seine äußersten Kräfte, um das Gewicht zum letzten Mal zu stemmen. Seine Schultern schrien vor Schmerz, und er glaubte zu spüren, wie die Muskelfasern in seinen Oberarmen unter der Hochspannung zu reißen begannen. Im Bankdrücken war er inzwischen bei 150kg angelangt, das vierte Anheben war eine Plackerei und das Fünfte die Hölle. Aber trotzdem fürchtete er nicht, das Gewicht könne ihm aus den Händen gleiten und auf seinem Brustkorb landen, weswegen er sich nicht die Mühe machte, jemanden vom Fitness-Team des Clubs zu bitten, sich neben ihn zu stellen und im schlimmsten Fall einzugreifen. Er selbst war derjenige, der zur Hilfe kommen sollte, wenn es hart auf hart kam. Sein gesamtes Erwachsenenleben hatte er sich auf diese Rolle vorbereitet, und insgeheim wusste er, eines Tages käme der Tag der Abrechnung, und da würde er, und nur er allein, über Leben und Tod entscheiden.
»Genau! Gib’s ihm. Gib ihm Saures«, rief ein Mann im Vorbeigehen, was darauf hindeutete, dass Gunnar beim Trainieren hörbar geächzt und gestöhnt haben musste. Er holte ein paarmal tief Luft, bevor er wagte aufzustehen. Sein nassgeschwitzter Rücken klebte an der Bank, und vor seinen Augen tanzten schwarze Flecken. Er war zufrieden mit seiner Leistung. Jetzt brauchte er nur noch eine kräftige Mahlzeit, damit sich die Muskeln nach dem Training wieder aufbauen konnten. Für seinen Geschmack könnten sie ruhig noch etwas stattlicher werden, und das war keine Eitelkeit, sondern hatte mit seiner Arbeit zu tun. In seinem Job hatte man es als muskelbepackter Typ einfach leichter, auch wenn es natürlich in erster Linie auf die Kraft ankam. Auf Kraft und Mut.
Er verbrachte geraume Zeit unter der Dusche und genoss das Gefühl, wie sich alle Poren öffneten und der Schweiß herausgespült wurde. Das Gewichtheben erzeugte in ihm eine Art Euphorie, so wie der Sieg des Willens über den Körper ihn mit Stolz erfüllte. Beim Laufen war es anders. Zum Laufen musste er sich immer zwingen, und hinterher fühlte er sich nicht besonders. Aber in seinem Job musste man, wenn es drauf ankam, auch mal einen Sprint hinlegen können, obwohl er bezweifelte, dass es je dazu kam. Er stieg in seine Hose und beschloss, das Unterhemd unter dem Hemd wegzulassen. Ihm war so heiß, seine Haut schien zu glühen.
Er stopfte seine Sachen hastig in die Sporttasche, zog sich das Hemd über, knöpfte es zu und steckte die Krawatte in seine Hosentasche. Die könnte er auch im Auto noch binden. Dann griff er nach seinen Schuhen, ging barfuß durch den Vorraum des Fitness-Clubs und geradewegs hinaus in den Schnee. Zuerst schnappte er nach Luft vor Kälte, doch dann wurde er von einem eiskalten Glücksgefühl überwältigt. Der weiche Schnee trat zwischen den Zehen hervor und knirschte beruhigend bei jedem Schritt. Als er bei seinem Auto ankam, waren seine Füße taub vor Kälte, und das Brodeln in seinem Körper hatte aufgehört. Er fühlte sich gut. Jetzt würde er sein Hemd nicht mehr durchschwitzen. Er schaltete die Heizung an und richtete den warmen Luftstrom auf seine Füße, um sie zu trocknen, während er sich die Krawatte band. Dann zog er Socken und Schuhe an, aber noch ehe er seine Schnürsenkel gebunden hatte, klingelte sein Handy. Als er die Nummer sah, schaute er blitzschnell auf die Uhr, doch er hatte keine Eile. Er musste erst in einer Stunde unten im Ministerium sein.
Enttäuschung kroch in ihm hoch, als er das Telefon weglegte, und wieder einmal gab er sich dem deprimierenden Gefühl hin, dass Island und er nicht zusammenpassten. Alles, was man in der Personenschutzausbildung lernte, wie erst kürzlich im Fahrsicherheitstraining, würde in diesem kleinen Land vermutlich nie zur Anwendung kommen. Er hatte geglaubt, dass das Regierungsgebäude der richtige Platz für ihn wäre, und man hätte ihn dort auch mit Handkuss genommen, denn der Polizeipräsident ordnete für die Spitzenpolitiker immer öfter Personenschutz an. Aber diese wenigen ernsthaften Jobs hatten meist zahlreiche Bewerber, und die einzige Anstellung, die ihm nun blieb, war der Posten, den er schon seit vielen Monaten bekleidete – Türsteher im Ministeriumsgebäude. Er schluckte die Enttäuschung hinunter und fluchte im Stillen vor sich hin. Was für eine Ministerin war das überhaupt, die keinen Chauffeur wollte?
6
Er stapfte durch tiefen Schnee, als er die Ingólfsstræti auf und ab ging, während er den Verkehr vor dem Ministerium beobachtete. Er hatte versucht hineinzukommen, aber der Sicherheitsbeamte, der hinter dem Empfangstresen am Computer saß, hatte ihn angeschnauzt, er solle gefälligst draußen bleiben. Er bog um die Ecke des Gebäudes und stieg die Treppenstufen hoch bis unter die Balkons, die auf die Sölvhólsgata hinausgingen. Die Tür dort war abgeschlossen, also schlich er weiter um das Gebäude herum und spähte hinauf zu den Fenstern in der Hoffnung, einen Blick auf die Ministerin zu erhaschen.
Hin und wieder blieb er stehen und zog das Bild heraus, das er aus der Zeitung ausgerissen hatte, und betrachtete es. Es gab keinen Zweifel, er war es. Verdammte Scheiße. Und an seiner Hand die kleine Úrsúla, aber nicht mehr das kleine Mädchen mit dem Kurzhaarschnitt, sondern eine erwachsene Frau in einer eleganten Jacke, das Haar zu einem stattlichen Knoten hochgesteckt. Was bildete sie sich eigentlich ein, mit ihm Händchen zu halten? Er versuchte, in ihren Augen auf dem Zeitungspapier irgendeine Antwort zu lesen, aber das Foto war zu grobkörnig, als dass er erkennen konnte, ob sich dieses kleine Mädchen irgendwo im geradlinigen Verlauf ihres Lebens selbst abhanden gekommen war und sich nun dem Bösen verschrieben hatte.
An der Ingólfur-Statue am Arnarhóll blieb er stehen, drehte sich um und blickte die Straße hinunter. Es war schon spät und er hatte sie immer noch nicht herauskommen sehen. Wenn er es sich recht überlegte, hatte er überhaupt nur eine Handvoll Leute dort unten am Eingang beobachtet. Es waren immer dieselben Gesichter, die hineingingen und wieder herauskamen, aber jetzt war nur noch in wenigen Fenstern Licht und von den Angestellten niemand mehr zu sehen. Das hier schien die Hintertür des Gebäudes zu sein. Er eilte die Straße wieder hinab in Richtung Ministerium, am Sölvhólsgata-Eingang vorbei und auf den Parkplatz hinter dem Haus, und diesmal wurde er fündig. Von diesem Hof aus, zwischen dem Hotel und dem Ministeriumsgebäude, entdeckte er noch einen weiteren Eingang ins Innenministerium, direkt über dem unteren Parkdeck, das man von der Sölvhólsgata aus nicht gleich sah. Diese Parkfläche war für gewöhnliche Autos gesperrt und hatte eine von diesen automatischen Schranken an der Einfahrt, die der Fahrer mit einer bloßen Handbewegung öffnen konnte. Für Fußgänger war es dagegen zugänglich, also schlurfte er die Treppe hinunter und betrat das Parkdeck. Die Parkplätze direkt am Eingang waren unbezeichnet, weiter in Richtung Ministerium sah er eine Fläche, die durch ein blaues Schild als Behindertenparkplatz ausgewiesen war. Dahinter kamen die Parkplätze, nach denen er suchte. Die Plätze für den Minister, jetzt die Ministerin, und den Staatssekretär. Beide waren besetzt. Auf dem mit »Staatssekretär« beschrifteten Parkplatz stand eine großer, schwarz glänzender Jeep mit getönten Scheiben, auf dem anderen ein ziemlich durchschnittlicher kleiner Toyota. Er wusste sofort, dass dieses Auto Úrsúla gehörte. Er brauchte nicht einmal auf das Schild vor der Kühlerhaube zu schauen. Der Toyota war schon seit Längerem nicht mehr gründlich von Schnee und Eis befreit worden, sodass sich auf dem Dach wie auch auf dem Kofferraum und der Kühlerhaube dicke Eisschichten gebildet hatten – typisch für die kleine Úrsúla, die mit ihren Gedanken ständig überall war, nur nicht dort, wo sie sollte. Er zog seinen Jackenärmel über die Hand und wischte den Schnee von der Windschutzscheibe. Úrsúla würde sich bald auf den Heimweg machen, und dann wäre sie froh, die Scheibe nicht freikratzen zu müssen. Sorgfältig wischte er alle Scheiben frei, dann zog er sein Notizbuch hervor, riss ein Blatt heraus und schrieb Úrsúla eine Nachricht. Zu dumm, dass es wieder angefangen hatte zu schneien. Hinter den Scheibenwischer geklemmt, wäre der Zettel nach kürzester Zeit durchweicht und unleserlich. Er legte die Hand um den Türgriff des Autos, und das Glück war ihm hold. Die Tür ließ sich öffnen, sodass er die Nachricht an Úrsúla direkt auf den Sitz legen konnte, wo er ihr beim Einsteigen gleich ins Auge fallen würde. Er grinste. Auch das war typisch für den kleinen Wirbelwind: zu vergessen, ihr Auto abzuschließen.
7
Úrsúla war selbst überrascht, wie heftig sie beim Entdecken des Zettels zusammenzuckte. Erstens ärgerte sie sich über sich selbst, dass sie offenbar zu dämlich war, ihr Auto abzuschließen. Und zweitens hatte sie nicht daran gedacht, dass sie, indem sie auf dem »Minister«-Parkplatz geparkt hatte, öffentlich zur Schau stellte, was für ein Auto sie fuhr. Es war abzusehen, dass die Chaoten des Landes sich wie immer zu allem und jedem – die Ernennung zur Innenministerin eingeschlossen – ihre eigene Meinung bildeten.
Wer sich mit dem Teufel einlässt, verkauft seine Seele und bringt das Böse über sich stand auf dem Zettel, gefolgt von einem unleserlichen Gekritzel. Wie es schien, war irgendjemand der Überzeugung, sie habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Natürlich war es nichts Neues, dass Politiker Nachrichten dieser Art bekamen, die sich auf ihre Kooperation mit der amtierenden Regierung bezogen, deren Arbeit nicht jedem gefiel. Aber sie war überparteilich und deshalb davon ausgegangen, nicht in die Schusslinie derartiger Kritik zu geraten. Die Leute mussten sich doch langsam an die Zusammenarbeit der Parteien gewöhnt haben, schließlich war die Legislaturperiode schon weit fortgeschritten und sie nur deshalb auf den Plan gerufen worden, um verschiedene Projekte ihres Vorgängers Rúnar zu Ende zu führen, der sein Amt aus gesundheitlichen Gründen hatte niederlegen müssen. Sie knüllte das Blatt zusammen und warf es hinter sich zwischen die Sitze. Auf einen Papierschnipsel mehr oder weniger kam es bei diesen Unmengen von Verpackungsmüll, Saftkartons und Bonbonpapierchen, die sich in ihrem Auto angehäuft hatten, nun auch nicht mehr an. Sie würde sich den Wagen am Wochenende mal gründlich vornehmen, inzwischen konnte man den Dreck förmlich riechen. Sie seufzte und versuchte, ihr Herzklopfen im Zaum zu halten. Sie war von Anfang an darauf gefasst gewesen, dass sie nicht bei allen gleichermaßen beliebt sein würde, und sie war ebenso darauf gefasst, dass sie von den Meinungen der Leute erfuhr. Aber der Zettel in ihrem Auto irritierte sie doch. Er war irgendwie zu nahe dran, zu persönlich. Ab jetzt würde sie den Wagen auf dem oberen Parkplatz abstellen, dem für die gewöhnlichen Angestellten.
Während sie auf dem Bürgersteig vor ihrem Haus einparkte, kurbelte sie mühsam die Fensterscheibe hoch. Wegen dem Gestank war sie mit offenem Fenster gefahren. Irgendwo in dem Unrat hinter ihrem Sitz musste sich ein halb gegessenes, angeschimmeltes Sandwich oder etwas Ähnliches verstecken. Sie durfte nicht vergessen, Nonni zu bitten, das Auto zu reinigen. Angesichts der E-Mails und der Checkliste, die sie über das Wochenende mit nach Hause genommen hatte, würde sie wohl eher nicht dazu kommen, das selbst zu erledigen. Sie würde die Zeit nutzen, um sich buchstäblich in alles hineinzuversenken, was im Ministerium gerade auf der Tagesordnung stand.
»Gratuliere, mein Schatz«, rief Nonni, als sie die Eingangstür öffnete. »Du hast den ersten Tag überlebt!« Kátur rannte ihr übermütig entgegen. Der kleine, haarige Körper zappelte vor Freude, sie zu sehen, und wie gewöhnlich ging sie in die Hocke, um ihn zu begrüßen. Sie nahm seinen zierlichen Hundekopf zwischen beide Hände, gab ihm einen Kuss auf die weiche Stirn und atmete dabei seinen Geruch ein. Er war offenbar frisch gebadet. Nonni steckte ihn regelmäßig in die Badewanne und seifte ihn mit Shampoo ein, obwohl Úrsúla ihm immer wieder sagte, dass das nicht gut für Hunde sei.
»Danke für die Begrüßung, mein Guter«, flüsterte sie in das Fell des Tieres, das nun eifrig mit dem Schwanz wedelte. Es war nicht übertrieben zu behaupten, dass sie diesen Hund liebte. Er war ihr Lebensretter gewesen, als sie zurück nach Island gegangen waren. Der Kompass, der ihr den Weg zur Liebe zeigte. Ihr zeigte, wie sie die Waffen niederlegen und versuchen konnte, ihre Rüstung zu lockern, die sie sich irgendwo zwischen dem Ebola-Fieber in Liberia und den Flüchtlingslagern in Syrien zugelegt hatte. Der Hund löste sich aus ihrem Griff und lief ein Stück in die Wohnung hinein, kehrte um und rannte zu ihr zurück. So lief die Begrüßung jedes Mal ab, er rannte zwischen ihr und der Familie hin und her, so als wolle er ihr den Weg zu den anderen zeigen. Und tatsächlich hatte sie einen solchen Wegweiser auch bitter nötig, denn seitdem sie wieder in Island waren, fühlte sie sich irgendwie abgetrennt von den anderen, so als gäbe es eine Art unsichtbaren Raumteiler zwischen ihr und ihrer Familie, den sie nicht durchdringen konnte.
Sie holte tief Luft und atmete den heimeligen Geruch ein, und für einen Moment begann sie zu zweifeln, ob es die richtige Entscheidung gewesen war, sich so spontan auf diesen Ministerposten einzulassen. Er bedeutete unausweichlich weniger Zeit zu Hause, weniger Energie für die Kinder, weniger Aufmerksamkeit für Nonni. Weniger Zeit, um ihr Gefühlschaos wieder in Ordnung zu bringen. Aber es war ja nur für ein Jahr. Nur ein Jahr, bis die Legislaturperiode zu Ende war.
»Pizza!«, riefen die Kinder im Chor, als sie die Küche betrat. Sie waren dabei, den Pizzateig nach ihren Vorlieben zu belegen, während Nonni für sie beide offenbar eine Hummerpizza vorbereitete. Auf der Küchenbank stand eine offene Flasche Weißwein; ein Glas für sie war bereits eingeschenkt, und der Esszimmertisch war festlich mit Kerzenlicht eingedeckt.
»Ihr seid die Besten«, seufzte sie, küsste die Kinder auf die Stirn und nahm Nonni in den Arm. Er fühlte sich warm an, war glatt rasiert und duftete, und sie spürte, wie ihr Herz für einen Moment weich wurde vor Dankbarkeit, die zugleich von Zweifel durchsetzt war, ob sie einen so perfekten Mann überhaupt verdiente. Das ging schon seit mehr als einem Jahr so. Jedes Mal, wenn sie ihm gegenüber Liebe oder Wärme empfand, drängte sich in ihrem Inneren sofort ein bitteres Gefühl dazwischen. Schuldbewusstsein, Reue, Selbsthass. Warum konnte sie ihn nicht einfach lieben, so, wie sie ihn früher geliebt hatte?
»Und, wie war’s?«, flüsterte er und reichte ihr den Wein. Sie setzte sich auf den Barhocker und nippte an ihrem Glas. Sie würde ihm heute Abend, wenn die Kinder im Bett waren, erzählen, wie der Tag begonnen hatte. Wie es ihr ergangen war, als sie gut vorbereitet ihr erstes Gespräch führte. Und sie würde ihm von den hochkomplizierten Aufgaben erzählen, in die sie sich sofort stürzen musste. Aufgaben, die sie in jeder Hinsicht herausforderten, wie etwa die, mit einer derart heftigen und persönlichen Angelegenheit konfrontiert zu werden. Das Gesicht der Mutter, die in ihrem Büro vor ihr gesessen hatte, verzerrt vor Trauer und Wut, stand ihr noch lebhaft vor Augen. Sie beobachtete ihre eigene Tochter, die gerade Paprikastreifen zu einem Muster auf ihrer Pizza anordnete. Es tat ihr in der Seele weh, als sie sich klarmachte, dass sie gerade mal zwei Jahre jünger war als das Mädchen, das vergewaltigt worden war.
SAMSTAG
8
Der Knall war so laut, dass Úrsúla nicht wusste, ob es der Lärm selbst oder die Druckwelle der Explosion war, die ihre Trommelfelle nach innen drückte und sie in dieser Stellung lähmte, sodass sie, mit dem Gesicht nach unten, in vollkommener Stille auf dem Boden lag. Am Rand ihres Sichtfeldes sah sie, wie sich etwas bewegte, doch die Sicht inmitten der Staubwolke war stark begrenzt, also blieb sie regungslos liegen, kaute auf dem Sand, der ihr Mund und Nase verklebte, und genoss, wie das aufwallende Glücksgefühl, noch am Leben zu sein, sie durchströmte. Sie wollte dieses Gefühl so lange auskosten, wie sie konnte, denn in Kürze würde sie aufstehen und der Tatsache ins Auge sehen müssen, dass die Bombe nicht weit von den Aufnahmelagern eingeschlagen war, wenn nicht sogar in unmittelbarer Nähe, und dementsprechend ihren Tribut gefordert hatte. Und dann würde sie das schlechte Gewissen beschleichen, dass sie noch am Leben war, und sie würde wieder in die dumpfe Starre abgleiten, die sie in Liberia im Griff gehabt hatte. Die Stille in ihrem Kopf riss allmählich auf und sie bemerkte auf einmal ein unterdrücktes Schreien und Weinen, und sie stützte sich mit den Händen auf und versuchte, sich auf die Füße zu hieven. Es war höchste Zeit, die Menschen, die im Flüchtlingslager Schutz gesucht hatten, über die Grenze nach Jordanien zu bringen.
Úrsúla schreckte zu Hause in Reykjavík auf ihrem Sofa von ihrem eigenen Herzklopfen auf. Im Fernseher lief ein Zeichentrickfilm, der zweifellos zur Unterhaltung von Kleinkindern gedacht war, die zu einer solch unchristlich frühen Zeit schon wach waren. Sie seufzte tief und wünschte sich für ein paar Sekunden zurück nach Syrien, zurück zu dem Moment, nachdem die Bombe hochgegangen war, als das Leben in ihren Adern pulsierte und ihr Dasein einen Zweck zu haben schien. Als sie das Gefühl hatte, ein Ziel, wenn nicht eine Berufung zu haben. Als sie dafür verantwortlich war, die Überlebenden und die Notleidenden, die Verängstigten und die Verletzten in Sicherheit zu bringen.
Sie wusste nicht, ob sie geschlafen oder sich verworrenen nächtlichen Tagträumen hingegeben hatte, so als ob sie im Geiste nach Erinnerungen suchte, die ihr erstarrtes Gefühlsleben aufrütteln konnten, um es durchzukneten und zu trainieren, bis es wieder Fuß fasste. Kátur, der sich zu ihren Füßen zusammengerollt und gedöst hatte, kroch auf dem Bauch an ihrem Körper entlang nach oben, bis seine kalte, feuchte Schnauze an ihrem Hals lag und sie seinen Atem an ihrer Wange spürte. Es war, als ob der Hund ihre Gedanken entschlüsseln konnte, und jedes Mal war sie ganz gerührt über die Zuneigung, die er ihr entgegenbrachte. Sie hatte Gefühle für ihn, und das bedeutete Gewissheit und Trost, denn wenn sie diesen muffig riechenden Zottelpelz lieben konnte, dann musste sie auch die Fähigkeit besitzen, ihren eigenen Nachwuchs zu lieben.
Úrsúla setzte sich auf und schüttelte die Empfindlichkeiten von sich ab. Kátur fixierte sie und wartete geduldig. Wenn sie jetzt aufstand, würde er freudig um sie herumspringen, als wäre sie gerade nach Hause gekommen, und dann an der Hintertür winseln, damit sie ihn zum Pinkeln in den Garten ließ. Sie würde solange in der Türöffnung stehen und ihre Lungen mit der kalten isländischen Luft füllen, dann würde sie Kaffee kochen und sich für den Tag zurechtmachen. Sie hatte noch einen dicken Stapel Akten durchzuarbeiten, sich in Gesetzestexten und Richtlinien über Einwanderungsbelange schlauzumachen und eine Aufgabenliste für die nächste Woche zu erstellen. Es war ziemlich klar, dass sie ihre Zeit nicht selbst einteilen würde, oder höchstens zum Teil, also musste sie die wenigen Stunden, die ihr zur Verfügung standen, verdammt gut nutzen.
9
Es waren die Erwartungen, die die Enttäuschung nach sich zogen. Hätte er sich nicht bereits in seinem Traumjob gesehen, wäre er jetzt nicht so ernüchtert. Obwohl Gunnar sich mit den Lebensregeln des Buddhismus auskannte und sie sich durch Meditation versuchte anzueignen, mitsamt den Versprechungen, die daraus hervorgingen, fiel es ihm trotz allem noch immer schwer, ganz auf diese Lehre zu vertrauen. Deshalb war es besser, sich gleich zu Anfang klar zu machen, dass die Milch verschüttet war. Dass es mit dem Traumjob nichts werden würde. Dass das Leben schon zu Ende war.
Er saß mit gekreuzten Beinen, die Hände entspannt auf den Knien, und konzentrierte sich darauf, ruhig ein- und auszuatmen und an nichts anderes zu denken als an den Luftstrom, der über seine Oberlippe und in seine Nasenlöcher strich und dann hinunter in die Lunge gelangte, wo er das Blut mit frischem Sauerstoff versorgte, wobei er zugleich das Kohlendioxid aufnahm und es auf demselben Weg wieder aus seinem Organismus beförderte. In seinem Kopf schwirrten Szenen aus Tagträumen, in denen ihm seine Kraft und seine Scharfsichtigkeit zugute kamen, um eine wichtige Person vor Gefahren zu beschützen, und er musste diese Gedanken immer wieder verdrängen und von sich weisen, um sich weiterhin auf die Luft zu konzentrieren, die in seinen Körper und wieder aus ihm herausströmte.
Meditieren tat ihm immer gut, auch wenn er nie länger als fünf Minuten durchhielt. Auch jetzt war er hinterher beim Aufstehen irgendwie ruhiger als vorher, obwohl die Enttäuschung noch immer in ihm schwelte und er ganz einfach stinksauer war. Immerhin war er erleichtert, dass er keinen Anflug von Wut in sich spürte. Wut war, was er am meisten fürchtete, denn die Wut war der Vorbote der Aggression. Das hier war nur eine Enttäuschung. Er hatte sich darauf gefreut, diesen Job zu beginnen, sich gefreut, das Dienstfahrzeug und die Ministerin kennenzulernen, sich gefreut, diesen Job ernst zu nehmen und ihn besser zu machen als jemals jemand in Island.
Am meisten quälte ihn die Gewissheit, von seinen Träumen und Wünschen einmal abgesehen, dass er alle Fähigkeiten besaß, die notwendig waren, um ein guter Bodyguard zu sein. Die Wichtigkeit dieses Jobs war ihm bewusst, und dass er nicht zuletzt darin bestand, ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, damit der oder die, die er bewachen sollte, ihre Arbeit angstfrei erledigen konnte. Aber er besaß auch Intuition. Und Intuition, das hatte sein Hauptausbilder in der amerikanischen Fachschule für Personenschutz zu ihm gesagt, sei die wichtigste Eigenschaft eines Leibwächters. Intuition war eher fühlen als wissen und eher spüren als sehen. Und last but not least: wagen, diesem Gespür zu vertrauen.
Er streckte beide Arme in die Luft und beugte sich dann nach vorne, um den Rücken nach der Sitzhaltung zu dehnen, und als er sich wieder aufrichtete, spürte er, wie in ihm eine Hoffnung aufkeimte. Minister kommen und gehen, im schlimmsten Fall hatte er noch ein Jahr bis zur nächsten Parlamentswahl, und dann würden in der Regierung die Karten neu gemischt, es gab Leute, die nichts gegen einen Chauffeur einzuwenden hatten, und nebenher könnte er sich schon einmal im Ausland umschauen.
»Wo soll man sich in dieser Wohnung eigentlich hinsetzen?«, fragte Íris, als sie, aus dem Schlafzimmer kommend, das Wohnzimmer betrat, in einem alten Kurzarmshirt aus seinem Schrank und mit verstrubbeltem Haar, das in alle Richtungen stand. »Schließlich können nicht alle so endlos auf dem Fußboden hocken wie du.« Er grinste und zeigte auf das Sofa.
»Da ist ja der Boden noch besser«, bemerkte sie. »Dieses Sofa zählt nicht als Sitzgelegenheit.« Sie hatte recht, das Sofa war weder schick noch sonderlich bequem, aber es war ein ausgezeichnetes Symbol seiner Ich-bin-genügsam-Lebensphilosophie. Íris kapierte das nicht und beklagte sich jedes Mal über seinen Minimalismus, ob sie bei ihm übernachtete oder zu Besuch war. Er stand auf und ging zu ihr hinüber, während sie an der Küchenbank lehnte und einen Tetrapak Proteinshake schüttelte.
»Guten Morgen, schöne Frau«, sagte er und strich ihr durch das dunkle Haar. Sie küsste ihn.
»Guten Morgen, schöner Mann«, erwiderte sie. Sie war wundervoll, wenn sie so war, und er spürte wieder die Schmetterlinge im Bauch wie so oft, wenn er sie eine Weile nicht gesehen hatte oder wenn sie so sanft und anschmiegsam war. Wenn sie sich im Griff hatte.
10
Die Zeit war zu einem einzigen endlosen Strom geworden, und immer, wenn Stella auf die Uhr sah, war es sieben, und sie wusste nie, ob es sieben Uhr abends oder morgens war. Eigentlich hatte sie den ganzen Abend darauf gewartet, dass die Clique irgendwohin zum Tanzen weiterzog, aber der Aufbruch wurde immer wieder herausgezögert, und schließlich tanzten sie einfach im Wohnzimmer. Auf einmal langweilte sie sich und überlegte zu gehen, wobei sie nicht wusste, ob es an dem Mangel an attraktiven Frauen auf der Party lag oder an der Nachrichtensprecherin, die sich an ihre Fersen geheftet hatte, um sie in eine Unterhaltung zu verwickeln oder einfach, um sie anzustarren.
»Come on, meine Süße, gib ihr doch ne Chance«, sagte Anna A in dem mütterlich fürsorglichen Ton, in dem die Annas sie immer anredeten, und strich ihr liebevoll über die Wange. Stella konnte der Berührung entnehmen, dass auch Anna ziemlich high war und es nicht danach aussah, als wollte diese Party in irgendeinen Club weiterziehen. Das hier würde erst mal so weitergehen, unter Umständen bis weit in den Sonntagmorgen.
»Willst du noch ein Smartie?« Stella schüttelte den Kopf, nahm einen Schluck Wasser aus dem Glas, das Anna ihr reichte, und schlenderte wieder ins Wohnzimmer. Ein paar Mädels tanzten, andere saßen auf dem Sofa und quatschten, darunter die Nachrichtensprecherin, die letztlich doch noch in Fahrt gekommen zu sein schien. So würde sie ihr wenigstens nicht mehr von einem Zimmer zum nächsten hinterherdackeln. Die zweiflüglige Terassentür stand offen, und Stella ging nach draußen und atmete die frische Nachtluft. Im Hotpot saßen drei Frauen und sangen, und ihre Stimmen klangen in ihren eigenen Ohren garantiert besser als in Wirklichkeit. Sie konnte sich jetzt in den Hotpot fläzen und lauthals mitsingen oder im Wohnzimmer mittanzen, aber sie war die Liste schon ein paarmal durchgegangen, irgendwo in diesem zeitlosen Rausch zwischen sieben Uhr und sieben Uhr. Ihr war schwindelig und so heiß, dass sie dachte, ihr Kopf würde zerspringen, also ging sie wieder ins Haus, schnappte im Flur ihre Jacke, öffnete die Haustür und trat hinaus in die kühle Stille.
Draußen auf der Treppe stand die Nachrichtensprecherin und hatte ihren Schal um den Hals und über Mund und Nase gewickelt, so als wolle sie sich vermummen und das Bedauern kaschieren, das sich beim Passieren dieser Tür unausweichlich einstellte.
»Das ist doch jedes Mal derselbe Schwachsinn«, sagte sie durch ihren Schal. »Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich immer wieder hingehe. Ich mach mir doch gar nichts aus Ecstasy oder solchem Zeug.«
»Kommst du nicht hauptsächlich, um mich anzuglotzen?«, fragte Stella und knöpfte ihre Jacke zu, wobei ihr auffiel, wie weich die Knöpfe waren. Sie blieb stehen und strich mit dem Zeigefinger darüber. Das waren ganz gewöhnliche Plastikknöpfe, und sie hatte keine Ahnung, warum sie ihre ebenmäßige Oberfläche bisher nie wahrgenommen hatte.
»Man wird ja wohl noch träumen dürfen«, sagte die Nachrichtensprecherin. »Das ist garantiert der einzige Grund, weshalb ich hier bin.«
»Ich hatte den Eindruck, du hast dich vorhin auf dem Sofa ganz gut unterhalten. Als ob du dabei gewesen wärst, mit jemandem anzubandeln«, sagte Stella und strich mit den Fingerkuppen weiter über ihre Jackenknöpfe. Glatt und weich.
»Aber nur so lange, bis was Besseres in Sicht war«, erwiderte die Frau und stakste vorsichtig die vereiste Treppe hinunter, und die Verbitterung in ihrer Stimme war nicht zu überhören. »Bye«, sagte sie schließlich, ohne sich noch mal umzudrehen, und ging. Stella sah ihr hinterher, wie sie sich entfernte, in ihrem dicken Mantel und mit dem Schal um den Kopf, und gleichzeitig auf offenen High Heels, in denen sie einen komischen Gang hatte und mit Sicherheit sofort nasse Füße bekam. Beim Anblick dieser Schuhe spürte sie ein leichtes Ziehen in der Brust. Die Nachrichtensprecherin hatte ganz offensichtlich diese hohen Schuhe angezogen, um auf der Party gut auszusehen, oder genauer gesagt, um zu versuchen, gut auszusehen, mit ihren streng nach hinten gekämmten, hochgesteckten Haaren, so als wäre sie gleich auf Sendung, und es schien ihr nicht mal aufzufallen, dass diese Frisur sie locker zwanzig Jahre älter machte.
»Hey!«, rief sie hinter ihr her. »Hast du Lust, zusammen noch irgendwo was zu essen zu holen?« Die Nachrichtensprecherin blieb abrupt stehen und drehte sich um.
»Und wo?«, fragte sie. Stella zuckte mit den Schultern.
»Egal, irgendwo. Ich habe keine Ahnung, ob es Abend oder Morgen ist, also weiß ich nicht, was wo offen hat. Sushi oder Hlöllis Sandwiches oder was auch immer hier in der Nähe ist. Ich hab auf einmal einen wahnsinnigen Kohldampf.« Die Nachrichtensprecherin schaute auf die Uhr und räusperte sich.
»Es ist sieben Uhr abends. Samstagabend.«
»Wow, diese Partys machen mich immer ganz konfus. Ich hätte schwören können, es ist Samstagmorgen.« Die Nachrichtentante lächelte.