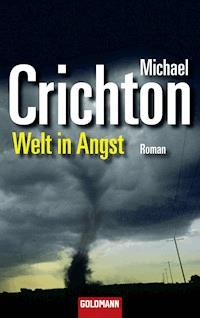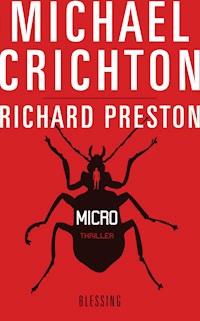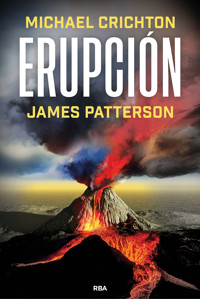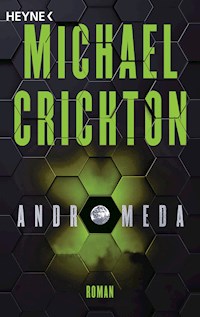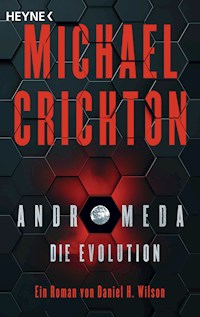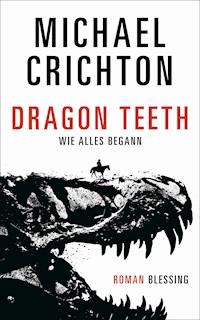9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Forschungslabor mitten in der Wüste von Nevada: Hier werden mit Hilfe der Nanotechnologie Miniaturkameras für die Kriegsführung entwickelt, die auf der Struktur von Bakterien aufbauen. Aber eines Tages können einige dieser Mikroroboter aus dem Labor entweichen, und nun machen sie Jagd auf alles, was in der Wüste lebt: Schlangen, Kaninchen – und Menschen. Der Biotechnologe Jack Forman soll den Killerschwarm vernichten. Doch er steht vor einer scheinbar hoffnungslosen Mission …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sammlungen
Ähnliche
»Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden fünfzig bis hundert Jahren eine neue Kategorie von Organismen entstehen wird. Diese Organismen werden insofern künstlich sein, als sie ursprünglich von Menschen entworfen wurden. Sie werden sich jedoch vermehren und ihre ursprüngliche Form ›evolutionär‹ verändern; sie werden entsprechend jeder vernünftigen Definition des Wortes ›lebendig‹ sein […]. Das Tempo des evolutionären Wandels wird extrem hoch sein […]. Die Auswirkungen für die Menschheit und die Biosphäre könnten ungeheuer sein, größer als die der industriellen Revolution, der Atomwaffen oder der Umweltverschmutzung. Wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, um die Entstehung künstlicher Organismen zu steuern.«
Doyne J. Farmer und Alletta d’A. Belin
»Viele Menschen, mich eingeschlossen, haben ein ungutes Gefühl, wenn sie an die Folgen dieser Technologie für die Zukunft denken. Das Ausmaß der möglichen Veränderungen ist gewaltig, und es besteht die große Gefahr, dass die Gesellschaft ohne ausreichende Vorbereitung nur sehr schlecht damit umgehen wird.«
K. Eric Drexler
EINFÜHRUNG:
Künstliche Evolution im 21. Jahrhundert
Die Vorstellung von der fortwährenden Entwicklung der Welt ist ein Gemeinplatz, und nur selten machen wir uns seine volle Tragweite bewusst. Für gewöhnlich denken wir dabei zum Beispiel nicht an eine epidemische Krankheit, die ihren Charakter verändert, während sich die Epidemie ausbreitet. Ebenso wenig stellen wir uns vor, dass sich Evolution an Pflanzen und Tieren binnen Tagen oder Wochen vollzieht, aber dem ist so. Und normalerweise betrachten wir die grüne Welt um uns herum nicht als den Schauplatz eines immer währenden Krieges mit hochkomplizierten chemischen Waffen, wo Pflanzen Pestizide produzieren, wenn sie von Insekten angegriffen werden, die ihrerseits Widerstandsformen entwickeln. Aber genau das ist der Fall.
Wenn wir die wahre Natur der Natur erfassen, die wahre Bedeutung von Evolution begreifen könnten, dann würden wir uns eine Welt vorstellen, auf der sich jede Pflanzen-, Insekten- und Tierart von Augenblick zu Augenblick verändert, weil sie auf alle anderen Pflanzen-, Insekten- und Tierarten reagiert. Ganze Populationen von Organismen entstehen und vergehen, bewegen und verändern sich. Dieser rastlose und unaufhörliche Wandel, so unerbittlich und unaufhaltsam wie Meereswellen und Gezeiten, impliziert eine Welt, in der alles menschliche Handeln zwangsläufig unberechenbare Folgen hat. Jenes Gesamtsystem, das wir Biosphäre nennen, ist derart kompliziert, dass wir im Voraus nicht wissen können, welche Auswirkungen unser Tun haben wird, niemals Veränderungen auch nur ansatzweise voraussagen werden können.1
Deshalb haben in der Vergangenheit selbst unsere bestgemeinten Bemühungen unerwünschte Folgen gehabt; entweder weil wir zu naiv waren oder weil diese sich kontinuierlich wandelnde Welt unberechenbare Reaktionen auf unser Handeln zeigte. So gesehen, ist die Geschichte des Umweltschutzes ebenso entmutigend wie die Geschichte der Umweltverschmutzung. Wer zum Beispiel behauptet, das industrielle Abholzen der Wälder sei schädlicher als ökologische Schutzmaßnahmen gegen Waldbrände, der übersieht die Tatsache, dass beides mit großer Überzeugung betrieben wurde und beides den Urwald unwiderruflich verändert hat. Beides liefert gleichermaßen umfassende Beweise für den sturen Egoismus, der die Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt prägt.
Die Tatsache, dass die Biosphäre unvorhersehbar auf unser Tun reagiert, ist kein Argument für Untätigkeit. Sie ist hingegen ein gewichtiges Argument für ein behutsames Vorgehen und für eine skeptische Haltung gegenüber dem, was wir glauben, und dem, was wir tun. Leider hat unsere Spezies in der Vergangenheit diese Behutsamkeit schmerzlich vermissen lassen. Und es ist kaum vorstellbar, dass sich daran in Zukunft etwas ändern wird.
Wir glauben zu wissen, was wir tun. Das haben wir schon immer geglaubt. Wir wollen einfach nicht einsehen, dass wir uns in der Vergangenheit geirrt haben und demnach auch in Zukunft irren können. Stattdessen schiebt jede Generation frühere Fehler auf die Unvernunft nicht ganz so kluger Köpfe – und begeht dann erhobenen Hauptes neue Fehler.
Wir sind eine von nur drei Spezies auf unserem Planeten, die von sich behaupten können, dass sie sich ihrer selbst bewusst sind,2 doch vielleicht wäre Selbsttäuschung für uns Menschen ein bezeichnenderes Charakteristikum.
Irgendwann im einundzwanzigsten Jahrhundert wird unser von Selbsttäuschung bestimmter Leichtsinn mit unserer wachsenden technologischen Macht kollidieren. Zu dieser Kollision wird es sicherlich an der Nahtstelle zwischen Nanotechnologie, Biotechnologie und Computertechnologie kommen. Alle drei Bereiche vermögen, sich selbst reproduzierende Einheiten in die Umwelt zu entlassen.
Mit der ersten dieser sich selbst reproduzierenden Einheiten leben wir schon seit einigen Jahren: Computerviren. Und auch mit den Problemen der Biotechnologie machen wir allmählich immer mehr praktische Erfahrungen. Dass, wie kürzlich bekannt wurde, Gene aus gentechnisch verändertem Mais in gentechnisch nicht verändertem Mais in Mexiko aufgetaucht sind – trotz gesetzlicher Verbote und trotz der Versuche, es zu verhindern –, ist bloß der Anfang eines sicherlich langen und beschwerlichen Weges, diese Technologie unter Kontrolle zu bringen. Gleichzeitig sind die alten Überzeugungen, Biotechnologie sei grundsätzlich ungefährlich – Überzeugungen, die seit den Siebzigerjahren von der großen Mehrheit der Biologen verbreitet wurden –, ins Wanken geraten. Seit australische Wissenschaftler im Jahre 2001 unabsichtlich ein ungeheuer tödliches Virus entwickelten, nehmen viele Menschen die alten Denkmuster noch einmal kritisch unter die Lupe.3 Zukünftig werden wir mit dieser Technologie sicherlich nicht mehr so unbeschwert umgehen wie in der Vergangenheit.
Die Nanotechnologie ist die neueste dieser drei Technologien, und in mancher Hinsicht ist sie auch die radikalste. Ihr Ziel ist es, unvorstellbar kleine Maschinen zu bauen, in der Größenordnung von einhundert Nanometern, also einem hundertmilliardstel Meter. Solche Maschinen wären etwa tausendmal kleiner als der Durchmesser eines Menschenhaars. Experten prophezeien, dass uns diese winzigen Maschinen alles liefern werden, von Miniaturcomputerelementen über Krebstherapien bis hin zu neuen Kriegswaffen.
Als Idee geht die Nanotechnologie auf einen Vortrag zurück, den Richard Feynman 1959 unter dem Titel »There’s Plenty of Room at the Bottom« hielt.4 Vierzig Jahre später steckt dieser Forschungsbereich trotz anhaltenden Medieninteresses noch immer größtenteils in den Kinderschuhen. Doch inzwischen werden praktische Fortschritte erzielt und deutlich mehr Gelder investiert. Großkonzerne wie IBM, Fujitsu und Intel stecken immense Summen in die Forschung. In den vergangenen zwei Jahren ließ die US-Regierung eine Milliarde Dollar in die Nanotechnologie fließen.
Unterdessen werden mit Nanotechniken bereits Sonnenschutzmittel, Flecken abweisende Stoffe und Verbundmaterialien für Autos hergestellt. Nicht mehr lange, und die Nanotechnologie ermöglicht den Bau von winzigen Computern und Speicherchips.
Und einige der lang erwarteten »Wunderprodukte« sind auch schon auf dem Markt: Im Jahre 2002 stellte ein Unternehmen selbstreinigende Fensterscheiben her; eine andere Firma produzierte einen Wundverband aus Nanokristallen mit antibiotischen und entzündungshemmenden Eigenschaften.
Zurzeit ist die Nanotechnologie hauptsächlich eine Materialtechnologie, doch ihre Möglichkeiten reichen weit darüber hinaus. Schon seit Jahrzehnten werden Spekulationen über Maschinen angestellt, die sich selbst reproduzieren können. Im Jahre 1980 wurden in einer NASA-Studie mehrere Methoden erörtert, mit denen sich solche Maschinen herstellen ließen. Und vor zehn Jahren beschäftigten sich zwei renommierte Wissenschaftler ernsthaft mit der Materie:
»Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden fünfzig bis hundert Jahren eine neue Kategorie von Organismen entstehen wird. Diese Organismen werden insofern künstlich sein, als sie ursprünglich von Menschen entworfen wurden. Sie werden sich jedoch vermehren und ihre ursprüngliche Form ›evolutionär‹ verändern; sie werden entsprechend jeder vernünftigen Definition des Wortes ›lebendig‹ sein […]. Das Tempo des evolutionären Wandels wird extrem hoch sein […]. Die Auswirkungen für die Menschheit und die Biosphäre könnten ungeheuer sein, größer als die der industriellen Revolution, der Atomwaffen oder der Umweltverschmutzung. Wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, um die Entstehung künstlicher Organismen zu steuern.«5
Auch der größte Verfechter der Nanotechnologie, K. Eric Drexler, äußerte sich ähnlich besorgt:
»Viele Menschen, mich eingeschlossen, haben ein ungutes Gefühl, wenn sie an die Folgen dieser Technologie für die Zukunft denken. Das Ausmaß der möglichen Veränderungen ist gewaltig, und es besteht die große Gefahr, dass die Gesellschaft ohne ausreichende Vorbereitung nur sehr schlecht damit umgehen wird.«6
Selbst gemäß den optimistischsten (oder unheilvollsten) Prognosen wird es solche Organismen erst in Jahrzehnten geben. Wir können nur hoffen, dass wir bis dahin auf internationaler Ebene Kontrollinstanzen für sich selbst reproduzierende Technologien eingesetzt haben. Entscheidend ist, dass die Gesetzesübertritte streng geahndet werden. Wer Computerviren erzeugt, wird schon heute mit einer Härte strafrechtlich verfolgt, wie es noch vor zwanzig Jahren undenkbar gewesen wäre, und Hacker landen hinter Schloss und Riegel. Auf Abwege geratene Biotechnologen werden ihnen bald Gesellschaft leisten.
Aber natürlich ist nicht auszuschließen, dass wir die Einrichtung solcher Kontrollen versäumen. Oder dass jemand sehr viel früher als erwartet künstliche, sich selbst reproduzierende Organismen erzeugt. Tritt das ein, wären die Folgen unabsehbar. Und davon handelt der vorliegende Roman.
Michael Crichton
Los Angeles 2002
Inhaltsverzeichnis
Es ist jetzt Mitternacht. Das Haus ist dunkel. Ich weiß nicht, wie die Sache ausgehen wird. Den Kindern ist fürchterlich schlecht, sie übergeben sich. Ich höre, wie mein Sohn und meine Tochter in verschiedenen Badezimmern würgen. Vor einigen Minuten war ich bei ihnen, um zu sehen, was da hochkommt. Mir macht die Kleinste Sorgen, aber auch ihr musste ich das zumuten. Es war ihre einzige Chance.
Ich glaube, mit mir ist alles in Ordnung, zumindest im Augenblick. Aber die Aussichten sind natürlich nicht gut: Die meisten, die mit dieser Geschichte zu tun hatten, sind bereits tot. Und es gibt so vieles, was ich nicht weiß.
Die Fabrik ist zerstört, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir es rechtzeitig geschafft haben.
Mae ist heute Nachmittag zu dem Labor in Palo Alto gefahren. Ich hoffe, es ist ihr gelungen, denen dort begreiflich zu machen, wie bedrohlich die Lage ist. Ich habe gedacht, das Labor würde sich melden, aber bislang habe ich noch kein Wort von ihnen gehört.
Ich habe ein Klingeln in den Ohren, das ist ein schlechtes Zeichen. Und in Brust und Unterleib spüre ich ein Vibrieren. Die Kleine spuckt eigentlich nur, übergibt sich nicht richtig. Mir ist schwindelig. Ich hoffe, ich verliere das Bewusstsein nicht. Die Kinder brauchen mich, vor allem die Kleine. Sie haben Angst. Verständlicherweise.
Auch ich habe Angst.
Wie ich hier so im Dunkeln sitze, kann ich kaum glauben, dass noch vor einer Woche mein größtes Problem darin bestand, einen neuen Job zu finden. Jetzt kommt mir das fast lachhaft vor.
Aber andererseits entwickeln sich die Dinge ja nie so, wie man denkt.
I.
ZU HAUSE
1. Tag, 10.04 Uhr
Die Dinge entwickeln sich nie so, wie man denkt.
Ich hatte nie vor, Hausmann zu werden. Ein Ehemann, der zu Hause bleibt. Ein Vollzeitvater, wie immer man es auch nennen will – die Begriffe taugen alle nicht richtig. Aber genau das war ich seit sechs Monaten. Jetzt war ich bei Crate and Barrel im Zentrum von San Jose, um ein paar Gläser nachzukaufen, und bei der Gelegenheit sah ich, dass sie auch eine gute Auswahl an Tischsets hatten. Wir brauchten noch ein paar Sets; die geflochtenen, ovalen, die Julia vor einem Jahr gekauft hatte, waren ziemlich hinüber und mit Babynahrung verkrustet. Weil sie geflochten waren, konnte man sie nicht waschen, und das war das Problem. Also blieb ich vor der Auslage stehen und schaute, ob sie gute Sets im Angebot hatten, ich fand ein paar blassblaue, die ganz hübsch waren, und nahm noch ein paar weiße Servietten. Und dann fiel mein Blick auf gelbe Sets, denn sie leuchteten richtig und waren schön, also nahm ich die auch noch. Es waren keine sechs Stück mehr im Regal, und ich dachte, sechs wären besser für uns, also bat ich die Verkäuferin nachzusehen, ob sie noch welche im Lager hatten. Während sie weg war, legte ich ein Platzdeckchen auf den Tisch, stellte einen weißen Teller darauf und legte eine gelbe Serviette daneben. Das Arrangement sah ausgesprochen fröhlich aus, und ich überlegte gerade, ob ich vielleicht acht statt sechs nehmen sollte, als mein Handy klingelte.
Es war Julia. »Hi, Schatz.«
»Hi, Julia. Wie läuft’s?«, sagte ich. Im Hintergrund hörte ich eine Maschine, ein gleichmäßiges Stampfen. Wahrscheinlich die Vakuumpumpe für das Elektronenmikroskop. In ihrem Labor gab es mehrere Rasterelektronenmikroskope.
Sie sagte: »Was machst du gerade?«
»Ich kaufe Tischsets.«
»Wo?«
»Crate and Barrel.«
Sie lachte. »Bist du der einzige Mann da?«
»Nein …«
»Na dann ist ja gut«, sagte sie. Ich spürte, dass Julia sich nicht die Bohne für unser Gespräch interessierte. Sie war mit ihren Gedanken woanders. »Hör mal, weshalb ich anrufe, Jack, es tut mir furchtbar Leid, aber es wird heute Abend wieder spät.«
»Aha…« Die Verkäuferin kam zurück und brachte weitere gelbe Sets. Mit dem Handy am Ohr winkte ich sie zu mir. Ich hielt drei Finger hoch, und sie legte drei Sets hin. Zu Julia sagte ich: »Ist alles in Ordnung?«
»Ja, ja, hier geht’s bloß mal wieder drunter und drüber, wie üblich. Wir senden heute per Satellit ein Demo an unsere Investoren in Asien und Europa, und wir haben Probleme mit der Satellitenschaltung hier, weil der Ü-Wagen, den sie geschickt haben – ach, ich will dich nicht langweilen … jedenfalls, wir werden zwei Stunden länger brauchen, Schatz. Vielleicht noch mehr. Vor acht bin ich ganz bestimmt nicht zu Hause. Kannst du den Kindern was zu essen machen und sie ins Bett bringen?«
»Kein Problem«, sagte ich. Und das war es auch nicht. Ich war daran gewöhnt. In letzter Zeit machte Julia ständig Überstunden. Meistens kam sie erst nach Hause, wenn die Kinder schon schliefen. Xymos Technologies, die Firma, bei der sie arbeitete, versuchte bei den Geldgebern erneut Kapital lockerzumachen – zwanzig Millionen Dollar –, und der Druck war enorm. Zumal Xymos sein Geld damit verdiente, Technologien für die »molekulare Produktion« zu entwickeln, wie die Firma es nannte, was jedoch die meisten Leute als Nanotechnologie bezeichneten. Nano erfreute sich heutzutage bei Investoren keiner großen Beliebtheit. Zu viele Geldgeber waren in den vergangenen zehn Jahren enttäuscht worden, denn Produkte, die angeblich zum Greifen nahe waren, kamen nie aus den Labors heraus. Investoren betrachteten die Nanotechnologie inzwischen als leere Versprechung, die Produkte verhieß, aber nicht lieferte.
Aber das war Julia nicht neu; sie hatte selbst für zwei Investorenfirmen gearbeitet. Nach ihrer Ausbildung als Kinderpsychologin war sie Spezialistin für »Technologie-Inkubation« geworden und half Technologie-Unternehmen, die noch in den Kinderschuhen steckten, auf die Sprünge. (Sie witzelte gern, dass sie im Grunde noch immer Kinderpsychologie betrieb.) Nach einiger Zeit gab sie den Job als Unternehmensberaterin auf und ließ sich von einer der betreuten Firmen einstellen. Inzwischen saß sie bei Xymos im Management.
Julia sagte, Xymos habe etliche Durchbrüche geschafft und sei der Konkurrenz in dem Bereich weit voraus. Es sei nur noch eine Frage von Tagen, bis sie den Prototyp eines kommerziellen Produkts fertig hätten. Doch ich war da skeptisch.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!