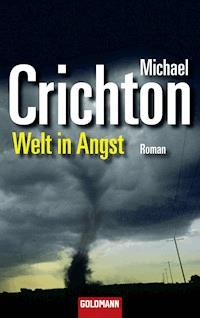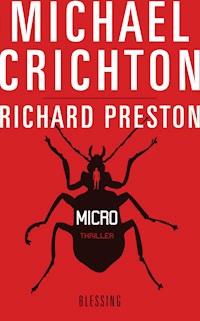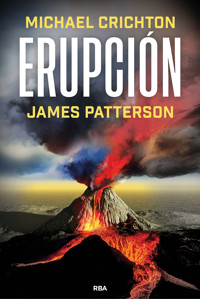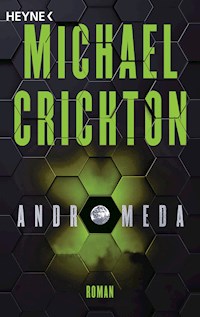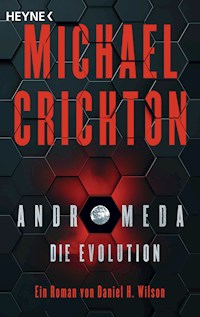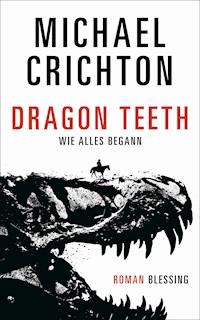
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Ursprung von Jurassic Park
Wyoming 1875: So wie die Erde unter den donnernden Büffelherden des noch wilden Westens bebt, wird die Welt von der Entdeckung einer noch größeren, viel älteren Naturgewalt erschüttert. Fossile Funde belegen: Einst müssen riesige Urzeitwesen die Erde bevölkert haben — die Dinosaurier. Damit rückt ein wenig beachteter, aber revolutionärer Wissenschaftszweig, die Paläontologie, ins Licht der Öffentlichkeit.
Der lebensgefährliche Wettlauf zweier Wissenschaftler: Nach einer wahren Geschichte ersann Michael Crichton einen seiner ersten Thriller — entstanden 1974 und erst unlängst veröffentlicht — um Gier, Obsession und den Anfang einer neuen Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Der Roman Dragon Teeth aus dem Nachlass von Michael Crichton, entstanden 1974, darf als einer der ersten Wissenschaftsthriller dieses Ausnahmeautors und Schöpfers von Jurassic Park gelten. Wie alles begann? Mit der legendären lebenslangen Rivalität zweier Wissenschaftler, Charles Marsh und Edward Drinker Cope, die in den 1890er-Jahren danach trachteten, den alleinigen Ruhm für die bedeutsamen Entdeckungen von Dinosaurierfossilien einzuheimsen. Nach dieser wahren Geschichte ersann Crichton einen rasanten Thriller um Gier, Obsession und den Anfang einer neuen Zeit.
Zum Autor
Michael Crichton wurde 1942 in Chicago geboren und studierte in Harvard Medizin; seine Romane, übersetzt in mehr als 36 Sprachen, verkauften sich über 200 Millionen Mal, dreizehn davon wurden verfilmt. Zu seinen bekanntesten Büchern zählen Next, Timeline und Jurassic Park. Crichton ist bis heute der einzige Künstler, der es schaffte, mit Film, Fernsehserie und Roman gleichzeitig die ersten Plätze der Charts zu belegen. Im November 2008 starb Michael Crichton im Alter von 66 Jahren.
MICHAEL
CRICHTON
DRAGON TEETH
WIE ALLES BEGANN
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch
von Klaus Berr
Blessing
Originaltitel: Dragon Teeth
Originalverlag: HarperCollins, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by CrichtonSun LLC. All Rights Reserved.
Copyright © 2018 by Karl Blessing Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung und -illustration: Geviert, Grafik & Typografie, München, nach einem Entwurf von Will Staehle
Umschlagabbildungen: © Shutterstock
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-23390-7 V002
www.blessing-verlag.de
EINLEITUNG
Auf einer frühen Fotografie erscheint William Johnson als gut aussehender junger Mann mit einem schiefen, beinahe naiven Grinsen. Wie eine Studie in schlaffer Teilnahmslosigkeit lehnt er an einem neugotischen Gebäude. Er ist ein großer Kerl, aber seine Größe scheint für seine Selbstdarstellung unwichtig. Die Fotografie trägt die Signatur »New Haven, 1875« und wurde offensichtlich aufgenommen, nachdem er sein Zuhause verlassen hatte, um am Yale College sein Studium zu beginnen.
Ein späteres Foto mit der Aufschrift »Cheyenne, Wyoming, 1876« zeigt einen ganz anderen Johnson. Sein Mund ist von einem dichten Schnurr- und Kinnbart eingerahmt, sein Körper wirkt härter, muskulöser und von schwerer Arbeit gekräftigt, der Unterkiefer kantig; mit straffen Schultern und gespreizten Füßen steht er selbstbewusst da – und knöcheltief im Schlamm. Deutlich sichtbar ist eine eigenartige Narbe auf seiner Oberlippe, von der er in späteren Jahren behaupten wird, sie bei einem Indianerangriff davongetragen zu haben.
Die folgende Geschichte erzählt, was zwischen den beiden Bildern passiert ist.
Für William Johnsons Tage- und Notizbücher bin ich den Nachlassverwaltern von W. T. Johnson zu Dank verpflichtet, vor allem Johnsons Großnichte Emilie Silliman, die mir erlaubte, ausführlich aus dem unveröffentlichten Material zu zitieren. (Viele der Fakten in Johnsons Bericht wurden 1890 veröffentlicht, im Verlauf der heftigen Vorherrschaftskämpfe zwischen Cope und Marsh, die schließlich sogar die Regierung beschäftigten. Aber der Text selbst wurde nie veröffentlicht, nicht einmal Auszüge davon – bis jetzt.)
1. TEIL
DIE EXPEDITION IN DEN WESTEN
DER JUNGE JOHNSON SCHLIESST SICH DER EXPEDITION IN DEN WESTEN AN
William Jason Tertullius Johnson, der älteste Sohn des Schiffsbauers Silas Johnson aus Philadelphia, schrieb sich im Herbst 1875 am Yale College ein. Laut seinem Schuldirektor in Exeter war Johnson »begabt, gut aussehend, athletisch und klug«. Aber der Direktor fügte auch hinzu, Johnson sei »eigensinnig, faul und sehr verzogen, mit einem bemerkenswerten Desinteresse an allem, was nicht seinem eigenen Vergnügen dient. Wenn er kein Ziel im Leben findet, riskiert er einen unschicklichen Abstieg in Trägheit und Laster.«
Diese Worte hätten als Beschreibung für Tausende junger Männer im Amerika des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts dienen können, junge Männer mit einschüchternden, dominanten Vätern, Unsummen von Geld und keinem sinnvollen Zeitvertreib.
In seinem ersten Jahr in Yale erfüllte William Johnson die Prophezeiungen seines Direktors. Im November erhielt er eine Bewährungsstrafe wegen Glücksspiels, und noch eine im Februar darauf wegen eines Vorfalls, bei dem es um Alkoholexzesse und das eingeschlagene Schaufenster eines Händlers in New Haven ging. Silas Johnson bezahlte die Rechnung. Trotz seines unbesonnenen Verhaltens blieb Johnson jungen Frauen gegenüber höflich und sogar schüchtern, denn noch hatte er kein Glück bei ihnen gehabt. Ihrerseits hatten sie, trotz ihrer konservativen Erziehung, durchaus Gründe, seine Aufmerksamkeit zu suchen. In jeder anderen Hinsicht zeigte er jedoch nicht die geringste Reue. An einem sonnigen Nachmittag zu Frühlingsanfang zerstörte und versenkte er die Jacht eines Zimmergenossen, mit der er über den Long Island Sound segelte. Das Boot sank binnen Minuten, Johnson wurde von einem vorbeikommenden Kutter gerettet. Auf die Frage, was passiert sei, antwortete er den ungläubigen Fischern, er könne gar nicht segeln, weil es »so unglaublich mühsam zu lernen ist. Und es sieht ja auch ganz einfach aus.« Als der Zimmergenosse ihn zur Rede stellte, gab er zu, er habe ihn gar nicht gefragt, ob er die Jacht benutzen dürfe, weil es »so lästig war, dich zu suchen«.
Als Johnsons Vater die Rechnung für die verlorene Jacht vor sich hatte, beklagte er sich bei Freunden, dass »die Kosten der Ausbildung eines jungen Mannes in Yale ruinös teuer« seien. Sein Vater war der ernsthafte Sohn eines schottischen Einwanderers, und er gab sich einige Mühe, die Exzesse seines Sprösslings zu verheimlichen; in seinen Briefen drängte er William wiederholt, sich ein Lebensziel zu suchen. Aber William schien mit seiner verzogenen Oberflächlichkeit zufrieden zu sein, und als er seine Absicht verkündete, den kommenden Sommer in Europa zu verbringen, sagte sein Vater: »Der Gedanke erfüllt mich mit größter finanzieller Sorge.«
Deshalb war seine Familie auch sehr überrascht, als William Johnson abrupt beschloss, im Sommer 1876 in den Westen zu gehen. Johnson gab nie öffentlich preis, warum er seine Meinung geändert hatte. Aber diejenigen, die ihm in Yale nahestanden, kannten den Grund. Die Entscheidung, in den Westen zu gehen, war das Resultat einer Wette.
In seinen eigenen Worten, aus dem Tagebuch, das er penibel führte:
Wahrscheinlich hat jeder junge Mann irgendwann in seinem Leben einmal einen Erzrivalen, und in meinem ersten Jahr in Yale hatte ich meinen. Harold Hannibal Marlin war in meinem Alter, achtzehn Jahre alt. Er war gut aussehend, athletisch gebaut, redegewandt, unermesslich reich, und er war aus New York und fühlte sich wie viele New Yorker jemandem, der aus Philadelphia stammte, überlegen. Ich fand ihn unerträglich. Dieses Gefühl wurde erwidert.
Marlin und ich wetteiferten an jeder Front – im Klassenzimmer, auf dem Sportplatz, bei den studentischen nächtlichen Streichen. Es gab nichts, bei dem wir nicht konkurrierten. Wir stritten unaufhörlich, der eine war immer der entgegengesetzten Meinung des anderen.
Eines Abends beim Essen sagte er, die Zukunft Amerikas liege im sich entwickelnden Westen. Ich sagte, das sei nicht so, die Zukunft unserer großen Nation könne kaum von einer riesigen Wüste abhängen, die von wilden Eingeborenenstämmen bevölkert sei.
Er erwiderte, ich wisse nicht, wovon ich spräche. Das war ein wunder Punkt – Marlin war tatsächlich im Westen gewesen, zumindest in Kansas City, wo sein Bruder lebte, und er versäumte es nie, seine Überlegenheit in Sachen Reisen zum Ausdruck zu bringen.
Mir war es bislang noch nicht gelungen, sie auszumerzen.
»In den Westen zu gehen ist keine große Sache. Jeder Narr kann das«, sagte ich.
»Aber nicht alle Narren sind dorthin gegangen – zumindest Sie nicht.«
»Ich hatte nie den geringsten Wunsch, es zu tun«, erwiderte ich.
»Ich sage Ihnen, was ich denke«, sagte Hannibal Marlin und achtete darauf, dass die anderen ihn hörten. »Ich glaube, Sie haben Angst.«
»Das ist absurd.«
»O ja. Eine schöne Reise nach Europa ist eher etwas für Sie.«
»Europa? Europa ist etwas für alte Leute und verstaubte
Gelehrte.«
»Lassen Sie es sich gesagt sein, Sie werden diesen Sommer durch Europa reisen – vielleicht mit einem Sonnenschirm.«
»Und wenn ich es tue, heißt das noch nicht …«
»Aha! Sehen Sie?« Marlin wandte sich an die um den Tisch versammelten Studenten.
»Er hat Angst. Angst.« Er lächelte auf eine wissende, gönnerhafte Art, die mich zur Weißglut brachte und mir keine andere Wahl ließ.
»Tatsache ist«, sagte ich gelassen, »ich habe mich für diesen Sommer bereits zu einem Ausflug in den Westen entschieden.«
Dies überraschte ihn, und das blasierte Lächeln gefror ihm auf den Lippen. »Ach so?«
»Ja«, sagte ich. »Ich schließe mich Professor Marsh an. Er nimmt jeden Sommer eine Gruppe Studenten mit.« In der Woche zuvor hatte ich eine Anzeige in der Zeitung gesehen; ich erinnerte mich noch vage daran.
»Was? Der fette, alte Marsh? Der Knochenprofessor?«
»Genau der.«
»Sie gehen mit Marsh? Die Unterkünfte für seine Gruppe sind spartanisch, und es heißt, er nehme seine Jungs gnadenlos ran.
Das scheint mir so gar nicht Ihre Sache zu sein.« Er kniff die Augen zusammen. »Wann brechen Sie auf?«
»Das Datum hat er uns noch nicht genannt.«
Marlin lächelte. »Sie haben Professor Marsh noch nie gesehen, und Sie werden nie und nimmer mit ihm gehen.«
»Doch, das werde ich.«
»Werden Sie nicht.«
»Ich sage Ihnen, das ist bereits beschlossene Sache.«
Marlin seufzte auf seine gönnerhafte Art. »Ich wette tausend Dollar, dass Sie nicht gehen.«
Marlin hatte die Aufmerksamkeit der am Tisch Sitzenden verloren, doch die bekam er jetzt sofort wieder zurück. Tausend Dollar waren 1876 eine Menge Geld, auch für zwei reiche Jungen.
»Tausend Dollar, dass Sie in diesem Sommer nicht mit Marsh in den Westen gehen«, wiederholte Marlin.
»Sie, Sir, haben eben eine Wette abgeschlossen«, erwiderte ich. Und in diesem Augenblick erkannte ich, dass ich, ohne eigene Schuld, jetzt den ganzen Sommer in irgendeiner grässlichen Wüste in Gesellschaft eines bekannten Spinners verbringen und alte Knochen ausbuddeln würde.
MARSH
Professor Marsh hatte seine Räume im Peabody Museum auf dem Campus von Yale. Auf einer schweren grünen Tür stand in großen weißen Lettern: PROF. O. C. MARSH. BESUCHE NUR NACH SCHRIFTLICHER TERMINVEREINBARUNG.
Johnson klopfte. Da niemand antwortete, klopfte er noch einmal.
»Gehen Sie.«
Johnson klopfte ein drittes Mal.
In der Mitte der Tür öffnete sich ein kleines Fenster, und ein Auge spähte heraus. »Worum geht’s?«
»Ich würde gerne mit Professor Marsh sprechen.«
»Aber will er auch mit Ihnen sprechen?«, fragte das Auge. »Ich bezweifle es.«
»Ich melde mich auf seine Anzeige hin.« Johnson hielt die Zeitung von der vergangenen Woche in die Höhe.
»Tut mir leid. Zu spät. Alle Positionen sind bereits besetzt.« Das Fenster wurde wieder zugeklappt.
Johnson war es nicht gewöhnt, dass man ihm irgendetwas verweigerte, vor allem nicht einen lächerlichen Ausflug, den er eigentlich gar nicht machen wollte. Wütend trat er gegen die Tür. Er starrte in den Kutschenverkehr auf der Whitney Avenue. Aber dank seines Stolzes und der tausend Dollar, die auf dem Spiel standen, beherrschte er sich wieder und klopfte höflich noch einmal. »Es tut mir leid, Professor Marsh, aber ich muss wirklich mit Ihnen in den Westen gehen.«
»Junger Mann, das Einzige, wohin Sie gehen müssen, ist weg von meiner Tür. Gehen Sie.«
»Bitte, Professor Marsh. Bitte lassen Sie mich an Ihrer Expedition teilnehmen.« Der Gedanke an seine Demütigung vor Marlin war für Johnson schrecklich. Seine Stimme brach, Tränen stiegen ihm in die Augen. »Bitte, lassen Sie mich ausreden, Sir. Ich werde tun, was immer Sie sagen, bringe sogar meine eigene Ausrüstung mit.«
Das Fenster ging wieder auf. »Junger Mann, jeder bringt seine eigene Ausrüstung mit, und jeder tut, was immer ich sage, bis auf Sie. Sie bieten hier einen sehr unmännlichen Anblick.« Das Auge spähte wieder heraus. »Jetzt gehen Sie.«
»Bitte, Sir, Sie müssen mich nehmen.«
»Wenn Sie hätten mitkommen wollen, hätten Sie sich schon letzte Woche auf die Anzeige melden sollen. Alle anderen haben es getan. Wir hatten letzte Woche dreißig Kandidaten, aus denen wir auswählen konnten. Jetzt haben wir alle ausgesucht bis auf – Sie sind nicht zufällig Fotograf?«
Johnson sah seine Chance und ergriff sie. »Fotograf? Ja, Sir, das bin ich. Das bin ich tatsächlich.«
»Nun denn. Das hätten Sie gleich sagen sollen. Kommen Sie herein.« Die Tür ging weit auf, und Johnson sah nun zum ersten Mal die schwere, mächtige, weihevolle Gestalt von Othniel C. Marsh, Yales erstem Professor für Paläontologie, vor sich. Er war von mittlerer Größe und schien sich einer fleischigen, robusten Gesundheit zu erfreuen.
Marsh führte ihn ins Innere des Museums. Die Luft war kalkig, und Sonnenstrahlen durchstachen sie wie in einer Kathedrale. In dem riesigen, höhlenartigen Saal sah Johnson Männer in weißen Mänteln, die sich über große Steinbrocken beugten und mit kleinen Meißeln Knochen freilegten. Sie arbeiteten sehr vorsichtig, das sah er, und benutzten kleine Bürsten, um ihre Arbeit zu säubern. In einer entfernten Ecke wurde ein riesiges Skelett zusammengebaut, das Knochengerüst wuchs bis zur Decke.
»Giganthropus marshiensis, die Krönung meiner Arbeit«, sagte Marsh und deutete auf das hoch aufragende Knochenwesen. »Bis jetzt zumindest. Habe sie ’74 im Wyoming Territory entdeckt. Ich stelle sie mir immer als eine Sie vor. Wie heißen Sie?«
»William Johnson, Sir.«
»Was macht Ihr Vater?«
»Mein Vater ist im Schiffsbau, Sir.« Johnson musste wegen des Kalkstaubs husten.
Marsh schaute argwöhnisch. »Geht es Ihnen nicht gut, Johnson?«
»Nein, Sir, alles ist vollkommen in Ordnung.«
»Krankheit kann ich in meiner Umgebung nicht dulden.«
»Um meine Gesundheit ist es bestens bestellt, Sir.«
Marsh schien davon noch nicht überzeugt. »Wie alt sind Sie, Johnson?«
»Achtzehn, Sir.«
»Und wie lange sind Sie schon Fotograf?«
»Fotograf? Äh – seit meiner Jugend, Sir. Mein, äh – mein Vater machte Fotos, und ich lernte es von ihm, Sir.«
»Sie haben Ihre eigene Ausrüstung?«
»Ja – äh, nein, Sir – aber ich kann mir eine beschaffen. Von meinem Vater, Sir.«
»Sie sind nervös, Johnson. Warum denn?«
»Ich brenne nur darauf, Sie zu begleiten, Sir.«
»Soso.« Marsh starrte ihn an, als wäre Johnson selbst ein merkwürdiges anatomisches Exemplar.
Da Johnson dieser Blick befangen machte, versuchte er es mit einem Kompliment. »Ich habe schon so viele aufregende Sachen über Sie gehört, Sir.«
»Tatsächlich? Was haben Sie denn gehört?«
Johnson zögerte. In Wahrheit hatte er nur gehört, dass Marsh ein besessener, getriebener Mann war, der seine Stellung im College seinem monomanen Interesse für fossile Knochen und seinem Onkel verdankte, dem berühmten Philanthropen George Peabody, der die Mittel für das Peabody Museum, für Marshs Professur und für Marshs jährliche Expeditionen in den Westen bereitgestellt hatte.
»Nur dass Studenten es als Privileg und Abenteuer empfunden haben, Sie begleiten zu dürfen, Sir.«
Marsh schwieg einen Augenblick. Schließlich sagte er: »Ich kann Komplimente und müßige Schmeicheleien nicht ausstehen. Ich lasse mich nicht gerne ›Sir‹ nennen. Sie können mich mit ›Professor‹ ansprechen. Was Privilegien und Abenteuer angeht, biete ich verdammt harte Arbeit, und davon jede Menge. Aber eines kann ich Ihnen sagen: Alle meine Studenten sind gesund und wohlbehalten zurückgekehrt. Nun denn – warum wollen Sie denn so unbedingt mitkommen?«
»Persönliche Gründe, Si… Professor.«
»Alle Gründe sind persönliche Gründe, Johnson. Ich frage Sie nach Ihren.«
»Nun, Professor, ich interessiere mich für das Studium von Fossilien.«
»Sie interessieren sich? Sie sagen also, Sie sind daran interessiert? Junger Mann, diese Fossilien« – er deutete mit einer ausladenden Geste durch den Saal –, »diese Fossilien erfordern nicht nur Interesse. Sie erfordern leidenschaftliche Hingabe, sie erfordern religiösen Eifer und wissenschaftliche Spekulation, sie erfordern hitzige Diskurse und Dispute, sie gedeihen nicht auf Interesse allein. Nein, nein. Tut mir leid. Nein, wirklich nicht.«
Johnson fürchtete, er hätte seine Chance mit seiner beiläufigen Bemerkung verspielt, aber in einer schnellen Wendung lächelte Marsh und sagte: »Wie auch immer, ich brauche einen Fotografen, und Sie sind mir willkommen.« Er streckte die Hand aus, und Johnson schüttelte sie. »Woher kommen Sie, Johnson?«
»Aus Philadelphia.«
Der Name hatte eine außerordentliche Wirkung auf Marsh. Er ließ Johnsons Hand los und trat einen Schritt zurück. »Philadelphia? Sie … Sie sind aus Philadelphia?«
»Ja, Sir, stimmt etwas nicht mit Philadelphia?«
»Nennen Sie mich nicht ›Sir‹. Und Ihr Vater ist im Schiffsbau?«
»Ja, das ist er.«
Marshs Gesicht rötete sich, sein Körper zitterte vor Wut. »Und ich nehme an, Sie sind auch Quäker? Hm? Ein Quäker aus Philadelphia?«
»Nein, Methodist, um genau zu sein.«
»Sind die beiden nicht sehr ähnlich?«
»Das glaube ich nicht.«
»Aber sie leben in derselben Stadt wie er.«
»Wie wer?«
Marsh verstummte, starrte stirnrunzelnd zu Boden und machte dann eine weitere abrupte Wendung, indem er seine Körpermasse in Bewegung brachte. Für einen so korpulenten Mann bewegte er sich erstaunlich sportlich und behände.
»Denken Sie sich nichts«, sagte er und lächelte wieder. »Ich habe keinen Streit mit irgendeinem Einwohner der Stadt der Brüderlichen Liebe, gleichgültig, was andere auch sagen mögen. Und doch kann ich mir vorstellen, dass Sie sich fragen, wohin meine Expedition zur Suche nach Fossilien in diesem Sommer führen wird?«
Die Frage war Johnson noch nie in den Sinn gekommen, aber um angemessenes Interesse zu zeigen, erwiderte er: »Ein bisschen neugierig bin ich schon, ja.«
»Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich kann es mir vorstellen. Nun ja, das ist ein Geheimnis«, sagte Marsh, beugte sich zu Johnson und zischte die Worte. »Haben Sie mich verstanden? Ein Geheimnis. Es wird ein Geheimnis bleiben, das nur mir bekannt ist, bis wir im Zug in den Westen sitzen. Haben Sie das vollkommen verstanden?«
Johnson wich unter der Vehemenz der Worte zurück. »Ja, Professor.«
»Gut. Wenn Ihre Familie Ihr Reiseziel wissen will, sagen Sie ihnen Colorado. Das stimmt nicht, denn wir werden in diesem Jahr nicht nach Colorado gehen, aber das ist unwichtig, da Sie keinen Kontakt haben werden und Colorado ein wunderbarer Ort ist, um dort nicht zu sein. Verstanden?«
»Ja, Professor.«
»Gut. Nun denn, wir brechen am 14. Juni auf, vom Grand Central Depot in New York. Und kehren spätestens am 1. September zum selben Bahnhof zurück. Wenden Sie sich morgen an den Museumssekretär, und er wird Ihnen eine Liste der Ausrüstungsgegenstände geben, die Sie bereitzustellen haben – in Ihrem Fall natürlich zusätzlich zu der fotografischen Ausrüstung. Sorgen Sie für genügend Material für hundert Fotografien. Irgendwelche Fragen?«
»Nein, Sir. Nein, Professor.«
»Dann sehen wir uns am 14. Juni am Bahnsteig, Mr. Johnson.« Sie gaben sich kurz die Hand. Marshs Hand war feucht und kalt.
»Vielen Dank, Professor.« Johnson drehte sich um und ging auf die Tür zu.
»Ah, ah, ah. Wo wollen Sie denn hin?«
»Nach draußen.«
»Alleine?«
»Ich finde den Weg …«
»Niemand, Johnson, darf sich ohne Begleitung durch diese Räume bewegen. Ich bin kein Narr, ich weiß, dass es Spione gibt, die ganz erpicht darauf sind, einen Blick auf meine jüngsten Notizen oder die neuesten Knochen zu werfen, die sich aus dem Gestein schälen. Mein Assistent Mr. Gall wird Sie hinausbegleiten.« Bei der Erwähnung dieses Namens legte ein dünner, verkniffener Mann in einem Labormantel seinen Meißel weg und ging mit Johnson zur Tür.
»Ist er immer so?«, flüsterte Johnson.
»Wunderbares Wetter«, sagte Gall und lächelte. »Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Sir.«
Und damit stand William Johnson wieder auf der Straße.
FOTOGRAFIE
Johnson wollte nichts lieber, als den Bedingungen dieser Wette und der drohenden Expedition zu entkommen. Marsh war offensichtlich ein Verrückter erster Ordnung und möglicherweise auch gefährlich. Er nahm sich vor, noch einmal mit Marlin zu Abend zu essen und sich irgendwie aus dieser Wette herauszuwinden.
Doch an diesem Abend erfuhr er zu seinem Entsetzen, dass die Wette bereits eine gewisse Berühmtheit erlangt hatte. Inzwischen wusste das ganze College davon, und während des Essens kamen immer wieder Leute an seinen Tisch, um ihn danach zu fragen, eine Bemerkung oder einen Witz darüber zu machen. An einen Rückzieher war jetzt nicht mehr zu denken.
Er begriff, dass er in der Falle saß.
Am nächsten Tag ging er in das Geschäft von Mr. Carlton Lewis, einem örtlichen Fotografen, der zwanzig Lehrstunden in seiner Kunst für die unerhörte Summe von fünfzig Dollar anbot. Mr. Lewis amüsierte sich über seinen neuen Schüler; die Fotografie war nicht unbedingt die Beschäftigung, der ein reicher Mann üblicherweise nachging, sondern eher ein unsicheres Geschäft für Leute, denen die Mittel fehlten, um einem prestigeträchtigeren Erwerb nachzugehen. Sogar Mathew Brady, der berühmteste Fotograf seiner Zeit, der Chronist des Bürgerkrieges, der Mann, der Staatsmänner und Präsidenten fotografiert hatte, war von den bedeutenden Herrschaften, die für ihn Modell saßen, immer wie ein Diener behandelt worden.
Aber Johnson war hartnäckig, und im Verlauf einiger Wochen lernte er die Techniken dieser Aufnahmemethode, die vierzig Jahre zuvor von dem Telegrafisten Samuel Morse aus Frankreich eingeführt worden war.
Die zu der Zeit vorherrschende fotografische Technik war das Kollodium-Nassplatten-Verfahren; in einem abgedunkelten Raum oder einem Zelt wurden frische Chemikalien vor Ort gemischt und Glasplatten mit einer klebrigen, lichtempfindlichen Emulsion überzogen. Diese frisch hergestellten Platten wurden schleunigst zur Kamera gebracht und belichtet, solange sie noch nass waren. Beträchtliches Können war nötig, um eine gleichmäßig beschichtete Platte herzustellen und sie dann zu belichten, bevor sie trocknete; die spätere Entwicklung war im Vergleich dazu einfach.
Johnson fiel das Erlernen der Techniken der Fotografie schwer. Er konnte die einzelnen Schritte nicht schnell genug und mit dem routinierten Rhythmus seines Lehrers ausführen; seine frühen Emulsionen waren entweder zu dick oder zu dünn; seine Platten hatten Blasen und unregelmäßige Emulsionsdichten, die seine Aufnahmen amateurhaft machten. Er hasste die Enge des Zeltes, die Dunkelheit ebenso wie die stinkenden Chemikalien, die seine Augen reizten, seine Finger verfärbten und seine Kleidung versengten. Vor allem aber hasste er die Tatsache, dass er diese Kunst nicht so problemlos meisterte. Und er hasste Mr. Lewis, der zum Philosophieren neigte.
»Weil Sie reich sind, erwarten Sie, dass alles einfach ist«, kicherte Lewis, wenn Johnson wieder einmal fluchend herumfummelte. »Aber den Platten ist es egal, wie reich Sie sind. Den Chemikalien ist es egal, wie reich Sie sind. Der Linse ist es egal, wie reich Sie sind. Wenn Sie überhaupt etwas lernen wollen, müssen Sie zuerst Geduld lernen.«
»Sie können mich mal«, erwiderte Johnson dann verärgert. Der Mann war nichts als ein ungebildeter Ladenbesitzer mit Allüren.
»Ich bin nicht das Problem«, sagte Lewis gutmütig. »Sie sind das Problem. Und jetzt: Probieren Sie es noch einmal.«
Johnson knirschte mit den Zähnen und fluchte leise.
Doch im Verlauf der Wochen wurde er wirklich besser. Ende April hatten seine Platten eine gleichmäßige Dichte, und er arbeitete schnell genug, um gute Belichtungen zustande zu bringen. Seine Platten waren frisch und scharf, und er freute sich sehr, als er sie seinem Lehrer zeigte.
»Worüber freuen Sie sich denn so?«, fragte Mr. Lewis. »Diese Bilder sind erbärmlich.«
»Erbärmlich? Sie sind perfekt.«
»Technisch sind sie perfekt«, sagte Lewis mit einem Achselzucken. »Das heißt nur, dass Sie genug wissen, um jetzt die Grundzüge der Fotografie zu erlernen. Ich glaube, das ist der Grund, warum Sie überhaupt zu mir kamen.«
Lewis brachte ihm die Feinheiten der Belichtung bei, die Tücken von Blendenstufe, Brennweite und Tiefenschärfe. Johnson verzweifelte, denn es gab noch so viel mehr zu lernen: »Porträts weit offen mit kurzer Belichtung schießen, weil die weit offene Blende eine Weichheit vermittelt, die dem Abgebildeten schmeichelt.« Und dann: »Landschaften mit kleiner Blende und langer Belichtung schießen, weil die Leute eine Landschaft sowohl in der Nähe wie in der Ferne scharf sehen wollen.« Er lernte, den Kontrast zu variieren, indem er die Belichtung und die anschließende Entwicklungszeit veränderte. Er lernte, wie man das Motiv ins Licht setzt, wie man die Zusammensetzung der Emulsion für klare und für trübe Tage verändert. Johnson arbeitete hart und schrieb detaillierte Notizen in sein Tagebuch – aber auch Klagen.
»Ich verachte diesen kleinen Mann«, so lautete ein typischer Eintrag, »und doch brenne ich darauf, dass er sagt, was er nie sagen wird: dass ich sein Handwerk gelernt habe.« Doch sogar in dieser Klage hörte man, dass der hochmütige junge Mann, der noch einige Monate zuvor keine Lust gehabt hatte, Segeln zu lernen, sich verändert hatte. Er wollte seine Aufgabe mit Bravour meistern.
Anfang Mai hielt Lewis eine Platte ans Licht und untersuchte sie dann mit einem Vergrößerungsglas. Schließlich wandte er sich Johnson zu. »Diese Arbeit ist beinahe akzeptabel«, gab er zu. »Das haben Sie gut gemacht.«
Johnson war beschwingt. In sein Tagebuch schrieb er: »Beinahe akzeptabel! Beinahe akzeptabel! Nichts, was je zu mir gesagt wurde, klang so süß in meinen Ohren!«
Auch andere für Johnson bis dahin typische Wesenszüge und Verhaltensweisen änderten sich: Fast gegen seinen Willen fing er an, sich auf die Expedition zu freuen.
Ich betrachte die drei Monate im Westen noch immer so, wie ich drei Monate erzwungene Anwesenheit in der Deutschen Oper betrachten würde. Aber ich muss eine angenehme, wachsende Aufregung eingestehen, je näher die schicksalhafte Abreise rückt. Ich habe alles auf der Liste des Museumssekretärs besorgt, darunter ein Bowiemesser, einen Revolver von Smith & Wesson mit sechs Schuss, ein Gewehr vom Kaliber 50, robuste Kavalleriestiefel und einen Geologenhammer. Das Fotografieren beherrsche ich einigermaßen gut; ich habe die achtzig Pfund Chemikalien und Ausrüstung sowie die hundert Glasplatten besorgt; kurz gesagt: Ich bin abreisebereit. Nur ein größeres Hindernis steht noch zwischen mir und der Abreise: meine Familie. Ich muss nach Philadelphia und es ihr sagen.
PHILADELPHIA
Philadelphia war in diesem Mai die geschäftigste Stadt Amerikas, sie platzte schier aus allen Nähten wegen der Menschenmassen, die zur Centennial Exposition von 1876 in die Stadt strömten, der ersten Weltausstellung zur Feier des hundertjährigen Jubiläums der Unterzeichnung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Bei einem Rundgang durch die riesigen Ausstellungshallen sah Johnson all die Wunder, die die Welt in Erstaunen versetzten – die große Dampfmaschine von Corliß, die pflanzlichen und landwirtschaftlichen Exponate aus den Staaten und Territorien Amerikas und all die neuen Erfindungen, die der letzte Schrei waren.
Die Idee, sich die Kraft der Elektrizität zunutze zu machen, war in aller Munde: Man sprach sogar davon, elektrisches Licht zu gewinnen und nachts die Straßen der Städte zu beleuchten; es hieß, Edison werde vor Ablauf eines Jahres eine Lösung finden. Unterdessen gab es andere elektronische Wunder zu bestaunen, vor allem den merkwürdigen Apparat des Tele-Phons.
Jeder, der die Ausstellung besuchte, sah diese Kuriosität, obwohl nur wenige ihr irgendeinen Wert beimaßen. Johnson gehörte zur Mehrheit, wie er in seinem Tagebuch vermerkte: »Wir haben doch bereits den Telegrafen, der Kommunikation für alle bietet, die sie wünschen. Der zusätzliche Vorzug der Sprachkommunikation über weite Entfernungen erschließt sich mir nicht. Vielleicht werden in der Zukunft einige Menschen die Stimme eines anderen aus weiter Ferne hören wollen, aber viele können es nicht sein. Ich persönlich halte Mr. Bells Tele-Phon für eine dem Untergang geweihte Kuriosität ohne wahren Wert.«
Trotz der prächtigen Gebäude und der vielen Menschen stand in der Nation nicht alles zum Besten. Es war ein Wahljahr, und es wurde viel über Politik diskutiert. Präsident Ulysses S. Grant hatte die Centennial Exposition eröffnet, aber der kleine General war nicht mehr beliebt; Skandale und Korruption kennzeichneten seine Regierung, und die Exzesse von Finanzspekulanten hatten die Nation in eine der schlimmsten Depressionen ihrer Geschichte gestürzt. An der Wall Street waren Tausende Investoren ruiniert worden; die Farmer im Westen wurden durch einen starken Preisverfall sowie durch harte Winter und Heuschreckenplagen vernichtet; die wieder aufflammenden Indianerkriege in den Territorien Montana, Dakota und Wyoming boten ein widerwärtiges Bild, zumindest für die Presse im Osten, und sowohl die Demokratische wie die Republikanische Partei versprachen im Wahlkampf dieses Jahres, sich auf Reformen zu konzentrieren.
Aber für einen jungen Mann, vor allem für einen reichen, bildeten all diese Nachrichten – die guten wie die schlechten – lediglich einen aufregenden Hintergrund am Vorabend seines großen Abenteuers. »Ich genoss die Wunder dieser Ausstellung«, schrieb Johnson, »aber eigentlich fand ich sie ermüdend zivilisiert. Meine Augen schauten in die Zukunft und zu den Great Plains, die bald meine Bestimmung sein würden. Meine Familie war bereit, mich ziehen zu lassen.«
Die Johnsons residierten in einem der prächtigen Herrenhäuser an Philadelphias Rittenhouse Square. Es war das einzige Zuhause, das William je gekannt hatte – üppiges Mobiliar, gesittete Eleganz und Bedienstete hinter jeder Tür. Er beschloss, es seiner Familie eines Morgens beim Frühstück zu sagen. Im Rückblick fand er ihre Reaktionen vollkommen vorhersehbar.
»Ach, Darling! Was willst du denn nur da draußen?«, fragte seine Mutter, während sie ihren Toast butterte.
»Ich halte das für eine famose Idee«, sagte sein Vater. »Ausgezeichnet.«
»Aber hältst du das für klug?«, fragte seine Mutter. »Da gibt es doch diese Probleme mit den Indianern, wie du weißt.«
»Es ist gut, dass er geht, vielleicht skalpieren sie ihn«, verkündete Edward, sein jüngerer Bruder, der damals vierzehn war. Er sagte solche Sachen die ganze Zeit, und keiner achtete auf ihn.
»Ich verstehe nicht, was dich daran reizt«, sagte seine Mutter noch einmal mit Besorgnis in der Stimme. »Warum willst du dahin gehen? Das ergibt doch keinen Sinn. Warum gehst du nicht stattdessen nach Europa? An Orte, die kulturell stimulierend und sicher sind?«
»Er ist dort ganz bestimmt sicher«, sagte sein Vater. »Erst heute hat der Inquirer über den Sioux-Aufstand in den Dakotas berichtet. Man hat Custer höchstpersönlich hingeschickt, um ihn niederzuschlagen. Der macht kurzen Prozess mit denen.«
»Ich mag gar nicht daran denken, dass du gegessen werden könntest«, sagte seine Mutter.
»Skalpiert, Mutter«, korrigierte Edward sie. »Sie schneiden einem die ganzen Haare vom Kopf ab, natürlich nachdem sie einen erschlagen haben. Außer dass man manchmal noch nicht ganz tot ist, und dann spürt man, wie sie die Haut und die Haare bis hinunter zu den Augenbrauen abschneiden …«
»Nicht beim Frühstück, Edward.«
»Du bist abscheulich, Edward«, sagte seine Schwester Eliza, die zehn war. »Du bringst mich zum Kotzen.«
»Eliza!«
»Aber wenn es so ist, Mutter. Er ist widerwärtig.«
»Wo genau gehst du mit Professor Marsh hin, mein Sohn?«, fragte sein Vater.
»Nach Colorado.«
»Ist das nicht nahe bei den Dakotas?«, fragte seine Mutter.
»Nicht sehr.«
»Ach, Mutter, weißt du denn überhaupt nichts?«, fragte Edward.
»Gibt es in Colorado Indianer?«
»Indianer gibt es überall, Mutter.«
»Dich habe ich nicht gefragt, Edward.«
»Soweit ich weiß, gibt es in Colorado keine feindselig gestimmten Indianer«, sagte sein Vater. »Es heißt, es ist ein wunderbarer Landstrich. Sehr trocken.«
»Es heißt, es ist eine Wüste«, sagte seine Mutter. »Und schrecklich ungastlich. In was für einem Hotel wirst du wohnen?«
»Wir werden vorwiegend zelten.«
»Gut«, sagte sein Vater. »Viel frische Luft und körperliche Anstrengung. Belebend.«
»Du schläfst auf der Erde mit den ganzen Schlangen und Tieren und Insekten? Das klingt entsetzlich«, sagte seine Mutter.
»Sommer im Freien, gut für einen jungen Mann«, sagte sein Vater. »Heutzutage schickt man viele kränkliche Jungs zum Abhärten in ein Zeltlager.«
»Vermutlich …«, sagte seine Mutter. »Aber William ist nicht kränklich. Warum willst du gehen, William?«
»Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich etwas aus mir mache«, erwiderte William, den seine eigene Ehrlichkeit überraschte.
»Gut gesagt«, rief sein Vater und schlug auf den Tisch.
Letztendlich gab seine Mutter ihre Zustimmung, obwohl sie ernsthaft besorgt wirkte. Er fand sie übertrieben bemutternd und töricht; die Ängste, die sie zum Ausdruck brachte, bestärkten ihn nur in seiner Selbstüberhebung und seiner Entschlossenheit zu gehen, er kam sich sehr mutig vor.
Er hätte vielleicht anders gedacht, hätte er gewusst, dass man ihr am Ende des Sommers die Nachricht überbringen würde, ihr Erstgeborener sei tot.
»ALLES BEREIT ZUM GRABEN FÜR YALE?«
Um acht Uhr abends verließ der Zug das höhlenartige Innere des Grand Central Depot in New York. Auf seinem Weg durch den Bahnhof war Johnson einigen attraktiven jungen Frauen in Begleitung ihrer Familien begegnet, aber er hatte sich nicht dazu überwinden können, ihre neugierigen Blicke zu erwidern. Schließlich müsse er seine Reisegruppe finden, sagte er sich. Insgesamt zwölf Studenten würden Professor Marsh und seine beiden Mitarbeiter Mr. Gall und Mr. Bellows begleiten.
Marsh war bereits da, er ging an den Waggons entlang und begrüßte jeden auf dieselbe Art: »Hallo, junger Kollege, alles bereit zum Graben für Yale?« So schweigsam und argwöhnisch er normalerweise war, so aufgeschlossen und freundlich zeigte er sich jetzt. Marsh hatte sich seine Studenten aus gesellschaftlich hochstehenden und wohlhabenden Familien sehr sorgfältig ausgesucht, und diese Familien waren alle gekommen, um ihre Jungs zu verabschieden.
Marsh war sich durchaus bewusst, dass er als Reiseführer für die Sprösslinge der Reichen fungierte, die sich später vielleicht angemessen dankbar dafür zeigen würden, dass er aus ihren jungenhaften Söhnen Männer gemacht hatte. Er war sich des Weiteren darüber im Klaren, dass sämtliche Forschungsmittel in seinem Fachgebiet von privaten Gönnern wie etwa seinem Onkel und Financier George Peabody kamen, da viele prominente Geistliche und Theologen die paläontologische Forschung als gottlos verurteilten. Hier in New York war das neue American Museum of Natural History eben erst von anderen Selfmademen wie Andrew Carnegie, J. Pierpont Morgan und Marshal Field angemietet worden.
Denn so eifrig religiöse Männer die neue Lehre der Evolution in Verruf zu bringen suchten, so engagiert versuchten wohlhabende Männer, sie zu fördern. Im Prinzip des Überlebens des Stärkeren sahen sie eine neue, wissenschaftliche Rechtfertigung für ihren eigenen Aufstieg und ihre oft skrupellose Lebensführung. Schließlich hatte keine geringere Autorität als der große Charles Lyell, ein Freund und Wegbereiter von Charles Darwin, immer und immer wieder darauf bestanden, dass »im universellen Kampf ums Dasein das Recht des Stärkeren letztendlich die Oberhand gewinnt«.
Hier nun fand sich Marsh umgeben von den Kindern der Stärksten. Privat vertraute Marsh Bellows an, dass »die Verabschiedung in New York der produktivste Teil der Expedition ist«, und daran dachte er natürlich, als er Johnson mit seinem üblichen »Hallo, junger Mann, alles bereit zum Graben für Yale?« begrüßte.
Johnson war umringt von einer Schar Gepäckträger, die seine sperrige fotografische Ausrüstung in den Zug luden. Marsh sah sich um und runzelte dann die Stirn. »Wo ist Ihre Familie?«
»In Philadelphia, Si… Professor.«
»Ihr Vater ist nicht gekommen, um Sie zu verabschieden?« Marsh erinnerte sich, dass Johnsons Vater im Schiffsbau tätig war. Er wusste nicht viel über den Schiffsbau, aber offensichtlich war er lukrativ und bestimmt von durchtriebenem Handeln. Im Schiffsbau wurden täglich Vermögen gemacht.
»Mein Vater hat mich in Philadelphia verabschiedet.«
»Ach, wirklich? Die meisten Familien wollen mich persönlich kennenlernen, um ein Gefühl für die Expedition zu bekommen …«
»Ja, da bin ich mir sicher, aber sehen Sie, sie dachten, hierherzukommen wäre zu belastend für meine Mutter, die mit meiner Reise nicht völlig einverstanden ist.«
»Ihre Mutter ist nicht einverstanden?« Marsh konnte die Bestürzung in seiner Stimme nicht verhehlen. »Womit nicht einverstanden? Sie ängstigt sich doch sicherlich nicht wegen mir …«
»O nein. Es sind die Indianer, die ihr Sorge bereiten, Professor. Sie ist nicht damit einverstanden, dass ich in den Westen gehe, weil sie wegen der Indianer Angst um mich hat.«
Marsh schnaubte. »Offensichtlich weiß sie nichts über meine Vorgeschichte. Ich bin weithin anerkannt als ein enger Freund des roten Mannes. Wir werden keine Probleme mit Indianern bekommen, das verspreche ich Ihnen.«
Doch die Situation war insgesamt unbefriedigend für Marsh, der später Bellows zuflüsterte, dass Johnson »älter aussieht als die anderen«, und dunkel andeutete, dass »er vielleicht gar kein Student ist. Und sein Vater ist im Schiffsbau. Ich glaube, mehr muss nicht gesagt werden.«
Der Abfahrtspfiff ertönte, es gab letzte Küsse und viel Winken für die Studenten, und der Zug setzte sich in Bewegung.
Marsh hatte für seine Gruppe einen privaten Salonwagen organisiert, der von keinem Geringeren als Commander Vanderbilt bereitgestellt worden war, einem inzwischen ans Krankenbett gefesselten, weißhaarigen Zweiundachtzigjährigen. Es war die erste von vielen erfreulichen Annehmlichkeiten, die Marsh dank seiner ausgedehnten Verbindungen zur Armee, zur Regierung und zu Industriekapitänen wie Vanderbilt für diese Reise organisiert hatte.
In seiner Blütezeit war der mürrische Commander, eine schwerfällige Gestalt in einem Pelzmantel, den er sommers wie winters trug, von ganz New York bewundert worden. Mit ruchlosen und aggressiven Instinkten und einer scharfen Lästerzunge hatte dieser ungebildete Junge aus Staten Island, Sohn niederländischer Bauern, die Kontrolle über die Schifffahrtslinien ab New York und San Francisco an sich gerissen; später interessierte er sich für die Eisenbahn und baute die Strecke seiner mächtigen New York Central Railway aus dem Herzen New Yorks bis ins florierende Chicago aus. Er lieferte immer guten Stoff für die Zeitungen, sogar in den seltenen Fällen, in denen er eine Niederlage einstecken musste; als der verschlossene Jay Gould ihn im Ringen um die Kontrolle über die Erie Railway besiegte, verkündete er: »Dieser Erie-Krieg hat mich gelehrt, dass es sich nie auszahlt, ein Stinktier zu treten.« Bei einer anderen Gelegenheit beschwerte er sich vor seinen Anwälten: »Was kümmert mich das Gesetz? Habe ich denn nicht die Macht?«, und diese Aussage machte ihn zu einer Legende.
In späteren Jahren wurde Vanderbilt zunehmend exzentrisch, er pflegte engen Kontakt zu Hellsehern und Hypnotiseuren und sprach mit Toten, oft auch über drängende Geschäftsangelegenheiten; und obwohl er skandalöse Feministinnen wie Victoria Woodhull förderte, jagte er dennoch Mädchen hinterher, die nur einen Bruchteil so alt waren wie er.
Einige Tage zuvor hatten New Yorker Zeitungen verkündet: »VANDERBILT LIEGT IM STERBEN«, woraufhin der alte Mann aus dem Bett sprang und die Reporter anblaffte: »Ich liege nicht im Sterben. Und auch wenn ich im Sterben liegen würde, dürfte ich immer noch genug Kraft haben, um euch diese Verleumdung zurück in eure verlogenen Kehlen zu stopfen.« So berichteten es zumindest die Reporter, allerdings wusste jeder in Amerika, dass die Sprache des Commanders um einiges deftiger war.
Eleganz und Modernität von Vanderbilts Salonwagen waren unübertrefflich – ausgestattet mit Tiffanylampen, Porzellangeschirr und Kristallglas, waren sie der letzte Schrei, und auch die raffinierten, brandneuen, von George Pullman erfundenen Schlafsofas sorgten für ungewohnten Reisekomfort. Inzwischen hatte Johnson alle anderen Studenten kennengelernt, und er notierte in sein Tagebuch, sie seien »ein wenig langweilig und verzogen, aber alles in allem ein recht abenteuerlustiger Haufen. Doch wir alle haben eine gemeinsame Angst – vor Marsh.«
Wenn man sah, wie Marsh durch den Waggon stolzierte, in einen der üppigen Polstersessel sank, um eine Zigarre zu rauchen, oder nach dem Bediensteten schnippte, damit er ihm ein geeistes Getränk brachte, wurde deutlich, dass er diese Umgebung als für seine Person angemessen betrachtete. Und tatsächlich nannten die Zeitungen ihn manchmal den »Baron der Knochen«, so wie Carnegie der »Baron des Stahls« war und Rockefeller der »Baron des Öls«.
Wie diese anderen großen Männer hatte Marsh es aus eigener Kraft nach oben geschafft. Als Sohn eines New Yorker Farmers hatte er früh Interesse für Fossilien und Gelehrsamkeit gezeigt. Trotz des Spottes seiner Familie hatte er die Phillips Academy Andover besucht und sie mit neunundzwanzig Jahren mit Auszeichnung und dem Spitznamen »Daddy Marsh« abgeschlossen. Von Andover ging er nach Yale und von Yale nach England, um die Unterstützung seines philanthropischen Onkels George Peabody zu erbitten. Sein Onkel bewunderte Gelehrsamkeit jedweder Art, und es freute ihn sehr, dass ein Mitglied seiner Familie eine akademische Karriere einschlug. Er gab Othniel Marsh die Mittel für die Gründung des Peabody Museum in Yale. Der Haken dabei war nur, dass Peabody später Harvard eine ähnliche Summe spendete, um auch dort ein Peabody Museum zu gründen. Der Grund dafür war, dass Marsh den Darwinismus befürwortete und George Peabody derart areligiöse Ansichten ablehnte. Harvard war die Heimat von Louis Agassiz und wurde deshalb zu einer Hochburg der Anti-Evolutionisten – Peabody hatte den Eindruck, Harvard würde sich als nützliches Korrektiv zu den Exzessen seines Neffen erweisen. All das erfuhr Johnson in geflüsterten Unterhaltungen in den schwankenden Pullman-Kojen in dieser Nacht, bevor die aufgeregten Studenten in den Schlaf sanken.
Am Morgen erreichten sie Rochester, am Mittag Buffalo, und sie freuten sich auf den Anblick der Niagarafälle. Leider war ihr einziger kurzer Blick, von einer Brücke ein Stückchen stromabwärts, eine Enttäuschung. Diese verwanden sie jedoch schnell, als sie erfuhren, dass Professor Marsh sie alle in seinem Privatabteil erwartete.
Marsh schaute den Gang in beide Richtungen entlang, schloss die Tür und verriegelte sie von innen. Obwohl es ein warmer Nachmittag war, schloss er alle Fenster und verriegelte sie ebenfalls. Erst dann wandte er sich den zwölf wartenden Studenten zu.