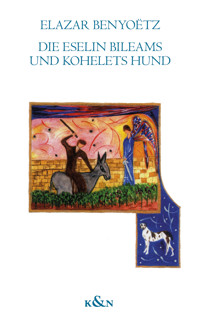Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Elazar Benyoëtz ist der wohl bedeutendste deutschsprachige Aphoristiker der Gegenwart. Dieser Band versammelt Auszüge aus einem Korpus von fast 700 Briefen von und an Benyoëtz, die thematisch sortiert und mit Anmerkungen versehen sind. Der Leser gewinnt aus den Exzerpten erstmals einen umfassenden Einblick in das Selbstbild des Autors bezogen auf Person und Werk sowie auch in sein Verhältnis zur Literatur und zu seiner Zeit. Ein chronologisches Verzeichnis der Briefe und BriefpartnerInnen, ein Personenregister sowie eine annotierte Bibliographie zu Werk und Sekundärliteratur vervollständigen den Band, der damit ein unentbehrliches Hilfsmittel jeder wissenschaftlichen Beschäftigung mit Benyoëtz darstellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 782
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Friedemann Spicker
Beziehungsweisen
Elazar Benyoetz: Ein Porträt aus Briefen
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2019 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.narr.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-7720-8699-1 (Print)
ISBN 978-3-7720-0109-3 (ePub)
Inhalt
Zur Einführung
Briefe müssen nicht im Zusammenhang stehen, aber eine Beziehung glaubwürdig widerspiegeln und für den Schreibenden sprechen.
EB an Monika Fey, MonikaFey, 24. Januar 2006
Der Aphorismus ist das Stiefkind der Literaturwissenschaft und der Literaturgeschichte, ungeachtet seiner großen Autoren von Karl Kraus, KarlKraus bis Elias Canetti, EliasCanetti, um nur vom letzten Jahrhundert zu sprechen. Wer allein die neueren Bände des „de Boor/Newald“, der repräsentativen, in zehn Bänden vorliegenden deutschen Literaturgeschichte, den von Wilfried Barner, WilfriedBarner herausgegebenen Band für die Zeit von 1945 bis zur Gegenwart (1994) und den von Helmuth Kiesel, HelmuthKiesel verfassten zur deutschsprachigen Literatur 1918–1933 (2017), daraufhin durchsieht, wird dieser Aussage unmittelbar zustimmen müssen. Der Aphorismus kommt dort (so gut wie) nicht vor.
Stiefkind: Das gilt umso mehr für die mystisch-religiöse Aphoristik, für die im 20. Jahrhundert (in einer breit gefächerten Palette von Möglichkeiten) immerhin Autoren wie Peter Hille, PeterHille, Christian Morgenstern, ChristianMorgenstern, Franz Kafka, FranzKafka, Ferdinand Ebner, FerdinandEbner, Rudolf Schröder, Rudolf AlexanderAlexander Schröder, Theodor Haecker, TheodorHaecker, Franz Werfel, FranzWerfel, Ernst Meister, ErnstMeister, Franz BaermannSteiner, Franz Baermann Steiner und Ludwig Strauß, LudwigStrauß stehen. Gleichzeitig, und das mag ein Grund für die Skepsis der Literaturwissenschaft sein, ist der Aphorismus auf der Ebene der Gebrauchsliteratur, in Lebenshilfe und Kalenderweisheit, bis auf den heutigen Tag von ungebrochener Attraktivität.
Da nimmt es nicht wunder, dass man den Briefband eines Autors wie Elazar Benyoëtz, der sich sein ganzes Leben lang ausschließlich dem Aphorismus und seinen lyrisch-meditativen Nachbarformen gewidmet hat, nicht ohne eine kurze Einführung zu Leben und Werk lassen kann. Dabei ist der Autor mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden; bedeutende Literaturwissenschaftler von Harald Weinrich, HaraldWeinrich bis HaraldFricke, Harald Fricke, die sich ihm zuwandten, haben ihn unisono in einer Reihe mit Lichtenberg, Georg ChristophLichtenberg, Kraus, KarlKraus und Canetti, EliasCanetti gesehen. Das hat an seiner Randstellung, nicht nur in geographischer Hinsicht, bisher wenig bis nichts geändert, wenn er auch in jüngster Zeit vermehrt zum Gegenstand literarisch-theologischer Erörterungen geworden ist.
Elazar Benyoëtz, 1937 in Wiener Neustadt geboren und bald darauf mit den Eltern nach Israel emigriert, war schon in jungen Jahren ein erfolgreicher israelischer Lyriker, ehe er 1963 für einige Jahre nach Deutschland ging, um dort vorwiegend wissenschaftlich-bibliographisch zu arbeiten und die „Bibliographia Judaica“ aufzubauen. In Israel wurde er dafür stark angefeindet. Zu den Fragen seiner literarischen Sozialisation hat er sich selbst häufig geäußert; auch die Briefexzerpte dieses Bandes sprechen vielfach davon. Seit 1969 lebt er in Tel Aviv und Jerusalem. Die Entfernung vom Sprachraum seiner Literatur ist konstitutiv, auch wenn die Kontakte nach Deutschland, in Briefen oder auf (Lese-)Reisen, vielfältig und eng blieben. Er veröffentlichte in regelmäßiger Folge deutschsprachige Aphorismenbände, zunächst in dem kleinen VerlagMüller, Gotthold Müller, dann bei Hanser, dem Verlag, zu dessen Autoren auch Stanislaw Jerzy Lec, Stanislaw JerzyLec und Elias Canetti, EliasCanetti zählen, und in jüngerer Zeit bei Braumüller (Wien) und Königshausen und Neumann (Würzburg) sowie in zahlreichen kleinen Privatdrucken, die zum großen Teil aus Lesungen entwickelt wurden. Ab 1990 erschienen neuartig strukturierte Bände, in denen neben Aphorismen tagebuchähnliche Kurzberichte, Lektürekommentare und literarhistorische Exkurse, Lyrik und Briefauszüge, Zitate und Selbstzitate zusammengestellt sind, nach 2010 auch vermehrt seine Lesungen in Buchform. Allesamt sind sie der verloren gegangenen deutsch-jüdischen Symbiose gewidmet. Das Jüdische ist bei allen Fäden in die Gattungsgeschichte hinein schon allein deshalb als das Neue zu verstehen, weil hier kein deutscher Jude mehr schreibt wie noch Ludwig Strauß, LudwigStrauß oder Werner Kraft, WernerKraft, sondern ein Israeli sich an deutsche Leser wendet.
Benyoëtz entwickelt sein (deutsch-)jüdisches Thema – Assimilation erscheint ihm als „Identitäuschung“ – von den Geschichten des Alten Testaments mit den Zentralgestalten KainKain, HiobHiob, AbrahamAbraham her. Er verfolgt damit das Konzept der Verbindung hebräischer Weisheitslehre und deutscher Aphoristik. Den Spruch bringt er mit Glauben, aber auch mit Widerspruch in Verbindung, mit beidem knüpft er an älteste Traditionen an. Das Buch KoheletKohelet, der Prediger Salomo, ist ihm Vorbild, das einzige, das er so unumschränkt gelten lässt. An diese hebräische Spruchdichtung sucht er mit seinen „Sprüchen“ und ihrer Autorität anzuschließen. Für sein Gesamtwerk ist es charakteristisch, dass er es in Teilen oft aufnimmt, variiert und neu komponiert; es ist von der Suche nach einer aphoristisch-lyrischen Mischgattung gekennzeichnet. Der Ausgangspunkt seiner Poetologie ist eine höchst komplexe Kürze, durch Mehrsinnigkeit mit Spannung aufgeladen, die etwa dem Wortspiel in aller Regel eine neue Kraft verleiht. Auch die Definition ist in das Spannungsreich-Ambivalente hinein weiterentwickelt, in dem Gleichsetzung, Gegensatz, Folge, ironische Durchleuchtung, entgegensetzende Antwort in wechselnden Anteilen enthalten sind.
Thematisch steht Benyoëtz gleichfalls mit zentralen Komplexen seines Werkes in der Tradition der Gattung, und er führt sie nicht nur fort, er entwickelt sie fort. Aus einer zentralen Uneindeutigkeit, einer bewussten Ambivalenz zwischen kotextueller Isolation sowie Zusammenhang und Einbindung als Teil eines Größeren, entwickelt sich das Gattungsweitende und -überschreitende. Das dem neuen Buchtyp zugrunde liegende Mittel ist das Zitat. Erinnerung als lebendig-ganzheitlich, gegenwärtig und vergegenwärtigend ist dabei ein Leitmotiv. Auch mit Versbrechung und Mittelachse, die endgültig einen Grenzbereich zwischen Aphorismus und Lyrik besetzen, geht eine innovative Veränderung einher. Dabei sind die abgrenzende Aufnahme der Sprachmythisierung und -personalisierung von Karl Kraus, KarlKraus und insbesondere die Verbindungslinien zu Kafka, FranzKafkas Aphoristik mit ihrer autonomen Bildlichkeit ebenso von Bedeutung wie die Beziehungen zu den jüdischen Exilaphoristikern FranzSteiner, Franz Baermann Baermann Steiner und Ludwig Strauß, LudwigStrauß und, von Martin Buber, MartinBuber her, das dialogische Prinzip.
Benyoëtz, der unter allen zeitgenössischen Aphoristikern das meiste interpretatorische Interesse geweckt hat, gilt als der bedeutendste deutschsprachige Gattungsautor der Gegenwart. In einer Gattung, die zu seiner Zeit in Deutschland, von ein paar frommen Erbauungsaphoristikern abgesehen, fast ausschließlich von sozialpolitisch orientierten, im Übrigen agnostisch-atheistischen Autoren geprägt ist, sich in ihrer Breite der Variation vorgegebener Muster widmet und in Gesinnungs- und Lebenshilfeaphoristik ergeht, stellt Benyoëtz’ Aphoristik mit seinen Konzepten von Kürze und Wörtlichkeit, seinem Erproben von Autorität und Weisheit als aphoristische Grundlagen, insbesondere aber mit seiner Metaphorik in der Nähe des Schweigens in Verbindung mit der Mittelachse einen durch das Miteinander von hochintellektueller Literatur und Religiosität beispiellosen Gipfelpunkt dar.
Hier ist wohl auch ein persönliches Wort zu der Beziehung des Herausgebers zum Autor angebracht, weil es dem Leser erlauben wird, den vorliegenden Band auch in dieser Hinsicht einzuschätzen. Kennengelernt als Autor habe ich Elazar Benyoëtz im Zuge meiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit dem Aphorismus, sei es literaturhistorisch, sei es zeitgenössisch, zu Ende des Jahres 1976; mein Besitzeintrag in den „Einsätzen“ (1975) 16.11.1976 bezeugt es. Die Hoffnung, die der Klappentext ausdrückt, es sei ein „bemerkenswertes Bändchen“, hat sich in meinem Fall erfüllt: Der schmale Band aus dem kleinen Verlag hat mich erreicht. Und in mehr als einem Sinne, denn die Hanser-Bände „Worthaltung“, „Eingeholt“ und „Vielleicht – vielschwer“ habe ich sogleich erworben, die früheren „Einsprüche“ nachgeholt. Benyoëtz fordert ein ‚anwesendliches Lesen‘, wenn er schrebt: „Die landläufige Vorstellung vom Aphorismus […] fordert ein abwesendliches Lesen, das nur noch auf Nebenreize reagiert. Ich suche die Kunst, die Kunst findet meine Hand: aus dieser erblüht eine Handvoll Gedanken“ („Filigranit“, S. 8f.). Es materialisiert sich für den späten Nach-Leser wohl in den An- und Unterstreichungen, den Ausrufe- und auch den Fragezeichen, dem Verweis auf frühere Bände („wie vor“), den Kringeln, die Korrespondenzen verbinden, den Marginalien: „vgl. Kasper, HansKasper“ oder „ s. Lichtenberg, Georg ChristophLichtenberg“: ein Lesen, das sich Rechenschaft gibt. Meine Rückkehr nach Europa nach einigen Jahren an einer koreanischen Universität, in denen ich den Anschluss an aktuelle Neuerscheinungen etwas verloren hatte, lässt sich im August 1991 geradezu am Benyoëtz-Leser ablesen: „Treffpunkt Scheideweg“, im Vorjahr erschienen, habe ich noch im November desselben Jahres gekauft. Im Mai 1996 sind wir uns bei einer Lesung in Amsterdam zum ersten Mal persönlich begegnet, und ich nutzte die Gelegenheit, „Filigranit“ und die mir bisher unbekannten kleinen Herrlinger Drucke zu erwerben. Unser Briefwechsel setzt im Jahr darauf ein. Er bezieht sich unter anderem auf die Auswahl aus seinem Werk, die ich für den Band „Aphorismen der Weltliteratur“ vorgenommen habe.
Eine neue Stufe der Zusammenarbeit bedeutete es, als er im Jahr 2000 den Band „Der Mensch besteht von Fall zu Fall“ komponierte und ich ein Nachwort beisteuerte. Ich konnte ihn für eine Lesung in meiner Kölner Buchhandlung gewinnen, zu der ich die Einführung gab. Bis 2004 kommt es zu mehreren Begegnungen, in Köln, in Bonn, bei der Verleihung des Joseph-Breitbach-Preises der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz; die Briefe wachsen zu einem Briefwechsel an. Als mein Buch über den Aphorismus im 20. Jahrhundert, in den Siebzigern geplant, erschienen war (das ihm ein angemessen großes Kapitel widmet), löste es eine Flut von Briefen bei ihm aus, wie sie auch hier auszugsweise dokumentiert ist. Meine Beschäftigung mit dem Aphorismus, stellte er fest, decke sich genau mit der Entstehungszeit seiner Aphoristik. Er las intensiv: „Das bedeutet, dass ich bald zwölf Stunden mit Ihrem Buch und mit Ihnen spreche.“ Und er schrieb: „Ihre Gattungsgeschichte wird immer mehr zur Geschichte meiner Jugend.“ Dass Elazar Benyoëtz die Gattungsgeschichte wie kaum ein Aphoristiker sonst kennt, wusste ich aus seinen Publikationen; wie genau er sie kennt und wie dicht das Netz persönlicher Bekannntschaft ist, das lernte ich jetzt erst in Fragmenten kennen. In der Folge habe ich dann mehrfach von meiner fortlaufenden Beschäftigung mit dem Autor Rechenschaft gegeben: so in einem größeren Lexikonartikel, in kleineren Festbeiträgen und Rezensionen, in Anthologien und literaturhistorischen Überblickswerken sowie in begleitenden Texten im Lichtenberg-Jahrbuch (Bibliographie im Anhang). Ich konnte ihn zu Tagungen einladen: 2005 zur Lichtenberg-Tagung in Ober-Ramstadt, 2008 zum dritten Aphoristikertreffen in Hattingen, 2015 im Rahmen der Jüdischen Kulturtage im Rheinland in Hilden. Und im Jahr 2007 konnte ich ihn dafür gewinnen, meiner Reihe dapha-drucke im Deutschen Aphorismus-Archiv mit dem ersten Band, einer Auswahl von Aphorismen und Briefen, das Maß vorzugeben.
Der Brief hat im Zusammenhang des Werkes von Elazar Benyoëtz einen im Vergleich zu anderen Autoren herausragenden, wenn nicht einzigartigen Stellenwert: Er ist integraler Bestandteil seiner Vorstellung der Gattung , Buchʻ als einer Komposition von Mischtexten aus Aphorismus, Tagebuch und Gedicht, aus Zitaten und eben Briefauszügen. Dementsprechend sind in seine Werke seit den neunziger Jahren immer wieder auch Briefe integriert. Und auch diverse Briefsammlungen liegen vor, kleinere, unselbstständig gedruckte Briefwechsel mit einzelnen Partnern, größere, vor allem mit dem Band „Vielzeitig“ von 2009, der Briefe von 1958 bis 2007 sammelt, und in „Olivenbäume die Eier legen“, das der Autor als ein „Nachbuch“ bezeichnet und in dem er die Stationen seines Lebens und Werkes auch mit den brieflichen Reaktionen dokumentiert.
Hier nun erwartet den Leser keine weitere Briefsammlung. Aus einem Teil dieses umfangreichen Briefwerkes wird in diesem Band der Versuch eines Autorenporträts unternommen, wie es in den Bemerkungen „Zur Edition“ im Anhang im Einzelnen vorgestellt wird.
F. S.
I„Unleugbar spielten die Briefe in meinem Leben und Werk eine entscheidende Rolle.“ – Der Brief als „gerichtetes Wort”
Lange habe ich noch an dem Briefwechsel* gearbeitet und solange auch gezögert, Ihnen zu schreiben und Sie erneut um Ihr Wort zu bitten, um Ihr Wort als Dichter, Leser, Freund, Zeuge und Dichter. Es wäre sehr wichtig, dass Sie sich vor diesen Briefwechsel stellen; zu Bodman, Clara vonClärle, das Sie genau erkannten, zu Manuel auch, dessen Novellen Sie herausgaben** und dessen Bild nicht ganz deutlich wird. Und auch zu mir, ja. Betrachten Sie es bitte nicht als Aufgabe – ein Blatt, ein sonniges, schattenspendendes, ein einziges Blatt von Ihrem Baum wäre Leben genug. Die erweiterte Auswahl, die neue Zusammenstellung ist fast makellos, entspricht dem Gelebten und bleibt anfechtbar. Mehr kann ich nicht sagen, könnten Sie aber – auf einer Seite, in einem Vorwort, Nachwort oder Begleitbrief. *** Für Ihre lange, getreue Begleitung, für Ihre ermutigende Rede sage ich Ihnen Dank.
* Solange wie das eingehaltene Licht. Briefwechsel mit Clara von Bodman, Clara vonBodman; Vielzeitig, S. 287 et. pass.; vgl. Olivenbäume, S. 167ff. et pass. (Die Titel der Bücher von EB hier in Kurzform; vgl. dazu die Bibliographie der Werke und Briefeditionen im Anhang.)
** Emanuel von Bodman, Emanuel vonBodman: Das hohe Seil und andere Novellen. Nachwort Albrecht Goes, AlbrechtGoes. Stuttgart: Reclam 1991
*** Der mit beiden befreundete Dramatiker Max Zweig, MaxZweig schrieb das Geleitwort zum Briefwechsel. Vgl. Solange wie das eingehaltene Licht, S. 5–9; vgl. Allerwegsdahin, S. 121f., 127f.; vgl. Aberwenndig, S. 124f., 126f., 321
Ihre erneute Stellungnahme zum Briefwechsel* freut mich, sie ist gut und klar, erlaubt einen neuen Denkansatz und ermöglicht ihn – vom Bart bis zum Honig. Aber wie, wenn beide, Honig wie Bart, echt sind? Und das sind sie doch: der Bart des jungen Juden und Dichters, der Honig der alten Dame. Der Honig zumal ist ein natürlicher, und auch der naturreinste ist immer klebrig. Das ist nicht durchwegs angenehm, doch vermindert nicht den Nahrungswert und zieht von der Süße nichts ab. Oder doch? Ich weiß nun, was Ihnen unangenehm war und wohl noch ist, weiß aber noch immer keinen Grund für Ihre heftige Abwehr: „Auf keinen Fall veröffentlichen!“ Mag sein, dass so manches im Briefwechsel gegen mich spricht, wie zum Beispiel, dass ich mir Honig um den Bart schmieren lasse, muss dies aber auch gegen Clara sprechen? Um sie geht es doch, um sie allein geht es mir. […]. Ich war nicht bemüht, im verklärten oder heiteren Licht zu erscheinen. Von mir gibt es in diesem Buch nur Briefe, Bodman, Clara vonClaras Briefe dagegen enthalten ihr Größenmaß und geben sie maßvoll wieder, sind also viel mehr als nur Briefe, doch leuchten sie schöner und leuchten besser ein, wenn meine Briefe durch ihre Briefe fahren. Oder war es, liebe Daphne, Ihr ganz persönliches Bangen um mein schöneres Bild? Das würde mir gefallen, denn gern gefalle ich Ihnen, trotzdem ist Gefallsucht nicht meine hervorragendste Stärke. So meine ich, es sei gut, dass wir uns über Bart und Honig, über jung und alt, Gefallsucht und Verfallenheit neue Gedanken machen. Dieser Briefwechsel wäre ein annehmbarer Ansatz dazu. Noch einmal: Möge Ihre Abneigung noch so gut begründet sein, sie gehörte zu diesem Fall und wäre losgelöst von ihm nicht zu denken, nicht von Grund auf neu zu bedenken. Ich meine: Der Ausgang entscheidet über den Ansatz, die Jahre werden in der Liebe zu Dauer, und was wir am Ende bedauern, das sind wir zu Anfang gewesen.
* Mit Clara von Bodman, Clara vonBodman. Vgl. Brief an Daphne Hertz, DaphneHertz, Vielzeitig, S. 118f.
Briefwechsel ist Austausch, Mitteilung – nicht gleich, nicht durchwegs, nicht unbedingt Dialog. Auch muss nicht immer von Dialog gesprochen, geschweige denn geschwärmt werden. Dialog ist im Sprechen selbst angesetzt, doch lässt sich über diesen Ansatz ebenso gut hinwegsetzen. Manchmal ist dies gerade, was das Imposante eines Briefes ausmacht. Der groß angelegte Brief ist immer zunächst ein großartig ausgestellter Wechsel. Mit dem konkreten Briefpartner wird das Ganze auf eine Neugier beschränkt, man kann dann scheinbar „besser folgen“, bleibt an der Sache aber nur über die Neugier beteiligt, ohne sich darum stärker angesprochen zu glauben. „Das an dich gerichtete Wort verliert mit dir seine Richtung“. Die Richtung ist das von mir Verlorengegebene, damit bist du schon gemeint, dadurch noch nicht getroffen.
Ich habe mich sehr gern in die Briefe* eingelesen. Es sind ja durchweg Personen, die interessieren und die auch etwas zu sagen haben, was in Deinen Briefen genauestens aufgenommen (und stimuliert) wird. Schön, ein bezügliches Denken in diese Form zu überführen, die ja zum Glück nie aus der Literatur verschwunden ist. So liest man gern weiter, es ist eine ganz eigentümliche Spannung in diesem Buch (das eines werden soll). Vielleicht hängt das auch mit der eigenen (jüdischen?) Dialektik zusammen, die Versöhnung nicht als „Aufhebung“ (Verschmelzung der Standpunkte) denkt, sondern strikt als Gespräch meint (das gelegentlich auch schon mal lauter werden darf), als Dialog, der aufgegeben ist, wenn die Stimme des Anderen zum Verstummen gebracht wird. Nein, es ist ein sehr schöner Band, auf dessen Erscheinen ich mich freue.
* Das gerichtete Wort. Auswahl aus dem Briefwechsel 1973–1993; zurückgezogen
Man sieht einem Aphoristiker an, ob er Tagebuch schreibt oder nicht, ob seine Aphorismen von ihm kommen oder seinem Tagebuch entstammen. Man sieht es vor allem an der Fähigkeit eines Aphoristikers, von sich und mit sich selbst zu sprechen. Wer das kann, der schreibt nicht nur Tagebücher, er ist mit seinen Tagebüchern auch intim. Aus dieser Intimität, die ich bezeugen kann, beanspruche ich aber auch den „Brief“ für die Gattung. Das habe ich theoretisch noch nicht laut genug ausgesprochen, aber unübersehbar angedeutet: mit der Aufnahme von Briefen oder Brieffragmenten in meine Bücher. Der Brief gehört zur aphoristischen Praxis, zumal es das Wort zu einem gerichteten macht. (Meine geplante Briefedition heißt „Das gerichtete Wort“. Die drei Wörter mögen auch meine Auffassung vom Aphorismus bedeuten). Damit hätten Sie wieder einen Begriff für meine Aphoristik, einen Schlüssel, der aufschließt.
Meinem deutschen Aphorismus ging der Brief voraus und der Brief liegt meiner ganzen Aphoristik zugrunde. Ich betone: die deutsche Aphoristik, weil meine hebräische in Schrifttum und Habitus ihren Grund und Quelle hat. Sie ist keine Worthaltung, und von der Bibel her ist jedes Wort ein gerichtetes. Im Deutschen musste ich mich erst zum Denken erziehen, meine Gedanken ausbilden und „bebildern“, damit sie nicht zu Meinungen herabsinken. Das hätte ich durch mein Tagebuch allein nicht erreicht. Tagebücher sind keine gute Schule, weil man an sich ja kein Wort richten kann, auch wenn man sich ständig zu etwas ermahnen muss.
Das Briefeschreiben als Passion und Schule habe ich vor wenigen Jahren aufgegeben, ich brauch das nicht mehr, und auch meine Aphoristik hat es nicht mehr nötig. Ich kann übrigens einem Aphoristiker auch ablesen, ob er Briefe schreibt oder nicht.
Weil Du Dich so lange um das Hebräische bemühst und Dich so ernsthaft hineinsingst, fällt es mir leichter, Dir Hebräisches, deutsch Gedachtes, zu schreiben. Die Fragen, die Du mir stellst, kommen aus einer hebräischen Neugier. Wenn ich sie auf Deutsch beantworte, gehe ich dem Hebräischen entgegen. Eine Zweitsprache schafft Distanz und erleichtert das sich selbst Umarmen, wozu sonst nur Erinnerungen fähig sind. Erinnerungen sind Selbstumarmungen, über das Gedächtnis hinweg. Es gibt Gesprächspartner und Briefpartner, die keine Gesprächspartner sind, aber gute Adressen, wie Ohren, die sich spitzen lassen, weil sie nicht allem offenstehen mögen. Es sind zuhörende Erzähler, die alles aus dem Gegenüber herausspinnen. Sie sind nur scheinbar passiv, die Aufmerksamkeit ist die beste Hebamme des Erzählens. Es ist – nun auch der Briefwechsel – voller Panik, wie wenn alles auf ein Ende drängen, ich in eine Enge getrieben würde, in der ich verzweifelt aus einer Situation, aus einem Menschen Funken Poesie schlagen möchte.
Briefe müssen nicht im Zusammenhang stehen, aber eine Beziehung glaubwürdig widerspiegeln und für den Schreibenden sprechen. Briefe sind Einsichtungen; wenn man im Briefwechsel steht, wie im Leben, wie in der Versuchung, wie auf Kriegsfuß. Ich sehe viele Gesichter, Regungen, Leidenschaften, Hemmungen, erkenne Taktik und Verspieltheit. Sie sind mir alle willkommen. Ich sehe ein Ganzes, das Ganze kommt zur Auswahl, wird beschnitten, hört damit auch auf, „ganz gut“ und „ganz schön“ zu sein. Es wird sich ergänzen lassen und könnte immer wieder zur Geltung kommen. Verloren ist der „Blick aufs Ganze“. Das Ganze wird gepuzzelt. Fremde Menschen, die nicht von Leidenschaft sind, die nur die Falten sehen, nicht das Eingefaltete, treffen die Auswahlen, besorgen die Editionen und führen sie, kommentierend, auf ein Ganzes zurück, das sich nie wieder finden ließe. Das fremde Auge bindet das Ende an den unverbindlichen Anfang und stellt den Zusammenhang her, als wär’s ein Verhängnis. So entstehen die Bilder, die „genauen“, die nach und nach „authentischen“, mit denen wir konfrontiert werden. Daran lässt sich studieren, was alles genau ist, heißt oder sein soll. Wirklich im gelebten Leben ist das Nichtgenaue, das Annähernde. Das Treffliche belebt das Daneben.
„Allzu 70–jährig.“ Das Jahr, das uns so sehr zu schaffen macht. Mit Deiner Kritik hast Du mir schon geholfen, sie hat mich, wie es sein soll, verunsichert. Es ist ein Moment der Schwäche, ich mache mir mehr Skrupel als Gedanken. Mit „allzu 70–jährig“ hast Du, Dich selbst dagegen auflehnend, den Kern getroffen. Ich müsste von vorn beginnen, und dazu fehlt mir die Aussicht. Die Aussichtslosigkeit sollte den sinkenden Mut heben. Das Ich zu beherrschen ist schwer, das gespaltene zu überwältigen hoffnungslos. Mein Weg als Israeli und Jude ins Deutsche ist nicht nur mein Lebensweg, ist auch der Schrei meines Lebens. Ich musste mich fügen, ohne mich beugen zu können. Was ich annehmen musste, habe ich nie akzeptiert. Den Deutschen, für die ich schreibe, bin ich nicht „einzusehen“, aber auch den Israelis nicht, weil ich für sie gerade nicht schreibe. Das Pathos liegt im Schreiben, die Distanzlosigkeit im „für“. Das liegt auch dem zugrunde, was Du „einen alten Streitpunkt unter uns beiden“ nennst. Es ist kein Streitpunkt, es ist eine Hemmung. Wann immer Du meine Prosa lobtest, war es mir eine Auszeichnung. Ich habe mir Prosa nie zugetraut und fühle mich auch jetzt von der Vorstellung verfolgt, kein Schriftsteller zu sein. Das liegt tief und geht mir nicht leicht über die Lippen. Diese Not ist zugleich aber meine Schaffenskraft: aus dem Bewusstsein, Dichter zu sein, und nichts als Dichter. Im Sinne des lyrischen Ursprungs, meines traurigen Frühlingserwachens. Sprichst Du mir das – in bester Prosa-Absicht – ab, muss ich mich zur Wehr setzen.
Es war wohl nicht anders möglich, als all diese Konflikte auch in den Briefwechsel hineinzutragen. Ich bin der einzige, der das tun kann, nicht darum auch der geeignetste. Der Verleger* wünscht sich Briefe zum Werk, er sieht es neutral, objektiv vor sich, die Briefe sollen dessen Erschließung dienen, zugleich aber eine andere von mir gepflegte „Gattung“ zum Bewusstsein bringen. So würde er denken, meine ich, er hat sich nicht näher darüber geäußert, er verlässt sich auf mich. Briefe zum Werk, Werk für Werk, lassen sich leicht finden und aneinanderreihen. Aber lässt sich das wirklich von „meinem Weg“ trennen? Und könnte daraus ein Buch werden, das man mit Anteilnahme liest?
Die Gefahr liegt nahe, es bliebe schematisch und steif. Der mythologische „Leser“ will dem Werk nicht auf den Grund, sondern auf den Hintergrund kommen. Auch ich wüsste gern, was hinter diesem Werk gestanden haben mag. Die Wahrheit kann ich freilich nicht liefern, aber ein Bild, das nach und nach korrigiert werden könnte, am Ende korrigiert werden müsste. Ein Bild, aber auch viele verschiedene Selbstbildnisse, die dazu gehörten, nicht Stimmen allein. Unter den Briefen Deiner Sammlung befinden sich nicht wenige davon, Du bekommst den Schreibenden zu sehen, und diese Briefe an mich sind mir die liebsten. Namen sind mir teuer, mit vielen verbindet mich Dankbarkeit; die Freunde machen die Lesbarkeit eines Werkes aus. Genug, Du weißt Bescheid und kannst so weiterfahren. Wenn Du am Ende bist, wird sich ein Bild einstellen, das uns zeigt.
Zur Frage: „Muss das jetzt schon publiziert werden? Wir leben doch noch“ –
Die Antwort: Wir leben doch noch, und es muss nicht schon publiziert werden; es ist aber auch die Ausnahme, dass wir es publizieren dürften. Die Publikation wird unsere Freundschaft nicht zerstören, und die Briefe sind alle längst geschrieben. Sie können im Schatten bleiben oder ins Licht gehoben werden. Meine Ansicht: Was zum Leben gehört, bleibe in der Pflege der Lebenden. Was zur Diskretion des Gelebten gehört, bleibe diskret. Darüber hinaus schreiben wir einander nicht anders, als wir miteinander sprechen, und das tun wir immer so und nicht anders, auch wenn man uns zuhört. Wer an unserem Gespräch teilnehmen mag, soll daran teilnehmen können, andere werden es nicht lesen, weil es sie nicht interessiert. Wir sprechen miteinander, wie ehrliche Freunde miteinander sprechen, das ist nicht Literatur, aber denkwürdig genug. Als Freund gehörst Du auch zu meinem Werk, nicht nur zu meinem Leben.
* Olivenbäume. Braumüller
Ich habe mich an Deinen Rat gehalten, habe nicht alles weggegeben*, und doch unendlich mehr als vorgesehen und von mir verlangt: übereifernd mich auf die Probe stellend. Denn dazu wäre ich – als Sammler und nicht Wegwerfer – vor weniger Zeit gar nicht fähig gewesen. Dein „Gebot“ war: Trennung für immer, ohne Wehmut. Ohne Sehnsucht. Mein gestriges Gefühl und heutiger Gedanke sagen mir, dass ich mich nach den „Materialien zu meinem Leben und Werk“ nicht sehnen werde. Ich sehe auch den Wert des Hinterbleibens – nicht des Bleibens, das einzig einem Werk einverleibt werden könnte – und habe, um mir das sagen zu können, unseren Briefwechsel vor Augen, der mir als Gewissen galt und nun Gewissheit geworden ist. Das ist das Herz meines literarischen Nachlasses, nicht nur, weil Du mein Begleiter warst, sondern, weil ich ohne Deine Begleitung nicht gewissenhaft am Werk hätte bleiben können. Das war mir die Bedeutung unseres Briefwechsels und ist mir „im Voraus“ eine Genugtuung, dass unsere Nachkommen davon wüssten. Es fiel mir nicht leicht, den Briefwechsel aus der Hand zu geben, aber nun sind wir beide alt genug, und wir bleiben bei- und füreinander, solange wir leben. Es fügte sich, dass ich eben jetzt (mit der 30. Fassung) mein Buch abgeschlossen habe.** Jetzt könnte es Dir gefallen.
* Briefwechsel an das Brenner-Archiv
** Olivenbäume
Hältst Du Dein Wort, machst Du Halt; haltbar wird, was sich entziehen will. Hältst Du mein Wort, habe ich Deine Gesichtszüge in Händen. „So fremd bist Du mir, wie nah. Die Nähe erträgst Du nicht, die Fremde ist mir schwer. An der Entstehung Deiner Bücher mithelfen zu dürfen ist meine Erfüllung.“* Das sind abfahrende Gesichtszüge, die ihre Stationen haben. Das gerichtete Wort ist das geeignete Mittel der Physiognomisierung. Ich spreche zu Dir, damit Du dich zeigst. Das magst Du nicht, Du weigerst Dich. Man zeigt sich nicht, lässt sich ja auch nicht gehen, bleibt lange auf der Hut, länger auf der Lauer. Sich zeigen, das käme einer Anzeige gleich. Ehe man sein Gesicht zeigt, spricht man sich aus, man ist ausgesprochen da – und ist nicht in Sicht getreten. Ich wende mich an Dich, werde Dir eine Wand: Du lehnst dich an ihr, kannst durch sie auch gehen. Der korrespondierende Augenblick tritt ein, in dem dies möglich wird. Dann hast Du Dich gezeigt, und ich verhalf Dir dazu. Deine Gesichtszüge, einige von ihnen, bleiben in meinen Briefen unverwischbar für immer. Du tratest in Sicht und bist zu lesen.
* Brief von Riccarda Tourou, RiccardaTourou, 3. Januar 2013
Ungefähr dürfen wir zehn Jahre feiern, weil es aber fraglich ist, bekommst Du ein fragwürdiges Geschenk: unseren Briefwechsel, so weit von mir übertragen und gehütet und im PC gespeichert. Es könnte Gewinn bringen, je nach dem. Ich habe nichts redigiert, einiges – rein technisch – korrigiert, von meinen (oft erschreckenden) Textflächen einiges weggeschnitten, das Übrige kannst Du selbst tilgen, für das erste Bild ist doch wichtig zu sehen, wie viel an Flächen ich Dir zugemutet habe, dafür sind fast alle Deine Gedichte der Reihenfolge nach erhalten. Es ist nicht uninteressant zu sehen, was alles in dieser Zeit – also auch mit und zwischen uns – an Literatur entstanden war. Manche Briefe ließ ich in der Originalform (und Farbe), die Gedichte habe ich in keinem Fall angetastet, der Rechtschreibung aber angepasst. Es ist ja keine Edition, und bei mir suche man auch keine Konsequenz. Ich lese gern in verschiedenen Ausgaben und zitiere ebenso gern aus verschiedenen, mir ist alles Schreiben recht, solange man nicht vergisst, „dass Tonfälle Gesten, dass Begriffsinhalte Blicke sind, die nachgelebt und nachgebärdet, nicht nur abgelesen und abgeschrieben werden können“ (Friedrich Gundolf, FriedrichGundolf).
Es ist das Dokument unserer Freundschaft, mit allen Steigerungen.
Mit den Briefen hat es noch seine Berechtigung, denn unleugbar spielten die Briefe in meinem Leben und Werk eine entscheidende Rolle: Sie ist meinem Werk abzulesen, und mit den zwei Briefbänden* habe ich für eine spätere Aufmerksamkeit ja auch gesorgt. Zwingend wäre ein weiterer Band nicht, doch eher als Bände anderen Genres gerechtfertigt. Für die Erschließung meines Werks wäre damit etwas getan, was sonst nicht mehr getan wird. Selbst wenn ichs vom Wiener Literatur-Archiv erwartete. Archive bewahren, geben nicht weiter, wenn nicht „einer“ initiativ wird. In meinem Nachlass ruhen umfangreiche Manuskripte, die nicht zur Geltung kamen, die ich mir „brennend“ herausgebracht wünschte und von denen ich nie bereut habe, dass sie liegen geblieben sind. Es muss auch mit dem Ehrgeiz aufhören, damit das „In-sich-gehen“ nicht allerwegs Phrase bleibe. Mein Werk kann auch „ungebilligt“ überleben. Die Briefe sind kein technisch zu bewältigendes Problem, auch das Vorhandene muss seine Konzeption entwickeln.
Erfahrungen sind gut im Umlauf, nicht gut im Umsatz. Ein Autor eignet sich am wenigsten dafür, ich bin dazu untauglich, denn ich kann nichts in Ruhe lassen, auch längst geschriebene Briefe nicht.
Einmal geschrieben, muss es um- und fortgeschrieben werden. Es müsste ein anderer her, doch auch der andere ist immer anders ein Anderer. Neugier allein kann da nicht befriedigen, auch rein Fachmännisches nicht. Den Germanisten interessierte das Germanistische, den Psychologen das Psychologische, den Österreicher das Österreichische. Es müssten mehrere daran arbeiten, das geht aber nicht; schon das Auswählen ist schwer genug. Ferner müsste gekürzt und angemerkt werden, und Du hast schon einmal erfahren, wie lästig es ist, wie schwer zu bewältigen.
* Vielzeitig. Olivenbäume
Meine Wirkung, die immer eine stille, unauffällige, nie offizielle, auch kaum erwartete war – kein Schrei, kein Reiz, kein Protest. Und doch in die Tiefe gehend? Das lässt sich behaupten, schwerlich belegen. Der Briefwechsel könnte kleine Belege, hauchdünne, beisteuern. Das wäre ohne Bedeutung, und doch von Wert. Der Fromme neigt zum Unscheinbaren, die Religion ist kein Holz auf Lager – Woodstock –, sie begehrt die Tiefenwirkung und ist dem Unsichtbaren ergeben.
Ich lege dazu, weil ich gerade dabei bin, Briefe aus dem Jahr 2000. Du wirst sehen, was mich alles „schon immer“ beschäftigte und wie schon immer ich wohlwollende, meistens wenig taugliche Menschen hatte: bei größter Zuneigung, mitunter bei gutem kritischen Verstand, aber ohne „Elan vital“. Ich liebe freilich auch die Träumer, die nichts von Erfüllung ahnen, sie kriegen alles in den Mund, nichts in den Griff. Schade eben, dass ich die Typen nicht romanhaft auseinanderhalten und zusammenbringen kann, da kommen die Bibliothekare, Archivare, die glauben, den Puls der Nationalliteratur abhorchen zu können, sie müssen nichts verstehen, sie sitzen an den Quellen, im Archiv, wer ist der Literatur näher als sie …
Der große Brocken ist das Briefprojekt*, unverdrossen mache ich meine Register, stelle dabei fest, dass mir halbe Jahrgänge fehlen und dass so manches unwiederbringlich verloren ist, aber auch dass mein Problem – in allem und immer – die Fülle ist. Ich schaffe es nicht, kann schwer sieben und sichten, ich habe den Eindruck, es müsste auf zwei Bände hinauslaufen, und zwar: Band. 1) Begleiter; Band. 2) Jünger.
Es wird dann biographisch und literarhistorisch weniger interessant oder aufregend (keine großen Namen), aber es hätte Hand und Fuß und Sinn und ließe sich auch mehr als Briefwechsel (wiewohl redigiert, mitunter streng) gestalten.
Band 1 – die Wissenschaftler: Fricke, HaraldFricke, Helmich, WernerHelmich, Holzner, JohannHolzner, Mieder, WolfgangMieder**, Sonnemann, UlrichSonnemann, Spicker, FriedemannSpicker, Stenzel, JürgenStenzel, Weinrich, HaraldWeinrich, Wiedemann, ConradWiedemann, Wohlmuth, JosefWohlmuth – es können auch Laien hinzukommen, wie Dorothee von Chamisso, Dorothee vonChamisso***, Hilde Schultz-Baltensperger, HildegardSchultz und Riccarda Tourou, RiccardaTourou.
Bd. 2 – Bongardt, MichaelBongardt, Dausner, RenéDausner, Grubitz, ChristophGrubitz, Heyden, KatharinaHeyden, Talebitari, BurkhardTalebitari, Welz, ClaudiaWelz.
Dies wäre schon einmal ein engerer Kreis, den man konzentriert verfolgen kann, es ginge um mein Werk, aber auch um das Thema Beziehung, die Bände ließen sich mit halbwegs gutem Sinn trennen, viele der Briefe liegen mir im PC vor, ich könnte die Auswahl vornehmen, ohne auf das ÖLA**** ausweichen zu müssen, wo natürlich viel mehr vorliegt, auch müsste ab und zu eine Abschrift verglichen werden, aber ich will nicht „historisch-kritisch“ streng vorgehen, es bliebe die Frage: kommentiert oder nicht, und wenn – wie weit? Das nämlich wäre noch einmal so viel Arbeit.
Nun, leuchtet Dir das Programm ein? – Jetzt bin ich mich aber satt.
* Unabgeschlossen
** Prof. Dr. Wolfgang Mieder, WolfgangMieder (geb. 1944), Literaturwissenschaftler. Professor an der University of Vermont. Spezialgebiete Sprichwort und Märchen; vgl. Olivenbäume, S. 15. Zu den übrigen Personen vgl. das Verzeichnis der Briefpartner(innen)
*** Dorothea von Chamisso, Dorothee vonChamisso (1912–2010), Altphilologin, Witwe des Urenkels von Adelbert von Chamisso, Adelbert vonChamisso, seit 1988 mit dem Chamisso-Preisträger EB freundschaftlich verbunden; Vielzeitig, S. 305; Allerwegsdahin, S. 166f.; Keine Worte zu verlieren, S. 17f.; Olivenbäume, S. 195–200
**** Literatur-Archiv der Österreichischen National-Bibliothek, Wien
Nur drei Stationen – Wittlich, Weinsberg, Schwäbisch Gmünd – , überall willkommen geheißener Gast, in feinen Hotels untergebracht, mit wenigen Reisen dazwischen – und vielen Gesichtern. Und doch: Ich bin noch gar nicht zu mir gekommen, nichts geschrieben, und dabei gefällt mir die eine, eigentlich entscheidende Lesung – geschrieben vor zwei Monaten – nicht mehr.
In dieser Not (erlaube mir, sie so zu nennen: Es ist mitunter erbaulich, sich lächerlich zu empfinden und – es bleibe unter uns – „so herum“ zu genießen) „flüchtete“ ich mich in unseren Briefwechsel und – arbeitslos seit Wochen – „arbeite ich daran“, als wären es meine Tagebücher. Nicht viel, nicht lang, aber es freute mich – darüber nachzudenken, was mich dazu bringt, was ich mir dabei denke, was dazu zu sagen wäre.
Was ich in meinem Tagebuch dazu schrieb, kann ich jetzt nicht sagen, das ist immer „für später“. Im Moment sage ich mir: dass es nicht anders gehen kann, schon gar, wenn ichs einmal rückwärts gelesen habe, quasi geschichtlich, unsere Beziehung zurückverfolgend und mich – angenehm – erinnernd. Das war ein lesendes Sich-Erinnern, ein noch fühlbares, ehe die Briefe, wie gestern geschrieben, wieder in die „Truhe“ (um beim Romantischen zu bleiben) gelegt werden – auf nimmer Wiederlesen, weil das Alter sich nicht zweimal seine Jugend als Hintergrund zurückrufen kann. Aus dem Gedächtnis wird Erinnerung, aus der Erinnerung das Nachlassen und der Nachlass.
Nach der zweiten Begegnung büßte der Briefwechsel sein Leben für die Gegenwart ein, und da geschah es: Die Gegenwart selbst suchte sich die Briefe aus, an die sie anknüpfen, sich also aussprechen konnte. Mit der bloßen Vorstellung „veröffentlicht“ eröffnete sich eine neue Perspektive. Was Dir und mir galt, hatten wir zweimal für uns, wie es in der Regel ja ist. Mit dem eingeschobenen Fremdenblick werden die Briefe zu „Texten“, die niemandem gelten, aber an sich zu gelten hoffen: weil geltungsbedürftig oder – weil lesenswert. Sie sollten lesenswert werden. Nun gibt es kein Ausweichen: Auch das hier ist „für später“, wie alles, was ich schreibe, und es kommt der Tag, an dem Du dies in einer anderen Fassung zu lesen bekommst, und wenn Du oder ich Glück haben, wird es in zwei Sätzen geschehen, denn es verdiente, in einen Satz gebannt zu werden.
Bestünde der Brief nur aus dem einen Satz: „Wie kannst du aushalten, was du wissend schreibst?“, wäre er vollständig und einwandfrei, weil es eine echte Frage ist, die auf etwas hinweist, das zu fragen ist: aus dem Inhalt oder aus der Beziehung. Es ist gleichsam etwas, das mit Dir zu tun hat.
Und das andere nicht? Ja, weil Du keine Schmeichlerin bist; nein, weil es in keinem Punkt Dich enthält oder aufdeckt. Das kann, das würde jeder sagen können. Und wenn es mich beim ersten Lesen auch freute, weil du mir lieb bist und ich Dir glaube, es ist nicht der Ausdruck, mit dem ich Dich nach außen zeigen möchte. Du bist Dichterin und stehst für die Dichtung ein. Ob Du willst oder nicht. Und das ist eben das Komplizierte des Briefwechsels, ich muss jene sehen, deren Blick ich Dich „ausliefere“. Es geht nicht um „gewichtig“, unser Briefwechsel ist vor allem privat, nicht aus Gefallsucht geschrieben, nicht für eine Veröffentlichung gedacht. Und doch denke ich, dass wir alles, was auch nur aus unserer Feder fließt, zu verantworten haben. Selbst die Schmeichelei müsste zur Würde kommen. Mit einer neuen Wendung. Schaffen wir’s nicht, haben wir versagt.
„Briefe sind Mitteilungen an sich selbst, die man zufällig frankiert hat.“*
Es geht darum, dass es frankierte Mitteilungen sind, die wir deshalb Briefe nennen, obwohl es doch Briefe gab, die nicht frankiert werden mussten und dennoch Mitteilungen an sich selber waren: den Übermittler einbeziehend, den Boten hinzudenkend. Die Frankierung, nicht ihre Zufälligkeit, macht die Mitteilungen an sich selbst zum Brief. Tagebücher sind gewiss Mitteilungen an sich selbst, sie werden nicht frankiert und nicht Briefe genannt, obschon sie den nämlichen Adressaten im Sinn haben. Das Tagebuch ist eine Botschaft ohne Boten. Da mich „Brief“ und „Tagebuch“ gerade beschäftigen, darum kommt mir Ihr Aphorismus gelegen.
* Winfried Schindler, WinfriedSchindler: Die Wirklichkeit der Illusion. Aphorismen. Annweiler: Sonnenberg 2009, Nr. 101
Die Probleme des autobiographischen Schreibens häufen sich bedrohlich. Ich wage sie nicht auszusprechen; die einer erneuten Brief-Edition sind geringer. Briefe plaudern die Tage selbst heraus. Dann suchen sie einander. Zusammentragen und Sichten – leicht gesagt, die Fülle ist erdrückend, wenn ich nur wüsste, wo anzufangen. Also fange ich bei unserem Briefwechsel an, den wir auf seinen Kerninhalt schon einmal – mit Erfolg – geprüft haben, was aber nicht besagt, dass nur kernlose Briefe übrigblieben.
Es handelt sich – fast ausschließlich – um die PC-Jahre, ich möchte auf Handschriftliches nicht zurückgreifen, mich möglichst von Wien* freihalten – ohne „Recherchen“, gerade wie es mir vorliegt, mit allen Fehlern, die gereinigt werden müssten, und Kürzungen, die notwendig sind.
Nur in seltenen Fällen käme ein ganzer Briefwechsel in Betracht, in jedem Fall muss eine Aussage bleiben, ich meine die Beziehung – Lebensweg oder Gedankengang – und der Brief, der alles enthält und doch auch für sich spricht. Ich habe unseren Briefwechsel nun zusammengetragen. Manches werde ich verloren, anderes übersehen haben, es ist dennoch unser Briefwechsel in all seinen Phasen und das Bild unserer Beziehung, die ich getreu erhalten möchte.
Ich bitte Sie, das Ganze auf das Erhaltenswerte hin zu prüfen; korrigieren Sie, was sich korrigieren lässt, kürzen Sie oder schlagen Sie Kürzungen vor. Erst die mir vermittelten Vorstellungen sagten mir, was zu machen ist, was sich zu machen lohnt.
Ich bleibe nur noch der Briefe wegen im Deutschen, und dies nicht über das Jahr 2014 hinaus.
* Literatur-Archiv der Österreichischen National-Bibliothek, Wien
Das Schreiben macht Ihnen Freude, das Resultat ist ein Brief, ein Brief ist ein gerichtetes Wort, das sein Gesicht nicht verhüllt. Sie sprechen von sich und sprechen zu mir, nichts Schöneres als dies.
Täten Sie es nicht, zu wem habe ich dann mit meinen Büchern gesprochen? Sie blieben jüdische Selbstgespräche. Auf diesen Punkt kommen wir noch – im Verlauf der Blätter – zurück. Ihren Berg müssen Sie sowieso besteigen oder versetzen, Sie tun es besser mit mir, da die Bereitschaft dazu in Ihnen entsteht.
Der Briefwechsel um Lec, Stanislaw JerzyLec* ist in meinen Augen sehr bedeutsam; Sie haben ihn inzwischen gekürzt, aber entschuldigen Sie, wenn ich es so knapp sage: Ich finde ihn immer noch zu lang. Was ich allerdings nicht weiß, ist Ihre eigentliche Intention zu diesem Briefwechsel. Wenn Sie die Entwicklung der Gedanken wiedergeben möchten, dürfen Sie tatsächlich nicht weiter kürzen – wollen Sie hingegen Ihre eigene Position (z.B. „was mir zu schaffen machte“) in welcher Form auch immer „darstellen“, dann meine ich wirklich, dass es kürzer sein müsste. Was haben Sie vor?
* Stanislaw Jerzy Lec, Stanislaw JerzyLec, vgl. Anm. zu Brief Nr. 44
Die Fragen, die Du Dir stellst, kann ich zwar beantworten, doch mir und nicht Dir. Ich lese sie mit und warte auf Deine Antworten oder Beantwortung. Dir vorausgehen will ich mit der Beantwortung der Frage, ob eine Mail noch als Brief betrachtet werden kann oder soll. Die Frage ließ mich nicht schlafen, obschon sie mir nicht grundlegend scheinen wollte. Du setzt etwas voraus, wogegen Du Dich selber stemmst (oder gefeit glaubst), wozu Du selbst weder Muster noch Beispiel bist: Lese ich Deine Mails, erkenne ich nicht, worin oder wodurch sie sich von Briefen unterschieden. Der Unterschied muss gesucht oder hergestellt werden. Das ist sicher so, stimmt aber nicht. Es gibt keinen Unterschied, denn Du bist ein Briefschreiber, und das bist Du und bleibst Du unter allen Umständen und durch alle Medien. Gibt es nun auch keinen Unterschied, so gibt es doch eine Differenz, sie ist eine psychologische und sie betrifft die Bewusstseinslage und die zu tilgende Distanz. Bei Dir ist sie noch schwerer festzustellen als bei mir (auf den die Feststellung ebenfalls zutrifft: es gäbe keinen erkennbaren Unterschied zwischen Brief und Mail), denn Du beeilst Dich mit Schreiben und Antworten nicht, es bleibt immer die dem Zweck eingeräumte Zeit. Bei Dir entfällt schon ein Kennzeichen: Der Mailschreiber hat es mit der Eile – auch wenn er es nicht eilig hat oder wenn Eile nicht gefordert wird. Die Mail ist die Eilige Schrift. Und im Gegensatz zur Heiligen ist sie nicht um Korrektheit, Fehlerlosigkeit, Genauigkeit, Sauberkeit bemüht, das ist grundlegend: Mailschreiben heißt an sich – mit der Eile zu tun zu haben. Damit bricht in den „Text“ – der noch zu besprechen wäre – die so lange ferngehaltene / ausgeschaltete Schamlosigkeit ein. Man kann sich nicht zeigen, ist also auch alles, wie es ist. Vor dem Schirm heißt psychologisch – halböffentlich, das kann „theoretisch“ die ganze Welt mitlesen, es ist kein Blatt und kein Bogen, kein Zusammenfalten und mit eigener Zunge anzufeuchtender Umschlag, frankiert und abgestempelt. „Nicht Ich und Du.“ „Das Wort ist nicht gerichtet“, man meldet sich und kommt sich als Nachricht vor. Ich unterbreche, denn es ist zu früh, um frisch genug denken zu können, es ist das erste Festhalten einer lohnenden Besprechung – für später. Im Prinzip – für mich Schreibenden – ist es ähnlich dem Wechsel von der noch ganz intimen Füllfeder zur nichtintimen Schreibmaschine. Mit dem Halten der Füllfeder – mit dem Sie-nicht-aus-der-Hand-Geben, aber Aus-der-Hand-legen-Können – wähnte ich mich Herr des Schicksals, federführend im Auge eines jeden Worts, verantwortlich für jedes, ganz und gar und rund. Mit dem Geklimper der Finger, dem Geklopfe der metallnen Lettern ward es mächtig eingeschränkt. Der Text bekam eine sichtbare Festigkeit, ich selbst aber ward tief verunsichert, wie wenn ich meine schreibende Hand verlassen hätte. Es war für mich eine antipoetische Handlung, für die ich mit einem wachsenden kritischen Sinn büßen musste.
Dieser Wechsel prägte sich meinem Bewusstsein als grundlegend ein, und in diesem Punkt bleibe ich mit H. G. Adler, Hans GünterAdler* unauslöschlich verbunden, denn er redete mir die Schreibmaschine ein. Das habe ich ihm lange nachgetragen, ja, nicht verzeihen wollen, und das beunruhigt mich noch eben jetzt, da ich erkennen muss, dass ich mein deutsches Werk diesem Moment schulde oder verdanke. Ich wäre mit der Füllfeder nicht darauf gekommen, hätte es auch nicht geschafft, und – wäre ich später nicht mit größter Abneigung an den Rechner gelangt –„Treffpunkt Scheideweg“ wäre kaum zur Welt gekommen. Mein Werk bliebe ohne Folgen, oder – an „Variationen“ etc. gemessen – ich bliebe ohne Werk im Deutschen. Im Hebräischen blieb ich bei der Füllfeder – wäre vielleicht weitergekommen, ob ich meine Zeit je erreichte? Schwer zu denken, man könne mit der Füllfeder Zeitgenosse sein. An Oskar Loerke, OskarLoerke denken aber doch Zeitgenossen vieler Zeiten. Das Buch hat es mir angetan: Von Loerke, OskarLoerke geschrieben**, von Annette Kolb, AnnetteKolb auf mich kommend, Alfred Mombert, AlfredMombert enthaltend.*** Dreimalstolz. Dass es mir nicht daran lag, Zeitgenosse zu sein, steht auf einem anderen Blatt. Zeitgenosse meiner Jugendsehnsucht – ja, das wollte ich sein, mit Emmy Hennings, EmmyHennings**** und Lotte Pritzel, LottePritzel*****. Im Deutschen konnte ich jedenfalls sein, was zu werden mir im Hebräischen verwehrt bleiben musste: Zeitgenosse vieler Zeiten.
Das Jahr 2013 war mir Plage genug, es erfordert noch allerlei Reinigung, auch wäre mir das Verantworten von Briefen anderer, die konsultiert, befragt, beschnitten werden müssten – zu schwer, mitunter lästig, wobei ich deren Zustimmung weitgehend voraussetzen dürfte. Es wäre alles zu umständlich, vor allem zu umfangreich, und – lese ich mit Deiner Nase – es scheint auch wenig dafür zu sprechen. Nicht jeder, der gern Briefe schreibt, ist hinlänglich Briefschreiber.
Es gibt Menschen, die gern mit mir korrepondieren, das merkt man ihren Briefen auch an, manche entwickeln eine Stimme, manche hallen wider oder hauchen ihren Geist brieflich aus. Das wäre eine Studie für sich. Die herrschende Meinung ist dem Brief eher abgeneigt, die Neigung gilt dem Briefwechsel, auch wenn der Wechsel ohne Deckung bleibt. Das würde ein verlegerisches Problem ergeben, wie die Anmerkungen auch, die ich mir so gern sparen möchte. Ich könnte freilich andere Konzeptionen verteidigen, aber nicht gut genug darstellen. Es bleibt – anders als „Vielzeitig“ – die Geschichte meines Alterswerks und meines Alterns, mit der dazu geschaffenen Umwelt und vielen Nebenstimmen. So interessant oder eigenartig dies sein mag (mit Einsichten noch und noch), es bewegt sich in einem engen Interessenkreis und letztlich um einen wenig bekannten Autor.
Die hinreißenden Stellen sind wenige, denkbar wären kleine Auszüge als Vorspann – oder als Anmerkung oder im Anhang. Meine Briefe – streng ausgewählt, die Auswahl wieder gesiebt – und die Briefe selbst gut gekürzt. Widme bitte auch dieser Vorstellung einen Gedanken, ehe ich mich zu einer Konzeption entschließe. Ich möchte gern von editionellen Begriffen weg, doch gerade bei Briefen fürchten Verleger die (meist nicht vorhandenen) Editionskritiker, es gibt ja in der kritischen Welt nichts Leichteres zu kritisieren/bemängeln als einen Briefband (ein falsches Datum, eine alte Schreibart, das Fehlen eines Namens im Register, „ein Vergleich mit ergäbe …“). Es ist eben schwer, mit einem Briefband die Unvergleichlichkeit zu erreichen. Gut, dass es mir in der Aphoristik glückte, da konnte ich aber auch taktieren.
* H. G. Adler, Hans GünterAdler (1910–1988), deutschsprachiger Prager Schriftsteller; vgl. Allerwegsdahin, S. 92; vgl. Die Rede geht im Schweigen vor Anker, S. 51; vgl. Aberwenndig, S. 93 mit Anmerkung
** Oskar Loerke, OskarLoerke: Zeitgenosse aus vielen Zeiten. Berlin: S. Fischer 1925
*** EB: Annette Kolb, AnnetteKolb und Israel; vgl. Treffpunkt Scheideweg, S. 34; Loerke, OskarLoerke: Zeitgenosse aus vielen Zeiten, S. 206–215; vgl. Olivenbäume, S. 301
**** Emmy Hennings, EmmyHennings (1885–1948), Schriftstellerin und Kabarettistin; gehört mit ihrem Ehemann Hugo Ball, HugoBall (Heirat 1920) zu den Begründern des Dadaismus.
***** Lotte Pritzel, LottePritzel (1887–1952), Puppenkünstlerin, Kostümbildnerin und Zeichnerin
Dein Brief hat mich einigermaßen erschüttert, weil es das Bild Deines Lebens, wie es ist und wie es war, wiedergibt: Alle Ecken und Enden finden sich in den Brief ein. Der freie Blick des über Paris schwebenden Geistes des Romanisten, das fliehende Gedächtnis, der suchende Blick, der noch sieht, was nicht verborgen bleiben kann: die Rothschild-Schule, die Lage also und der Rückknüpfung [?], alle Bemühungen um Freiheit und Änderungen, die Dich auszeichneten, das Vertrauen im Experiment, die Verbrüderung jener, die irgendwann wieder aufhören, Brüder zu sein, weil sie „stämmig“ werden und streng um Abgrenzung bemüht sind, Territorium, Acker, Quelle, Brunnen, Wüsten und Verwüstungen. Das alles ist in Deinem Brief zusammengeklagt. Man verspricht nicht mehr, zu leicht könnte man sich versprochen haben.
Über Wert und Bedeutung von Briefwechseln müssen wir einander nicht überzeugen. Welcher Verlag gäbe Lavater, Johann KasparLavaters Briefwechsel* heraus, was muss alles geschehen, geleistet, zusammengetragen werden, um einen Briefwechsel herauszubringen, den manche erforschen werden, niemand aber lesen wird? Gedacht wurde schon viel über Briefe und Briefwechsel, umgedacht nicht genug. Da stehe ich mit meinem kümmerlichen Briefwechsel. Nötig ist eben der Wechsel – aber nicht nur der Briefe. Als Erkenntnis gebe ich zu überlegen, dass nichts über die Vollständigkeit eines Briefwechsels Goethe, Johann Wolfgang vonGoethe-Schiller Schiller, Friedrichginge, damit wäre aber nicht gesagt, dass die Briefe Goethes oder Schillers allein gerade die Hälfte wären. Sie zählen nur weniger, wiegen aber jeder für sich schwer genug.
* Ab 2018 wird im Rahmen eines Schweizerischen Nationalfonds-Projektes eine historisch-kritische Ausgabe einer Auswahl aus Joh. Caspar Lavater, Johann KasparLavaters Briefwerk vorbereitet; vorgesehen sind zehn Bände. Diese werden, wie schon die Ausgewählten Werke Lavater, Johann KasparLavaters, im Verlag der Neuen Zürcher Zeitung erscheinen.
Ich schicke Dir die erste Auswahl*, die müsstest Du nun strenger durchkämmen. Das Endziel, denke ich, soll ein Arrangement sein, das deute ich mit den ersten Auszügen an: Brief – Freundschaft – Werk.
Meine Stimme ist die häufigere und die lautere, sie müsste gedämpft werden. Nun sage ich Dir etwas, das Du von mir kennst, das Dir aber – nach wie vor fremd ist: „Gedruckt“, was und wie auch immer – bedeutet: Text, Lesestoff, Literatur. Und Literatur muss schön und gut oder gut und schön sein. Die Verantwortung des Autors gilt dem Text gegenüber, ist er gut (geworden) – hat er seine Pflicht erfüllt.
Unsere Freundschaft besteht, ist ein Faktum, unantastbar, die Briefe sind ihr Ausdruck – unveränderlich: In der Intimität und posthum. Die Veröffentlichung ändert daran nichts, aber das dritte Auge der lesenden Neugier, das die Intimität weniger interessiert und von Dichtern möglichst Dichtes erwartet, zumal in einer rein literarischen Umgebung, wie die einer Festschrift. Alles, was im Leben gilt, gilt auch in der Literatur und für uns, z.B. Kosmetik. Du gebrauchst sie im Leben, sollst sie auch in der (Brief-)Literatur gebrauchen dürfen, Du korrigierst ja auch andere Fehler. Ob ich damit Recht habe? Es ist keine Rechtsfrage, ist Kosmetik und gehört zur schönen Literatur wie zum schönen Leben. Ich spreche von Briefen, nicht von Briefeditionen, von Ästhetik, nicht von Philologie. Ich schreibe, wie es kommt, und sage, wie es ist, das Schreiben vor Augen und hinterm Ohr. Wie immer Du duftest, wie gut Du dich schminkst, wir werden uns treffen. Oder einander verfehlt haben. Du bist der Brief.
Dies zur Erklärung meines Standpunkts, Deiner bleibe, wie er ist, tadellos und unantastbar.
Was ich von Dir bitte: dass Du Dir ein Wunschbild vom Beitrag machst; dass Du streng auswählst und ohne Rücksicht kürzest und streichest. Denk an Dich, an mich nur, wenn und wo unumgänglich. Vor allem muss Deine Stimme vernommen werden. Du wirst erkennen, was du gern gesagt hast oder wieder gern sagen würdest. Wenn Du die Redaktion in dem Sinne durchgeführt hast, setze ich die Auswahl fort.
* Elazar Benyoëtz – Ingeborg Kaiser, IngeborgKaiser: Die Freunde des Dichters machen die Lesbarkeit seines Werkes aus. Aus dem Briefwechsel 2004–2016. In: Ingeborg Kaiser, IngeborgKaiser: Porträts, Lesarten und Materialien zu ihrem Werk. Hg. von Klaus Isele, KlausIsele. Norderstedt: Books on demand 2016, S. 56–84
ADas Netz der Beziehungen
II„Lebten wir in Zeit und Geist genössisch?“ – Zeitgenossen
Ich freue mich, dass Sie das bibliographische Material nunmehr für Ihr Archiv beisammen haben.
Herr Otto Heuschele, OttoHeuschele* hat sich in meinem „früheren“ Leben in rührender Weise bei meinem Start als junger Schriftsteller für mich eingesetzt. Da mir aber keinesfalls klar ist, welche Haltung er während der Nazizeit eingenommen hat, besteht von meiner Seite nicht die Absicht, die Verbindung mit ihm aufzunehmen. Wenn er mir schreibt, werde ich ihm selbstverständlich höflicherweise antworten.
* Otto Heuschele, OttoHeuschele (1900–1996), Schriftsteller, Essayist, Aphoristiker, Herausgeber; vgl. Brief Nr. 45
Was Herrn Heuschele, OttoHeuschele betrifft, haben Sie gewiss recht. Wir werden ja sehen, ob er sich meldet. Gerechterweise will ich vorsichtig sein und ein Sich-nicht-Melden nicht gerade als Zeichen des schlechten Gewissens beurteilen. Indessen will ich aber den „Fall“ untersuchen. Ich dachte anfangs nicht daran, weil er mir, als ich kam, andeutete, Herr Wilhelm von Scholz, Wilhelm vonScholz*, den ich vorher gesprochen hatte, wäre doch nicht einwandfrei. So hielt ich ihn selbst für „einwandfrei“, was mir durch seine harmlose Erscheinung bestätigt zu sein schien. Nun aber will ich Ihnen noch einen anderen Gruß bestellen – von Georg von der Vring, Georg von derVring**, mit dem ich befreundet bin, den ich auch lieb habe. Er ist bestimmt einwandfrei***. Es geht ihm in letzter Zeit nicht gut, sogar so wenig gut, dass man kürzlich schon das entsetzliche Gerücht verbreitete, er wäre gestorben. So schlimm ist es aber nicht, er ist nur alt geworden und hatte sich einen Arm gebrochen. Er ist ein wirklicher Dichter, wenn auch die junge Generation solche Dichtung nicht mehr gelten lassen will. Deshalb bleibt er es dennoch, allen zum Trotz.
* Wilhelm von Scholz, Wilhelm vonScholz (1874–1969), Schriftsteller, Aphoristiker. Er arrangierte sich früh mit dem NS-Regime und wird wegen seiner zustimmenden Haltung zum Nationalsozialismus der NS-Literatur zugerechnet – so lt. Wikipedia
** Georg von der Vring, Georg von derVring ( 1898–1968), Schriftsteller und Maler; vgl. Die Eselin Bileams und KoheletKohelets Hund, S. 190 ; vgl. Die Rede geht im Schweigen vor Anker, S. 58
*** Bestimmt einwandfrei: „So vorsichtig prüfend ich mich glaubte, musste ich mir nach und nach das ,bestimmt ʻ sowohl als auch das ,einwandfreiʻ abgewöhnen; das geschah nicht ohne Folgen für meine Aphoristik.“ (An Friedemann Spicker, FriedemannSpicker, 25.4.2018)
Dank für das allermerkwürdigste „Du“-Heft*. Als ichʼs in der Hand hielt, dachte ich, ich hätte Deinen Brief nicht richtig gelesen, Dürrenmatt, FriedrichDürrenmatt könne doch unmöglich gestorben sein. Die Einleitung zum Heft las sich aber wie eine melancholische Ironie, als würden Dürrenmatt, FriedrichDürrenmatt oder seine Seele irgendwo im Raum über uns schweben. Das tat sie dann also auch. Ein Zusammentreffen von Datum und Seele in einem Zwischenraum. Voreilig schickte ich Christoph Grubitz, ChristophGrubitz** zum Neujahr eine aphoristische Auswahl aus Dürrenmatt, FriedrichDürrenmatts Werken (Diogenes-Büchlein)*** mit meinen verdrossenen Anmerkungen. Ich glaube nach wie vor, dass Dürrenmatt, FriedrichDürrenmatt groß im Großen ist, aber nicht im Kleinen. Unbegreiflich war es mir, wie er dieser Auswahl nur zustimmen konnte. Jetzt, nach dem Interview mit ihm, kann ich es verstehen. Die Schweiz hat ein Prachtexemplar seiner besten Gattung verloren, Israel einen seltenen, auch kostbaren, weil nur kritisch liebenden Freund.****
* Du – die Zeitschrift der Kultur. Dürrenmatt, FriedrichDürrenmatt (70). Tages-Anzeiger Zürich 1991. Dürrenmatt, FriedrichDürrenmatt starb im Dezember 1990.
** Vgl. Verzeichnis der Briefpartner(innen)
*** Das Dürrenmatt, FriedrichDürrenmatt Lesebuch. Herausgegeben von Daniel Keel. Mit einem Nachwort von Heinz Ludwig Arnold, Heinz LudwigArnold. Zürich: Diogenes 1991
**** Presseartikel „ Ich stelle mich hinter Israel“ (1973), Träger der Buber, MartinBuber-Rosenzweig, FranzRosenzweig-Medaille 1977, Ehrendoktorat Jerusalem
Nicht ich habe Margarete Susman, MargareteSusman** die „große Großmutter“ genannt, sondern Bodman, Clara vonClärle***, die sich selbst dann die „kleine Großmutter“ nannte. Sie war um fast zwanzig Jahre jünger als Margarete Susman, MargareteSusman, verehrte sie aber auch. Margarete Susman, MargareteSusman ist mir ganz natürlich Großmutter geworden, Bodman, Clara vonClärle wollte es sein, Annette Kolb, AnnetteKolb – die stolze Jungfrau („Ich war nie einem Mann erlegen!“) – war zu solchen Gefühlen nicht fähig, auch zu solchen Spielen nicht, aber zu anderen, wie eben mit dem „wilden Hebräer“ und seiner christlichen Schwester, das gefiel ihr, für das Geschwisterliche hatte sie im Leben wie im Werk Gefühl und Sinn, wir trafen uns auch öfter mit ihrem Bruder Paul. Sie war älter als Margarete Susman, MargareteSusman, und es gibt eine Briefstelle von Margarete Susman, MargareteSusman, in dem sie den Umstand mit Humor erwähnt, dass sie – meine Großmutter – nun auch die Großmutter meiner Schwester sein müsste. Das und anderes mehr können Sie in meinem Kolb-Buch lesen. Aber wie kommen wir zum Buch, da nun der Stiehm-Verlag eingegangen ist? Vielleicht finden Sie es im Ramsch.
Vor zwei oder drei Jahren erschien Annette Kolb, AnnetteKolbs Briefwechsel mit René Schickele, RenéSchickele, damit ist die Frage nach ihrem Antisemitismus laut geworden. Es ist eine Frage, aber eine für mich nicht mehr interessante, da ich nun alle meine Pappenheimer kenne. Antisemitismus lebt vom Hörensagen, vom Leichtsinn, aus Ignoranz und Charakterlosigkeit. Damit will ich seine Gründe nicht genannt haben, Annette Kolb, AnnetteKolb aber aus der langen Reihe der charakterlosen Schriftsteller herausnehmen. Das war sie in keinem Fall, in keinem Punkt; die Schwächen teilte sie mit vielen anderen. Die Stärke behält man für sich und zur Not. Sie gehört zu den besten, tapfersten und ehrlichsten Schriftstellern deutscher Sprache: auch hinsichtlich der Judenfrage; sie war sogar eine entschiedene und konsequente Zionistin, wovon man in Deutschland nichts wissen will; es ist leichter und billiger, für die große Europäerin zu schwärmen. Also bewährte sie sich im Leben und im Werk, für das sie in der Öffentlichkeit mit Namen und Gesicht, die sie hätte verlieren können, einstand. Mehr kann ich von einem Schriftsteller nicht verlangen. Kein deutscher Schriftsteller setzte sich mit einer Fußnote ein Denkmal, wie Annette Kolb, AnnetteKolb auf S. 176 ihres Romans „Die Schaukel“, Berlin 1934.****
Und schließlich ihre letzte Reise. Alle ihre illustren Freunde waren gegen ihre Reise; die 96jährige wollte von ihrem innigen Wunsch, das altneue Volk in seinem altneuen Land zu sehen, nicht lassen. Natürlich haben die Katholiken auch die Absicht ihrer Reise gefälscht, die Wahrheit darüber steht in meinem (vielverschwiegenen) Buch. „Dein Land ist schon mein Land geworden“ ist Annette Kolb, AnnetteKolbs letzte schriftliche Mitteilung an mich. Bodman, Clara von