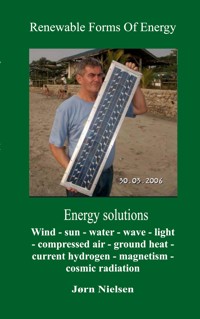Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Mein Leben als Hells Angel
- Sprache: Deutsch
Ein bewegender Einblick in das Leben eines Hells Angels.Jönke erzählt von seiner Jugend in Kopenhagen. Ob die spannenden Bandenkämpfe, Mutproben und Schlägereien oder die abenteuerlichen Liebeleien, Rafting- und Fallschirmspringerfahren oder sogar seine Bemühungen Spenden für Greenpeace zu sammeln. Nichts lässt er aus und ist dabei wunderbar ehrlich und gleichzeitig ist seine Erzählung gefüllt mit Selbstironie und Humor. Bis es zu dem Mord an Makrele kommt."Die ersten fünf Seiten lesen sich wie der Anfang eines eher billigen Krimis. Und dem Mord an Makrele und der Zeit danach hat der Autor nur zwei sehr kurze Kapitel zu Beginn des Bandes gewidmet. Von allen Beteiligten, einschließlich sich selbst, berichtet Jönke in der dritten Person. Doch dann wechselt er die Perspektive und erzählt uns von seinem Leben unter Rockern -- und den eigenen Regeln dieses Milieus. Dass man am Ende versteht, weshalb es den jungen Jörn Nielsen aus dem gut bürgerlichen Elternhaus schnurstracks zu den Hell's Angels führte, kann man nicht behaupten. Aber vielleicht gibt es da ja auch gar nichts zu verstehen. Auf alle Fälle lernt man aus diesem Lebensbericht eine ganze Menge -- vor allem über die Gesetze und den Kodex der Hell's Angels." --Hasso Greb-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jørn Nielsen
Big Run
mein Leben als Hell’s Angel
SAGA Egmont
Big Run - mein Leben als Hell’s Angel
Aus dem Dänischem von Gabriele Haefs nach
Copyright © 2003, 2018 Jørn Nielsen und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711524251
1. Ebook-Auflage, 2018
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Der Mord an Makrele
Der Mann hatte die Bewegungen der Frau genau im Blick. Er sah, wie sie das Gartentor öffnete und den Garten betrat. Er spürte, wie das Adrenalin in sein Blut strömte und die Spannung seinen Körper erfaßte. Er war nicht nervös. Nur konzentriert. Nervosität ist etwas für Menschen, die nicht wissen, was sie tun. Er dagegen hatte keinerlei Zweifel daran, warum er hier saß.
Er hatte sich gerade geduckt, als die Frau zu ihm herüberschaute. Oder, genauer gesagt: zu dem Wagen, in dem er saß. Einem zweifarbigen Lieferwagen mit einer Hecktür und einer Schiebetür an der Seite. Mit Fenstern in der Hecktür und zwischen Ladefläche und Fahrersitz. Und durch dieses letzte Fenster behielt er die Frau im Auge. Sie verschwand im Wohnhaus.
Er war nicht ihretwegen gekommen, aber sie gehörte mit dazu, denn er war hier, um ihren Mann zu töten. Die Frau tat ihm nicht leid. Sie mußte wissen – und wußte es vielleicht auch –, daß ihr Mann alle Chancen aufgebraucht hatte, die das »Schicksal« für ihn bereithielt.
Der Mann schaute aus dem Fenster. Die ruhige Wohnstraße lag wie ausgestorben da. In der Ferne entdeckte er eine Frau, die ihren Hund ausführte. Eine bleiche Sonne hing am Himmel. Es war noch so früh, daß sie nicht wirklich wärmen konnte. Im Lieferwagen war alles totenstill – abgesehen von den Pfefferminzdragees, die der Mann unablässig zerkaute.
Er kratzte sich am Hals und zupfte an seinem dunkelblauen Sweatshirt. Es wurde jetzt doch ein wenig wärmer. Er schaute auf die Uhr. »Oha«, flüsterte er vor sich hin. Er wartete schon seit über einer Stunde, aber er würde auch den ganzen Tag hier ausharren, sollte sich das als notwendig erweisen.
Er betrachtete den orangen VW, der vor dem Gartentor stand und ihm die Front zukehrte. An die zehn Meter trennten ihn von diesem Wagen. Er wußte, daß der dem Opfer gehörte, und er war sich fast zu hundert Prozent sicher, daß der andere mit seinem VW losfahren würde. Und wenn er erst hinter dem Lenkrad saß – dann wäre er ein toter Mann.
Ein älterer Mann, der auf einem Fahrrad vorüberschepperte, lenkte für einen Moment seine Aufmerksamkeit auf sich. Er zog den Kopf ein, aber das wäre nicht nötig gewesen. Niemand würde auf die Idee kommen, zu ihm hereinzuschauen. Wer konnte denn auch damit rechnen, daß der Lieferwagen den Tod geladen hatte?
Im Haus hatten Makrele und seine Frau soeben ihr Frühstück beendet und machten sich zum Aufbruch bereit. Makrele war der Präsident des Motorradclubs Bullshit. Obwohl er schon einige Mordanschläge überstanden hatte, hatte er deshalb seinen Lebensstil nicht geändert. Im vergangenen Jahr hatte er angedeutet, daß es vielleicht jetzt zu spät sein könnte, aber daß er keinen anderen Ausweg sehe, als weiterzumachen und aufs Beste zu hoffen. Und er ging davon aus, daß alles gutgehen würde, denn das Glück war ihm immer hold gewesen. Er hatte immer ein Einkronenstück bei sich, das einst seine Bewegungsfähigkeit und deshalb sein Leben gerettet hatte. Er dachte oft daran – und er hatte es sogar vergolden lassen. Er wußte es nicht, aber an diesem Morgen würde sein Kleingeld nicht ausreichen.
Er fragte die Frau weithin hörbar, ob sie noch nicht fertig sei. Das war sie, und die beiden gingen zur Tür. Ihr Hund sprang glücklich an dem Mann hoch, als ihm aufging, daß er mitkommen durfte. Sie öffneten die Tür zum Sonnentag. Der Hund lief vor ihnen her zum Gartentor. Makrele und seine Frau holten ihn ein und traten auf den Bürgersteig hinaus. Makrele öffnete die Tür zum Fahrersitz, stieg aber nicht sofort ein. Sie hatten es nicht eilig, und es war ein schöner Morgen. Die Frau brachte den Hund in einem Käfig hinter dem Fahrersitz unter. Sie knallte die Tür zu. Dann stieg sie ein. Makrele setzte sich neben sie und zog dann ebenfalls seine Tür zu. Es wurde jetzt heiß draußen – er kurbelte das Fenster nach unten.
Dann schrie seine Frau auf.
Der Mann in dem zweifarbenen Lieferwagen kratzte sich unter seiner Maske am Kopf. Die Maske saß so fest wie eine zweite Haut und nervte ihn. Er hatte sie schon einmal über sein Gesicht gezogen – als die Frau allein aus dem Haus gekommen war, danach hatte er sie wieder in seine Stirn geschoben.
Abgesehen von der roten Maske war er schwarz gekleidet. Mit Ausnahme seiner hellen Turnschuhe. Außer ihm enthielt der Lieferwagen nur zwei Dinge: Ein blaues Rennrad – seine Rückfahrkarte. Und eine mattschwarze Stengun-Maschinenpistole, geladen und entsichert. Das war sie, seit er hier saß. Er schaute kurz zu ihr hinüber und dachte: Ob das Opfer wohl zur Feier des Tages dreißig Kronenstücke in der Tasche hat?
Er schaute wieder aus dem hinteren Fenster. Das machte er häufig. Er wollte nicht gesehen werden, ohne das selber zu wissen. Es wäre doch ärgerlich, wenn ihm fünf oder sechs Jahre einfach wegen Mordversuchs aufgebrummt würden. Es wäre zweifellos – falls er in dieser Situation erwischt würde – schwer, den Richtern klarzumachen, daß er einen Waldspaziergang gemacht hatte oder nur mit dem Opfer plaudern wollte.
Es war ihm nur recht, daß der andere Wagen ihm die Front zukehrte. Das bedeutete, daß er und das Opfer einander in die Augen schauen würden. Er ging davon aus, daß sein Ziel hinter dem Lenkrad sitzen würde, ob die Frau nun dabei wäre oder nicht.
Sie war wirklich sein einziges Problem. Er wollte sie fast um jeden Preis schonen. Nur, wenn sie ihn selber in Lebensgefahr brächte, würde er sie liquidieren. Trotz der vielen Kugeln, die seine Stengun in die Luft abgeben würde, hatte er keine Angst, sie zu treffen. Er war ein trainierter Maschinenpistolenschütze, und er wußte, daß eine Stengun leicht zu beherrschen ist.
Er schaute auf die Uhr. 10.24 Uhr. Der letzte zerkaute Rest eines Dragees verschwand in seiner Kehle. Wieder kratzte er sich am Kopf.
Im Garten tauchte ein Hund auf. Und danach das Ziel und dessen Frau. Sofort zog er sich die Maske vor das Gesicht. Vorsichtig hob er mit der rechten Hand die Stengun vom Boden auf, während er Makrele und die Frau beobachtete, die jetzt den Garten verließen.
Die Frau ging auf die Straße hinaus und trat neben den Wagen. Sie öffnete die Schiebetür und verstaute den Hund auf der Ladefläche. Dann knallte sie die Tür zu, ging nach vorn und stieg ein.
Dasselbe machte auf der anderen Seite Makrele.
In dem Moment, in dem die Frau die Tür zuknallte, öffnete der Mann im Lieferwagen seine Schiebetür vorsichtig einige Zentimeter.
Jetzt fehlte nur noch eine Bewegung.
Makrele zog die Wagentür zu und kurbelte sein Fenster herunter, aber sein Mörder sah das nicht, denn in dieser Sekunde riß er die Tür des Lieferwagens zur Seite und sprang auf die Straße, wie ein Exhibitionist, der in einem Park hinter einem Baum auftaucht.
Er sah, daß die Frau ihn entdeckt hatte.
Sie schrie los.
Makrele schaute auf, als seine Frau zu schreien begann. Sie hatte bereits ihre Tür geöffnet und wollte den Wagen verlassen. Makrele sah, wie der schwarzgekleidete Mann angelaufen kam.
Die Maschinenpistole in seiner Hand war kein Scherz. Sie starrte ihn mit ihrem einen Auge an. Er mußte fort von hier. Er entschied sich für die Tür, die seine Frau eben geöffnet hatte. Sie war bereits aus dem Auto gesprungen und rannte am Auto entlang. Makrele robbte vorsichtig zur offenen Tür, während er zugleich aus weit aufgerissenen Augen den Mann mit der Maschinenpistole beobachtete.
Er versuchte dagegen anzukämpfen, mußte aber einfach laut aufschreien – und noch lauter, als er sah, wie der Mann sich bückte und zum Schuß ansetzte.
Er erlebte alles in Zeitlupe.
Er hörte das vertraute Geräusch der ersten Geschosse, die die Maschinenpistole verließen. Makrele hatte dieses Geräusch für »arrogant« gehalten, wenn er mit seinen Kumpels Probeschüsse abgegeben, und wenn er sich an Überfällen auf andere Clubs beteiligt hatte. Jetzt war ihm das alles egal. Er wußte, daß es das letzte war, was er jemals hören würde.
Die Salve trennte ihn von seiner Frau, die noch immer versuchte, sich in Sicherheit zu bringen, während er selber keine Waffe in Reichweite hatte. Er merkte, daß er getroffen wurde. Sein Körper wurde seltsam schwer. Er wußte, daß er nicht tot war, aber er konnte nicht mehr fliehen.
Aus der Ferne hörte er Schreie. Und Schritte. Für einen Moment glaubte er, ein weiteres Mal überlebt zu haben. Er würde aussteigen, jetzt, wo das hier überstanden war. Das versprach er sich selbst.
Eine weitere Salve zerriß die Luft, die ihn umgab.
Und dann war die Sache überstanden.
Die Frau reagierte als erste. Sie hatte den Wagen schon fast verlassen, als Makrele aufging, was hier passierte.
Der Mann war froh darüber, daß sie nicht mehr so dicht beieinander saßen. Das würde ihm die Arbeit erleichtern. Sie konnte nicht wissen, daß es das Beste für ihn gewesen wäre, sich beschützend über ihren Mann zu werfen. Makrele versuchte – zur großen Überraschung des Mannes – durch dieselbe Tür auszusteigen wie die Frau. Handelte er im Schock oder hatte er eine versteckte Waffe?
Der Mann fing Makreles verängstigten Blick ein. Dann ging er in die Hocke, um besseren Halt zu haben. Makrele schrie jetzt lauter als die Frau, aber der Mann kannte keine Gnade. Er gab eine kurze Salve auf das Führerhaus ab, um Makrele an der Flucht zu hindern. Dann lief er zum Wagen. Die Frau war jetzt nicht mehr zu sehen – vermutlich befand sie sich hinter dem Auto. Er richtete die Maschinenpistole auf Makrele, der bäuchlings auf dem Vordersitz lag, und leerte sie in den Leib seines Opfers.
Dann machte er kehrt und lief zurück zum Lieferwagen. Er ließ die rauchende Maschinenpistole fallen. Riß sein Fahrrad von der Ladefläche, sprang hinauf und fuhr los, in Richtung …
Die Zeit danach
Ich schaue aus dem Fenster auf die schöne Natur, die mich umgibt. Ich schreibe diese Zeilen in einem Sommerhaus. Ich bin müde wie ein ganzes Altersheim.
Ich habe den ganzen Tag in den mächtigen Wellen gebadet und danach einige Stunden Sonnenbad angehängt. Wenn ich bade, gehe ich in Shorts und Hemd zu einem Boot, das hier verankert liegt, und lege dort Kleidung und Badetuch ab. An meinen Armen habe ich einige Tätowierungen, die niemand sehen und erkennen darf. Nicht, weil sie besonders schön ausgeführt wären, sondern weil ich wegen Mordes gesucht werde.
Ich halte mich schon seit einem Monat in diesem Ferienparadies auf. Es war eine schöne Zeit, sie wird mir sicher als eine der besten in meinem Leben in Erinnerung bleiben. Aber ab und zu kommt es doch vor, daß ich mich einsam fühle. Ab und zu langweile ich mich. Nach der ersten Woche hier oben ist mir aufgegangen, daß ich meine Zeit auch zu etwas Vernünftigem nutzen könnte. Und deshalb habe ich beschlossen, über mein bisheriges Leben zu schreiben. Es war kein langweiliges Leben, und bestimmt war es kein Leben, das ich bereue.
Ich miete dieses Haus hier für tausend Kronen pro Woche, und es ist seinen Preis wert. Ich kann es mir gemütlich machen, wie ich es will, ohne neugierige Blicke fürchten zu müssen.
Ich bin von sympathischen Nachbarn umgeben. Auf der einen Seite hausen einige surfbegeisterte junge Menschen. Von denen sehe ich nicht viel. Hinter mir wohnt eine kinderreiche Familie. Ich habe ein wenig mit ihnen geplaudert – sie sind wirklich nett. Auf meiner anderen Seite wohnt ein älteres Ehepaar, mit dem ich mich schon häufig unterhalten habe. Sie sind überaus lieb zu mir. Es ist mir fast ein wenig peinlich, daß ich ihnen gegenüber nicht die Wahrheit sagen kann. Gestern hat der Mann mich durch den Garten geführt. Und sie haben mir eine ganze Schüssel Erdbeeren aus ihrem Küchengarten geschenkt.
Wenn mir auf meinen Spaziergängen Einheimische begegnen, dann grüßen sie mich herzlich. Ich komme mir selber schon wie ein Einheimischer vor.
Abgesehen vom Schreiben vertreibe ich mir die Zeit mit langen Spaziergängen am Strand und im Wald. Ich hätte nie geglaubt, daß ich die Natur so sehr genießen könnte, aber es kommt vielleicht daher, daß ich weiß, was mich erwartet, falls sie mich finden. Die übliche lange Isolationsrunde, die einen mürbe klopfen soll. Die Polizei behauptet, sie steckten Leute in Isohaft, um in Ruhe ihre Ermittlungen durchführen zu können. Aber das ist gelogen. Es ist eine psychische Folter, die den Gefangenen brechen soll.
Mein Sommerhaus besteht aus einem großen gemütlichen Wohnzimmer, einem Flur, zwei Schlafzimmern, einem schönen modernen Badezimmer und einer Küche. Ich koche nicht selber. Wenn ich warm essen will, dann gehe ich zum Grill, der anderthalb Kilometer von hier entfernt liegt. Wenn Gäste kommen, bringen sie etwas Leckeres mit, und dann machen wir es uns in meinem Unterschlupf gemütlich. Nur sehr wenige wissen, daß ich hier bin. Aber die kommen dafür um so öfter. Sie kommen jedoch nur werktags, die Wochenenden sind für meine Frau reserviert, und wenn sie hier ist, dann gibt es keinen Grund, warum noch andere hier sein sollten. Sie hat mich kein einziges Wochenende im Stich gelassen, seit ich gesucht werde, obwohl sie sorgfältig beschattet wird. Vermutlich riskiert auch sie eine Freiheitsstrafe, wenn sie hier bei mir gefunden wird, obwohl ihr einziges Verbrechen doch nur darin besteht, daß sie mich liebt.
Heute hatte ich Besuch von zwei von meinen Brüdern. Wir haben gut gegessen, aber wir sind nicht an den Strand gegangen – zusammen besitzen wir eine ganze Galerie von Tätowierungen. Es wäre nicht leicht, sie zu verbergen – und drei Mann, die zu einem Boot waten, um sich dort umzuziehen, wirken einfach idiotisch. Ein Schornsteinfeger, der unerwartet den Garten betrat, als wir splitternackt und zufrieden in der Sonne lagen, hätte uns fast zu Tode erschreckt. Nur mein einer Bruder konnte noch sein Hemd überstreifen. Der andere stürzte in ein Zimmer und versteckte sich unter der Bettdecke. Peinlich, denn genau in diesem Zimmer war die Schornsteinklappe angebracht. Der Schornsteinfeger hat uns sicher für verrückt gehalten. Vielleicht hat er auch geglaubt, eine Schwulenbande beim geilen Sommerspiel zu überraschen.
Meine Brüder sind wieder weg, und ich bin allein mit meinen Gedanken und meinen unsicheren Zukunftsplänen.
Vor kurzem, während ich an der Arbeit saß, verirrte sich plötzlich eine Kohlmeise in mein Zimmer. Sie geriet in wilde Panik, als sie in einer Ecke gefangen war. Und das auch noch zusammen mit einem riesigen, ihr unbekannten Tier. Ich blieb auf meinem Stuhl sitzen, um ihre Angst nicht noch zu vergrößern. Nachdem sie mehrere Male gegen meine Aussichtsfenster geflogen ist, mußte ich sie auf den richtigen Weg bringen. Sie flog mit glücklichem Piepsen davon. Aus dem Gefängnis.
Der Gedanke an das Gefängnis stellt sich immer wieder ein, wenn ich allein bin. Aber das ist ja auch kein Wunder. Wenn ich für das verurteilt werde, was in der Anklageschrift steht, dann bekomme ich sechzehn Jahre.
Die ersten Tage hier oben waren hart. Doch nach drei Tagen, in denen ich ganz allein in meiner Gedankenwelt saß, brachte mich ein kleines Mädchen von acht oder zehn Jahren in bessere Laune. Ich machte einen meiner langen Spaziergänge und kam an einem Ferienlager für Kinder vorbei. Eine große Gruppe von Zelten, ein Ballspielplatz, eine Fahnenstange und viele spielende Kinder. Plötzlich riß die Kleine sich aus dem Spiel los und kam auf mich zugelaufen. »Hallo, wir sind im Lager«, rief sie – ihre Stimme bebte vor Begeisterung. »Das sieht herrlich aus«, erwiderte ich. »Habt ihr viel Spaß?« – »Ja«, rief sie und rannte zu den anderen zurück. Ohne es zu wissen, hatte sie soeben mit einem Mann gesprochen, den die Kopenhagener Mordkommission als »außergewöhnlich gefährlich und bis an die Zähne bewaffnet« eingestuft hat. Andererseits könnten sie ja kaum mit der Mithilfe der Öffentlichkeit rechnen, wenn sie Mitteilungen dieser Art veröffentlichen würden:
»Das 24jährige Mitglied der Motorradbande Hell’s Angels gilt als freundlicher, ruhiger Charakter und als absolut harmlos.«
Sie wußte gar nicht, in was für gute Laune sie mich versetzt hatte.
Im Fernsehen habe ich soeben gesehen, daß Jan Bonde Nilesen freies Geleit zu seinem Prozeß gewährt worden ist. Ob die Mordkommission mir das wohl auch zusichern würde? Aber nicht doch! Wer Geld hat, bekommt alles – wer keins hat, muß sehen, was aus ihm wird. Und das weiß ich ja. Als erstes werde ich satt, und zwar beim Abendessen unten im Grill.
Ich bin dort fast schon zum Stammgast geworden. Ich rede mit dem Personal über Gott und die Welt. Meine vielen Besuche wirken auf diese Weise natürlicher. Wer weiß, ob ich in dem Grill schon einmal neben einem Bullen gegessen habe? Ich glaube, die wenigsten würden mich erkennen. Die Gefahr liegt wohl vor allem darin, daß ich nervös werde, wenn ich einen entdecke – und daß mir das anzusehen ist.
An einem der Tage, an dem ich die Vorderseiten aller Zeitungen im Land zierte, war ich im lokalen Supermarkt, zusammen mit der Blume meines Lebens. Sie war nervös, aber daran habe ich mich inzwischen gewöhnt. Als wir dort Schlange standen, bat eine Dame mich, ihr eine Zeitung zu reichen. »Aber gern. Bitte sehr.« Ihr fiel nicht auf, daß ich mit dem Mann auf der Vorderseite identisch war. Aber man rechnet wohl auch nicht damit, daß jemand, nach dem gefahndet wird, so frech sein kann. Man verdächtigt keinen freundlichen, gutgekleideten Mann, der durch eine Feriensiedlung spaziert. Man hält mich wohl eher für ein verdrecktes langhaariges Ungeheuer, das durch die Gegend schleicht und Haß und Mord ausstrahlt. Vielleicht mit den Resten eines kleinen Kindes, die noch in seinem Bart hängen.
Ich habe mich mit drei Jungen von vielleicht zwanzig Jahren angefreundet. Sie wohnen in einem ungefähr einen Kilometer weiter gelegenen Ferienhaus. Ich bringe ihnen Cowboytricks bei und erzähle ihnen Räuberpistolen. Wir haben einige Male zusammengegessen, und sie haben mich in meinem Sommerhaus besucht.
Meine Brüder und meine Frau halten mich für bescheuert, wenn ich mich so unter die Nachbarn mische und neue Freunde finde. Ich halte dieses Vorgehen aber für klug. Ich wirke dann nicht wie ein Sonderling oder ein Einzelgänger. Ich glaube, es ist die beste Tarnung, mit zwei oder drei Typen und einem Ball herumzuwuseln.
Aber – wenn sie mich finden, dann finden sie mich eben.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Mein Leben
Ich weiß nicht, ob die Sonne schien, als ich am 5. Juni 1960 geboren wurde. Wenn meine Eltern gefragt würden, würden sie sicher mit müdem Gesicht antworten, daß das Wetter ein wenig unruhig gewesen sei.
Ich wurde in Söborg Torv geboren, in der Gemeinde Gladsaxe im Kopenhagener Umland. Es war zu der Zeit, als das ganze Land, ja, die gesamte westliche Welt, eine Blütezeit erlebte. Arbeitslosigkeit war unbekannt. Das Leben wurde positiv gesehen. Und das galt eigentlich auch für den Tod.
Meine Eltern stammten aus dem Milieu, das ich als Mittelklasse bezeichnen würde. Aus der untersten Mittelklasse zwar, aber auch die war ein hervorragender Aufenthaltsort.
Meine Mutter wurde 1937 in Kopenhagen geboren. Mein Großvater arbeitete als Schmied in der Nordhavn-Werft, meine Großmutter war Hausfrau.
Mutter hatte eine ältere Schwester, die immer kommandieren mußte. Sie war dermaßen stur und dumm, daß sie ohne großes Geschrei nicht einmal sterben konnte. Ich weiß noch, wie wir glotzten, wenn sie tief Luft holte und rot anlief. Mutter nahm das alles immer gelassen hin. Ich konnte ihr ansehen, daß sie im tiefsten Herzen den Kopf über ihre Schwester schüttelte, daß sie genau wußte, wer hier die Klügere war. Vater nannte sie ganz einfach den »Sperrballon« – aber nur, wenn sie außer Hörweite war. Ich erinnere mich daran, wie sie einmal – ich muß damals so um die sieben gewesen sein –, in eine wilde Diskussion mit meinem Großvater geriet, als es um die Frage ging, wer ihnen ein Bild geschenkt hatte, das an der Wand hing. Das Ganze endete damit, daß meine Tante und ihr Mann das Bild von der Wand rissen und es zerfetzten. Wenn ich damals die Augen meiner Mutter hätte deuten können, dann hätte ich natürlich die Antwort gewußt, lange, ehe sie sich dann herausstellte: Mein Großvater hatte natürlich recht gehabt.
Der erste Posten meiner Mutter, an den ich mich erinnere, war der einer Sekretärin in einer Anwaltskanzlei in Lyngby. Ich weiß, daß sie zuvor bei Minerva Film gearbeitet hat. Als mein Bruder und ich dann etwas älter wurden, fand sie eine Anstellung als Schulsekretärin. Jetzt ist sie Geschäftsführerin in der Firma ihres neuen Mannes. Sie ist also in der Oberklasse gelandet, aber auch die ist vermutlich ein hervorragender Aufenthaltsort.
Mein Vater wurde 1930 geboren und ist damit sieben Jahre älter als meine Mutter. Er ist das zweite von vier Kindern. Ich habe nur meine Großmutter väterlicherseits kennengelernt, mein Großvater ist schon vor meiner Geburt gestorben. Sie lebten in Middelfart, wo ich viele Sommerferien verbracht habe – diese Sommeraufenthalte gehören zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen.
Mein Großvater väterlicherseits kam aus Schweden. Er wollte in die USA, um dort nach Gold zu suchen, blieb dann aber als Bienenzüchter in Middelfart hängen. Gott sei Dank, sonst hätte es mich nie gegeben.
Sie lebten in einem Einfamilienhaus außerhalb des Ortskerns. Sie hatten einen großen Garten mit Kartoffeln und Gemüse, und der war ihnen sicher eine willkommene Hilfe – in den dreißiger Jahren lag das Geld schließlich nicht auf der Straße. Ein Insasse des örtlichen Irrenhauses kümmerte sich um den Garten. Das war damals absolut üblich, und beide Seiten waren damit gleichermaßen zufrieden.
Mein Vater hat mir erzählt, wie der Verrückte sich aus Omas weißen durchsichtigen Küchengardinen eine Hose nähte. Aus Zement und Pferdezähnen hat er sich ein Gebiß gebastelt. Er war sicher das, was man einen »komischen Vogel« nennen könnte.
Vater trat mit siebzehn in Kopenhagen eine Postlehre an. Seine beiden Brüder folgten diesem Beispiel, das Briefmarkenlecken muß also in der Familie gelegen haben. Er hat seitdem die ganze Zeit bei der Post gearbeitet – nur unterbrochen durch seinen Wehrdienst und einige Manöver als Kapitän der Reserve. Ich habe mir erzählen lassen, daß ich so stolz war wie ein frischgewählter Papst, wenn er mich in Uniform aus dem Kindergarten abholte. Die anderen Kinder glaubten, mein Vater sei General, und ich widersprach ihnen da nicht.
Nach vielen Jahren als Personalchef bei der Post endete er als Postmeister in einer Gemeinde im Kopenhagener Umland. Ich glaube, das gefällt ihm richtig gut. Ich weiß nicht, ob man behaupten könnte, daß er ebenfalls in der Oberklasse gelandet ist, aber ich glaube, wo immer er sich nun befindet, ist ein hervorragender Aufenthaltsort.
Kein Ton! Kein Ton kam während meiner ersten beiden Lebensjahre von meinen Lippen. Meine Eltern und meine Familie hielten mich für stumm. Aber seither habe ich alles wieder aufgeholt.
Ich weiß noch, daß ich mich mit vier Jahren weigerte, tanzen zu gehen. Mein älterer Bruder ging schon eine ganze Weile hin. Es war offenbar das erste Mal, daß mein Starrkopf sich durchsetzte.
Meine wichtigste Kindergartenerinnerung bezieht sich auf einen Tag, an dem ich einem Jungen namens Jonathan eine gescheuert habe. Er war rothaarig, sommersprossig und so wütend wie eine Ratte auf einer glühendheißen Kochplatte. Er schlug mich mit einer Eisenschaufel von hinten nieder und verpaßte mir mein erstes Loch im Kopf. Ich lernte dadurch, daß man keinem, den man niedergeschlagen hat, den Rücken zukehren sollte – falls seine Augen nicht zeigen, daß er ausgeschaltet ist.
Ich erinnere mich auch an meine erste Verliebtheit. Ich kann damals höchstens fünf oder sechs gewesen sein. Sie zeigte sich zumeist durch Nachlaufen, Schubsen und Ziehen. Aber es kam auch ab und zu zu einem Küßchen. Meine Baby Love hieß Jette. Ich war sehr unglücklich, als sie mich verließ – genauer gesagt, sie verließ den Kindergarten. Sie war ein halbes Jahr älter als ich. Zum Glück war mir nicht so recht bewußt, was da in mir vorgegangen war, und deshalb legte es sich bald wieder. Ich bin ihr zehn oder zwölf Jahre später noch einmal begegnet, und nach einer kurzen »Auffrischung« konnten wir uns sehr gut aneinander erinnern.
Mein älterer Bruder ging mittlerweile seit zwei Jahren in ein Haus, das für mich nur ein Wort war – »Schule«. Eines Tages kam die Reihe dann an mich. Ich begann den ersten Schultag im Garten meiner Großmutter, wo ich fotografiert werden sollte. Ich trug hellblaue Jeans und ein passendes Hemd. Das paßte gut zu meinen hellblonden Haaren. Ich freute mich ungeheuer auf die Schule – so seltsam das auch klingen mag.
In den ersten beiden Jahren ging auch alles sehr gut, aber dann ließ mein Interesse nach, und als wir nach der sechsten Klasse einen neuen Klassenlehrer bekamen, hatte ich die Schule endgültig satt – und wurde frech wie ein Fleischerhund.
Vor unserem ersten Klassenlehrer hatten wir gewaltigen Respekt. Ich erinnere mich an einen Tag in der sechsten Klasse, als ich und ein Kumpel – wir hatten seit vierzehn Tagen einen Vertretungslehrer – wie üblich fünf oder zehn Minuten zu spät zur Stunde eintrudelten. Ich war der absolute Großkotz in der Klasse und öffnete die Tür mit einem lärmenden Tritt. Und mit einem breiten Feixen, das aber sofort zu einem schmalen Strich wurde, gefolgt von einem Schmollmund, als eine knallende Ohrfeige meine Wange traf. Es klang, als hätte ein Pferd mit einem Stock einen Hieb versetzt bekommen. Damals war es in der Schule noch erlaubt, Ohrfeigen zu verteilen, und ich fand das ganz in Ordnung so. Aber hätte ich auch nur versucht, mich zu Hause zu beklagen, hätte das zu weiteren Maulschellen geführt.
Zu diesem Zeitpunkt hatten meine »Alten« eingesehen, dass ich nicht gerade der Klassenprimus war. Das konnte ich ihnen im Gesicht ansehen, wenn sie vom Elternsprechtag zurückkamen.
Ich führte mich nicht so auf, um irgend jemandem eins auszuwischen. Ich langweilte mich in den Stunden einfach so schrecklich. Ich mußte alles mögliche anstellen, um die Zeit totzuschlagen. Die anderen in meiner Klasse fanden das toll, die Lehrer dagegen amüsierten sich durchaus nicht. Ich – und zwei andere, die mein Klassenlehrer als »Mitläufer« bezeichnete – mußten uns immer wieder anhören, daß wir den Unterricht ruinierten. Ich glaube das eigentlich nicht – die meisten aus der alten Klasse haben inzwischen entweder solide Jobs oder machen irgendwelche Zusatzausbildungen.
In der siebten Klasse wurde mein bester Freund auf eine andere Schule verbannt. Unseren Eltern wurde mitgeteilt, daß entweder er gehen müsse oder ich. Einige andere durften nachmittags nicht mit mir spielen. Als mein Vater das hörte, reagierte er durch das Verbot, meinerseits mit ihnen zu spielen. Ich glaube, er stellte sich vor, daß nach einiger Zeit niemand mehr wissen würde, wer wem zuerst was untersagt hatte. Wir trafen uns natürlich trotzdem – und jetzt machte es noch mehr Spaß, es war ja schließlich verboten.
Die Aufenthalte im Schullandheim waren eigentlich das einzige an der Schule, das mir wirklich Spaß machte. Und es gab einige davon. Der letzte Ausflug dieser Art – an meiner ersten Schule – war sicher der lustigste. Sechzig Schüler und sechs Lehrer in einem Ferienzentrum an der Vigsö-Bucht in Jütland. Einzelhäuser, in denen jeweils sechs Personen untergebracht waren. Wir konnten uns selber aussuchen, mit wem wir zusammenwohnen wollten, und in unserer Butze sammelte sich natürlich ein feiner Haufen. Alle Klassetypen im selben Schuppen. Dazu gehörten der Rote Paul, den wir Pfuschi nannten – ein großer rothaariger Wildfang, der dauernd lachte. Er studiert derzeit Jura. Der zweite in der Runde war und ist noch immer der beste Freund, den ich je gehabt habe. Er trug den Spitznamen Anton, denn mit Nachnamen hieß er Berg, wie die Marzipanfirma. Ein kleiner Junge – und immer bereit zu einem Ringkampf. Der dritte war – zusammen mit mir – der Scherzkeks im Haus. Er hieß Michael, wurde aber immer nur Friede genannt, ein lustiger Heini, der heute bei einer Versicherungsgesellschaft arbeitet. Der vierte war Friedes bester Freund, Ole. Ein stiller, sympathischer Junge, der nicht viel Aufhebens um sich machte. Ein guter Freund. Der letzte war Lars, der Dichter und Tagträumer des Hauses. Eine Art jugendliches Genie, das leider ein halbes Jahr später starb.
Tagsüber hatten die Gruppen allerlei Aufgaben zu lösen, die die Lehrer uns zuteilten. Abends waren in den verschiedenen Häusern Jux und Gemütlichkeit angesagt. Unsere Butze war die beliebteste von allen – und wurde bald in »Wirtshaus« umbenannt.
Das Wichtigste – nach dem Anbaggern von Mädchen – war die Beschaffung eines ordentlichen Schnapses. Kaum hatten die Lehrer uns gute Nacht gesagt – so gegen elf Uhr abends –, da kamen die Leute von nah und fern angeschlichen, und dann ging’s los. Wir fürchteten keine Razzia von Seiten der Lehrer – die waren sicher ebenso beschäftigt wie wir.
Vor allem kann ich mich an den dritten Abend erinnern, als die größte Suff und Kotztour meines Lebens. Ich hatte einen halben Liter Wodka, etwas Saft und vier oder fünf Bier gekauft. Auch die anderen hatten im lokalen Lebensmittelladen Vorräte gebunkert. Die ersten ›Elefanten‹-Biere waren schon geleert worden, ehe die Lehrer sich davon überzeugt hatten, das Friede, Freude, Eierkuchen herrschten – und danach konnten wir uns über die anderen Getränke hermachen.
Ich saß in einem Sessel mit Armlehnen. Auf der einen Lehne standen Wodka und Saft – auf der anderen stand mein Glas. Ich verließ den Sessel erst wieder, als die Flasche leer war.
Als ich mich durch den Wodka hindurcharbeitete, fing ich an, mich wie ein Russe aufzuführen. Ich hatte gelesen oder gehört, daß die Russen ihre Gläser über ihre Schultern werfen, wenn sie mit Wodka angestoßen haben – und das erregte im Haus gewaltige Heiterkeit. Der einzige, der nicht mitlachte, war Lars – das erste Glas landete in seinem Zimmer, vor dem Bett, wo es zu Atomen zersprang. Als er – nachdem er das erste aufgefegt hatte – um ein Haar vom nächsten getroffen worden wäre, das dann in seinem Bett zerbrach, ja, da hatte seine Geduld ein Ende. Es war wohl das einzige Mal, daß unser Poet – jedenfalls in der Zeit, in der ich ihn gekannt habe – zu den Boxhandschuhen griff.
Aber das kapierte ich in diesem Moment nicht. Ich war bereits sturzbesoffen. Als ich mich aus meinem Sessel aufrappelte, tat ich das Dümmste, was man überhaupt nur tun kann, wenn man zu tief ins Glas geschaut hat: Ich ging hinaus in die Kälte. Und sofort stieg mir der Alkohol in die Birne. Das letzte, woran ich mich erinnere, ist, daß ich vor dem Klo lag und den Göttern opferte. Irgendwer tippte mir auf die Schulter. Ich blickte auf – und zwar in Friedes offenen Mund. Ich weiß nicht, ob ich dessen Inhalt auf den Kopf bekam, denn alles wurde schwarz, aber später – als ich wieder zu mir gekommen war – erfuhr ich, daß ich mich knapp vier Stunden lang erbrochen hatte und daß in der letzten Dreiviertelstunde nur noch Galle und Blut herausgekommen waren. Aber es hatte endlich doch ein Ende genommen, und einige unglückliche Mädchen aus der Klasse hatten mich ins Bett gebracht. Dafür belohnte ich sie später auf dieser Fahrt natürlich – mit einer Runde Knutschen in einer dunklen Ecke.
Ich war dermaßen verkatert, daß ich drei Tage lang nichts essen konnte. Am letzten Abend, wo wirklich der Bär los war, drehte sich mein Magen um, wenn ich eine Schnapsflasche nur ansah.
Kurz nach dieser Fahrt lieferte ich in der Schule meinen ärgsten Bubenstreich. Zusammen mit Pfuschi wollte ich den Lehrern einen Schrecken einjagen. Sie hatten eine Besprechung im Lehrerzimmer – einem Raum in einem langen schmalen Gang, an dem keine Klassenzimmer lagen. Um ihre Ruhe zu haben, stellten sie immer hinten im Gang einen Vertretungslehrer auf, aber diesmal hatten sie das wohl vergessen, und deshalb hatten die beiden kleinen Terroristen freie Bahn. Pfuschi gab Feuer und ich warf – und es machte einen ungeheuren Lärm, als der Kracher unmittelbar vor der Tür der kaffeetrinkenden Lehrer landete. Bestimmt hatten sie danach eine hohe Reinigungsrechnung.
Wir wurden natürlich erwischt und mussten einen Brief für unsere Eltern mitnehmen. Pfuschi wurde angezeigt, mir wurde mitgeteilt, daß meine Anwesenheit in der Schule während der nächsten Woche unerwünscht sei.
Diese unterschiedliche Behandlung wirbelte ziemlichen Staub auf, aber wie mein Klassenlehrer sagte: »Jörn hat schon seit längerer Zeit für eine Woche Ferien gespart.«
Ich wagte nicht so recht, zu Hause den Brief abzugeben – ich hatte ja ohnehin schon allerlei auf dem Kerbholz –, und deshalb beschloß ich, durchzubrennen. Damals war ich gerade vierzehn.
Vier Jahre zuvor waren wir in ein Einfamilienhaus in Lyngby gezogen, und meine Mutter arbeitete nun schon als Schulsekretärin. Ironischerweise besuchte sie gerade ein Treffen aller Schulsekretärinnen der Gemeinde und saß neben der Kollegin, die den Brief über mich geschrieben hatte, als mein Vater anrief und mitteilte, daß das schwarze Schaf der Familie durchgebrannt war. Das veranlaßte meine Mutter dazu, wieder mit dem Rauchen anzufangen, was ich damals ziemlich witzig fand. Heute weiß ich, daß darin die tiefe Liebe und Zuneigung zum Ausdruck kamen, die sie ihrem unmöglichen Sohn entgegenbrachte.
Ich blieb nur zehn Stunden verschwunden, und zu meiner freudigen Überraschung gab es weder Strafpredigten noch Ohrfeigen, als ich nach Hause kam.
In den ersten Schuljahren interessierte ich mich in meiner Freizeit vor allem für Fußball und Schlittschuhlaufen. Fünf Jahre lang war ich Mitglied im Kreisverband Stengård des dänischen Fußballverbandes FDF. »Faters dressierte Flußpferde«, »Faters Dussel furzen«. Wir galten als fromm und wurden deshalb verspottet – dabei war das einzig Fromme das Vaterunser, das wir nach jedem Treffen beteten, und das kann ja wirklich niemandem schaden.
Der Kreisleiter war ein Geistlicher, ein netter alter Knabe, voller Bart und Jux, trotz seines ernsthaften Amtes. Er litt unter einer überaus ernsten Krankheit, und als ich ihn zuletzt sah, mußte er zum Predigen auf einem Barhocker sitzen. Aber seinem Humor hatte das nicht geschadet.
Nach einer Pause von einem halben Jahr konnte er mich übrigens zur Rückkehr in den FDF überreden – diesmal als Jugendleiter. Eigentlich machte mir das auch großen Spaß, aber trotzdem hörte ich nach einem halben Jahr wieder auf. Er hätte Toten einreden können, daß sie noch lebendig seien. Aber er war das Predigen ja auch gewöhnt.
Meine Fußballkarriere begann bei den Zwergen im Ballclub Stengård, dem STB, der sich später in Bagsværd Ballclub umbenannte. Ich ging mit meinem älteren Bruder hin, doch der stieg bald wieder aus – er wollte sich lieber dem Eiskunstlauf widmen. Ich trat später in den Lyngby Ballclub ein – für den mein Fußballherz noch heute schlägt – und spielte dort drei oder vier Monate in der normalen Mannschaft.
Zwischendurch liebäugelte ich wie mein Bruder mit dem Eislaufen. Es war nicht nur ein Hobby, sondern führte zu vier Jahren hartem Training und Sommerkursen und Turnieren. Ich wurde zweimal seeländischer Meister, 1971 und 1972.
Mein Bruder erzielte viel feinere Ergebnisse. Als Senior gewann er die dänische und die norwegische Meisterschaft. Außerdem qualifizierte er sich für EM und WM. Auch ich erreichte die EM, aber nur in Form des Banketts im Hotel Scandinavia. Ich landete auf der Rückseite der Zeitung BT, weil ich mit der niederländischen Weltmeisterin tanzte. Später avancierte ich dann auf die Titelseite der BT, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Das Ganze war aber eher ein Mädelsport, fand ich. Bei den Wettbewerben nahmen niemals mehr als drei oder vier Teilnehmer teil – auf der Herrenseite. Bei den Teilnehmerinnen standen jeweils mindestens zwanzig in jeder Sparte.
Als Kind war ich dreimal im Ausland. Später wurden solche Reisen zu meiner großen Leidenschaft.
Meine erste Reise führte mich mit der ganzen Familie nach Norwegen. Insgesamt waren wir zu vierzehn unterwegs. Onkel, Tanten, Kusinen. Wir wohnten in einem Gebirgsdorf. Tagsüber waren wir in den Bergen unterwegs. Die Skiloipen hoch, um uns die Beine zu brechen, wie ich sagte. Ich weigerte mich, Ski zu laufen – da konnten meine Eltern sagen, was sie wollten. Eine Kusine brach sich dann auch das Bein, ich hatte also nicht ganz unrecht gehabt.
Auf der Heimfahrt wäre ich beim Nachlaufen auf dem Fährendeck fast ums Leben gekommen. Mein älterer Bruder und ein großer Vetter wollten mir wie üblich davonrennen. Ich jagte hinter ihnen her. Bei den Rettungsbooten rutschte ich in einer Pfütze aus und landete unter der Reling, so daß mein ganzer Unterleib über die Schiffsseite hing. Dem Schicksal sei Dank, daß ich nicht im pechschwarzen Eiswasser gelandet bin. Zwei Minuten später wäre ich ein toter Eiswürfel gewesen.
Die nächste Auslandsreise führte mich mit dem Fußballverein nach Schottland. Ich war zwölf und saß zum ersten Mal in einem Flugzeug. Das gefiel mir sofort gut – vor allem der Anlauf über die Landebahn, wo man in den Sitz gepreßt wird. Es war ein herrliches Kraftgefühl.
Wir wurden in einer Art Jugendherberge untergebracht. Ich teilte mein Zimmer mit meinem Schulkameraden Anton. Wir kamen weit im Land herum. Wir sahen Edinburgh, die Burgen, eine Whisky-Brennerei – aber kosten durften wir nicht, da in Schottland sehr strenge Schankgesetze herrschten.
Ich weiß noch, daß die meisten Mädchen sich unterwegs verliebten. Im Bus zum Flughafen flennten sie dann und sangen: »I’m leaving on a jet-plane. Don’t know when I’ll be back again.«
Auf dem Rückflug nahm ich im Flugzeug meinen Mut zusammen und kaufte einen halben Liter Rum. Den wollte ich durch den Zoll schmuggeln – wir waren noch zu jung, um Alkohol einführen zu dürfen. Wir landeten am frühen Morgen, und es war weit und breit kein Zollbeamter zu sehen. Ich hatte trotzdem Schmetterlinge im Bauch. Ich schenkte die Flasche meinen Eltern. Sie wußten nicht, daß es sich um Schmuggelware handelte, und ich weiß nicht, was sie gemacht hätten, wenn sie es gewußt hätten. Meine Eltern waren so gesetzestreu, daß es fast ans Groteske grenzte. Ich habe einmal gesehen, wie mein Vater eine halbe Flasche Gin ins Waschbecken kippte. Sie hatten einen halben Liter zuviel gekauft, als sie die deutsch-dänische Grenze überquerten.
Meine dritte Auslandsreise führte nach Italien und ist für mich noch immer die schönste der drei Fahrten. Wir wurden im Flughafen von Rom von Freunden meiner Eltern erwartet, einem kanadischen Ehepaar. Der Mann arbeitete in Rom bei der kanadischen Botschaft, und die Familie wohnte ein wenig außerhalb der römischen Innenstadt in einem großen dreistöckigen Reihenhaus.
Ich hatte zu Hause gehört, daß der Verkehr hier unten ein wenig heftig sein sollte, und das war wirklich nicht übertrieben. Als wir vom Flughafen losfuhren, stießen wir gleich auf der ersten Kreuzung auf zwei Autos, die miteinander kollidiert waren. Neben dem einen stand ein brüllender Mann. Daß er nicht gerade Schmeicheleien von sich gab, konnten wir seinem tiefroten Gesicht und seinen wilden Gesten ansehen. Neben dem anderen Wagen stand eine Frau und schrie zurück, unterstützt von einer Freundin, die halb aus dem Seitenfenster hing. Gleichzeitig drückten beide Autofahrer die Hupen voll durch. Es war wirklich eine unvergeßliche Szene.
In Rom gab es so viele Autos wie in ganz Dänemark zusammen. Ich kann mich daran erinnern, wie mein Bruder und ich eines Tages über die Spanische Treppe schlenderten. Wir standen wegen der vielen Abgase kurz vor einer Ohnmacht. Meine Güte, was für eine verschimmelte Friedenspfeife, was für ein Gestank.
Wir aßen den ganzen Tag Pizza und tranken eimerweise Cola. Wir suchten die Sehenswürdigkeiten auf. Den Petersdom, Vatikanstaat, das Colosseum. Wir machten Ausflüge nach Sorrent und nach Capri, zum Vesuv und nach Pompeji.
Die kanadische Familie hatte drei Söhne. Sie gingen jeden Tag bis zwei Uhr zur Schule. Mein Bruder und ich lagen so lange am Swimmingpool, doch wenn sie dann nach Hause kamen, ging es los. Sie tauchten kurz ins Wasser, dann zogen wir in die Stadt. Es war eine schöne Art, Rom kennenzulernen. Gleichzeitig lernten wir etwas Italienisch – vor allem jedoch unflätige Wörter und Redensarten.
Mein Bruder und ich bekamen, was wir brauchten, nicht mehr und nicht weniger. Ich meine nicht, daß wir verwöhnt wurden. Unsere Erziehung war tadellos. Es gab ab und zu eine Ohrfeige – insgesamt acht bis zehn Stück, vielleicht – aber auch das waren nicht zu viele.
Es gab sicher eine Zeit, in der wir unsere Eltern nicht oft genug sahen, aber sie mußten auch Geld verdienen. Wir durften sehr viel, aber wenn wir zu weit gingen, schlugen sie energisch zu.
Ich weiß noch, daß wir immer beim Abwasch helfen mußten. Das gefiel uns überhaupt nicht. Wir zerbrachen immer mehr Geschirr, um uns von dieser Pflicht zu befreien. Mutter hielt ihre Söhne anfangs vielleicht für ungeheuer ungeschickt, aber dann roch sie Lunte. Sie reagierte darauf, indem sie ein Spülsparschwein aufstellte – und dann wurde uns einfach Taschengeld gekürzt, wenn wir etwas zerbrachen. Von Stund an waren wir weniger ungeschickt.
Es war wunderbar, wenn Mutter von der Arbeit kam und Kuchen und Kakao mitbrachte. Es war einfach gemütlich, zusammenzusitzen und zu erzählen, was zum Beispiel in der Schule passiert war. Aber irgendwann war Schluß mit der Gemütlichkeit – ich hatte den Eindruck, daß ich nichts mehr erzählen konnte, ohne mir eine Strafpredigt einzufangen.
Ihr größtes Problem mit mir war, daß ich nichts essen wollte. Ich war schrecklich wählerisch. Nur kaltes Essen brachte ich hinunter, und ich nutzte jeden Trick und jede Entschuldigung, um mich vor warmem Essen zu drücken. Wir führten jede Menge Essens-Diskussionen, und oft wurde ich danach ins Bett geschickt. Ich bin noch immer wählerisch, aber ich habe es meiner Mutter und ihrer Ernährung zu verdanken, daß ich heute so frisch und gesund bin.
Ich sprach nicht viel mit meinem Vater, und als ich in der Schule zu einem Hort der Unruhe wurde, wurden wir fast zu Feinden. Er war in der Regel müde, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, und er hatte nicht mehr die Kraft, uns zuzuhören. Erst als meine Eltern geschieden waren, fanden er und ich zueinander. Jetzt liebe ich ihn sehr. Wir sind beide gleichermaßen starrköpfig, aber jetzt akzeptieren wir einander. Mit sechzehn hätte ich ihn fast niedergeschlagen, aber Gott sei Dank ist es dann doch nicht so weit gekommen.
Ich weiß noch, wie wir einmal unser Haus anstreichen wollten. Mein Vater und ich standen auf entgegengesetzten Hausseiten. »Damit es nicht zu Handgreiflichkeiten kommt«, sagte meine Mutter.
Mein Bruder und ich fingen an, ein Jugendzentrum namens Egegården zu besuchen. Eine Zeitlang hingen wir zusammen mit zehn oder zwölf Kumpels im Einkaufszentrum Lyngby herum – wir waren eine Art Minirockerbande mit Fahrrädern und Mopeds. Das Jugendzentrum Egegården war der Aufenthaltsort von fünfundzwanzig bis dreißig mopedfahrenden Jungs – den Children of the Devil. Die Mitglieder wohnten alle in der Nähe des Jugendzentrums. Wir hatten sie auf einem Fest kennengelernt.
Langsam fanden wir Zugang zu dieser Bande, in der es auch einzelne ältere Mitglieder mit Autos oder Motorrädern gab. Zu diesem Zeitpunkt gab es in der Gegend von Gladsaxe schon etliche kleine Banden, denn ein großer Rockerclub namens Roadrunners hatte sich aufgelöst. Seit Jahren waren die Roadrunners in Gladsaxe und Umgebung gefürchtet gewesen. Sie hatten in ihren Glanzzeiten an die hundertfünfzig Mitglieder. Leute aus der Gegend gründeten dann den bekannten Motorradclub Nomads. Sie trafen sich in einigen Bauwagen oben am Ringvej.
Unser Club brachte ihnen gewaltigen Respekt entgegen. Ich weiß noch, daß sechs von ihnen einmal unangemeldet zu Besuch kamen, nachdem sie gehört hatten, daß wir uns Aufnäher mit dem Namen Last Heroes hinten auf die Jacken gesetzt hatten. Dieser Namenszug ähnelte dem der Hell’s Angels, die wir aus einigen kleinen Taschenbüchern kannten, die ansonsten rein gar nichts mit den Hell’s Angels zu tun hatten. Zum Glück trug an diesem Tag niemand so eine Jacke. Und obwohl die Gerüchte nicht falsch waren, beteuerten wir energisch, nie von solchen Abzeichen gehört zu haben. Die letzten Helden verhielten sich an diesem Tag nicht gerade heldenhaft, und wir gaben die Patches rasch wieder auf.
In der folgenden Zeit gingen wir ohne Abzeichen, beteiligten uns aber an allen möglichen Schlachten der anderen Banden – der Værebro-Rocker, der Höje-Gladsaxe-Rocker und anderen. Ich weiß noch, wie wir einmal nach Hareskoven fuhren, um einen von uns zu rächen, der Prügel bezogen hatte. Es machte einen Höllenspaß. Fünfunddreißig Mopeds. Zwei auf jedem Moped. Zur Feier des Tages hatten wir eine kleinere Bande zur Verstärkung herangezogen – die Stengårdsvænge-Bande. Wir erwischten sechs oder sieben von den Hareskov-Leuten. Sie standen am Waldrand und tranken Bier, als wir wie eine Flutwelle mit Heimweh über sie hereinbrachen. Sie bezogen Schläge, daß es nur so knallte – vor allem mit Händen und Füßen, aber auch vereinzelt mit Holzknüppeln. Wir konnten nie herausfinden, ob wir wirklich die richtigen erwischt hatten. Aber sie waren immerhin mit den richtigen befreundet – und das reichte uns damals schon.
Die großen Namen in der dänischen Rockerszene waren damals – abgesehen von den Nomads aus Gladsaxe – Gypsy Nova aus Frederiksværk, Filthy aus Nörrebro in Kopenhagen und die Dirty Angels aus Valby.
Meine Eltern wußten genau, daß mein Bruder und ich das Jugendzentrum Egegården besuchten, doch daß ich auch zu einer Mopedbande gehörte, erfuhren sie erst, als ich mit dem Gesetz aneinandergeriet.
Ich war fünfzehn. Wir sammelten uns bei unserer Stammkneipe Lippert’s. Wir waren vielleicht zwanzig Kumpels, und der Abend war durch und durch langweilig. Ich stand vor der Kneipe und sprach mit meinem alten Klassenkameraden Friede, als in der Tränke plötzlich eine Schlägerei im besten Westernstil loszubrechen schien. Als ich hineinkam, schwirrten Tische, Stühle, Aschenbecher und Flaschen durch die Luft. Ich sah sofort, daß mein Bruder Probleme hatte, und ich stürzte mich mit einem Eifer in meine erste Wirtshausschlägerei, über den ich nachher selber gestaunt habe.
Die Prügelei wogte hin und her und endete schließlich auf der Straße. Fünfunddreißig bis vierzig Menschen waren darin verwickelt. Die letzten, die sich noch prügelten, waren ich und zwei von der Gegenseite. Ich konnte dem einen ein Knie an die Birne rammen, aber als ich dann den anderen erledigen wollte, wurde mein Arm auf halbem Weg zurückgehalten. Ich fuhr herum, um meinen neuen Widersacher mit meiner freien Faust niederzustrecken, aber zu meinem Entsetzen sah ich, daß ich mich mit einem Polizisten angelegt hatte.
Zum ersten Mal in meinem Leben wurden mir die bekannten Stahlarmbänder angelegt, und kurz darauf waren ich und fünf oder sechs andere auf dem Weg zur Wache von Gladsaxe.
Ich hatte keine Ahnung, mit wem wir da aneinandergeraten waren und warum. Später stellte sich heraus, daß mein Bruder und zwei von den anderen sich gelangweilt hatten. Um ein wenig Leben in die Bude zu bringen, hatten sie den lokalen Fußballverein provoziert. Mein Bruder war an einem der Spieler vorbeigegangen und hatte sein Glas über ihm ausgeleert. Der Spieler hatte gefragt, was zum Teufel der Scheiß denn solle, worauf mein Bruder um Entschuldigung gebeten hatte. »Macht ja nichts«, hatte der Spieler gesagt. »Ach, oh?« fragte mein Bruder darauf. »Dann kann ich ja auch noch den Rest ausgießen.« Und damit war die Schlägerei in Gang. Bescheuert, aber total harmlos.
Nach kurzem Verhör und zwei Stunden Zelle wurde ich um drei Uhr morgens von zwei Krimis zu meinen Eltern nach Hause gefahren. Ich war soooo klein mit Hut, als ich mit den beiden Bullen vor der Tür stand. »Wer ist da?« hörte ich die schlaftrunkene Stimme meiner Mutter. »Öh, komm doch bitte kurz runter«, antwortete ich.
Zu meinem Schrecken hörte ich, daß auch mein Vater wach war. Jetzt ist die Kacke am Dampfen, dachte ich. Aber ich kam mit einem mahnenden Zeigefinger der Polizei und zweihundert Kronen Buße davon. Mein Bruder hatte erzählt, ich sei irrtümlicherweise festgenommen worden. Eigentlich hätten sie sich einen ganz anderen vorknöpfen müssen. Daß dieser andere mein Bruder selber war, das verrieten wir natürlich nie.
Ungefähr zu der Zeit, in der das alles passierte, machte ich zusammen mit meinem Freund Anton ein vierzehntägiges Schulpraktikum auf der Wache. Wir spielten beide mit dem Gedanken, zur Bullerei zu gehen. Ich weiß nicht, was uns daran gefiel, aber es schien jedenfalls ein ziemlich witziger Job zu sein.
Jeden Morgen fanden wir uns zusammen mit den »Fohlen«, also den Polizeianwärtern, in der Polizeischule ein. Unser Kontaktmann war ein toller Typ, ein alter Knabe namens Poul Lund. Er hatte nur Unfug im Sinn, und nichts war witziger, als zuzusehen, wie er die jungen »PP« – die Probe-Polizisten – zur Schnecke machte. Er konnte die Dienstanwärter einfach nicht leiden. Nicht viele von ihnen hatten den Suppenteller erfunden, wie er sagte. Aber bei dem miesen Lohn kann man auch nicht lauter Einser verlangen.
Poul Lund hatte während des Krieges im KZ Buchenwald gesessen und verfügte deshalb über eine gewisse Erfahrung.
Wir nahmen an Erste Hilfe-Kursen, Funklehrgängen und allem möglichen anderen teil, was mit zur Ausbildung gehörte. Drei- oder viermal waren wir auf dem Schießplatz und probierten die 7.65er der Polizei aus. Den Gehörschutz auf die Lauscher und acht Schuß pro Mann. Ich muß ehrlich zugeben, daß ich auch aus fünfzehn Zentimeter Entfernung keinen Kuharsch getroffen hätte, aber es machte trotzdem ziemlichen Spaß.
Etwa drei Wochen nach meinem Aufenthalt in der Polizeischule beschlossen die normale Schule und meine Eltern, es sei wohl das beste, wenn ich meinen Schulbesuch beendete. Das war dasselbe wie ein Rausschmiß, hörte sich aber sehr viel netter an. Da ich ohnehin mit einer besonderen Erlaubnis dort war – ich wohnte in Lyngby, ging aber in Gladsaxe zur Schule –, ließ sich nicht viel ändern. Es waren nur noch zwei Wochen bis zu den Sommerferien – aber auch die blieben mir erspart. Im nächsten Schuljahr sollte ich an der Engelborgschule in Lyngby anfangen, ich hatte keinerlei Examen gemacht, aber mir war das alles wirklich schnurz.
Die eine der beiden freien Wochen verbrachte ich bei meinem Freund Poul Lund an der Polizeischule – wenn er Zeit hatte, um sich um mich zu kümmern – und deshalb konnte von Langeweile keine Rede sein.
Es ist ein seltsamer Gedanke, daß ich damals fast Bulle geworden wäre. Zum Glück kam es dann ja anders. Ich mochte die älteren Beamten ziemlich gut leiden, stellte aber bald fest, daß viele von den jüngeren mehr oder weniger gehirntot waren. Ich aß und lebte fast drei Wochen lang unter ungefähr zweihundert von dieser Sorte – und das reichte.
Ich war gerade sechzehn geworden und fuhr mit meinen Eltern in den Sommerferien nach Kanada. Ich fand die Vorstellung gar nicht toll, mich von meinen Freunden trennen zu müssen, aber als wir dann unterwegs waren, gab es keine Probleme mehr.
Von London aus flogen wir mit einem Jumbo-Jet. Ich war zutiefst beeindruckt – das war wirklich etwas, worüber ich zu Hause erzählen konnte. Ich kannte sonst niemanden, der schon einmal mit einem solchen Koloß geflogen war. Ich fand ihn riesiggroß, aber auf späteren Flügen kam er mir dann vor wie in der Wäsche geschrumpft.
Die Ferien begannen in Saint Johns in Neufundland, wo wir bei Freunden meiner Eltern wohnen sollten, einem Oberarzt und seiner Frau – die pure Oberklasse. Was mich am meisten beeindruckte, war die Begegnung mit dem Kulturminister des Bundesstaates – einem witzigen Junggesellen, der mir das neue Kulturhaus der Stadt zeigte. Ich trug meinen Namen ins Gästebuch ein – zwischen Lord Montgomery und Prinz Philip. Wow!
Wir verbrachten zwei Tage in seinem Sommerhaus – einer tollen Hütte mit hohem Nadelwald an einem leuchtendblauen See. Zum Haus gehörten ein Badesteg, ein Bootshaus und natürlich ein Boot. Auf dem anderen Seeufer wohnten zwei reizende langbeinige Mädels, mit denen ich in Saint Johns Tennis gespielt hatte. Sie waren total verrückt nach mir, weil sie mich für einen Landsmann von Björn Borg hielten. Ich versuchte mehrere Male, ihnen den Unterschied zwischen Dänemark und Schweden zu erklären, aber entweder konnten sie das nicht begreifen, oder ich drückte mich nicht deutlich genug aus.
Sie hatten ein großes Rennboot, mit dem wir umherbretterten, und wir machten auch eine Wasserskitour. Ich weiß noch, wie schwer ich es fand, mich auf den beiden Brettern aufzurichten. Ich sah eher aus wie ein Spastiker, als ich lernen sollte, auf dem Wasser zu laufen. Nach fünf oder sechs Versuchen schaffte ich es endlich, und dann ging es gleich richtig los. Und dieses Schwein von Boot legte wirklich ein wahnwitziges Tempo vor.
Der Oberarzt fuhr mit mir zu Filmaufnahmen an einem Ort namens Pretty Harbour – was eine Fahrzeit von vielen Stunden bedeutete. Später habe ich den Film in Dänemark gesehen, »The Killer Whale« oder »Orca – Der Killerwal«. Der Hafen bot einen traurigen Anblick – ein kleines Fischerdorf mit vielen alten Fischern und Fischersfrauen, und verheert wie die äthiopischen Steppen. Sie hatten sich diesen Ort für die Aufnahmen ausgesucht, weil er reichlich öde und unheimlich aussah – und weil sie schlechtes Wetter brauchten. Woran kein Mangel herrschte: Statistisch gesehen regnete es hier dreihundert Tage pro Jahr – in der übrigen Zeit war ganz normales schlechtes Wetter. Es gibt ein Bild, auf dem ich neben einem mechanischen Orcawal auf Rädern stehe.
Aus meiner Sicht erscheint das Teil übrigens als ein überaus trauriger Film. Ich war immer auf der Seite der Tiere. Ich weiß noch, daß ich an einer Stelle im Film fast geweint hätte, nämlich, als eine Walkuh in einer Schiffsschraube Selbstmord begeht, nachdem sie auf dem Schiffsdeck eine Fehlgeburt erlitten hat.
Nach Saint Johns wollten wir eine Rundreise durch die USA und das östliche Kanada antreten. Wir fuhren sehr viel Taxi, wohnten in Wolkenkratzerhotels und sahen uns alle Sehenswürdigkeiten an – Paraden, Ausstellungen, Wasserfälle.
In Boston wurde uns gesagt, daß wir nicht allein in der Stadt herumlaufen dürften. Wir durften uns eigentlich kaum ungeschützt aus dem Hotelzimmer wagen. Bei unserer Ankunft wurden uns Flugblätter von irgendeinem Verein in die Hände gedrückt, der die Kriminalität bekämpfte – sogar Fahrstuhlfahren im eigenen Hotel konnte gefährlich sein. In Boston blieb man am besten im Hotelbett und schloß die Tür ab. Das Essen ließ man sich dann vom Zimmerservice bringen. Aber auch den mußte man genau im Auge behalten.
Es ist leicht zu verstehen, warum so viele Amerikaner so fett sind, bei all dem Junkfood, das sie in sich hineinstopfen – Burger mit Pommes und die obligatorische Cola. Und sie essen sehr oft. Das ist nicht so wie bei uns, wo man nur auswärts essen geht, wenn Muttern keine Lust zum Kochen hat. Nein, dort macht man das drei-, viermal pro Woche. Und dort gibt es nicht nur ein fettes Familienmitglied – nein, da gibt es ganze Burgerfamilien. Hier fällt nicht der »Dicke« in der Klasse auf – nein, hier gibt es den »Dünnen« in der Klasse.