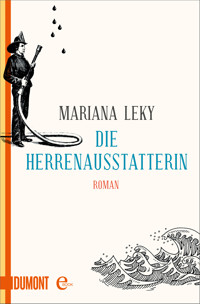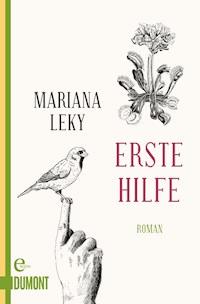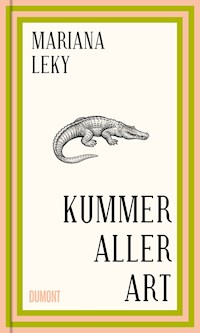8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Sollten in den Trinkwasserspendern in Wartezimmern nicht lieber Fische schwimmen? Warum sieht die Sprechstundenhilfe immer so aus, als sei sie frühmorgens schon von einem Visagisten zurechtgemacht worden? Warum ist der eine Arzt so wortkarg, der andere so schwatzhaft? Und vor allem: Was hat das alles mit mir zu tun? Mariana Leky betreibt Feldforschung in der Arztpraxis. Sie nimmt die Leser mit in Wartezimmer und auf Untersuchungsliegen, die jeder kennt, aber noch keiner so gesehen hat. ›Bis der Arzt kommt‹ ist ein vergnügliches Buch für alle, die schon mal »Aaaah…« sagen mussten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Sollten in den Trinkwasserspendern in Wartezimmern nicht lieber Fische schwimmen? Warum sieht die Arzthelferin immer so aus, als sei sie frühmorgens schon von einem Visagisten zurechtgemacht worden? Warum ist der eine Arzt so wortkarg, der andere so schwatzhaft? Und vor allem: Was hat das alles mit mir zu tun?
Mariana Leky betreibt Feldforschung in der Arztpraxis. Sie nimmt die Leser mit in Wartezimmer und auf Untersuchungsliegen, die jeder kennt, aber noch keiner so gesehen hat.
Mariana Leky wurde 1973 in Köln geboren und lebt heute in Berlin. Sie studierte nach einer Buchhandelslehre Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Im DuMont Buchverlag erschienen der Erzählungsband ›Liebesperlen‹ (DuMont Taschenbuch 2010) sowie die Romane ›Erste Hilfe‹ (2004) und ›Die Herrenausstatterin‹ (2010).
Mariana Leky
BIS DER ARZT KOMMT
Originalausgabe
eBook 2013
© 2013 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Zitatnachweis: Anmerkung 1: Harald Martenstein, »Was ist denn schlimm an dem Wort ›Arzthelferin‹?«, in: ZEITmagazin, 13.12.2012, Nr.51
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagmotiv: © Neubauwelt
eBook-Konvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN eBook: 978-3-8321-8766-8
www.dumont-buchverlag.de
Wenn die Patienten unter der Hand (des sie Berührenden) aufschrecken, so ist das sehr schlimm.
Hippokrates
I went to the doctor to get a prescription
I told him little fact and lots of fiction
Robbie Williams
DIE ARZTHELFERIN[1]
Die Arzthelferin gehört nicht zu den Leuten, die nur schwer »Nein« sagen können. Sie ist die Schwellenhüterin des Arztes, und die am sorgfältigsten bewachte Schwelle ist die Terminvergabe beim telefonischen Erstkontakt. An dieser Grenze benimmt sich die Arzthelferin, als habe sie ein ganz und gar verschnürtes Herz. Man darf sich da nicht täuschen lassen: Das Herz der Arzthelferin ist groß und dehnbar, mit idyllischen Vorhöfen und wohnlichen Kammern. Leider zeigt sich das erst später.
Wenn sich die Arzthelferin beim telefonischen Erstkontakt mit einem angriffslustigen »Ja?!« meldet, kann man sicher sein, dass es das einzige »Ja« bleiben wird, das man während des Gesprächs von ihr bekommt. Die zu diesem Zeitpunkt angriffslustige Arzthelferin nämlich glaubt, dass man nur anruft, um den Arzt zu belästigen. Sie glaubt, dass man sich vorsätzlich etwas zugezogen hat, um den Arzt zu stören, dass man sich beispielsweise tagelang nackt in den Wind gestellt hat, um den Arzt mit einer Bronchitis aufzuhalten, dass man sich monatelang Nutella auf die Zahnbürste geschmiert hat, um den Arzt mit Karies zu behelligen, dass man vorsätzlich und mit Anlauf in ein Loch im Waldboden gesprungen ist, um den Arzt mit einem Muskelfaserriss zu inkommodieren, dass man jeden Tag in die Kirche gegangen ist, um Gott eine Nasennebenhöhlenentzündung abzuschwatzen, mit der man dem Arzt dann zu Leibe rücken kann.
Die Arzthelferin behütet den Arzt insbesondere vor Leuten, die ein neuer Patient werden wollen. »Waren Sie schon mal bei uns?« ist die entscheidende erste Frage der Arzthelferin. Weil man ahnt, dass man bei einem »Nein« nach ganz weit hinten verwiesen wird, versucht man, das unvermeidliche »Nein« bis zur Unkenntlichkeit zu verzieren. »Ich fürchte, ich war leider bisher noch nicht wirklich bei Ihnen«, sagt man, oder: »Es wäre das erste Mal.« »Also nein«, resümiert die Arzthelferin. Wenn man dann auch noch schüchtern fragt: »Hätten Sie vielleicht zeitnah einen Termin frei?«, kann man sicher sein, dass die Arzthelferin einen anfahren wird, als habe man sie gefragt, was sie drunter trägt oder ob sie einem finanziell aushelfen könne.
Eine solche Arzthelferin lässt sich durch nichts erweichen. Wenn man sagt: »Ich habe aber starke Schmerzen«, dann antwortet sie: »Solange Sie noch telefonieren können, kann es ja so schlimm nicht sein« oder »Ich auch.« Wenn man sagt: »Ich habe aber vermutlich eine noch nie da gewesene, spektakuläre Krankheit, die nach Ihrem Chef benannt werden wird«, antwortet sie: »Mir egal.« Wenn man sagt: »Ihre Praxis wurde mir aber von Professor Doktor Wohlgeboren empfohlen, ich soll auch herzliche Grüße ausrichten«, antwortet sie: »Grüße zurück.«
Wenn man ganz besonders hartgesotten ist, versucht man es mit: »Ich bin aber privat versichert.« Dann zögert die Arzthelferin. Bevor sie einem aber den zeitnahen Termin für Privatversicherte anbieten kann, verliert man die Nerven und sagt: »Kleiner Scherz.« – »Selten so gelacht«, sagt die Arzthelferin dann und legt auf.
Es gibt auch Arzthelferinnen, die gleich zu Anfang sehr viel sagen, und zwar alles in einem Wort. Dieses Wort kann ziemlich lang ausfallen, wenn nämlich die Arzthelferin angewiesen wurde, sich am Telefon namentlich vorzustellen, und außerdem in einer Gemeinschaftspraxis arbeitet, in der mindestens ein Arzt einen Doppelnamen trägt.[2] Daran, wie sie sich meldet, kann man übrigens merken, ob sich im Privatleben der Arzthelferin etwas Entscheidendes verändert hat. Wenn sie ganz kurz stockt, bevor sie ihren Namen sagt, ist ihr der eigene Name neu, weil sie gerade geheiratet oder sich gerade hat scheiden lassen. Besser, man fragt nicht nach.
Wenn man die entscheidende Schwelle überschritten hat und am Tresen vor der Arzthelferin steht, glaubt man kurz, man habe sich vertan und sei in eine Praxis für Verschönerung geraten. Die Arzthelferin nämlich sieht aus, als schliefe in oder neben ihrem Bett ein Visagist. Noch bevor die Arzthelferin erwacht, geht dieser Visagist lautlos zu Werke, er legt abschwellende Teebeutelchen auf ihre Lider, zupft ihre Augenbrauen zurecht, appliziert schimmernde Cremes und färbt den Haaransatz nach.[3] Wenn die Arzthelferin dann erwacht, muss nur noch getuscht und frisiert werden. Nur so, mit einem beigestellten Visagisten, ist es zu erklären, dass die Arzthelferin immer und schon um sieben Uhr fünfzehn perfekt aussieht und dass sie sich niemals, wie herkömmliche Leute, durchs Haar fahren muss.
Man steht vor dem Tresen der aus dem Ei gepellten Arzthelferin, man hatte heute früh keinen Visagisten zur Hand, nicht einmal ein Frühstück, weil man nüchtern einbestellt wurde. Man steht dort in einem kleinen Pulk anderer Wartender, die auch nicht gepellt aussehen, eher geschält; struppig und triefend steht der kleine Patientenpulk da wie eine Herde alter Ponys im Schnee.
Man wartet, bis man angesprochen wird, das kann dauern. Mit glasigen Augen sieht man der Arzthelferin bei ihren Verrichtungen zu. Immer wieder rauscht der Arzt herein, um ihr einen Zettel zu überreichen, den auf der ganzen Welt nur sie entziffern kann, um ihr Einwortsätze zu sagen, die auf der ganzen Welt nur sie verstehen kann, man schaut ihr zu, wie sie einen ihrer zahllosen Telefonhörer abnimmt, ein »Ja?!« hineinblafft oder, mit dem immer gleichen Singsang, ihren langen Satz aufsagt. Eines ihrer Telefone klingelt immer und stets mit einer viel zu munteren symphonischen Melodie. Man sieht der Arzthelferin zu, wie sie »Moment« in einen weiteren Hörer sagt und ihn zu anderen Hörern auf den Tresen legt. Man sieht ihr zu, wie sie Krankenkassenkärtchen prüft, wie sie dem surrenden Rezept- und Überweisungsscheindrucker Rezepte und Überweisungsscheine entnimmt. Und unter all den gesingsangten Sätzen, dem Surren, den Telefonklingelsymphonien, dem Niesen und Scharren der Wartenden hört man das Schweigen, das aus den hingelegten Telefonhörern rinnt, das Schweigen der Patienten, die am anderen Ende der Leitung warten, die einen Termin möchten oder ein Testergebnis. Manchmal hört man aus einem abgelegten Hörer, der schon sehr lange da liegt, ein klägliches »Hallo? Hallo?«, dann versucht man, den Blick der Arzthelferin zu erhaschen und zeigt stumm auf den Hörer. »Ich hab auch nur zwei Hände«, belehrt einen die Arzthelferin dann. »Natürlich«, sagt man, obwohl man ihr das kaum glaubt.
Die Arzthelferin ist so ungeheuer wach, so agil, und man selbst steht so verschnoddert da, so verschneit, zerrupft und knietief im Schweigen der wartenden Hörer. Weil es gerade jetzt mit dem Selbstwertgefühl nicht weit her ist, weil auch das Selbstwertgefühl nüchtern einbestellt wurde, findet man, dass die Arzthelferin ganz und gar in ihrem Leben angekommen ist, in ihrem gepflegten Leben, während man selbst bisher leider nur beim Arzt angekommen ist.
Wenn die Arzthelferin während der Behandlung gefragt ist, wenn sie Blut abnehmen oder Beihilfe zu einer Spritze leisten soll, zeigt sie ihr wahres Herz. Fragt der Arzt einen beispielsweise, ob man Angst vor Spritzen ins Knie hat, und man sagt »Ja«, obwohl man bislang keine Angst vor Spritzen ins Knie hatte, aber jemand ist, der immer gern zugreift, wenn ihm eine neue Angst angeboten wird, holt der Arzt die Arzthelferin dazu, die während der Spritze gekonnt tätschelt und plaudert. Es zeigt sich, dass die Arzthelferin eine Virtuosin des Tätschelns und ablenkenden Small Talks ist. Während der Arzt mehrere Meter Spritze unter der Kniescheibe verstaut, verwickelt einen die Arzthelferin mit leichter Hand in ein Gespräch, sie versteht es, aus allem, aus wirklich allem, ein anregendes Gesprächsthema zu machen, sie erörtert das Für und Wider des Wetters, von Armbanduhren, des neuen Anstrichs der Sprechzimmerfußbodenleisten, und während man dankbar an den Lippen der Arzthelferin hängt und der Arzt die Stelle unter der Kniescheibe mit irgendetwas befüllt, hört man plötzlich einen gedämpften Knall ganz in der Nähe. Man fragt sich, ob eine Fachliteratur aus dem Regal oder die Wirbelsäulennachbildung vom Tisch gefallen ist, man schaut besorgt nach unten, um nachzusehen, ob der über das Knie gebeugte Arzt zu Boden gegangen ist, aber all das ist es nicht. Was da knallte, war nichts anderes als das abspringende Band vom eingeschnürten Herzen der Arzthelferin.
DAS WARTEZIMMER
In den meisten Wartezimmern stehen verchromte Kleiderbügel zur Verfügung, die sich nicht von der Hängestange nehmen lassen. Sie klackern aneinander, wenn man trotzdem versucht, seinen Mantel aufzuhängen, ein Tonsignal, das den anderen Wartenden einen weiteren Wartenden ankündigt.
Manchmal gibt es in einer Ecke einen Trinkwasserspender, den allerdings nie jemand benutzt, man könnte genauso gut Fische hineintun. Vermutlich denken alle wartenden Patienten, dass das Wasser schon seit Praxiseinweihung bewegungslos im Kanister vor sich hin steht oder dass heute schon Trillionen viraler oder bakterieller Zeigefinger auf den Trinkwasserspenderknopf gedrückt haben.
An den Wänden des Wartezimmers hängt Kunst.[4] Manchmal abstrakte Bilder. Bei deren Betrachtung fragt man sich, ob der Arzt sie in seiner spärlichen Freizeit selbst gemalt hat oder ob sie von einem Patienten stammen, man fragt sich, was der Patient mittels seiner abstrakten Bilder verarbeiten musste, und hofft, dass es nicht der Besuch beim Arzt war.
In vielen Wartezimmern hängt ein Flachbildfernseher. Darin gibt es tonlose Tierdokumentationen zu sehen, Impressionen einer Safari oder etwas mit heimischen Vögeln. Zwischendurch läuft aber auch ein powerpointpräsentationsartiger, bebilderter Text über diverse Erkrankungen und deren Behandlung. Bemerkenswerterweise sind es durchweg Sachen, die man sich durch langes Warten zuziehen kann (Bandscheibenvorfall, Knicksenkspreizfuß, Migräne).
Patienten im Wartezimmer sprechen einander nicht an. Vielleicht, weil einem bei kapitaler Bronchitis nicht nach Unterhaltung ist. Oder weil man fürchtet, sich dann die Infekte und detaillierten Leidensgeschichten der Mitwartenden zuzuziehen. Vielleicht, weil man Angst hat und mit dieser Angst in Ruhe gelassen werden möchte, weil es sich um eine unansprechbare Angst handelt, eine Angst, die viel zu erhaben ist, als dass sie sich durch dahergelaufene Nebensitzer von sich selbst ablenken ließe. Vielleicht braucht man Ruhe, weil man gerade in magischen Verhandlungen steht, die alle Konzentration erfordern. »Wenn es harmlos ist, werde ich ab sofort nie wieder lügen«, verspricht man still in die Stille des Wartezimmers hinein, oder: »Wenn es keine weiteren Entzündungsherde gibt, räume ich mit meinem Leben auf und werde künftig jede Minute genießen.« Diese stillen Verhandlungen sind quälend in ihrer Einseitigkeit, denn bislang ist noch nie jemand aufgrund dieser inneren Beteuerungen herabgefahren, um sich neben den Verhandelnden zu setzen, ihm auf den Schenkel zu schlagen und energisch zu sagen: »Abgemacht! Dann leg mal los.«
Die Luft im Wartezimmer ist dick von der Schwere der magischen Verhandlungsmasse, von übergewichtigen Bakterien und auch, weil im Wartezimmer wegen möglicher Zugluft keiner lüftet. Man hört das Umblättern von Illustriertenseiten, das untersagte Tippen auf Mobiltelefonen, Niesen, Husten, Räuspern, das Rascheln von Taschentüchern und der Kleidung derer, die wegen drohender Haltungsschäden eine neue Sitzposition probieren.
Von ferne hört man die Verrichtungen der Arzthelferin, das Klingeln und Surren ihrer Apparate. Ab und zu steht jemand auf, um die Arzthelferin zu fragen, wie lange man noch warten muss. »Einen Moment noch«, sagt die Arzthelferin dann, »wir tun, was wir können.«
Ansonsten sagt keiner etwas. Dabei hätte man jetzt Zeit, sich gründlich kennenzulernen. Man könnte, wenn man alles über Königshäuser gelesen hat, über Stars in Scheidung, Stars im Glück und in Entzugskliniken gemeinsam Collagen, Hüte oder Schiffe aus den Illustrierten basteln. Man könnte auch Stadt, Land, Fluss spielen, mit den neu eingeführten Kategorien Hochadel, Stars und Heimische Vögel. Man könnte feststellen, wie viel man gemeinsam hat (Knicksenkspreizfüße zum Beispiel oder ein ganz neues Interesse für das Rotkehlchen), man könnte sich die dann plötzlich gar nicht mehr so vergilbten Witze aus der Freizeit Revue vorlesen, man könnte sich Narben zeigen oder fragwürdige Leberflecke, man könnte sich gegenseitig einen günstigen Verlauf nahelegen (»Ach, das haben Sie? Meine Tante hatte das auch, und die ist trotzdem weit über neunzig geworden«), man könnte gemeinsam das Wartezimmer umgestalten, man könnte auch mal lüften. Und vielleicht würden sogar die Wartenden mit der großen Furcht ihre inneren Verhandlungen kurz unterbrechen, sich aus ihrer herrischen Angst herauswinden (natürlich nur unter der Beteuerung: »Ich bin gleich zurück«), und wenn dann die Arzthelferin den Kopf durch die Tür steckte und sagte: »So, der Nächste bitte«, würde man, in Umbauarbeiten, in die Suche nach einer Königin mit Y oder ins Gespräch vertieft, »Einen Moment noch« zu der Arzthelferin sagen, »einen Moment noch. Wir tun, was wir können.«
DIE SELBSTAUSKUNFT
Wenn man einen Arzt zum ersten Mal konsultiert, bekommt man ein Klemmbrett mit einem Blatt zur Selbstauskunft in die Hand gedrückt, dazu einen Werbekugelschreiber. Auf dem Blatt stehen Krankheiten, daneben zwei Spalten. In der linken, nah an den Krankheiten, stehen untereinander lauter JAs, in der rechten lauter NEINs. Unter der langen Reihe von JAs und NEINs steht die Frage, welche Medikamente man regelmäßig einnimmt, darunter zwei Linien.
Man ist sehr gut dran, wenn man in der Selbstauskunft ein Neinsager bzw. ein Neinumkringler ist. Wenn man, neben all den mehr oder minder verheerenden Krankheiten, die einem vorgeschlagen werden, ohne zu zögern jedes JA übergeht, jedes NEIN umkringelt und auf der Selbstauskunft am Schluss eine vollständige Reihe rasch umkringelter NEINs prangt. Würde man sie nicht so beiläufig machen, könnte die Neinumkringelung, könnte jeder einzelne Neinkringel, jedes unberührte JA Anlass geben, die Dinge ins rechte Licht zu rücken.[5]
Leider leuchtet einem das Glück der ausnahmslosen Neinumkringelung erst ein, wenn es dahin ist. Wenn man plötzlich auch mal linksseitig kringeln muss, wenn sich im Leben und in der Selbstauskunft das eine und das andere JA einfinden. Plötzlich ist man, JA, schon mal operiert worden, plötzlich hat man, JA, etwas Chronisches, plötzlich ist, JA