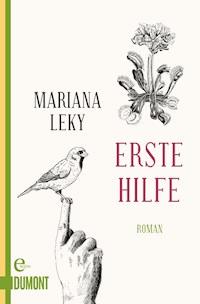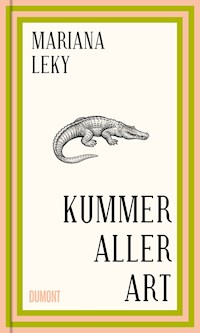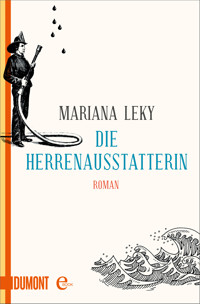
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von der Autorin des Bestsellers 'Was man von hier aus sehen kann' Katja Wiesberg verschwimmt die Welt vor Augen. Ihr Mann ist fort, und sie ist ihren Job los. Katja ist allein. Da sitzt auf einmal ein älterer Herr auf dem Rand ihrer Badewanne und stellt sich als Dr. Blank vor. Es ist der Geist ihres ehemaligen Nachbarn. Und noch ein Fremder taucht auf: Nachts steht ein Feuerwehrmann vor der Tür, der behauptet, zu einem Brand gerufen worden zu sein – und nicht wieder geht. Mit entwaffnender Zutraulichkeit nistet er sich in Katjas Leben ein. Erst allmählich begreift sie, wie gut er ihr tut: Ein kleinkrimineller Feuerwehrmann, der Karatefilme liebt, ist gerade das Richtige, um sie zurück ins Leben zu holen. Eine abenteuerliche Dreiecksgeschichte nimmt ihren Lauf, zwischen einer aus dem Alltag gefallenen Frau, einem überaus selbstbewussten Liebhaber und einem lebensweisen Toten, den allerdings nur Katja sehen kann. Mariana Lekys Roman verführt in eine Welt, die komischer und trauriger ist als unsere – und dabei geisterhaft menschlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Katja Wiesberg verschwimmt die Welt vor Augen. Ihr Mann ist fort, sie ist ihren Job los und allein. Da sitzt auf einmal ein älterer Herr auf dem Rand ihrer Badewanne und stellt sich als Dr. Blank vor. Und noch ein Fremder taucht auf: ein Feuerwehrmann, der behauptet, zu einem Brand gerufen worden zu sein, und nicht wieder geht. Eine abenteuerliche Dreiecksgeschichte nimmt ihren Lauf, zwischen einer aus dem Alltag gefallenen Frau, einem überaus selbstbewussten Liebhaber und einem lebensweisen Toten. Mariana Lekys Roman entführt in eine Welt, die komischer und trauriger ist als unsere – und dabei geisterhaft menschlich.
»Lekys Sprache ist von scharfer Präzision und hinreißendem Witz.«
F. A. Z.
»Mariana Leky schreibt genau, ehrlich, witzig, furchtlos und erfrischend. Das perfekte Lesevergnügen.«
BRIGITTE
»Ein tiefgründiges Schmunzelstück.«
KURIER WIEN
»Grotesk und rührend, vor allem aber verblüffend weise.«
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
© Franziska Hauser
Mariana Leky studierte nach einer Buchhandelslehre Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Bei DuMont erschienen der Erzählband ›Liebesperlen‹ (2001), der Roman ›Erste Hilfe‹ (2004) sowie ›Bis der Arzt kommt. Geschichten aus der Sprechstunde‹ (2013). 2017 erschien ihr Roman ›Was man von hier aus sehen kann‹, der wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste stand. Sie lebt in Berlin und Köln.
Mariana Leky
Die Herrenausstatterin
Roman
Von Mariana Leky sind bei DuMont außerdem erschienen:
Liebesperlen Erste Hilfe Bis der Arzt kommt. Geschichten aus der Sprechstunde Was man von hier aus sehen kann
eBook 2020
© 2010 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Zero, München
ISBN eBook: 978-3-8321-8544-2
www.dumont-buchverlag.de
Meinen Eltern
»Ich mache Ihnen den Vorschlag, sich mir anzuvertrauen.«
Der vermummte Herr in Frank Wedekinds Frühlings Erwachen
Bis später
Alles hätte gut und gern so weitergehen können, aber dann ist alles zerbrochen, was, wie Blank später sagte, ein sicheres Zeichen dafür ist, dass es eben nicht so habe weitergehen können, auch wenn ich das geglaubt hatte. Was man selber glaubt, ist, auch das sagte Blank später, manchmal unmaßgeblich in der Frage, ob etwas zerbrochen gehört oder nicht.
Morgens, wenn ich aufwachte, war Jakob längst wieder da oder gar nicht weg gewesen. Er lag neben mir in meinem Bett, je nach Jahreszeit unter einem Laken oder einer Decke. Jakob schlief wie ein Toter und brauchte anschließend lange, um richtig wach zu werden. Oft verschlief er und wachte erst auf, wenn die Sprechstundenhilfe anrief und sagte: »Sie müssten jetzt wirklich mal kommen, hier ist alles voller Schmerzpatienten.« Dann stieg Jakob schlaftrunken in seine Kleider, ging schlaftrunken los, kaufte unterwegs einen Kaffee zum Mitnehmen, er tat das ohne Worte, weil man ihn in der Kaffeebar kannte, er kam schlaftrunken in die Praxis und durchquerte schlaftrunken sein volles Wartezimmer. Seine Sprechstundenhilfe wusste, dass Jakob morgens dankbar war für jedes Wort, das er nicht sagen oder hören musste, deshalb sagte sie nichts, folgte ihm ins Behandlungszimmer, zog ihm dort den zerdrückten Kaffeepappbecher aus der Jackentasche, reichte ihm den frisch gewaschenen Kittel und wies Jakob, kurz bevor der erste Schmerzpatient hereinkam, wortlos auf den Schlaf in seinen Augenwinkeln hin. Es ist beunruhigend, von jemandem behandelt zu werden, der noch Schlaf in den Augen hat.
Jakob war Zahnarzt. Ich lernte ihn kennen, als meine Zähne schlecht waren, deshalb kannte ich mich mit Zahnärzten gut aus und wollte eigentlich keinen neuen mehr kennenlernen. Ich kannte mich mit den Wartezimmern aus, in denen hauptsächlich Leute sitzen, die aussehen, als kämen sie nur mal so zur Kontrolle. Ich kannte den Zahnarztbegrüßungshandschlag, ein kurzer fester Griff mit einer vom vielen Waschen farblosen und wachsweichen Hand. Ich kannte das ungeduldige Zahnarztnicken, wenn man dem Zahnarzt noch etwas sagen möchte, bevor man den Mund aufsperrt und nichts mehr sagen kann. Man fängt bereits im Türrahmen des Behandlungszimmers an zu reden, um auf dem kurzen Weg zwischen Tür und Behandlungsstuhl alles gesagt zu haben, man verhaspelt sich dabei in dem Versuch, zahnarztwunschgemäß schneller zu reden, rasant schildert man Ort und Stärke der Beschwerden und beteuert rasant, dass man wirklich jeden Abend mit Zahnseide und Zahnhölzchen, Interdentalbürstchen und Munddusche hantiert hat, weil man sich gut mit jemandem stellen will, der wahrscheinlich gleich dafür sorgt, dass es schmerzhaft wird. Leider vergisst man dabei immer, dass der Zahnarzt mit Beteuerungen nichts anfangen kann. Der Zahnarzt will, dass man noch rasanter schildert, die Beteuerungen am besten ganz auslässt und endlich den Mund aufsperrt.
Ich kannte den Satz, den Zahnärzte sagen, wenn der Mund endlich aufgesperrt ist: »Wir werden uns noch ein paar Mal wiedersehen müssen«, sagen sie, bevor sie anfangen zu behandeln. Ich kannte auch die anschließende Schweigsamkeit der Zahnärzte. Zahnärzten hat man nicht beigebracht, dass manche Dinge weniger schmerzhaft sind, wenn man erklärt bekommt, was warum und wie lange schmerzhaft sein wird. Ich kannte den leeren Blick der Zahnärzte, wenn sie mit ihren Bohrern hantieren, die sich immer anhören wie ein versehentlich angerufenes Faxgerät, nur viel lauter.
Als mein damaliger Zahnarzt im Urlaub war, ging ich zu seiner Vertretung. Die Vertretung war Jakob, der damals noch Dr. J. Wiesberg hieß. In seinem Wartezimmer saß niemand nur mal so zur Kontrolle.
Als ich Jakob zum ersten Mal sah, war er ausgeschlafen, mein Termin lag am frühen Nachmittag. Als er mir zur Begrüßung die Hand gab, lief ihm eine Träne über die Wange.
»Weinen Sie?«, fragte ich, weil mich die unverhoffte Regung erstaunte. Außerdem ist es beunruhigend, von einem weinenden Zahnarzt behandelt zu werden.
»Ich weine nicht«, sagte er, »meine Augen sind nur zu trocken.« Er zog ein Fläschchen aus seiner Kitteltasche und hielt es mir hin. Tears again, stand darauf, und Jakob erklärte, dass er sich die Flüssigkeit regelmäßig in seine zu trockenen Augen träufeln müsse, was dazu führe, dass ab und zu eine Träne unkontrolliert über seine Wange laufe.
Ich drehte das Fläschchen in den Händen und wusste nicht, was ich sagen sollte, weil mir noch nie ein Zahnarzt etwas von sich gezeigt hatte, und schließlich sagte ich: »Es hat ein benutzerfreundliches Design.« Jakob nickte und lächelte mich an. Ich gab ihm das Fläschchen zurück und sagte möglichst schnell Sachen, die man vorher noch sagen will, und Jakob nickte kein bisschen, sondern stellte konstruktive Fragen. Er besah sich meine Zähne, murmelte Buchstaben und Zahlen und sagte: »Wir werden uns noch ein paar Mal wiedersehen.«
»Heben Sie bitte sofort die Hand, wenn es schmerzhaft wird, dann hören wir schnurstracks auf«, sagte er, als er anfing zu behandeln, und dann: »Und jetzt denken Sie mal an was Schönes.«
Weil es sich anbot, dachte ich an Jakob, denn Jakob war schön, obwohl er Zahnarzt war. Jakob bohrte an meinem Zahn herum und sagte mehrmals, ich solle sofort die Hand heben, wenn es schmerzhaft würde, denn dann würden wir schnurstracks aufhören, er sagte das nachdrücklich, als seien wir nicht bei einer Zahnbehandlung, sondern auf einer besonders waghalsigen Expedition, die ich als Erste unternahm. Jakob erklärte ausführlich, was warum wie lange eventuell schmerzhaft sein könnte, er war kein bisschen schweigsam. »Sie machen das wirklich wunderbar«, sagte er, obwohl es gar nicht besonders schmerzhaft war, »Sie machen das mit Bravour«, er sagte: »Menschen, die Schmerzen mit solcher Geduld begegnen, sind selten« und: »Sie ertragen das mit der Ruhe eines indischen Yogi.« Er sagte das alles ernst und leise, und spätestens jetzt wusste ich, warum Jakobs Wartezimmer so voll war. Ich freute mich, ausgerechnet an Jakob geraten zu sein, und als es dann doch etwas schmerzhaft wurde, hob ich nicht die Hand, sondern schaute auf ein großes Schild, das an der Decke über dem Behandlungsstuhl hing. In großen Buchstaben stand darauf: Gleich ist es vorbei.
Tatsächlich war es gleich vorbei, und tatsächlich hatte niemand eine Ahnung davon, dass genau jetzt die Sache mit Jakob losging. Es ist ganz und gar normal und ganz und gar ungeheuerlich, dass man immer ahnungslos ist, wenn solche Sachen ihren Anfang nehmen. Nie hat man bei ihrem Losgehen eine Ahnung von ihrem Ausmaß und ihrer Wucht oder davon, was warum und wie lange schön oder schmerzhaft sein wird, und ich wünschte, ich wüsste, was gewesen wäre, wenn auf dem Schild über dem Behandlungsstuhl nicht Gleich ist es vorbei, sondern Jetzt geht es los gestanden hätte. Wenn dort Das ist Jakob, jetzt geht es los, und es wird sehr, sehr lange nicht vorbei sein, gestanden hätte. Und: Es wird schön, so schön, wie noch nie etwas war, und dann wird es schmerzhaft, so schmerzhaft, wie noch nie etwas war, aber leider zu spät sein, um schnurstracks aufzuhören, wenn da gestanden hätte, was genau wie schön oder schmerzhaft sein würde, ich wünschte, ich wüsste, was passiert wäre, wenn ich all das hätte lesen können auf dem Schild über dem Behandlungsstuhl, während ich einen Bohrer und ein Absauggerät im Mund hatte und Dr. J. Wiesberg konzentriert meinen Zahn behandelte.
Vielleicht wäre nichts anders gewesen und ich nur erstaunt, dass ich ausgerechnet an einen Zahnarzt geraten wäre. Vielleicht wäre ich glücklich über den Teil mit dem nie dagewesenen Schönen gewesen, und vielleicht hätte ich über den Teil mit dem nie dagewesenen Schmerzhaften gedacht: »Das wollen wir ja mal sehen«, so, wie ein herkömmlicher Zahnarzt es sagt, wenn man ihm bereits beim Reinkommen etwas von Hölzchen und Bürstchen erzählt.
Wenn Jakob am Vormittag aufstand, war ich schon weg, ich stand früh auf und ging übersetzen. Ich übersetzte von Montag bis Freitag in einem Großraumbüro Gebrauchsanweisungen, Berichte, Broschüren und Beipackzettel, Werbetexte und besinnliche Sprüche und ab und zu ein Schild. Es gab viel zu übersetzen und einen Chef, der Bengt hieß. Bengt ist ein Name, der, wenn man ihn mehrmals hintereinander ruft, klingt wie ein aufprallender Ball, und Bengt wurde oft gerufen. »Bengt! Bengt!«, rief immer irgendwer, der mit seiner Übersetzung nicht weiterwusste. Dann kam Bengt, er hatte einen schnellen, hüpfenden Gang und sah immer aus, als würde Gott ihn dribbeln.
Es gab regelmäßige Arbeitszeiten und einen eigenen Schreibtisch, auf dem kein Foto von Jakob stand. Ich hätte nichts dagegen gehabt, eines hinzustellen, viele im Großraumbüro hatten Fotos von nahestehenden Menschen oder Tieren auf ihrem Schreibtisch, aber Jakob fand gerahmte Nahestehende eine Unart und war überzeugt, dass ich das auch fände.
Evelyn, die neben mir übersetzte, fand meinen Schreibtisch kahl. Auf ihrem standen Fotos von diversen Männern und Frauen in bunten, kleinen und großen Rahmen, verflossene und aktuelle Lieben und Tanten und Neffen, außerdem zu jeder Jahreszeit eine Schale voller Marzipankartoffeln. Evelyn bekam die Marzipankartoffeln von ihren Verehrern. Weil Evelyn viele Verehrer hatte, war sie etwas dick geworden und hatte sich vorgenommen, nicht mehr alle Marzipankartoffeln selber zu essen. Sie brachte die geschenkten Marzipankartoffeln mit ins Büro, stellte sie teilweise zur freien Verfügung auf ihren Schreibtisch und verteilte sie teilweise in Tüten unter den Kollegen, damit wir sie aufbewahrten für die Zeit, wenn die Wirkung der ganzen Marzipankartoffeln in Evelyn wieder nachgelassen hatte und Raum für neue war.
Die Wirkung der Marzipankartoffeln war hartnäckig. Die Verehrer waren es auch. Sie trieben jederzeit Marzipankartoffeln auf, sogar im Juni.
Seit kurzem hatte Evelyn nicht nur Marzipankartoffeln, sondern auch Tabletten dabei, für und gegen Schlaflosigkeit zum Beispiel, die sie bei Bedarf unter den Kollegen verteilte, denn einer von Evelyns Verehrern war Psychiater. Der Psychiater war verrückt nach Evelyn und machte deswegen neuerdings alles falsch. Er erzählte seinen ganzen traurigen Patienten von Evelyn und ihrer Schönheit, anstatt den Patienten zuzuhören, die kamen, weil sie erzählen wollten, dass sie keine Evelyn und überhaupt weit und breit keine Schönheit in ihrem Leben hatten, und sie wollten dabei ab und zu von einer konstruktiven Frage des Psychiaters unterbrochen werden und Tabletten verschrieben bekommen, die gegen ausbleibende Schönheit im Leben wirkten, aber der verliebte Psychiater ließ sie kaum zu Wort kommen und zückte weder den Rezeptblock noch die konstruktive Frage, und die traurigen Patienten wurden immer trauriger durch all die Geschichten darüber, was Evelyn heute wieder Schönes getan oder gesagt hatte, und immer selbstmordgefährdeter wurden sie auch.
Der Psychiater hatte einen abgeschlossenen Medikamentenschrank voller Tabletten, aber für Evelyn öffnete er alles.
Evelyn übersetzte aus dem Spanischen, ich aus dem Englischen, wir riefen selten nach Bengt. In den Pausen rauchten wir manchmal auf dem Klo und redeten über die leichten oder vertrackten Übersetzungen, an denen wir gerade saßen, und über Evelyns leichte oder vertrackte Liebesgeschichten. Nach dem Rauchen sprühten wir eine Mischung aus Odol und Imprägnierspray in die Kabine, je drei Sprühstöße, wir hatten gute Erfahrungen damit gemacht.
Jakob und ich wohnten nicht zusammen, aber Jakob hatte einen Zweitschlüssel, und wenn ich abends nach Hause kam, wartete er meistens in meiner Wohnung auf mich. Seine Hände waren weiß und weich vom vielen Händewaschen, er roch noch nach Desinfektionsmittel und ich noch nach Imprägnierspray, beides verflog.
Nachts ging Jakob oft spazieren. »Bis später«, sagte er dann, und wenn es später war, kam er wieder. Bis es später war, saß ich am Schreibtisch und übersetzte, was noch bis morgen übersetzt werden musste. Manchmal rief Jakob mich von unterwegs an, aus einer nächtlichen Haupt- oder Nebenstraße, einer Kneipe, einem Park oder, wenn er aus der Stadt gefahren war, einem Wald. Er erzählte, wem er begegnet war, einem Freund, einem Kollegen, einem Schmerzpatienten, einem Fuchs. Er fragte, wie es mit der Übersetzung gehe, und ich erzählte, ob es ging oder nicht, meistens ging es.
Manchmal nahm Jakob mich mit auf einen nächtlichen Spaziergang, einmal liefen wir einen Waldweg entlang. Es war stockfinster und ich rempelte Jakob an, weil ich den Abstand falsch eingeschätzt hatte. Jakob stolperte und stieß sich den Kopf an einem Ast. »Oh«, sagte ich, »du warst viel näher, als ich dachte.« Jakob rieb sich die Stirn. »Das bin ich immer«, sagte er.
Weil man manche Dinge besser fragen kann, wenn es dunkel ist und der andere einen nur schemenhaft sehen kann, fragte ich Jakob in dem stockfinsteren Wald, ob er sich vorstellen könne, mit mir zusammen zu wohnen. Ich wollte schon lange mit Jakob zusammen wohnen, hatte mich aber nie getraut, ihn das zu fragen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass Jakob sich das vorstellen konnte. Aber jetzt, im Wald, fand ich, dass man schließlich nie ganz sicher sein konnte, den anderen und seine Vorstellungen zu kennen, dass man sich das Kennen des anderen womöglich nur unterstellte, dass man wenigstens gefragt haben müsse, damit nicht irgendwann, wenn alles zu spät wäre, herauskäme, dass man sich doch immer dasselbe gewünscht hatte, damit nicht Jakob, wenn er ein Greis wäre und auf dem Sterbebett läge, sagen würde, er habe zeit seines Lebens darunter gelitten, dass wir nie zusammen gewohnt hätten.
Ich fragte Jakob, ob er mit mir zusammenwohnen wolle, Jakob lachte, legte den Arm um mich und sagte: »Gott bewahre.« Dann blieb er stehen und räusperte sich. »Aber ich kann dir ersatzweise anbieten, dass wir heiraten.«
Ich rechnete häufig mit Abwegigem. Ich stellte mir abwegige Dinge vor und rechnete dann mit ihnen, aber dass Jakob heiraten wollte, war so abwegig, dass selbst ich nicht damit gerechnet hatte. Heiraten ist für Jakob noch schlimmer als gerahmte Fotos von Nahestehenden, hatte ich geglaubt, und kein Wald und überhaupt kein Ort auf der Welt hätte so stockfinster sein können, dass ich Jakob darin gefragt hätte, ob er mich heiraten wolle.
Jetzt hätte ich Jakob doch gerne deutlicher gesehen. »Gern«, sagte ich, »ja, gern, natürlich.« Jakob legte den Arm um meine Schultern. »Gut«, sagte er, »dann machen wir das.«
Wir gingen schweigend weiter, stolperten dann über einen Traktorreifen und fielen der Länge nach hin. Wir blieben liegen, eine ganze Zeit lang und wortlos, weil wir beide den Plan vom Heiraten kaum fassen konnten. Dann, als man wieder besser sehen und Abstände richtig einschätzen konnte, blickte Jakob zu mir herüber und lächelte mich an. »Spektakulär, oder?«
»Absolut«, sagte ich.
Die Hochzeit feierten wir an einem See. Jakob hatte den Trauspruch ausgesucht. »Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod«, sagte der Pastor. »Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können«, sagte er, und er sagte es noch mal, als er um Mitternacht betrunken und glücklich in den See gefallen war.
Jakobs Mutter und mein Vater hielten Reden, sie stellten sich mit bebenden Zetteln vor unseren Tisch und redeten darüber, wie Jakob und ich bisher gewesen waren, in der Kindheit und der frühen und der späteren Jugend, dann wurde applaudiert und angestoßen.
Als Jakob ein Kind war, erzählte seine Mutter, habe sie ihn regelmäßig in die Notaufnahme gebracht, regelmäßig habe man Jakob verbinden, eingipsen oder nähen und einmal sein Auge in letzter Sekunde retten müssen, weil er als Einjähriger in eine unzureichend verschlossene Flasche Rohrfrei geschaut hatte. Mit dem Dreirad war er mitten in einen engmaschigen Stacheldraht gerast, aus dem man ihn herausschneiden musste, mit einer Kleinkindertröte im Mund war er übers Kopfsteinpflaster gerannt, bis er hinfiel und die Tröte im Hals steckte, aus Baumhäusern und von Hochbetten war er gefallen, mit acht Monaten ins stürmische Mittelmeer gekrabbelt und in letzter Sekunde nicht ertrunken.
Mein Vater erzählte, dass ich ein vorsichtiges Kind gewesen sei, das so gut wie nie hinfiel, was daran lag, dass ich die meiste Zeit am Küchentisch saß und malte. Ich malte Bilder in fröhlichen Farben. »Mal doch mal ein Monster, oder eine Krähe, irgendwas Dunkles wenigstens«, hatte mein Vater immer wieder angeregt, aber ich hatte unbeirrt weiter in Eiscremetönen gemalt.
In der Schule hatte Jakob die Unterschrift seiner Eltern auf den blauen Briefen gefälscht und im Treppenhaus Mülleimer über hochsteigenden Lehrern ausgekippt. Regelrecht verhaltensauffällig sei er gewesen, sagte Jakobs Mutter lächelnd. Ich hatte das Schulgemüsebeet und Freundschaften gepflegt, und wenn ich eine zwei geschrieben hatte, erzählte mein Vater, hatten die Lehrer mich gefragt, ob ich jetzt sehr enttäuscht sei.
In seinem Studium hatte Jakob sich nur lückenhaft auf Prüfungen vorbereitet oder gar nicht, er hatte trotzdem immer bestanden, weil, vermutete Jakobs Mutter, man Jakob gerne reden höre, auch wenn er nicht über das sprach, über das er eigentlich sprechen sollte. Das stimmte. In meinem Studium war ich auf alle Prüfungen immer umfassend vorbereitet gewesen. »Sie war schon immer recht ehrgeizig«, sagte mein Vater. Das stimmte nicht, ich war nicht aus Ehrgeiz, sondern aus Angst so gut vorbereitet gewesen, und weil man bei Angst das Naheliegende mit dem Abwegigen verwechselt, hatte ich mich auch auf abwegige Fragen umfassend vorbereitet und am Abend vor Prüfungen immer so viel Beruhigungstee getrunken, dass ich die ganze Nacht aufs Klo musste.
In meinen Urlauben, die sich nie weit weg abspielten, geriet ich auf Spaziergängen, an deren Ende eine wunderbare Aussicht stehen sollte, aus Versehen regelmäßig in beschauliche Wohnanlagen, die nichts versprachen, außer dass ich ganz bestimmt irgendwo falsch abgebogen war, weswegen ich, erzählte mein Vater, auf die Frage nach Urlaubserlebnissen immer einsilbig antwortete. Jakob, erzählte seine Mutter, geriet in seinen Urlauben regelmäßig in Gefahr. Angeblich aus Versehen kam er in einem sibirischen Wald voller Bären vom Weg ab, angeblich aus Versehen wurde er in einem afrikanischen Nationalpark voller Krokodile über Nacht eingeschlossen, und sowohl die sibirischen Bären, vor denen Jakob sich tot stellte, als auch die afrikanischen Krokodile, denen Jakob davonlief, waren gerade Mutter geworden und deshalb noch gefährlicher als sowieso schon.
Das Erste, sagte mein Vater, was ich ihm von Jakob erzählt hätte, sei, dass er gerne in einem Zelt leben würde. »Stell dir vor, in einem Zelt!«, hätte ich entrüstet gesagt, und dass ich eine sei, die am liebsten in einem großen freistehenden Eigenheim mit Fensterläden wohnen wolle.
Am Ende ihrer Rede sagte Jakobs Mutter, dass Jakob und ich füreinander abenteuerlich im besten Sinne seien. Jakob flüsterte: »Pass auf, gleich kommt eine Metapher«, und Jakobs Mutter sagte, ich sei für Jakob das Haus mit Fensterläden, das er sich nie getraut habe, und Jakob sei für mich das Zelt, das ich mich nie getraut habe.
Jakobs winzige Großmutter, die gläsern aussah und etwas unverständlich sprach, weil sie samt ihrer Stimmbänder hundertzweieinhalb Jahre alt war, erhob sich und sagte, wir seien das harmonischste Paar, das sie jemals gesehen habe. Dann fing sie an zu weinen, alle applaudierten, Jakob ging zu ihr hin, hob sie hoch wie eine kostbare Vase und setzte sie auf seinen Schoß. Dort saß sie, bis alles zu Ende geredet, gegessen, dargeboten und beklatscht worden war und endlich getanzt werden konnte.
Es wurde viel getanzt auf der Hochzeit, viel durcheinandergetrunken und viel geweint. Jakobs Großmutter hörte nicht auf zu weinen, weil wir ein harmonisches Paar waren, Jakobs Cousinen zweiten Grades weinten, weil sie sich gestritten hatten und nicht wussten, wie sie sich versöhnen sollten, Evelyn weinte, weil sie merkte, dass sie in Bengt verliebt war, ausgerechnet in Bengt, aber Bengt nicht mehr in sie, Jakobs Schwester weinte, als zum zweiten Mal ihr Lieblingslied gespielt wurde, meine Mutter weinte, weil sie das noch erleben durfte, Jakobs Nichte weinte, weil sie in Jakob verliebt war, meine Tante weinte, weil sie nicht mehr in meinen Onkel verliebt war, der Pastor weinte, weil er seine Rede so ergreifend fand, Jakobs Mutter weinte, weil Jakobs Vater das nicht mehr erleben durfte, meine Nichte weinte, weil der Sohn von Jakobs bestem Schulfreund ihr auf den Saum getreten und das neue Kleid zerrissen hatte. Immer stand irgendwer am Rand der Tanzfläche und weinte, aber nur kurz, denn immer kam schnell jemand dazu und tröstete und zog den, der geweint hatte, zurück auf die Tanzfläche, und dann wurde weitergetanzt.
Es wurde auch viel und durcheinander geküsst. Evelyn küsste einen Kieferorthopäden und hoffte, dass Bengt es sähe, aber Bengt sah es nicht, denn Bengt küsste im Schilf meine Patentante, die ihm mit roten Wangen versicherte, dass das nicht gehe und sie viel zu alt für ihn sei. Es ging aber doch. Der durchnässte Pastor versuchte, meine Mutter zu küssen, aber das ging nicht. Meine Nichte küsste den, der ihr auf den Saum getreten war, und Evelyn küsste nach dem Kieferorthopäden Jakobs angeheirateten geschiedenen Onkel.
Im Morgengrauen waren einige weg, einige schliefen an oder auf oder unter einem Tisch, einige unterhielten sich leise oder tanzten Stehblues ohne Musik. Jakob, Evelyn und ich gingen zum Bootssteg und legten uns dort hin, mein Kopf lag auf Jakobs Bauch, Evelyns Kopf auf meinem Bauch. Die Lampions über uns stießen im Nachtwind sachte aneinander, im Schilf quakten die Frösche, ein angeleintes Ruderboot schaukelte auf dem See. Evelyn richtete sich auf, nahm den letzten Schluck aus einer Wodkaflasche, die sie seit einiger Zeit nicht mehr aus der Hand gab, und guckte mit vorgestülpter Unterlippe auf das Boot. Evelyn war sehr betrunken. »Jede Begegnung eines Menschen mit einem anderen Menschen«, sagte sie und hob den Zeigefinger in die Luft, »ist die Begegnung eines leeren Bootes mit einem anderen leeren Boot.« Evelyn war vor einiger Zeit mit einem Buddhisten zusammen gewesen.
Jakob lachte, Evelyn ließ sich nach hinten kippen, fiel mit dem Kopf zurück auf meinen Bauch, murmelte noch etwas von Bengt und Boot und leer und sternhagelvoll und schlief dann ein.
Das siebenjährige und übernächtigte Kind von Jakobs französischem Studienfreund kam angelaufen und wünschte Jakob und mir ein Frohes neues Jahr, es hatte uns das schon mehrfach gewünscht, es war das Einzige, was es auf Deutsch wünschen konnte. »Danke sehr«, sagten wir. Das übernächtigte Kind setzte sich neben uns und ließ Steine über das Wasser springen. Jakob strich mit den Fingerkuppen über mein Schlüsselbein, hin und her, alles war jetzt ruhig, ich hörte nur das Quaken der Frösche, kleine Wellen, das Springen der Steine, die Geräusche in Jakobs Bauch. Ich hob Evelyns Kopf an, drehte mich auf die Seite, legte Evelyns Kopf auf meine Hüfte, die Augen fielen mir langsam zu. Bevor ich einschlief, hörte ich noch, wie Jakob in mein Ohr flüsterte: »Das haben wir gut gemacht«, und ich sah noch, dass auf der gegenüberliegenden Seite des Sees jemand stand und rauchte, jemand, den ich nur schemenhaft sehen konnte. Bestimmt war es ein vereinzelter Hochzeitsgast oder ein Angler, ich weiß genau, dass es nicht Blank gewesen sein kann, allein schon, weil er nie geraucht hat, trotzdem stelle ich mir manchmal vor, dass es Blank war, der da stand und rauchte und von der gegenüberliegenden Seite des Sees zu Jakob und mir herübersah. Ich stelle es mir vor, weil ich wünschte, Blank könnte sagen: »Ich weiß es ja, ich weiß es, ich war dabei, ich habe es gesehen.«
Jakobs Lieblingstante hatte uns zur Hochzeit einen eineinhalb Meter hohen pinkfarbenen Flamingo aus Porzellan geschenkt. Sein geschwungener Hals sah aus wie ein halbes Herz, er stand auf einem Bein, hatte das andere angewinkelt und spreizte seinen rechten Flügel. Die Tante hatte den Flamingo ironisch gemeint, aber das machte ihn nicht kleiner. Jakob wollte ihn sofort wegwerfen, bereits auf der Rückfahrt von der Hochzeit wollte er ihn auf einer Landstraße aussetzen. Jakob saß auf dem Beifahrersitz und hatte den Flamingo zwischen den Beinen. Auf der Rückbank war kein Platz mehr gewesen, sie war bereits voller sperriger Geschenke. Just Married, stand auf der Heckscheibe hinter den aufgetürmten Geschenken, Jakobs Mutter hatte das mit einem goldenen Lack dahin gesprüht, von dem niemand wusste, ob er jemals wieder abgehen würde.
Ich fand, dass wir den Flamingo nicht aussetzen dürften, weil man Geschenke, zumal Geschenke von Nahestehenden, die man liebt, auf jeden Fall behalten müsse. »Auch, wenn man unter den Geschenken leidet?«, fragte Jakob.
Der rechte Flügel des Flamingos lag auf Jakobs Knie, der Kopf auf seiner Schulter. Jakob versuchte, sich an dem Flamingo vorbei Pflaster auf seine Füße zu kleben, die die ganze Hochzeit über in neuen Schuhen gesteckt hatten.
»Darunter leiden ist ein bisschen übertrieben, in dem Fall, oder?«, fragte ich, »außerdem liebst du deine Tante doch.«
»Ich liebe meine Tante, aber ihre Geschenke liebe ich nicht. Und wenn man sich liebt, kann man sich ja wohl die Wahrheit sagen.«
»Natürlich«, sagte ich, »aber nicht, wenn die Wahrheit vollkommen überflüssig ist und deiner Tante nur wehtun würde.«
»Mir tut aber dieser vollkommen überflüssige Flamingo weh«, sagte Jakob und schob den Kopf des Flamingos zur Seite, der sich immer wieder an seinen Hals schmiegte.
»Vielleicht geht er ja bald kaputt, er sieht ziemlich teuer aus«, sagte ich, weil beim Porzellan das besonders teure besonders zerbrechlich ist.
»Wir stellen ihn in den Keller«, sagte Jakob.
»Und wenn deine Tante zu Besuch kommt?«
»Dann holen wir ihn hoch.«
»Und wenn sie spontan kommt?«
Jakobs Tante kam oft zu Besuch, und sie besuchte sowohl mich als auch Jakob gerne spontan.
Jakob hatte seine Füße fertig verpflastert, beugte sich zu mir herüber und küsste mich. »Nimm du ihn«, sagte er.
Wir stellten den Flamingo in mein Wohnzimmer. Jakob versuchte, es wie einen Unfall aussehen zu lassen. Mehrmals wöchentlich rempelte er den Flamingo an, er trat oder lehnte sich wie zufällig dagegen, aber selbst, wenn der Flamingo umfiel, blieb er unversehrt.
»Stellen wir ihn in den Garten«, schlug Jakob vor, »das wird ihn mürbe machen.« Wir trugen den Flamingo hinunter. Jakob stellte ihn hinter eine Tanne, weil man ihn da am wenigsten sah. »Hinter der Tanne ist er zu geschützt«, sagte ich und stellte den Flamingo schutzlos in die Mitte des Gartens, »wir müssen ihn der Witterung aussetzen.«
Wir gingen wieder nach oben und schauten aus dem Fenster hinunter. Der Flamingo hob sein Bein jetzt gut sichtbar mitten in einem Blumenbeet. »Hoffentlich geht es schnell«, sagte Jakob. Es ging aber nicht schnell. Der Flamingo ging über zwei Jahre lang nicht kaputt.
Als im Herbst zahlreiche Kastanien vom Baum herabsausten und den Flamingo verfehlten, bekamen fast alle Mitarbeiter in Bengts Übersetzungsagentur eine Grippe, nur Evelyn und ich blieben übrig. Bengt nahm Evelyns Tabletten für Schlaflosigkeit, hüpfte nervös um unsere Schreibtische herum und fragte immer wieder, ob es vielleicht auch etwas schneller gehe. Nachdem ich die vierte Nacht durchübersetzt hatte, beschloss Jakob, nach Dienstschluss heimlich mit zu übersetzen. »Das ist Betrug«, sagte ich. »Das ist ein Notfall«, sagte Jakob, »und Englisch kann schließlich jeder.« Er übersetzte mehrere Nächte lang Broschüren und Werbeslogans, steckte mir morgens die Texte zu, und als ich Bengt Jakobs Übersetzungen vorlegte, sagte er, es sei schon erstaunlich, dass ausgerechnet ich plötzlich so viele Flüchtigkeitsfehler machte, aber es freue ihn zu sehen, dass ich mutiger werde und mir nun auch freiere und kreativere Übersetzungen zutraue.
Als im Winter das Nachbarskind einen Schneeflamingo neben unseren zu bauen versuchte und jedes Mal spätestens am Hals und am Spielbein scheiterte, starb Jakobs Schwester an einem besonders hastigen Krebs. Bevor sie starb, lag sie eine Woche auf der Intensivstation. Jakob saß Tag und Nacht auf einem Hocker an ihrem Bett, hielt ihre Hand und weinte, als käme jetzt all die Flüssigkeit heraus, die seinen Augen immer gefehlt hatte. Ich stand hinter Jakob, um ihn aufzufangen, weil er vor Erschöpfung immer wieder einnickte. Wenn er eingenickt war, hielt ich mit einem Arm seinen Oberkörper fest, mit der anderen Hand seinen Kopf, so hielt ich ihn auch fest, als er bei der Beerdigung laut weinend auf die Sargträger losging.
Als sich im verregneten Frühling eine Pfütze auf dem Rücken des Flamingos bildete, in der ab und zu eine Amsel badete, flog Jakob für drei Monate nach Amerika. Wir schrieben uns täglich. Ich zählte die Tage. Wenn ich auf dem Wochenmarkt war, dachte ich: »Noch sechs Mal Wochenmarkt, dann kommt Jakob zurück.« Wenn ich im Supermarkt war und Verfallsdaten kontrollierte, dachte ich: »Wenn dieser Käse abläuft, ist Jakob wieder da«, und irgendwann war es nur noch zweimal Wochenmarkt, irgendwann reichte das Ablaufdatum von Butter, dann das von Joghurt, dann das von frischer Milch, und als die Sonne dafür sorgte, dass der Flamingo ausbleichte und stellenweise nicht mehr pinkfarben war, sondern ins Altrosa spielte, kam Jakob zurück. Er brachte Geschenke und Geschichten mit, Jakob hatte viel erlebt, er hatte ganz und gar unvorbereitet Vorträge über Zahnprothesen gehalten, er war auch in amerikanischen Nationalparks mehrfach in Gefahr geraten, und ich erschrak, weil mir erst jetzt auffiel, wie wenig ich erlebt hatte, ich hatte, weil ich hauptsächlich mit dem Warten auf Jakobs Rückkehr beschäftigt gewesen war, nur das Nötigste erlebt.
Als im nächsten Winter eine dünne Schneedecke auf dem gespreizten Flamingoflügel lag, gab es eine Rattenplage. Die Ratten kamen von der Straße in den Keller, nachts hörte man sie quieken. Ich machte die Wohnungstür immer nur so weit auf, dass ich mich hinaus- oder hineinquetschen konnte, und ich schloss sie immer schnell. »Die kommen nicht bis in die Wohnung«, sagte Jakob, »keine Ratte schafft vier Treppen.«
»Weißt du das sicher?«, fragte ich.
»Nein, aber es ist abwegig.«
»Das ist kein Argument«, sagte ich.
Als ich eines Abends den Backofen öffnete, um eine Pizza hineinzuschieben, saß im Backofen eine Ratte und sah mich an. Wir befanden uns auf Augenhöhe. Ich schloss die Backofentür, nahm meine Tasche und ging aus der Wohnung. »Ich gehe da nicht mehr rein«, sagte ich zu Jakob. »Ich weiß«, sagte er.
Ich ging nie wieder in die Wohnung. Jakob packte mit Freunden ein Wochenende lang meine Kisten, abends massierte ich seine Schultern. Eines Abends dachte ich, während ich Jakobs Schultern massierte, dass dies im Grunde ein guter Moment wäre, um vielleicht doch zusammenzuziehen. Jakob nahm meine Hand von seiner Schulter und küsste sie. »Ich ziehe nicht zusammen, Liebste«, sagte er, »falls du gerade darüber nachdenkst«, und ich sagte: »Jakob, du bist vollkommen verknotet und verspannt.«
Als wir die Kisten in den Lieferwagen packten, um sie in meine neue Wohnung zu bringen, sagte Jakob: »Der Flamingo. Das ist eine günstige Gelegenheit.« Wir waren müde und fanden, wir hätten das Geschenk jetzt lange genug behalten, und da auch Jakob jetzt fand, dass man, wenn man sich liebt, überflüssige Wahrheiten für sich behalten sollte, vor allem dann, wenn es für die überflüssige Wahrheit Jahre zu spät ist, beschlossen wir, Jakobs Tante zu sagen, der Flamingo sei beim Umzug kaputtgegangen, so gründlich, dass man ihn nicht mehr kleben könne. Wir ließen den Flamingo im Garten stehen, wir drehten uns nicht einmal nach ihm um.
Zwei Tage später rief mein ehemaliger Hausverwalter an. Jakob und ich lagen im Bett, in meiner neuen Wohnung zwischen unausgepackten Kisten, es war unangenehm, nackt mit einem Hausverwalter zu telefonieren.
»Da steht noch Ihr Vogel im Garten«, sagte der Hausverwalter.
»Der Vogel, ja«, sagte ich, »den holen wir noch ab.«
»Da würde ich dringend drum bitten«, sagte der Hausverwalter.
Jakob schlang von hinten die Arme um mich. »Werfen Sie ihn weg«, sagte er in das Telefon an meinem Ohr.
»Dazu bin ich nicht befugt«, sagte der Hausverwalter, »außerdem muss der auf den Sperrmüll.«
»Zerhacken Sie ihn«, sagte Jakob, »dann passt er in den Hausmüll.«
»Dazu bin ich nicht befugt«, sagte der Hausverwalter, »zerhacken Sie ihn doch selber.«
»Wir sind dazu auch nicht befugt«, sagte Jakob.