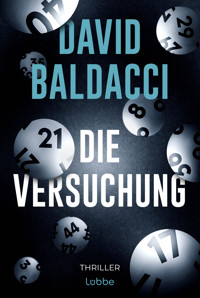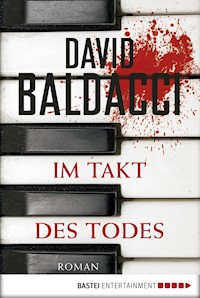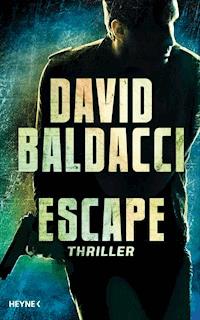Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sean King & Michelle Maxwell
- Sprache: Deutsch
Routiniert und mit einem atemberaubenden Spannungsbogen führt David Baldacci sein bewährtes Ermittlerduo Michelle Maxwell und Sean King durch die anfangs undurchsichtigen Zusammenhänge dieses Thrillers, der sich auf höchster gesellschaftlicher Ebene abspielt. In ihrem vierten Fall stolpern die beiden Privatdetektive fast zufällig in eine Katastrophe, die als fröhliche Geburtstagsfeier einer Zwölfjährigen beginnt: Am selben Abend noch wird das Geburtstagskind entführt. Und die kleine Willa ist nicht irgendein Mädchen - sie ist die Nichte des Präsidenten.
Grausiger Leichenfund und blutige Rätsel
Als die Ermittler Sean King und Michelle Maxwell im Haus der Familie eintreffen, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens: Die Mutter der Kleinen liegt mit aufgeschlitzter Kehle auf dem Boden - und offensichtlich haben die Täter der Leiche Blut entnommen. Doch wer hat ein Interesse an diesem Blut, und was hat Willa damit zu tun? Im Laufe ihrer Ermittlungen dringen die Detektive immer weiter in ein Netz aus dubiosen Machenschaften ein, die es aufzuschlüsseln gilt.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 31 min
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
Danksagungen
David Baldacci, geboren 1960, war Strafverteidiger und Wirtschaftsanwalt, ehe er 1996 mit DER PRÄSIDENT seinen ersten Roman veröffentlichte, der sofort zum Bestseller wurde. Auch alle seine folgenden Romane waren weltweit regelmäßig unter den Top Ten der Bestsellerlisten zu finden. Nach IM BRUCHTEILDER SEKUNDE, MITJEDEM SCHLAGDER STUNDE und IM TAKTDES TODESist dies der vierte Band in der Serie um das Ermittlerduo Michelle Maxwell und Sean King. David Baldacci lebt mit seiner Familie in der Nähe von Washington, D. C.
David Baldacci
BISZUMLETZTENATEMZUG
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch vonRainer Schumacher
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2009 by Columbus Rose, Ltd.
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »First Family«
Originalverlag: Grand Central Publishing, Hachette Book Group
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2011 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: Trevillion Picture Library
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
Datenkonvertierung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-0248-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Meiner Mom,
meinem Bruder und meiner Schwester -
für all ihre Liebe.
Prolog
Ihre Schritte waren bedächtig. Die Straße hinunter, dann nach links, zwei Querstraßen entlang, dann nach rechts. An einer Abzweigung legte sie eine kurze Pause ein; an der nächsten machte sie einen längeren Halt. Aber das war reine Gewohnheit, denn ihr inneres Radar zeigte keine Gefahr an. Sie beschleunigte ihre Schritte. Es waren noch ziemlich viele Passanten auf der Straße, obwohl es spät war, aber die Leute sahen sie nicht. Sie schien wie eine Brise an ihnen vorbeizuwehen - man fühlte sie, ohne sie sehen zu können.
Das dreistöckige Gebäude war dort, wo es immer gewesen war, wie festgekeilt zwischen einem Hochhaus zur Linken und einem Rohbau zur Rechten. Natürlich gab es Sicherheitseinrichtungen, aber die waren nicht der Rede wert. Einen Anfänger würden sie nur ein paar Minuten aufhalten, für einen Profi waren sie ein Witz.
Sie suchte sich ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes aus, statt durch die Vordertür einzubrechen. Diese Einstiegspunkte waren fast nie verkabelt. Sie legte den Riegel um, schob das Fenster hoch und wand sich hindurch. Die Bewegungssensoren hatte sie rasch hinter sich gelassen, aber dann wurde sie doch nervös: Sie war jetzt sehr nahe am Ziel, und das jagte ihr eine Heidenangst ein, auch wenn sie es nie zugegeben hätte.
Der Aktenschrank war verschlossen. Ein Lächeln stahl sich auf ihr Gesicht.
Du machst mir ganz schön Arbeit, Horatio.
Fünfzehn Sekunden später glitt die Schublade auf. Ihre Finger huschten über die Rücken der Aktenmappen. Genau in der Mitte hielt sie inne - dort, wo sie es nie erwartet hätte. Es war eine dicke Akte, aber damit hatte sie gerechnet. Sie zog die Akte heraus und blickte zum Kopierer.
Okay, dann los.
Horatio Barnes war ihr Psychiater. Vor einiger Zeit hatte er sie überredet, in eine Klinik zu gehen. Doch durch diese freiwillige Einkerkerung war aber nur ein einziges Rätsel gelöst worden, und das hatte nichts mit ihren Problemen zu tun. Später hatte Horatio sie hypnotisiert und in die Kindheit zurückgeführt; jeder Seelenklempner, der sein Geld wert war, tat das früher oder später. Die Sitzung hatte offenbar viele Dinge zutage gefördert. Das Problem war nur, dass Horatio beschlossen hatte, ihr nicht alles zu sagen, was sie ihm enthüllt hatte. Und nun war sie hier, um dieses Versäumnis zu korrigieren.
Sie legte die Seiten in den Papiereinzug des Kopierers und drückte den Knopf. Eins nach dem anderen huschten die Ereignisse ihres Lebens durch das Gerät. Und mit jedem Blatt Papier, das in die Ablage geworfen wurde, ging ihr Puls schneller.
Schließlich steckte sie die Originalakte wieder in die Schublade und band die Kopie mit einem Gummiband zusammen. Ruhig ging sie zu ihrem SUV zurück, erneut so unsichtbar wie eine Brise. Um sie her wogte das Nachtleben, doch niemand sah sie.
Sie stieg in ihren Wagen, ließ den Motor an. Ihre Hände legten sich um das Lenkrad. Sie hatte es schon immer geliebt, die Kraft der Achtzylindermaschine zu spüren, wenn sie über unbekannte Straßen raste. Doch als sie nun durch die Windschutzscheibe blickte, wollte sie nichts Unbekanntes mehr, nichts Neues. Sie wollte, dass alles wieder so wurde wie früher.
Sie blickte auf die Akte, sah den Namen auf der ersten Seite.
Michelle Maxwell.
Für einen Augenblick schien es ein fremder Name zu sein: Auf den kopierten Seiten standen das Leben, die Geheimnisse und die Qualen eines anderen. Probleme. Was für ein furchtbares Wort. Dabei klang es so harmlos. Probleme. Jeder hatte Probleme.
Der hubraumstarke Motor des SUV bollerte im Leerlauf und blies Kohlendioxid in eine Atmosphäre, die ohnehin schon voll davon war. Ein paar dicke Regentropfen klatschten auf die Windschutzscheibe. Michelle sah, wie die Leute schneller gingen, um dem drohenden Wolkenbruch zu entfliehen. Eine Minute später war das Unwetter da. Michelle spürte, wie der Wind an ihrem SUV rüttelte. Ein greller Blitz, krachender Donner. Die Heftigkeit des Unwetters ließ darauf schließen, dass es nicht lange anhalten würde. Eine solch verschwenderische Gewalt hatte sich bald erschöpft, die Energie war rasch aufgebraucht.
Michelle stellte den Motor ab, griff nach den Kopien, riss das Gummiband herunter und begann zu lesen. Zuerst allgemeine Informationen: Geburtsdatum, Geschlecht, Bildungsweg, berufliche Laufbahn. Michelle blätterte weiter. Da stand nichts, was sie nicht schon wusste. Aber das war keine Überraschung. Schließlich ging es hier um sie.
Als Michelle auf die fünfte Seite der mit Maschine geschriebenen Notizen blickte, zitterten ihre Hände. Die Kopfzeile lautete: »Kindheit - Tennessee«. Sie schluckte mit trockenem Mund, hustete, rang nach Luft, und das machte es noch schlimmer. Der Speichel gerann ihr im Mund, so wie damals, als sie bei der Ruderregatta beinahe an Erschöpfung gestorben wäre. Das Rennen hatte ihr eine Silbermedaille eingebracht, die ihr mit jedem Tag weniger bedeutet hatte.
Michelle griff nach einer Flasche Mineralwasser und trank. Dabei tropfte Wasser auf die Kopien. Michelle fluchte und wischte so wütend über das Papier, dass sie es beinahe zerriss. Tränen liefen ihr über die Wagen, ohne dass sie den Grund dafür wusste. Sie hob das eingerissene Papier dicht vor die Augen, konnte die Schrift aber nicht mehr entziffern und schaute aus dem Wagen in die dichten Regenschleier. Das Unwetter hatte die Leute vertrieben; die Straßen waren leer.
Michelle richtete den Blick wieder auf die Seiten, aber da war nichts mehr. Natürlich standen die Worte immer noch da, nur konnte Michelle sie nicht sehen.
»Du schaffst es«, feuerte sie sich selbst an. »Du kriegst das hin.«
Michelle riss sich zusammen, konzentrierte sich.
»Kindheit ... Tennessee«, begann sie.
Sie war wieder sechs Jahre alt und lebte mit ihren Eltern in Tennessee. Ihr Dad war Polizeibeamter auf dem Weg nach oben, und ihre Mom war ... nun, ihre Mom. Michelle hatte vier ältere Brüder, die damals alle schon ausgezogen waren. Nur noch die kleine Michelle war zu Hause gewesen.
Mit einem Mal fand sie sich wieder zurecht. Die Worte waren klar, und auch die Bilder wurden deutlicher, je tiefer sie in diesen abgeschiedenen Winkel ihrer Erinnerungen kroch. Als sie umblätterte und ihr Blick auf das Datum fiel, war es, als hätte ein Blitz es in ihr Inneres eingebrannt. Eine Milliarde Volt Schmerzen und ein gequälter Schrei, den man beinahe sehen und fühlen konnte.
Michelle starrte aus dem Fenster. Es goss jetzt wie aus Eimern. Die Straßen waren immer noch leer.
Nein, doch nicht ... Als sie die Augen zusammenkniff, sah sie einen großen Mann, der ohne Schirm und Mantel im strömenden Regen stand. Er war durchnässt. Hemd und Hose klebten ihm auf der Haut. Er starrte Michelle an, sie starrte zurück. Weder Furcht noch Hass oder Mitgefühl waren im Blick des Mannes zu erkennen, als er sie durch den Regen hindurch beobachtete. Nur eine unterschwellige Traurigkeit, die zu Michelles Verzweiflung passte.
Michelle ließ den Motor an, legte den Gang ein und trat aufs Gaspedal. Als sie an dem Mann vorbeischoss, schaute sie zu ihm. Ein Blitz zuckte und machte die Nacht einen Wimpernschlag lang zum Tag. In der Explosion aus grellem Licht und krachendem Donner waren ihrer beider Bilder wie eingefroren, als sie einander anschauten.
Sean King sagte kein Wort. Er versuchte auch nicht, Michelle aufzuhalten. Er stand einfach da, das nasse Haar in der Stirn. Doch sein Blick war so eindringlich, wie Michelle es noch nie gesehen hatte. Es machte ihr Angst. Seans Blick schien ihr die Seele aus dem Leib reißen zu wollen.
Eine Sekunde später war Michelle um die Ecke gebogen und verlangsamte das Tempo. Sie ließ das Seitenfenster herunter, stoppte neben einem Mülleimer und warf die Kopien hinein.
Augenblicke später war ihr SUV im Unwetter verschwunden.
1.
Luftschlangen und Maschinengewehre. Funkelnde Löffel gruben sich in cremige Leckereien, während schwielige Finger sich um stählerne Abzugsbügel legten. Fröhliches Lachen, als Geschenke ausgepackt wurden, begleitet vom bedrohlichen Peitschen eines landenden Helikopters.
Die Anlage war vom Verteidigungsministerium offiziell der Marine-Nachschubbasis in Thurmont zugeteilt, doch die meisten Amerikaner kannten sie als Camp David. Aber egal, welchen Namen man benutzte, es war kein normaler Ort für einen Kindergeburtstag. Ursprünglich ein Erholungslager, das zur Zeit der Großen Depression erbaut worden war, diente die Anlage seit Jahrzehnten als Landsitz der US-Präsidenten. Franklin D. Roosevelt hatte ihn »ShangriLa« getauft, denn er hatte den Platz der Präsidentenjacht eingenommen. Seinen heutigen, weniger exotischen Namen hatte das Anwesen von Dwight D. Eisenhower bekommen, der ihm den Namen »Camp David« gegeben hatte, nach seinem Enkel. Das einhundertdreißig Morgen große, ländliche Areal bot Möglichkeiten für die verschiedensten Freizeitaktivitäten. Es gab Tennisplätze, Wanderwege und genau ein Übungsloch für präsidiale Golfer.
Die Geburtstagsparty fand im Bowling Center statt. Ein Dutzend Kinder waren eingeladen, begleitet von ihren Gouvernanten. Natürlich waren alle aufgeregt; schließlich befanden sie sich auf heiligem Boden, über den schon Kennedy und Reagan gewandelt waren.
Die Chefgouvernante und Organisatorin war Jane Cox - eine Rolle, an die gewöhnt war; schließlich war sie die First Lady der Vereinigten Staaten. Jane, das schulterlange braune Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden, trug den Geburtstagskuchen höchstpersönlich nach draußen und gab obendrein die Vorsängerin beim »Happy Birthday« für ihre Nichte, Willa Dutton. Willa war ziemlich klein für ihr Alter und ungewöhnlich einnehmend, hatte man sie erst einmal kennengelernt. Jane würde es niemals zugeben, aber Willa war ihre Lieblingsnichte.
Die First Lady aß keinen Kuchen, denn sie musste auf ihre Figur achten. Seit ihrem Einzug ins Weiße Haus hatte sie ein paar Pfund zugelegt - wie bereits während des Höllenritts, den man Wahlkampf nannte, denn ihr Mann kandidierte für eine zweite Amtsperiode. Jane maß gut eins siebzig und war somit groß genug, dass sie Designermode tragen konnte und gut darin aussah. Ihr Mann wiederum war knapp unter eins achtzig, weshalb Jane auf allzu hohe Absätze verzichtete, damit der Präsident nicht kleiner aussah als sie. Der äußere Schein war sehr wichtig in der Politik.
Janes Gesicht war leidlich attraktiv - zumindest nach eigener Einschätzung, wann immer sie einen Blick in den Spiegel warf. Natürlich waren die Falten einer Frau zu sehen, die mehrere Geburten und Wahlkämpfe hinter sich hatte. So etwas hinterließ bei jeder Frau Spuren, und wenn man als First Lady eine Schwäche zeigte, und sei sie noch so klein, stürzte die Gegenseite sich unweigerlich darauf und schlachtete es aus. Doch der Großteil der Presse bezeichnete Jane immer noch als attraktiv. Einige schossen sogar übers Ziel hinaus und behaupteten, sie sähe aus wie ein Hollywoodstar. Früher hatte das vielleicht gestimmt, jetzt nicht mehr. Inzwischen war sie definitiv vom Vamp zur Charakterdarstellerin reiferen Alters geworden. Aber ein straffes Gesicht und ein knackiger Hintern standen ohnehin schon lange nicht mehr auf Janes Prioritätenliste.
Während der Party schaute sie immer wieder zum Fenster hinaus und blickte auf die finster dreinschauenden Marineinfanteristen, die draußen mit schussbereiten Waffen patrouillierten. Natürlich hatte der Secret Service das Präsidentenehepaar hierher begleitet, doch offiziell war Camp David noch immer eine Marinebasis. Deshalb bestand das gesamte Personal, vom Tischler bis zum Gärtner, aus Angehörigen der Seestreitkräfte, und für die Sicherheit sorgten größtenteils die Ledernacken, die hier stationiert waren. Camp David war besser bewacht als das Weiße Haus, auch wenn es nur wenige Leute gab, die das offiziell eingestehen würden.
Doch mit Sicherheitsfragen beschäftigte Jane sich nicht. Stattdessen schaute sie gutgelaunt zu, wie Willa das Dutzend Kerzen auf ihrer zweistöckigen Torte auspustete und anschließend half, die Kuchenstücke zu verteilen. Jane umarmte Willas Mutter, die große, schlanke, rot gelockte Pam Dutton.
»Willa sieht glücklich aus«, sagte Jane.
»Bei ihrer Tante Jane ist sie immer glücklich«, erwiderte Pam und tätschelte ihrer Schwägerin liebevoll den Rücken. »Ich kann dir gar nicht genug danken, dass du uns die Party hier feiern lässt, zumal Dan ... ich meine, der Präsident, ja nicht einmal hier ist.«
Da sie keine Blutsverwandte war, empfand Pam es noch immer als unangenehm, ihren Schwager beim Vornamen zu nennen, während die Geschwister des Präsidenten und auch Jane ihn häufig »Danny« nannten.
Jane lächelte. »Dem Gesetz nach haben Präsident und First Lady die gleichen Rechte, was Staatseigentum betrifft. Und für die Finanzen der Familie bin immer noch ich verantwortlich.« Sie lachte. »Danny kann nicht gut mit Zahlen umgehen.«
»Trotzdem, es war sehr aufmerksam von dir.« Pam schaute zu ihrer Tochter hinüber. »Nächstes Jahr ist sie ein Teenager. Meine Güte, meine Älteste ein Teenager! Kaum zu glauben.«
Pam hatte drei Kinder. Die zwölfjährige Willa, den zehnjährigen John und die siebenjährige Colleen. Jane hatte ebenfalls drei Kinder, doch sie waren älter. Ihr neunzehnjähriger Sohn besuchte bereits ein College, und ihre Tochter arbeitete als Krankenschwester in Atlanta. Der zweite Sohn, altersmäßig zwischen seinen Geschwistern, wusste noch nicht, was er mit seinem Leben anfangen sollte.
Die Cox hatten früh eine Familie gegründet. Jane war erst achtundvierzig, und ihr Mann hatte kürzlich seinen fünfzigsten Geburtstag gefeiert.
Jane sagte: »Jungen bringen einem das Herz durcheinander, Mädchen den Kopf.«
»Ich weiß nicht, ob mein Kopf für Willa bereit ist.«
»Du darfst die Verbindung nie abreißen lassen. Du musst immer wissen, wer ihre Freunde sind. Beobachte, was um sie herum vorgeht. Manchmal wird sie sich zurückziehen, aber das ist normal. Willa ist intelligent, und sie wird einmal sehr hübsch. Sie wird sich über dein Interesse freuen.«
»Das ist ein guter Rat, Jane. Schön, dass ich immer auf dich zählen kann.«
»Tut mir leid, dass Tuck es nicht geschafft hat.«
»Er sollte morgen wieder hier sein, aber du kennst ja deinen Bruder.«
Jane blickte Pam besorgt an. »Wird schon schiefgehen.«
Als Pam davonging, schaute Jane zu Willa hinüber. Das Mädchen verkörperte eine Mischung aus fraulicher Reife und kindlicher Naivität. Sie konnte besser schreiben als die meisten Erwachsenen und über Themen diskutieren, die Ältere in Erstaunen versetzten. Doch wer sie beobachtete, konnte sehen, wie kleinmädchenhaft sie kicherte, und dass sie das andere Geschlecht gerade erst entdeckte - mit einer Mischung aus Scheu und Interesse, wie bei vielen Mädchen ihres Alters.
Die Party neigte sich dem Ende zu, und die Gäste verabschiedeten sich. Jane Cox stieg in den Helikopter. Er war nicht als »Marine One« gekennzeichnet, denn der Präsident war nicht an Bord. An diesem Tag beförderte er nur die B-Mannschaft, was Jane ganz recht war. Privat waren sie und ihr Mann gleichgestellt, doch in der Öffentlichkeit ging sie stets die obligatorischen zwei Schritt hinter ihm.
Jane schnallte sich an, und ein uniformierter Marine warf die Tür zu. Vier Agenten des Secret Service begleiteten Jane. Der Helikopter hob ab. Nach wenigen Sekunden schaute Jane auf Camp David hinunter, den »Vogelkäfig«, wie der Codename des Secret Service lautete. Der Helikopter flog nach Süden. In dreißig Minuten würden sie auf dem Rasen vor dem Weißen Haus landen.
In der Hand hielt Jane ein Blatt Papier, das Willa ihr kurz vor dem Ende der Party in die Hand gedrückt hatte. Es war ein Dankbrief. Jane lächelte. Der Brief war in der Sprache eines reifen Menschen geschrieben und war beinahe ein Musterbeispiel für Etikette.
Jane faltete den Brief zusammen und steckte ihn weg. Der Rest des Tages und der Abend würden nicht so angenehm verlaufen. Die Pflicht rief. Jane hatte längst gelernt, dass das Leben der First Lady einer unablässig auf Hochtouren laufenden Maschine glich.
Der Helikopter setzte auf. Da der Präsident nicht an Bord war, gab es keinen Salut, als Jane zum Weißen Haus ging. Sie wusste, ihr Mann war im Büro neben dem Oval Office, das fast ausschließlich für zeremonielle Zwecke genutzt wurde. Doch Jane hatte mehrere Forderungen gestellt, als sie sich bereit erklärt hatte, ihren Mann beim Präsidentschaftswahlkampf zu unterstützen. Eine dieser Forderungen war gewesen, jederzeit ins Allerheiligste zu dürfen, ohne sich vorher anmelden zu müssen.
»Ich bin keine Besucherin«, hatte sie damals zu ihrem Mann gesagt. »Ich bin deine Frau.«
Jane trat auf den so genannten »Body Man« zu, offiziell der persönliche Assistent des Präsidenten, der vor dem Oval Office stand. Der Body Man sorgte dafür, dass der Präsident seinen Terminplan einhielt und mit höchstmöglicher Effektivität arbeiten konnte. Zu diesem Zweck stand er vor Sonnenaufgang auf und widmete jeden Augenblick seines Wachseins den Bedürfnissen des Präsidenten - lange, bevor der Präsident wusste, was für Bedürfnisse das eigentlich waren.
»Sorgen Sie dafür, dass der Präsident und ich ungestört sind, Jay«, sagte Jane zu ihm. »Ich gehe jetzt zu ihm rein.«
Sofort wich Jay zur Seite.
Jane verbrachte ein paar Minuten mit dem Präsidenten und erzählte ihm von der Geburtstagsparty. Dann ging sie in den Wohntrakt, um sich frisch zu machen und sich umzuziehen, denn später gab sie einen Empfang. Als der Tag endete, zog Jane sich in ihr »offizielles« Heim zurück, trat sich die Schuhe von den Füßen und gönnte sich einen Becher heißen Tee.
Zwanzig Meilen entfernt schrie Willa Dutton, das zwölfjährige Geburtstagskind, ihre Angst und ihr Entsetzen hinaus.
2.
Sean schaute während der Fahrt zu Michelle hinüber. Es war ein kurzer, abschätzender Blick. Falls Michelle ihn bemerkt hatte, sagte sie nichts. Stattdessen blickte sie stur nach vorn.
»Wann hast du die Frau kennengelernt?«, fragte sie.
»Als ich noch als Bodyguard gearbeitet habe. Wir sind in Verbindung geblieben. Eine nette Familie.«
»Hm«, machte Michelle und schaute weiter nach vorn.
»Warst du in letzter Zeit mal bei Horatio?«
Michelle verstärkte den Griff um den Kaffeebecher. »Warum bist du mir zu seiner Praxis gefolgt?«
»Weil ich wusste, was du vorhast.«
»Und was?«
»Du bist eingebrochen, um herauszufinden, was du ihm unter Hypnose erzählt hast.«
Michelle schwieg.
»Hast du es herausgefunden?«, hakte Sean nach.
»Es ist schon ziemlich spät, um jemanden zu Hause zu besuchen.«
»Weiche mir nicht aus, Michelle. Wir müssen darüber reden.«
»Du hast meine Frage nicht beantwortet«, sagte sie.
»Du meine auch nicht.«
»Sag schon: Warum fahren wir so spät zu diesem Haus?«
»Vielleicht geht es um einen Auftrag, den wir übernehmen sollen.«
»Deine nette Familie braucht einen Privatdetektiv?«
Sean nickte. »Und sie wollte nicht warten.«
Sie bogen von der kurvenreichen Landstraße in eine lange, von Bäumen gesäumte Auffahrt ein. Kurz darauf erschien eine Villa im Kolonialstil vor ihnen.
»Nicht übel«, bemerkte Michelle. »Dein Freund scheint ja ganz gut zurechtzukommen.«
»Regierungsaufträge. Offenbar gibt der Staat das Geld mit vollen Händen aus.«
»Da wäre ich nie drauf gekommen«, sagte Michelle. »Seltsam, das Haus ist dunkel. Hast du dich in der Uhrzeit geirrt?«
»Bestimmt nicht.« Sean hielt vor dem Haupteingang.
Michelle stellte den Kaffeebecher ab und zog ihre Pistole aus dem Gürtelholster. »Da hat eine Frau geschrien!«
»Warte.« Rasch legte Sean ihr eine Hand auf den Arm. Als Augenblicke später im Inneren des Hauses ein Krachen zu hören war, griff er ins Handschuhfach nach seiner eigenen Pistole. »Verdammt, du hast recht. Sehen wir nach, bevor wir die Cops rufen.«
»Geh du hintenrum, ich nehme die Vorderseite«, sagte Michelle.
Sean nickte, stieg aus und rannte zur Rückseite der Villa. Michelle ließ den Blick in die Runde schweifen. Es waren keine Fahrzeuge zu sehen. Sie huschte zum Vordereingang. Die Schreie und das Krachen waren inzwischen verstummt. Michelle hätte rufen und sich erkundigen können, ob alles in Ordnung sei, hätte damit aber Einbrecher gewarnt, die sich möglicherweise im Haus aufhielten.
Die Vordertür war abgeschlossen. Kaum hatte Michelle die Hand vom Türknauf genommen, krachte es. Die Kugel durchschlug das dicke Holz. Splitter wirbelten durch die Luft. Michelle spürte das Geschoss, als es an ihr vorbeizischte, bevor es in Seans Wagen einschlug.
Sie sprang von der Veranda, rollte sich ab und rannte los. Dabei riss sie das Handy aus der Tasche und wählte die 911. Sofort hob jemand ab. Sie wollte gerade etwas sagen, als das Garagentor aufflog und ein Geländewagen auf sie zuraste. Sie sprang zur Seite, schoss erst auf die Reifen, dann auf die Windschutzscheibe. Das Mobiltelefon flog ihr aus der Hand, als sie sich zu Boden warf und eine Böschung hinunterrollte. Sie landete in einem Haufen Laub und Dreck, sprang auf und blickte nach oben. Der Wagen hatte angehalten, der Beifahrer war ausgestiegen.
Michelle feuerte.
Die Kugel traf den Mann in die Brust, doch das Hartmantelgeschoss schaltete ihn nicht aus. Stattdessen taumelte er zurück, als seine kugelsichere Panzerung die Kugel auffing. Als er sicheren Stand gefunden hatte, hob er seine eigene Waffe.
Michelle warf sich hinter den dicken Stamm einer Eiche, ehe die MP5 des Mannes losratterte. Ein Dutzend Kugeln schlugen in den Baum und rissen die Rinde ab. Eichensplitter wirbelten durch die Luft.
Michelle konnte sich keinen Augenblick Pause erlauben, denn ein geübter Schütze brauchte nur Sekunden, um das Magazin einer Maschinenpistole zu wechseln. Sie sprang aus ihrer Deckung, beide Hände um den Griff der Waffe gelegt. Diesmal würde sie auf den Kopf des Mannes zielen.
Aber da war niemand mehr, auf den sie hätte zielen können.
Der Mann war verschwunden.
Vorsichtig stieg Michelle die Böschung hinauf, die Pistole im Anschlag. Doch als sie hörte, wie der Motor des Pick-ups ansprang, war es mit der Vorsicht vorbei. Sie kletterte weiter, so schnell sie konnte. Als sie die Auffahrt erreichte, war der Wagen bereits verschwunden.
Michelle rannte zu Seans Auto. Sie wollte dem Flüchtigen hinterher, sah dann aber Rauch unter der Motorhaube hervorquellen. Ihr Blick fiel auf die Einschusslöcher im Blech der Karosserie. Mit diesem Wagen würden sie und Sean nirgendwohin fahren.
»Sean?«, rief sie. »Sean!«
»Hier drin!«
Michelle eilte die Treppe hinauf, über die Splitter der Tür hinweg, stürmte ins Wohnzimmer und schwenkte dabei die Waffe in einem weiten Bogen.
Sean kniete auf dem Boden neben einer Frau. Sie lag auf dem Rücken, Arme und Beine vom Körper abgespreizt. Ihre Augen waren weit geöffnet, aber starr und leer. Das rote Haar fiel ihr bis auf die Schultern. Was die Frau getötet hatte, war auf den ersten Blick zu sehen: Ihre Kehle war zerfetzt.
»Mein Gott«, sagte Michelle. »Wer ist das?«
»Pam Dutton. Die Frau, mit der wir uns treffen wollten.«
Michelle sah Buchstaben auf den nackten Armen der Toten. »Was hat das zu bedeuten?«
»Keine Ahnung.« Sean beugte sich näher an die Tote heran. »Sieht aus, als wären die Buchstaben mit einem schwarzen Marker geschrieben.«
»Ist sonst noch jemand im Haus?«
»Finden wir's raus.«
»Wir dürfen den Tatort nicht kontaminieren, ehe die Spurensicherung hier ist.«
»Wir dürfen aber auch niemanden sterben lassen, den wir retten können«, konterte Sean.
Die Durchsuchung des Hauses dauerte nur ein paar Minuten. Im Obergeschoss gab es vier Schlafzimmer, zwei auf jeder Seite des Flurs. Im ersten Schlafzimmer entdeckten sie ein kleines Mädchen. Es war bewusstlos, hatte aber keine erkennbaren äußeren Verletzungen. Ihre Atmung war stabil, der Puls schwach, aber regelmäßig.
»Das ist Colleen Dutton«, sagte Sean.
»Wurde sie unter Drogen gesetzt?«
Sean hob das Augenlid des Kindes. Die Pupille war stark vergrößert. »Sieht so aus.«
Im zweiten Schlafzimmer lag ein kleiner Junge; er war im gleichen Zustand wie das Mädchen.
»John Dutton«, sagte Sean und überprüfte auch hier die Pupillen. »Ebenfalls betäubt.«
Das dritte Schlafzimmer war leer.
Das vierte Schlafzimmer war das größte. Und es war nicht leer.
Der Mann lag auf dem Boden. Er trug Hose und T-Shirt und war barfuß. Eine Seite seines Gesichts war blau und geschwollen.
»Das ist Tuck Dutton, Pams Mann.« Sean fühlte den Puls des Bewusstlosen. »Er atmet regelmäßig. Offenbar hat er einen ziemlichen Schlag abbekommen.«
»Wir sollten die Cops anrufen.« Michelle nahm das Telefon vom Nachttisch. »Mist! Die Leitung ist tot. Sie müssen die Kabel durchgeschnitten haben.«
»Versuch es über dein Handy.«
»Das habe ich verloren, als die Kerle mich überfahren wollten.«
»Was für Kerle?«
»Ein Fahrer und ein Typ mit einer Maschinenpistole. Hast du niemanden gesehen, als du reingekommen bist?«
Sean schüttelte den Kopf. »Als ich die Schüsse gehört habe, bin ich direkt durch die Hintertür ins Haus. Aber ich habe ein Krachen gehört.«
»Da sind die Kerle mit dem Wagen durchs Garagentor gebrochen«, sagte Michelle.
»Pam tot, Tuck niedergeschlagen, John und Colleen mit Drogen betäubt ...«, murmelte Sean.
»Du hast mir doch gesagt, sie hätten drei Kinder.«
»Haben sie auch. Willa ist anscheinend verschwunden. Das leere Schlafzimmer ist ihres.«
»Ob sie in dem Pick-up entführt wurde?«
»Was für ein Modell war es?«
»Ein Tundra, viertürig, dunkelblau. Ein Fahrer und der Schütze saßen darin.«
»Hast du sie gut genug gesehen, dass du sie identifizieren könntest?«
»Nein, aber einer trug eine kugelsichere Weste. Sie hat das Hartmantelgeschoss aus meiner Waffe aufgehalten. Außerdem hatte der Kerl eine schwarze Skimaske auf.«
Sean wählte 911 auf seinem Handy, gab die Informationen weiter, schob das Handy zurück in die Tasche und schaute sich um.
»Was ist das da?«, fragte er und zeigte auf den Schrank.
Michelle ging durchs Zimmer und besah sich das Gepäckstück, das aus dem Schrank hervorlugte. »Eine Reisetasche, halb offen.« Sie bückte sich. »Hier ist ein Anhänger ... United Airlines, Flug 567 nach Dulles. Das Datum ist heute.« Sie holte einen Waschlappen aus dem Bad, um den Reißverschluss zu öffnen, ohne mögliche Fingerabdrücke zu verwischen. Dann schaute sie in die Tasche. »Männerkleidung. Vermutlich gehört die Tasche Tuck.«
Sean blickte auf die nackten Füße und das T-Shirt des bewusstlosen Mannes. »Er kommt nach Hause, begrüßt Pam, geht rauf, um seine Tasche abzustellen, zieht sich um und kriegt eins über den Schädel.«
»Da ist noch etwas. Der Tundra, der aus der Garage kam ... Entweder gehörte der Wagen den Duttons, oder die Typen haben ihn in der Garage abgestellt.«
»Vielleicht, damit niemand sieht, wie sie Willa in den Wagen laden.«
»Hier draußen? Um diese Zeit? Warum sollten sie sich solche Umstände machen? Man kann von hier aus nicht einmal das Nachbarhaus sehen. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt Nachbarn gibt.«
»Warum haben sie ausgerechnet Willa mitgenommen und keines der anderen Kinder?«
»Gute Frage. Und warum bringen sie die Mutter um und lassen alle anderen am Leben?«
Sean und Michelle stiegen nach unten. Sean ging durch die Küche in die Garage, die Platz für drei Fahrzeuge bot. Auf einem Stellplatz stand eine Mercedes-Limousine, auf einem anderen ein Chrysler-Minivan. Der dritte Stellplatz war leer.
»Da hat wahrscheinlich der Pick-up gestanden«, sagte Michelle. »Weißt du, ob die Duttons einen blauen Tundra hatten?«
»Nein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Wagen ihnen gehörte, weil der Stellplatz frei ist. Die meisten Garagen sind mit Gerümpel vollgepackt. Dass hier alle drei Stellplätze frei sind bedeutet, dass die Duttons drei Fahrzeuge hatten, sonst hätten sie den freien Platz garantiert als Lagerraum genutzt.« Sean legte die Hand auf die Motorhaube des Mercedes. »Ist noch warm.«
Michelle strich mit den Fingern über die Reifen. »Und die sind feucht. Heute Abend hat es leicht geregnet. Tuck muss mit dem Wagen vom Flughafen gekommen sein.«
Sie kehrten ins Wohnzimmer und zur toten Pam Dutton zurück. Mit dem Ellbogen schaltete Sean das Licht an, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Dann zückte er seinen Notizblock und notierte die Buchstaben, die auf dem Arm der Toten standen.
Michelle bückte sich und untersuchte Pams Hände. »Sie hat Blutspuren und Haut unter den Fingernägeln. Wahrscheinlich hat sie sich gewehrt.«
»Ist mir auch schon aufgefallen. Hoffen wir, dass man in der DNA-Datenbank fündig wird.«
»Müsste da nicht mehr Blut sein?«, fragte Michelle.
Sean schaute sich die Leiche genauer an. »Du hast recht. Der Teppich müsste voller Blut sein. Wie es aussieht, haben sie ihr die Halsschlagader durchgeschnitten. Sie muss binnen kürzester Zeit ausgeblutet sein.«
Michelle wies auf ein Plastikstück, das unter dem Ellbogen der Toten hervorragte. »Ist es das, was ich glaube?«
Sean nickte. »Eine leere Spritze.« Er schaute zu seiner Partnerin. »Haben die Täter ihr Blut mitgenommen?«
3.
Bei Talbot's war Schlussverkauf, deshalb hatte Diane Wohl schon um vier Uhr Feierabend gemacht. Ein neues Kleid, ein paar Blusen, die ein oder andere Hose, ein Schal. Diane hatte gerade eine Gehaltserhöhung bekommen und wollte das zusätzliche Geld gleich einem guten Zweck zuführen. Schließlich war nichts verkehrt daran, sich dann und wann selbst ein bisschen zu verwöhnen.
Diane parkte ihren Wagen in der Hochgarage des Einkaufszentrums und ging die hundertfünfzig Meter bis zum Geschäft. Zwei Stunden später verließ sie es mit zwei Taschen voller Kleider. Sie hatte ihre patriotische Pflicht erfüllt und die schleppende Wirtschaft angekurbelt.
Diane warf die Taschen auf den Beifahrersitz und stieg ein. Sie hatte Hunger und dachte darüber nach, sich auf dem Heimweg etwas beim Chinesen zu besorgen. Sie hatte gerade den Schlüssel ins Zündschloss gesteckt, als sie den kleinen, kalten Metallring einer Pistolenmündung am Kopf spürte. Der Geruch nach Waffenöl und Zigaretten stieg ihr in die Nase.
»Fahr«, sagte eine ruhige, aber energische Stimme. »Sonst bist du tot.«
Diane gehorchte.
Eine Stunde später hatten sie die Vorstädte hinter sich gelassen. Nur der Asphalt, der abnehmende Mond und eine Wand von Bäumen waren noch zu sehen. Kein anderes Auto, kein Mensch. Diane Wohl war ganz allein mit dem Mann auf der Rückbank ihres Hondas.
»Bieg hier ab«, sagte der Mann.
Diane krampfte sich der Magen zusammen. Vor Angst kam ihr die Galle hoch.
Ein paar Minuten lang rumpelte der Wagen über einen Feldweg zwischen dunklen Bäumen hindurch.
»Anhalten«, befahl der Mann.
Diane schaltete die Automatik in Parkstellung. Als sie die Hand zurückzog, huschte ihr Blick zu ihrer Handtasche, in der ihr Handy steckte. Wenn sie es irgendwie einschalten konnte ... Oder wenn sie an ihre Schlüssel herankäme. Die könnte sie dem Kerl in die Augen stechen, wie sie es mal in einem Film gesehen hatte. Nur dass Diane so große Angst hatte, dass sie zu gar nichts mehr fähig war. Sie zitterte am ganzen Leib.
Der Mann sagte: »Raus.«
Diane rührte sich nicht. Ihr Mund war trocken, doch irgendwie brachte sie hervor: »Wenn Sie meinen Wagen und mein Geld wollen, können Sie es haben. Nur tun Sie mir bitte nichts.«
Der Mann ließ sich nicht beirren. »Raus.« Wieder drückte er Diane die Pistolenmündung in den Nacken. Ein Haar verfing sich an der Kimme und wurde mit der Wurzel ausgerissen. Tränen rannen Diane übers Gesicht. Sie öffnete die Wagentür und wollte aussteigen, die Handtasche fest umklammert, als plötzlich behandschuhte Finger ihren Arm packten.
»Die Tasche brauchst du nicht.«
Diane schloss die Tür hinter sich.
Als der Mann ebenfalls ausstieg, verließ sie der Mut. Sie hatte so sehr gehofft, der Kerl würde ihr nur den Honda stehlen, nicht aber das Leben.
Der Mann war schon älter und hatte dichtes, langes weißes Haar, das verschwitzt und schmutzig aussah. Sein Gesicht war wie aus Stein gemeißelt, voller Furchen und Gräben. Er war groß und kräftig, mit breiten Schultern und riesigen, schwieligen Händen. Er wog bestimmt mehr als zweihundert Pfund. Wie ein Turm ragte er über der zierlichen Diane auf. Selbst mit Waffe hätte sie kaum eine Chance gegen ihn gehabt. Er hielt die Pistole genau auf ihren Kopf gerichtet.
Dass er keine Maske trug, machte Diane die meiste Angst. Sie konnte sein Gesicht deutlich sehen. Es ist ihm egal, ob ich weiß, wer er ist, schoss es ihr durch den Kopf. Er wird mich vergewaltigen und umbringen und hier draußen liegen lassen.
Diane begann zu schluchzen. »Bitte, tun Sie es nicht«, flehte sie und trat einen Schritt vor, zuckte aber zurück, als ein anderer Mann von hinten an sie herantrat und sie an der Schulter berührte. Sie schrie auf und fuhr herum. Der Neuankömmling war klein und drahtig und besaß ein Latinogesicht. Doch Diane registrierte es kaum, denn der Mann hob einen Kanister, und ein dichter Nebel traf sie mitten ins Gesicht.
Würgend wankte Diane einen Schritt zurück und rang nach Atem. Nach wenigen Augenblicken verlor sie das Bewusstsein und sank in den Armen des Hünen zusammen.
Die Männer steckten Diane in den Laderaum eines gemieteten Vans, der in der Nähe stand, und fuhren davon.
4.
Die Gesetzeshüter waren in beeindruckender Stärke angerückt. Sean und Michelle, die am Rand des von Fichtennadeln übersäten Hofes standen, beobachteten, wie Polizisten und Kriminaltechniker über das Haus der Duttons herfielen wie Ameisen über einen Kadaver - in gewisser Hinsicht eine perfekte Analogie.
Rettungswagen hatten die überlebenden Angehörigen der Familie Dutton bereits ins Krankenhaus gebracht, während Mrs. Dutton noch immer drinnen lag. Der einzige Arzt, den sie noch sehen würde, war der Leichenbeschauer, und der würde ihren Körper noch mehr zerlegen, als ihr Mörder es getan hatte.
Sean und Michelle waren bereits drei Mal vernommen worden, zuerst von uniformierten Beamten, dann von Detectives der Mordkommission. Immer wieder hatten sie detaillierte Antworten gegeben. Nun waren ganze Notizbücher voll mit ihren Schilderungen der schrecklichen Ereignisse dieser Nacht.
Michelle richtete ihre Aufmerksamkeit auf zwei schwarze Limousinen in der Auffahrt. Als Männer und Frauen in Zivil aus den Wagen stiegen, fragte sie Sean: »Was macht das FBI hier?«
»Habe ich das nicht schon gesagt? Tuck Dutton ist der Bruder der First Lady.«
»First Lady? Du meinst Jane Cox, die Frau des Präsidenten?«
Sean nickte.
»Also wurde die Schwägerin der First Lady ermordet und ihre Nichte entführt?«
»Volltreffer«, sagte Sean. »Die Übertragungswagen der Fernsehleute müssten gleich hier sein. Unsere Standardantwort lautet ›kein Kommentar‹, klar?«
»Klar. Dann wollte Pam Dutton uns anheuern? Warum? Hast du eine Ahnung?«
»Nein.«
Sean und Michelle beobachteten, wie die FBI-Leute mit den Polizisten sprachen und anschließend im Haus verschwanden. Zehn Minuten später kamen sie wieder zum Vorschein und hielten auf Sean und Michelle zu.
»Die sehen nicht gerade glücklich aus, dass wir hier sind«, bemerkte Michelle.
Und so war es auch. Die FBI-Agenten wollten nicht glauben, dass Pam Dutton die beiden Privatdetektive herbestellt hatte, ohne dass diese den Grund dafür kannten.
Sean wiederholte zum vierten Mal: »Ich sagte doch schon, ich bin ein Freund der Familie. Pam hat mich angerufen und mich um ein Treffen gebeten. Ich hatte keine Ahnung, worum es ging. Um das herauszufinden, sind wir hier.«
»Um diese Uhrzeit?«
»Pam hat die Zeit festgelegt, nicht ich.«
»Wenn Sie den Duttons wirklich so nahestehen, haben Sie vielleicht eine Idee, wer für die Schweinerei hier verantwortlich sein könnte«, sagte einer der Agenten. Der mittelgroße Mann hatte ein schmales Gesicht und breite Schultern und schaute so säuerlich drein wie ein Magenkranker.
»Hätte ich eine Idee, hätte ich es längst gesagt. Haben Sie schon eine Spur vom Pick-up? Übrigens, meine Partnerin hat eine Kugel durch die Windschutzscheibe gejagt.«
»Warum trägt Ihre Partnerin eine Waffe?«, fragte der Magenkranke.
Sean griff langsam in seine Tasche und holte seinen Ausweis heraus. Michelle tat es ihm gleich, legte aber noch ihren Waffenschein dazu.
»Sie sind Privatdetektive?« Der Magenkranke sprach das Wort aus, als wäre es ein Synonym für »Kinderschänder«. Dann gab er Sean und Michelle die Ausweise zurück.
»Und ehemalige Mitarbeiter des Secret Service«, sagte Michelle. »Mein Partner und ich.«
»Schön für Sie.« Der Magenkranke nickte in Richtung Haus. »Der Secret Service wird sich wegen dieser Sache einiges anhören müssen.«
»Wieso?«, fragte Sean. »Geschwister der Präsidentenfamilie haben keinen Anspruch auf Schutz, es sei denn, es besteht eine unmittelbare Bedrohung. Der Secret Service kann schließlich nicht jeden bewachen.«
»Kapieren Sie denn nicht? Hier geht es um die öffentliche Wahrnehmung dieser Geschichte. Die Mutter ermordet, das Kind entführt ... Das kommt gar nicht gut in den Zeitungen, besonders nicht nach der Party in Camp David heute. Die First Family wird wohlbehalten nach Hause gebracht, während die bucklige Verwandtschaft von irgendwelchen Irren heimgesucht wird. Das sind nicht gerade die besten Schlagzeilen, die man sich wünschen kann.«
»Was war das für eine Party in Camp David?«, hakte Michelle nach.
»Ich stelle hier die Fragen«, entgegnete der Magenkranke.
Und so berichteten Sean und Michelle während der nächsten Stunde noch einmal in allen Einzelheiten, was sie gesehen hatten. So unangenehm der Magenkranke auch sein mochte, sie mussten zugeben, dass er gründlich war.
Sie endeten wieder im Haus und blickten auf Pam Duttons Leiche. Ein Kriminaltechniker machte Fotos von den Blutspuren, der tödlichen Wunde und den Spuren unter Pam Duttons Fingernägeln. Ein anderer notierte die Buchstaben auf den Armen der Toten und tippte sie in einen Laptop.
»Weiß hier jemand, was die Buchstaben zu bedeuten haben?«, fragte Michelle und deutete auf die Leiche. »Ist es eine Fremdsprache?«
Einer der Techniker schüttelte den Kopf. »Falls ja, habe ich noch nie davon gehört.«
»Das sieht mir eher willkürlich aus«, bemerkte Sean.
»Die Spuren unter den Fingernägeln deuten darauf hin, dass das Opfer sich gewehrt hat«, sagte Michelle. »Sieht so aus, als hätte sie dem Angreifer ziemliche Kratzer beigebracht.«
»Das wissen wir bereits«, sagte der Magenkranke.
»Wie geht es Tuck und den Kindern?«, erkundigte sich Sean.
»Unsere Leute sind auf dem Weg ins Krankenhaus, um ihre Aussagen aufzunehmen.«
»Wenn die Einbrecher Tucker niedergeschlagen haben, weil er sich gewehrt hat, hat er vielleicht etwas gesehen«, bemerkte ein Agent.
»Ja. Aber wenn er wirklich was gesehen hat, warum haben die Mörder ihn dann nicht erledigt, so wie seine Frau?«, entgegnete Michelle. »Die Kinder wurden betäubt und haben wahrscheinlich nichts mitbekommen. Aber warum haben die Täter einen Augenzeugen am Leben gelassen?«
Der Magenkranke zuckte mit den Schultern. »Wenn ich noch einmal mit Ihnen sprechen will - und davon können Sie ausgehen -, erreiche ich Sie unter der Adresse, die Sie mir gegeben haben, oder?«
»Ja«, erwiderte Sean.
»Gut«, sagte der Magenkranke und ging mit seinem Team davon.
»Verschwinden wir«, sagte Sean.
»Und wie?«, fragte Michelle. »Die Kerle haben unseren Wagen plattgemacht.«
Sean ging hinaus, starrte auf das Wrack seines Lexus und funkelte Michelle wütend an. »Das hättest du mir ruhig früher sagen können.«
»Ich hatte nicht viel Zeit.«
»Okay. Ich rufe uns ein Taxi.«
Als sie warteten, fragte Michelle: »Und? Sollen wir es jetzt einfach dabei bewenden lassen?«
»Was meinst du?«
Michelle deutete auf das Haus der Duttons. »Das da. Einer der Mistkerle hat versucht, mich umzubringen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich nehme so was persönlich. Außerdem wollte Pam uns einen Auftrag erteilen. Ich finde, wir sind es ihr schuldig, den Job zu Ende zu bringen.«
»Michelle, wir haben nicht die leiseste Ahnung, weshalb Pam mich angerufen hat und ob es mit ihrer Ermordung zu tun hatte.«
»Wenn nicht, wäre es die Mutter aller Zufälle.«
»Okay, aber was können wir tun? Polizei und FBI arbeiten bereits an dem Fall. Da bleibt nicht mehr viel Raum für uns.«
»Das hat dich früher nicht gestört«, sagte Michelle.
»Diesmal ist es etwas anderes.«
»Und warum?«
Sean antwortete nicht.
»Sean?«
»Ich hab dich gehört.«
»Und? Was ist diesmal anders?«
»Die Leute, um die es geht.«
»Wer? Die Duttons?«
»Nein. Die First Lady.«
»Die hat doch gar nichts damit zu tun.«
»Doch, hat sie.«
»Du redest, als würdest du sie kennen.«
»Tue ich auch.«
»Woher?«
Sean setzte sich in Bewegung.
»Was ist mit dem Taxi?«, rief Michelle ihm hinterher.
Sie bekam keine Antwort.
5.
Sam Quarry liebte sein Heim - oder das, was davon übrig war. Die Atlee-Plantage war seit fast zweihundert Jahren im Besitz seiner Familie. Einst hatte das Anwesen sich über viele Meilen erstreckt, und Hunderte von Sklaven hatten hier geschuftet. Nun waren Quarry nur noch zweihundert Morgen geblieben, und mexikanische Einwanderer brachten die Ernte ein. Auch das Herrenhaus hatte schon bessere Zeiten gesehen, doch wenn einem die Löcher in der Decke, die zugigen Zimmer und die gelegentliche Maus auf den brüchigen Holzdielen nichts ausmachten, konnte man noch immer in der Villa wohnen. Über den Fußboden des einstigen Herrenhauses waren konföderierte Generäle geschritten, sogar Jefferson Davis höchstpersönlich. Quarry kannte die Geschichte, doch er schwelgte nicht darin. Schließlich konnte niemand sich seine Familie oder deren Geschichte aussuchen.
Quarry war zweiundsechzig, schlank und kräftig, hatte dichtes, schneeweißes Haar, sonnengebräunte Haut und eine laute, befehlsgewohnte Stimme. Er liebte das Leben im Freien und genoss es, auf die Jagd zu gehen, zu fischen und im Garten zu arbeiten. Er war ein »Mann der Erde«, wie er selbst es zu nennen pflegte.
Quarry saß an seinem überladenen, narbigen Schreibtisch in der Bibliothek. Es war derselbe Schreibtisch, hinter dem schon Generationen von Quarrys gesessen und wichtige Entscheidungen getroffen hatten, die das Leben vieler Menschen beeinflusst hatten. Im Gegensatz zu einigen seiner Ahnen, die nachlässig gewesen waren, nahm Sam Quarry seine Verantwortung ernst. Er führte ein strenges Regiment, um für sich selbst und für die Leute zu sorgen, die hier noch beschäftigt waren. Außerdem war die Atlee-Plantage alles, was Quarry geblieben war.
Er streckte seine eins neunzig große Gestalt und faltete die schwieligen, sonnengebräunten Hände auf dem Bauch. Dann ließ er den Blick über die schlecht gemalten Porträts und die körnigen Schwarzweißfotos seiner männlichen Vorfahren schweifen und überdachte seine Situation. Quarry nahm sich stets Zeit, alles genau zu durchdenken - anders als die meisten anderen Menschen heutzutage, vom Präsidenten bis hin zu Wall-Street-Magnaten und dem Mann von der Straße. Alles musste schnell gehen. Jeder wollte alles am liebsten schon gestern. Diese Ungeduld führte häufig zu Fehlern.
Eine halbe Stunde saß Quarry einfach nur da und rührte sich nicht, während sein Hirn auf Hochtouren arbeitete. Schließlich beugte er sich vor, streifte sich Handschuhe über und begann unter dem strengen Blick seines Großvaters und Namensvetters Samuel W. Quarry, der lange Zeit die Opposition gegen die Bürgerrechtler in Alabama geführt hatte, nach dem Zweifingersystem auf der abgegriffenen Tastatur seiner IBM Selectric zu tippen. Einen PC besaß Quarry nicht, nur ein Handy. Er hatte oft genug davon gehört und gelesen, wie einfach es sei, Informationen von einem Computer zu stehlen, selbst wenn der Dieb in einem anderen Land saß. Wollte jemand etwas von seiner Schreibmaschine stehlen, müsste er bei Quarry einbrechen - und Quarry bezweifelte, dass ein Einbrecher sein Anwesen lebend verlassen würde.
Quarry hörte zu tippen auf, zog das Blatt heraus, überflog den kurzen Text, steckte das Blatt in einen Umschlag und verklebte die Lasche mit Wasser aus einem Glas auf seinem Schreibtisch. Er wollte keine Spuren hinterlassen, auch nicht in Gestalt der DNA seines Speichels.
Quarry legte den Umschlag in eine Schreibtischschublade, die er mit einem fast hundert Jahre alten Schlüssel verschloss; der uralte Mechanismus funktionierte noch ausgezeichnet. Dann stand er auf, ging zur Tür und trat hinaus ins Tageslicht, um einen Blick auf sein zerfallendes Königreich zu werfen. Dabei kam er an Gabriel vorbei, einem dürren, elfjährigen schwarzen Jungen, dessen Mutter, Ruth Ann, als Haushälterin für Quarry arbeitete. Quarry tätschelte Gabriel den Kopf und gab ihm einen zusammengefalteten Dollar sowie eine alte Briefmarke aus seiner Sammlung. Gabriel war ein kluger Junge, der genug Grips hatte, um ein College zu besuchen, und Quarry war entschlossen, ihm dabei zu helfen. Er hatte nicht die Vorurteile seines Großvaters und Urgroßvaters geerbt, die den erzkonservativen George Wallace als großen Politiker hatten hochleben lassen, als einen Mann, »der wenigstens noch wusste, wie man die Nigger auf den Platz verweist, der ihnen zusteht«.
Sam Quarry war der Überzeugung, dass alle Menschen ihre Stärken und Schwächen hatten, egal welcher Hautfarbe sie waren. Seine jüngste Tochter hatte sogar einen Farbigen geheiratet, und Sam hatte die Braut voller Freude zum Altar geführt. Inzwischen waren sie geschieden, und Quarry hatte die beiden seit Jahren nicht gesehen. Doch er gab die Schuld an der Trennung nicht seinem Ex-Schwiegersohn. Er wusste, wie schwierig es war, mit seiner jüngsten Tochter zusammenzuleben.
Quarry verbrachte zwei Stunden damit, mit seinem verbeulten, rostigen Pick-up, der schon mehr als stolze zweihunderttausend Meilen auf dem Buckel hatte, über sein Land zu fahren. Schließlich hielt er vor einem jahrzehntealten, silbernen Airstream-Wohnwagen mit zerfetztem Zeltvordach. Im Inneren gab es ein winziges Bad mit Toilette, einen mit Propangas betriebenen Herd, einen kleinen Kühlschrank unter der Spüle, einen Boiler, ein Mini-Schlafzimmer und eine Klimaanlage. Über ein Kabel zur großen Scheune wurde der Wohnwagen mit Strom versorgt. Quarry hatte den Airstream von einem Großhändler in Zahlung genommen, der während der Erntezeit in finanzielle Schwierigkeiten geraten war.
Unter dem Vordach saßen drei Männer, Indianer vom Stamm der Coushatta. Quarry war mit der Geschichte der Eingeborenen in Alabama sehr gut vertraut. Die Coushatta hatten jahrhundertelang im Norden von Alabama gesiedelt, mit den Muskogee und Cherokee als östlichen Nachbarn und den Chickasaw und Choctaw im Westen. Im Jahre 1830 waren die Coushatta zwangsweise in Reservate nach Texas und Oklahoma gebracht worden. Heutzutage lebten fast alle Coushatta in Louisiana, doch eine Hand voll hatte es zurück in den Goldammer-Staat geschafft.
Einer der Coushatta war vor Jahren hierhergekommen, lange nachdem Quarry das Anwesen von seinem Vater geerbt hatte. Seitdem lebte der Indianer hier. Quarry hatte ihm den Wohnwagen als Heim überlassen. Die anderen beiden waren erst seit sechs Monaten hier, und Quarry wusste nicht, ob sie blieben oder nicht. Aber er mochte sie, und sie schienen ihn zu tolerieren. Grundsätzlich vertrauten die Coushatta keinem weißen Mann, duldeten aber Quarrys Besuche und seine Gesellschaft, denn technisch gesehen gehörte sein Land ihnen: Die Coushatta hatte es schon bestellt, lange bevor es Weiße in Alabama gegeben hatte.
Quarry setzte sich auf einen Stuhl mit dickem Gummikissen, trank ein Bier mit den Coushatta, drehte sich ein paar Zigaretten und tauschte Geschichten mit den Indianern. Der Coushatta, dem Quarry vor gut zehn Jahren den Wohnwagen überlassen hatte, war klein und gebeugt, mit weißem Haar und einem Gesicht wie eine Skulptur von Frederic Remington. Von allen Indianern sprach er am meisten, und er trank auch mehr als die anderen. Er war ein gebildeter Mann, doch Quarry wusste nur wenig über ihn.
Quarry unterhielt sich mit den Indianern in deren eigener Sprache, doch sein Coushatta war ziemlich beschränkt; deshalb kamen die Indianer ihm entgegen, indem sie Englisch mit ihm redeten - und nur mit ihm, was Quarry ihnen nicht verübeln konnte: Der Weiße Mann trampelte noch immer auf ihnen herum, obwohl die Indianer das einzige Volk waren, das sich mit Fug und Recht als Amerikaner bezeichnen konnte. Das aber behielt Quarry wohlweislich für sich, denn die Indianer mochten kein Mitleid, hassten es sogar.
Fred, der alte Indianer, erzählte gerne die Geschichte, wie die Coushatta an ihren Namen gekommen waren. »Es bedeutet ›verirrter Stamm‹«, sagte er. »Unser Volk ist vor langer Zeit in zwei Gruppen von hier aufgebrochen, wobei die erste Gruppe Zeichen für die zweite hinterließ, damit diese ihr folgen konnte. Doch am Mississippi verschwanden die Zeichen plötzlich. Die zweite Gruppe zog trotzdem weiter und traf auf ein Volk, das unsere Sprache nicht verstand. Unsere Leute sagten ihnen, sie hätten sich verirrt, was in unserer Sprache coushai heißt. Das andere Volk glaubte, das sei unser Name. So hat er sich entwickelt und ist bis heute geblieben.«
Quarry, der die Geschichte schon ein Dutzend Mal gehört hatte, erwiderte: »Im Grunde, Fred, haben wir alle uns in gewisser Weise verirrt.«
Gut eine Stunde später, als die Sonne den Männern auf die Köpfe knallte und die Luft einem Glutofen glich, stand Quarry auf, klopfte sich den Staub von der Hose, tippte sich zum Abschied an den Hut und versprach den Indianern, bald wiederzukommen und eine Flasche Feuerwasser, Maiskolben, einen Eimer Äpfel und richtige Zigaretten mitzubringen, denn die Indianer konnten sich nur Selbstgedrehte leisten.
Fred schaute zu Quarry auf, steckte sich eine Selbstgedrehte zwischen die Lippen, bekam einen Hustenanfall und sagte: »Bring das nächste Mal die Filterlosen mit, die schmecken besser.«
»Mach ich, Fred.«
Quarry fuhr über zerfurchte Feldwege, sodass sein Wagen durchgeschüttelt wurde, doch er bemerkte es kaum. Das hier war sein Grund und Boden, sein Leben.
Der Weg endete.
Da stand das kleine Haus.
Genau genommen war es kein Haus, sondern eine Hütte. Hier wohnte niemand, jedenfalls noch nicht. Und selbst wenn es einmal so weit war, würde es hier niemand längere Zeit aushalten: Es war bloß ein Zimmer mit einem Dach und einer Tür.
Quarry drehte sich um die eigene Achse. Er sah nichts als Staub, Bäume und ein Stück blauen Alabamahimmel - der schönste Himmel, den er je gesehen hatte. Auf jeden Fall war er schöner als der Himmel in Südostasien, den Quarry inmitten feindlichen Abwehrfeuers durchflogen hatte, als der Vietcong ihn und seine F-4 Phantom II aus der Luft holen wollte.
Quarry ging zu der Hütte und betrat die Veranda. Er hatte die Hütte selbst gebaut. Sie stand nicht auf dem Gelände seines Anwesens, sondern ein paar Meilen entfernt auf einem kleinen Grundstück, das Quarrys Großvater vor siebzig Jahren gekauft hatte. Der alte Herr hatte allerdings nie etwas damit angefangen, denn das Grundstück lag mitten im Nirgendwo. Sein Großvater musste betrunken gewesen sein, als er diesen Flecken Dreck gekauft hatte, und er war oft betrunken gewesen. Für Quarrys Zwecke aber war das Grundstück ideal.
Die Hütte war nur sechzig Quadratmeter groß, aber das reichte. Die einzige Tür war von normaler Größe und hing an Messingscharnieren. Quarry schloss die Tür auf, ging aber nicht sofort hinein.
Er hatte die Wände fast doppelt so dick gebaut wie bei normalen Gebäuden dieser Art, doch man musste schon genau hinschauen, um es zu bemerken. Zwischen Innen- und Außenwand waren schwere Metallplatten eingelassen, was dem kleinen Gebäude eine unglaubliche Stabilität verlieh. Quarry hatte das Metall selbst eingesetzt und verschweißt. Jede Naht war ein wahres Kunstwerk. Wahrscheinlich hätte nicht einmal ein ausgewachsener Tornado die Hütte zum Einsturz bringen können.
Quarry ließ erst einmal frische Luft ins Innere, ehe er die Hütte betrat. Er hatte einmal den Fehler begangen, das nicht zu tun, und fast das Bewusstsein verloren, weil der Sauerstoffgehalt der Luft im Inneren extrem niedrig war. Es gab keine Fenster, und der Boden bestand aus dicken Holzplanken, mit Sandstrahl behandelt, sodass es nicht den winzigsten Splitter gab. Zwar gab es Fugen zwischen den Brettern, aber sie waren für das menschliche Auge kaum zu erkennen.
Der Unterbau war ebenfalls eine Besonderheit. Quarry konnte mit Fug und Recht behaupten, dass vermutlich kein Fußboden in Amerika ein Fundament besaß wie dieser. Die Innenwände waren über Weidedraht verputzt, und das Dach war so fest mit den Mauern verbunden wie der Rumpf eines Ozeanriesen mit dem Deck. Quarry hatte extrem starke Bolzen und Nieten verwendet, um jede Eigenbewegung der Hütte und sämtliche Einwirkungen von außen zu unterbinden. Das Fundament bestand aus gegossenem Beton, und es gab einen Kriechgang im Boden, knapp einen halben Meter breit.
Die Möblierung war schlicht: ein Bett, ein mit Leder gepolsterter Stuhl, ein batteriebetriebener Generator und noch ein paar andere Dinge einschließlich eines Sauerstofftanks an der Wand. Quarry stieg von der Veranda hinunter und begutachtete sein Werk. Jede Gehrung an den Außenwänden war perfekt, obwohl Quarry während des Baus häufig bei künstlichem Licht gearbeitet hatte. Es war eine anstrengende, schweißtreibende Arbeit gewesen, doch seine Gliedmaßen und sein Verstand waren von den beiden stärksten menschlichen Gefühlen angetrieben worden:
Hass.
Und Liebe.
Quarry nickte zufrieden. Er hatte gute Arbeit geleistet. Besser konnte er es nicht machen. Die Hütte wirkte unscheinbar, obwohl es sich in Wahrheit um ein ingenieurtechnisches Wunderwerk handelte. Nicht schlecht für einen Jungen aus dem tiefsten Süden, der nicht einmal aufs College gegangen war.
Quarry schaute nach Westen, wo er eine Überwachungskamera in einem Baum angebracht hatte, geschützt vor der Sonne und neugierigen Blicken. Äste und Blattwerk hatte er so zurechtgeschnitten, dass die Kamera alles sehen konnte, was sie sehen sollte. Ein in der Rinde verborgenes Kabel auf der Rückseite des Stammes führte über ein in der Erde verlegtes PVC-Rohr zu dem kleinen Haus, wo es sich gabelte und zwischen den Metallplatten durch die Wände führte.
Quarry schloss die Hütte ab und stieg in seinen Dodge. Jetzt musste er woanders hin, aber nicht mit einem Pick-up.
Quarry schaute hinauf zum makellosen Alabamahimmel. Ein schöner Tag für einen Flug.
6.
Eine Stunde später jagte die alte Cessna über die kurze Startbahn und erhob sich in die Luft. Quarry blickte aus dem Seitenfenster auf sein Land hinunter. Zweihundert Morgen - das hörte sich nach viel an, war es aber nicht.
Quarry flog tief und achtete auf Vögel und andere Maschinen, denn er meldete einen Flug nie an; deshalb musste er doppelt vorsichtig sein.
Nach gut einer Stunde ging er in den Sinkflug, landete auf dem Asphalt einer privaten Landebahn und betankte seine Maschine. Auf diesem Flugfeld gab es keine modernen Anlagen und keine Firmenjets, nur schäbige Wellblechhangars, eine holperige Asphaltstartbahn, einen Luftsack und Flugzeuge wie Quarrys: alte, zusammengeflickte Kisten, die jedoch liebevoll gehegt und gepflegt wurden. Und sie waren billig. Quarry hatte seine Cessna vor Jahren aus dritter Hand gekauft; heute hätte er sich das nicht mehr leisten können.
Quarry flog, seit er in die Air Force eingetreten und mit seiner F-4 Phantom über die Reisfelder und Dschungel Vietnams hinweggedonnert war. Später hatte er Bomben auf Laos und Kambodscha geworfen und Menschen getötet - und das nur, weil man es ihm befohlen hatte, obwohl diese Angriffe, wie er später herausgefunden hatte, nie offiziell genehmigt worden waren. Aber das wäre ihm damals ohnehin egal gewesen. Soldaten taten, was man ihnen befahl. Allerdings hatte Quarry damals auch nicht die Zeit gehabt, sich groß den Kopf darüber zu zerbrechen, was die hohen Tiere eigentlich wollten - nicht wenn der Feind unter ihm versuchte, ihn abzuschießen.
Quarry stieg wieder in sein kleines Flugzeug, gab Gas und stieg erneut in den Himmel. Er flog weiter und drehte in einen Treibstoff sparenden Gegenwind von fünf Knoten die Stunde.
Kurz darauf zog er den Gashebel wieder zurück, drückte den Steuerknüppel nach vorn und ließ sich von der Thermik tragen. Das war der schwierige Teil: die Landung auf seinem anderen Besitz. Er lag in den Bergen. Dort gab es keine Landebahn, nur einen langen Grasstreifen, den Quarry im Schweiße seines Angesichts gemäht hatte. Der Boden war fest und flach, doch die Seitenwinde stellten eine Herausforderung dar.
Quarrys Gesichtsmuskeln spannten sich, und er packte den Steuerknüppel mit festem Griff. Dann fuhr er die Landeklappen voll aus. Die Maschine setzte auf, machte einen Satz, setzte wieder auf und machte einen erneuten Satz. Als die Cessna das dritte Mal aufsetzte, blieb das Fahrwerk auf der Erde, und Quarry trat mit beiden Beinen auf die Radbremse. Bremse und Landeklappen ermöglichten es der Cessna, knapp vor dem Ende der Bahn zum Stehen zu kommen.
Quarry wendete das Flugzeug und stellte den Motor ab. Dann schnappte er sich seinen Rucksack, stieg aus und legte Bremskeile unter das Fahrwerk, damit die leichte Maschine nicht wegrollen konnte. Schließlich stapfte er mit seinen langen Beinen den Felshang hinauf. Er holte einen Schlüsselbund aus der Manteltasche und suchte den richtigen heraus. Dann bückte er sich und öffnete die dicke Holztür im Berg. Die Tür lag hinter Felsen versteckt, die Quarry mühsam aus einem Vorsprung gebrochen und hier aufgeschichtet hatte.
Sein Großvater hatte jahrzehntelang in dieser Kohlenmine gearbeitet. Genauer gesagt, seine unterbezahlten Arbeiter. Als Kind war Quarry öfter hier gewesen. Damals hatten sie die Straße benutzt, doch die hatte Quarry gestern versperrt. Früher hatten Laster die Kohle über diese Straße ins Tal gefahren; Quarry hatte sie benutzt, um alles hier heraufzuschaffen, was er brauchte. In seinem kleinen Flugzeug hätte er das Material nie transportieren können.
Natürlich war der Berg nicht immer eine Mine gewesen. Wind, Regen und geologische Aktivitäten hatten große Höhlen und Kammern erschaffen. Lange vor der ersten Fahrt einer Kohlenlore, während des amerikanischen Bürgerkriegs, waren in diesen Höhlen gefangene Soldaten der Nordstaaten gestorben. Ohne Sonne und frische Luft waren sie bis auf die Knochen abgemagert und schließlich jämmerlich zugrunde gegangen.
Heutzutage waren die Schächte mit Lampen ausgestattet, doch Quarry benutzte sie nur, wenn es unbedingt nötig war, denn der Strom wurde von einem alten Dieselgenerator erzeugt, und Treibstoff war teuer. Quarry verwendete eine alte Taschenlampe, wenn er etwas sehen wollte. Tatsächlich war es sogar dieselbe Lampe, mit der sein Vater »aufsässige« Schwarze gejagt hatte, nachts, in den Sümpfen von Alabama. Als Kind hatte Quarry oft aus einem Versteck beobachtet, wie sein Alter im Dunkeln nach Hause gekommen war, erfüllt von wilder, perverser Freude darüber, was er und seine Kumpane in ihrem Hass getan hatten. Manchmal hatte Quarry das Blut der Opfer an den Händen und Ärmeln seines Vaters gesehen, und der Alte hatte gekichert, wenn er sich anschließend einen Whisky genehmigt hatte. Es war verrückt und abartig, Menschen nur deshalb zu töten, weil sie anders aussahen als man selbst.
»Dieser miese alte Bastard«, schimpfte Quarry vor sich hin. Er verabscheute seinen Vater für all den Kummer, den er über andere Menschen gebracht hatte. Quarry öffnete eine weitere Tür in der Wand des Hauptschachts. Dahinter verbarg sich ein Raum. Quarry nahm eine batteriebetriebene Laterne von einem Regal, schaltete sie ein und stellte sie auf einen Tisch in der Mitte des Raumes. Dann schaute er sich um und bewunderte sein Werk. Er hatte den Raum mit dicken Bohlen verkleidet und mit Spachtelmasse verfugt. Anschließend hatte er das Ganze in therapeutischem Hellblau gestrichen. Quarry hatte das gesamte Material kostenlos von einem Freund bekommen, der eine kleine Baufirma besaß und nicht wusste, wo er Überschüsse lagern sollte. Hinter den Wänden befanden sich die gewaltigen Innereien des Berges. Doch jeder, der sich in dem Raum umsah, hatte das Gefühl, sich in einem Haus zu befinden. Und das war ja auch der Sinn des Ganzen.
Quarry ging in eine Ecke und musterte die Frau, die dort zusammengesunken auf einem Stuhl saß und schlief, den Kopf zur Seite geneigt. Quarry stupste sie am Arm, doch sie reagierte nicht. Na, das würde sich schnell ändern.
Quarry krempelte den Ärmel der Frau hoch, holte eine sterile Spritze aus seinem Rucksack und stieß sie der Frau in den Arm. Sekunden später schlug sie die Augen auf, und ihr Blick klärte sich. Als sie Quarry sah, öffnete sie den Mund, um zu schreien, aber das Klebeband auf ihren Lippen hinderte sie daran.
Quarry lächelte sie schief an, während er ihr zwei Ampullen Blut abnahm. Die Frau beobachtete ihn entsetzt. Sie konnte sich nicht bewegen; Fesseln hielten sie am Stuhl fest.
»Ich weiß, dass es Ihnen seltsam erscheint, Ma'am«, sagte Quarry, »aber glauben Sie mir, es dient einem guten Zweck. Ich will weder Sie noch sonst jemanden verletzen. Haben Sie verstanden?«
Er zog die Nadel heraus, desinfizierte die Einstichstelle mit einem in Alkohol getunkten Wattebausch und klebte ein Pflaster darauf.
»Haben Sie verstanden?«, fragte er erneut.
Die Frau nickte.
»Gut. Es tut mir leid, dass ich Ihnen Blut abnehmen musste, aber es ging nicht anders. Okay, jetzt bekommen Sie etwas zu essen und können sich waschen. Wir werden Sie nicht die ganze Zeit gefesselt lassen. Sie bekommen ein wenig Bewegungsfreiheit. Ich weiß, dass Sie noch nicht erkennen können, warum das alles nötig ist - die Fesseln und so weiter. Nicht wahr?«
Die Frau schaute ihm in die Augen. Trotz ihrer schrecklichen Situation nickte sie.
»Ausgezeichnet«, sagte Quarry. »Machen Sie sich keine Sorgen. Alles wird wieder gut. Und es wird keine Übergriffe geben, weil Sie eine Frau sind ... Sie wissen, was ich meine. So etwas dulde ich nicht. Sie haben mein Wort.« Zärtlich drückte er ihr den Arm.
Die Frau verzog den Mund zu einem verzerrten Lächeln.
Quarry steckte die Ampullen in seinen Rucksack und wandte sich von der Frau ab.
Einen Augenblick stellte sie sich vor, wie er plötzlich mit einem wahnsinnigen Lachen zu ihr herumwirbelte und ihr eine Kugel in den Kopf jagte oder ihr die Kehle durchschnitt.
Doch Quarry verließ den Raum.