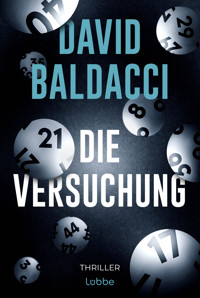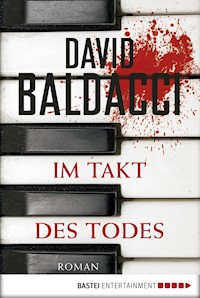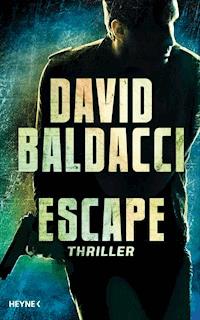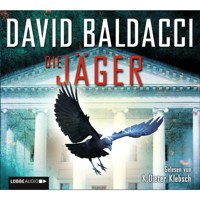
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Krimi
- Serie: Camel Club
- Sprache: Deutsch
Einst war er ihr Auftragskiller - inzwischen riskiert Oliver Stone mit seinen Freunden vom Camel Club alles, um die finsteren Machenschaften der US-Regierung aufzudecken. Kein Wunder, dass auf allerhöchster Ebene eine gigantische Hetzjagd auf ihn angezettelt wird: Stone wird zum meistgesuchten Mann Amerikas.
Tief in den Wäldern Virginias, in einer kleinen entlegenen Minenstadt, taucht er unter. Doch was hat es mit den rätselhaften Selbstmorden und Todesfällen auf sich, die dort geschehen? Ist der Ort wirklich eine Zuflucht für Stone - oder etwa eine tödliche Falle?
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 22 min
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
INHALT
CoverTitelImpressumWidmungKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Kapitel 44Kapitel 45Kapitel 46Kapitel 47Kapitel 48Kapitel 49Kapitel 50Kapitel 51Kapitel 52Kapitel 53Kapitel 54Kapitel 55Kapitel 56Kapitel 57Kapitel 58Kapitel 59Kapitel 60Kapitel 61Kapitel 62Kapitel 63Kapitel 64Kapitel 65Kapitel 66Kapitel 67Kapitel 68Kapitel 69Kapitel 70Kapitel 71Kapitel 72Kapitel 73Kapitel 74Kapitel 75Kapitel 76Kapitel 77Kapitel 78Kapitel 79Kapitel 80Kapitel 81Kapitel 82Kapitel 83DanksagungenDAVID BALDACCI
DIE JÄGER
Thriller
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Uwe Anton
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel ist auch als Hörbuch bei Lübbe Audio lieferbar
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Divine Justice«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2008 by Columbus Rose, Ltd.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2011 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Wolfgang Neuhaus
Umschlaggestaltung: HildenDesign, München
Umschlagmotiv: © Shutterstock/Hedrus; Shutterstock/Dave Newman
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-8387-1051-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Zum Gedenken an meinen Vater
KAPITEL 1
Die Chesapeake Bay ist Amerikas größte Flussmündung. Bei fast 320 Kilometer Breite hat sie eine Wasserfläche von unfassbaren 1690000 Quadratkilometern, und mehr als hundertfünfzig Flüsse und Bäche ergießen sich in die Bucht. Außerdem ist sie Heimat einer einzigartigen Flora und Fauna und ein Anziehungspunkt für Heerscharen von Bootsurlaubern. Die Bucht ist ein Stück Schöpfung von bemerkenswerter Schönheit – es sei denn, man schwimmt während eines Unwetters in der diesigen Düsternis des frühen Morgens in ihren eisigen Fluten.
Oliver Stone tauchte auf, durchbrach die Wasseroberfläche und schnappte in der salzigen Luft nach Atem wie ein Verdurstender mitten auf dem Ozean.
Der Sprung von der steilen Klippe hatte ihn tiefer ins Wasser tauchen lassen, als gut für ihn war. Wenn man von einem zehn Meter hohen Felsen in die tosende See springt, muss man froh sein, wenn man nicht auf einem Riff landet oder wenn einem in der plötzlichen Kälte nicht das Herz stehen bleibt.
Stone trat Wasser und ließ den Blick schweifen, um sich zu orientieren, doch nichts, was er sah, kam ihm vertraut vor oder machte einen einladenden Eindruck. Bei jedem Blitzschlag warf er einen Blick zu der drei Stockwerke hohen Klippe hinauf, von der er gesprungen war. Er trieb noch keine Minute in der Bucht, doch trotz des Ganzkörperschwimmanzugs, den er unter der Kleidung trug, kroch ihm die Kälte bereits in die Knochen. Er streifte Hose und Hemd vom Leib und schüttelte die Schuhe ab. Dann schwamm er mit kräftigen Zügen nach Osten. Ihm blieb nur wenig Zeit.
Zwanzig Minuten später schlug er die Richtung zur Küste ein. Inzwischen fühlten seine Arme und Beine sich an, als wären sie aus Beton. Früher hätte er diese Übung mit Leichtigkeit absolviert, aber er war keine zwanzig mehr. Verdammt, er war auch keine fünfzig mehr! Stone wollte nur noch an Land. Er hatte es satt, den Fisch zu spielen.
Stone richtete den Blick auf eine Felsspalte, schwamm mit letzter Kraft darauf zu, zog sich aus dem Wasser und näherte sich im Laufschritt einem großen Granitblock, wo er sich den Kleidersack griff, den er dort versteckt hatte. Er schälte sich aus dem nassen Schwimmanzug, trocknete sich mit einem Badetuch ab und zog frische Kleidung und ein Paar Tennisschuhe an. Die feuchten Sachen stopfte er in den Sack, band einen Stein daran fest und schleuderte ihn in die vom Unwetter gepeitschte Bucht, wo der Sack samt Inhalt sich zu Stones jahrzehntealtem Scharfschützengewehr und dem ebenso antiquierten Weitschusszielfernrohr gesellte. Offiziell war Stone aus seinem Job als Profikiller ausgeschieden. Er hoffte, sein neues Leben genießen zu können. Doch seine Erfolgsaussicht lag bei nicht einmal fünfzig Prozent.
Vorsichtig suchte Stone sich den Weg hinauf zu einem kiesigen Trampelpfad. Zehn Minuten später gelangte er zu einem bewaldeten Geländeabschnitt, auf dem sich Pinien im steifen Wind beugten, der vom Meer herüberwehte. Nach weiteren zwanzig Minuten, diesmal wieder im Laufschritt, erreichte Stone eine Ansammlung windschiefer Hütten, von denen die meisten kurz vor dem Einsturz standen.
Das erste, von Wolken getrübte Licht des neuen Tages verdrängte die Dunkelheit. Stone schwang sich durch das Fenster der kleinsten Hütte, die kaum mehr als ein Anbau war, allerdings über Annehmlichkeiten wie einen Holzfußboden und eine Tür verfügte.
Stone blickte auf die Armbanduhr. Er hatte höchstens noch zehn Minuten. Obwohl er hundemüde war, zog er sich noch einmal aus und huschte in die winzige Duschkabine, deren rostige Rohre nur einen dünnen Strahl lauwarmen Wassers hervorbrachten. Dennoch bürstete er sich kräftig ab, wusch den Gestank und die schmierigen Rückstände der tobenden Bucht ab und beseitigte auf diese Weise Indizien. Er war dermaßen erschöpft, dass er sich von seinen Instinkten leiten ließ; sein Verstand war zu ausgelaugt, um noch die Führung behaupten zu können. Stone war klar, dass sich das schnellstens ändern musste, denn sehr bald schon würde es zu einem weiteren geistigen Kräftemessen kommen. Seine Verfolger saßen ihm im Nacken.
Stone lauschte auf das zu erwartende Klopfen an der Tür. Es erklang, als er sich wieder ankleidete.
»He, Mann, bist du endlich fertig?«, rief eine Stimme. Sie schoss so plötzlich durch die dünne Sperrholztür wie die Pfote einer Katze in ein Mauseloch. Zur Antwort schlug Stone, der sich gerade die Schuhe anzog, mit der flachen Hand krachend auf den rissigen Dielenboden. Er hüllte sich in einen zerfransten Mantel, setzte sich eine John-Deere-Mütze auf, die er sich tief ins Gesicht zog, und zwängte sich eine dicke Brille auf die Nase. Mit der Hand strich er sich über den struppigen grauen Bart, den er sich in den letzten sechs Monaten hatte wachsen lassen. Dann öffnete er die Tür und nickte dem kleinen, gedrungenen Zeitgenossen zu, der draußen stand. Der Mann hatte einen Körperbau wie ein Fass, ein Hängelid am rechten Auge und von Nikotin und Kaffee gelb verfärbte Zähne. Er trug eine Strickmütze, eine verschlissene Farmer-Latzhose, schmutzige Arbeitsstiefel und einen fadenscheinigen, schmuddeligen Mantel. Auf seinem Gesicht lag ein unbekümmertes Lächeln.
»Ganz schön kalt heute Morgen«, sagte der Mann, rieb sich die Knollennase und paffte an seiner Zigarette.
Ach ja? Da wäre ich nie draufgekommen, dachte Stone.
»Aber es soll wärmer werden.« Der Mann trank aus dem offiziellen NASCAR-Kaffeebecher. Als er den Becher senkte, rann ihm die braune Brühe übers Kinn.
Stone nickte und ließ den Kopf hängen, wobei er seinen normalerweise wachsamen Augen hinter den verschmierten Brillengläsern einen leeren, beinahe stumpfsinnigen Ausdruck verlieh. Als er dem Mann folgte, knickte er das linke Bein nach außen und täuschte ein Hinken vor, das an den stelzenden Gang eines Vogels erinnerte und ihn etliche Zentimeter kleiner machte.
Sie beluden gerade einen alten, verbeulten Ford F-150 mit Brennholz, als ein Polizeiwagen und mehrere schwarze Limousinen in die Zufahrt einbogen. Kiesel spritzten wie Schrotkugeln nach allen Seiten. Die sportlichen, muskelbepackten Männer, die aus den Fahrzeugen stiegen, waren in blaue Windjacken gekleidet, auf deren Rücken in Goldbuchstaben FBI gedruckt stand, und trugen Pistolen mit VierzehnSchuss-Magazinen in den Gürtelholstern. Drei von ihnen kamen schnurstracks auf Stone und seinen Kumpel zu, während ein dicklicher Sheriff in Uniform, blitzblanken schwarzen Stiefeln und einem Stetson sich abmühte, mit ihnen Schritt zu halten.
»Was ist Sache, Virgil?«, rief der Alte mit der Strickmütze dem Sheriff entgegen. »Ist wieder so ’n Hurensohn aus dem Knast getürmt? Sind alles die Scheißliberalen schuld! Das waren noch Zeiten, als man erst geschossen und dann die Fragen gestellt hat, stimmt’s, Virgil?«
Virgil schüttelte den Kopf, Sorgenfalten auf der Stirn. »Diesmal ist es kein Ausbruch. Jemand ist tot, Leroy.«
»Wer denn?«
»Zeigen Sie mir Ihre Papiere«, schnauzte einer der FBI-Mitarbeiter.
»Wo waren Sie und Ihr Freund vor einer Stunde?«, erkundigte sich ein anderer FBI-Agent.
Leroys Blick huschte zwischen den Agenten hin und her. Dann blickte er wieder den Uniformierten an. »Heilige Scheiße, Virgil, was ist denn los?«
»Ich sagte doch, jemand ist tot. Ein wichtiger Mann. Es handelt sich um …«
Ein FBI-Mitarbeiter unterbrach ihn mit einem barschen Wink. »Zeigen Sie mir sofort Ihre Papiere!«, fuhr er Leroy an.
Wortlos zog Leroy eine dünne Brieftasche aus der Latzhose und reichte dem Mann seinen Führerschein. Während der FBI-Agent einen Palmtop aus der Windjacke holte und die Zulassungsnummer eingab, streckte sein Kollege Stone die Hand entgegen.
Stone rührte sich nicht. Mit stumpfsinniger Miene stierte er den FBI-Mann an, kräuselte die Lippen und knickte das linke Bein besonders tief ein. Er schien völlig verwirrt. Das alles war Teil der Verstellung.
»Er hat keinen Führerschein«, erklärte Leroy. »Der hat gar nichts. Der arme Kerl kann nicht mal sprechen, nur brabbeln.«
Die FBI-Agenten umringten Stone. »Er arbeitet für Sie?«
»Jawoll, Sir. Seit vier Monaten schon. Guter Mann, kann tüchtig zupacken. Verlangt wenig Geld. Eigentlich kriegt er bloß Unterkunft und Verpflegung. Aber er hat ’n schlimmes Bein und kann kaum Treppen steigen. Ist sicher einer von denen, die man bei der Arbeitsvermittlung nirgendwo unterbringen kann.«
Aufmerksam betrachteten die FBI-Agenten den unnatürlichen Winkel von Stones Knie; dann musterten sie sein Brillenträgergesicht und den zotteligen Vollbart.
»Wie heißen Sie?«, erkundigte sich einer der Männer.
Stone stieß kehlige Laute aus und fuchtelte ruckartig mit den Händen, als wollte er den FBI-Agenten auf kurios verfremdete Weise eine Kampfsportart vorführen.
»Ist wohl Zeichensprache oder so was«, meinte Leroy verdrossen. »Ich weiß nie, was er will. Ich kenne nicht mal seinen Namen. Ich rufe ihn immer nur ›He, Mann!‹, und dann zeig ich ihm, was getan werden muss. Hat bis jetzt ganz gut geklappt. Es ist ja nicht so, dass wir hier Herzoperationen machen. Meistens laden wir nur irgendwelchen Krempel aufs Auto.«
»Machen Sie ihm klar, dass er das Hosenbein heben soll, damit wir uns sein schlimmes Bein anschauen können«, verlangte ein FBI-Mann.
»Wozu?«
»Tun Sie’s einfach.«
Leroy gab Stone diesen Wunsch zu verstehen, indem er das eigene Hosenbein in die Höhe zog.
Stone bückte sich und ahmte mit vorgetäuschter Mühsal Leroys Handlung nach.
Sämtliche Umstehenden betrachteten die scheußliche Narbe auf Stones Kniescheibe.
»Au verdammt!«, rief Leroy. »Kein Wunder, dass er so schlecht laufen kann.«
Derselbe FBI-Mitarbeiter wies Stone mit einer Gebärde an, das Hosenbein wieder hinunterzurollen. »Na schön, das wäre geklärt.«
Stone hätte nie geglaubt, dass er jemals dankbar sein würde für die alte Bajonett-Stichwunde, die ihm einst ein nordvietnamesischer Soldat zugefügt hatte. Die Narbe sah sehr viel übler aus, als die Verletzung gewesen war, denn der Sanitäter hatte Stone mitten im Dschungel, im größten Dreck, während eines Artilleriesperrfeuers Erste Hilfe leisten müssen. Verständlicherweise hatten die Hände des Knochenflickers dabei ziemlich gezittert.
»Leroy und ich sind hier zusammen aufgewachsen«, sagte Sheriff Virgil zu den FBI-Leuten. »Wir haben an der Highschool zusammen in der Footballmannschaft gespielt. Er als Stürmer, ich in der Abwehr. Weißt du noch, Leroy, wie wir vor vierzig Jahren die Bezirksmeisterschaft gewonnen haben? Glauben Sie mir, Leroy ist keiner von den Typen, die durch die Gegend fahren und Leute umlegen.« Er blickte auf Stone. »Und der arme Kerl ist wahrscheinlich froh, dass er lebt. Einen Scharfschützen stelle ich mir jedenfalls anders vor.«
Der FBI-Agent, der Leroys Führerschein an sich genommen hatte, gab ihn seinem Besitzer zurück und schaute seine Kollegen an. »Der Mann ist sauber«, sagte er leise und mit einer gewissen Enttäuschung.
»Wohin wollen Sie fahren?«, fragte ein anderer FBI-Agent, als sein Blick auf den halb beladenen Pick-up fiel.
»Dahin, wohin ich um diese Jahreszeit zu dieser Morgenstunde immer fahre. Wir bringen Leuten Holz, die keine Zeit haben, selber welches zu schlagen. Wir verkaufen es, ehe die erste Kälte kommt. Danach geht’s runter zum Hafen, zum Boot. Vielleicht fahren wir raus, wenn das Wetter mitspielt.«
»Sie haben ein Boot?«, fragte ein Agent mit argwöhnischem Beiklang.
Leroy warf Virgil einen belustigten Blick zu. »Na klar, ’ne Luxusjacht. Die vermieten wir für zehntausend Dollar am Tag an russische Oligarchen.«
»Hör mit dem Quatsch auf, Leroy, bevor du dich in Schwierigkeiten bringst«, wurde er von Virgil ermahnt. »Die Sache ist ernst.«
»Ich will’s ja gern glauben«, entgegnete Leroy. »Aber wenn es einen Toten gegeben hat, solltet ihr keine Zeit verplempern, indem ihr mit uns quasselt. Wir wissen nämlich rein gar nichts.«
»Haben Sie heute früh jemanden vorbeikommen sehen?«
»Keine Menschenseele. Ihr seid die Ersten. Und wir waren beide schon auf den Beinen, ehe es richtig hell wurde.«
Stone hinkte zum Wagen und warf wieder Holz auf die Ladefläche.
Die FBI-Agenten warfen einander Blicke zu. »Ziehen wir ab«, sagte einer mit halblauter Stimme.
Augenblicke später waren sie verschwunden.
Leroy ging zu Stone und häufte ebenfalls Holz auf den Wagen. »Was war das wohl für ’n Kerl, der da ins Gras gebissen hat?«, fragte er nachdenklich, wenn auch eher im Selbstgespräch. »Ein wichtiger Mann, heißt es. Na, auf der Welt gibt’s ’ne Menge wichtiger Männer. Aber auch die sterben, genau wie wir alle. Das hat Gott so gefügt, um die Welt gerecht zu machen.«
Stone gab ein langgezogenes, lautes Knurren von sich.
Leroy schaute ihn an und grinste. »He, Mann, das ist so ziemlich das Gescheiteste, was ich an diesem Scheißmorgen gehört habe.«
Als ihre Arbeit getan war, gab Stone seinem Arbeitgeber mittels Zeichen zu verstehen, dass er nun seines Weges ziehen wollte. Leroy schien es gelassen aufzunehmen. »Hab mich schon gewundert, dass du überhaupt so lange geblieben bist«, sagte er. »Viel Glück.« Er schälte ein paar verblichene Zwanziger von einer Rolle und drückte sie Stone in die Hand. Der nahm das Geld, klopfte Leroy auf die Schulter und humpelte davon.
Nachdem Stone seinen Kleidersack gepackt hatte, ging er bis zur nächsten Fernstraße; dann trampte er im Laderaum eines Lastwagens, dessen Fahrer den schäbig aussehenden Anhalter nicht in der Wärme der Fahrerkabine dulden wollte, bis in den District of Columbia. Stone war es nur recht. So fand er wenigstens Zeit zum Nachdenken. Und es gab vieles, worüber er nachdenken musste. An ein und demselben Tag hatte er binnen weniger Stunden zwei der prominentesten Männer des Landes getötet – mit dem Gewehr, das er vor dem Sprung von der Klippe in die Bucht geworfen hatte.
In Washington angekommen, setzte der LKW-Fahrer ihn im Bezirk Foggy Bottom ab. Stone strebte zu seinem alten Wohnsitz am Mount-Zion-Friedhof.
Er musste einen Brief hinterlegen.
Und er wollte etwas abholen.
Danach wurde es Zeit, das Weite zu suchen.
Höchste Zeit.
Sein Alter Ego John Carr war tot.
Endlich.
Doch es bestand eine erschreckend hohe Wahrscheinlichkeit, dass Oliver Stone ihm bald ins Grab folgte.
KAPITEL 2
In der Abenddämmerung, die sich zügig dem Dunkel der Nacht näherte, lag das Gärtnerhäuschen still und einsam da. Über den Friedhof selbst hatte sich bereits die Dunkelheit gelegt. Nur die Dunstfahne war zu sehen, wenn Stones Atem an der kalten Luft kondensierte. Sein Blick erkundete jeden Quadratmeter des Geländes, denn er durfte sich jetzt keinen Fehler erlauben. Es war Dummheit, dass er überhaupt hier aufkreuzte, doch Stone betrachtete Treue als Verpflichtung, nicht als Gefühlsduselei, auf die man ebenso gut verzichten konnte. Diese Einstellung prägte ihn und machte ihn zu dem, der er war. Wenigstens das konnte man ihm nicht wegnehmen.
Ungefähr eine halbe Stunde wartete er in der Nähe und beobachtete, ob sich etwas Verdächtiges tat. Nachdem er die Hütte vor langer Zeit verlassen hatte, war sie monatelang observiert worden: Stone wusste es, weil er die Überwacher überwacht hatte. Doch nachdem er sich vier Monate lang nicht hatte blicken lassen, hatten sie die Observation eingestellt und sich zurückgezogen. Das bedeutete allerdings nicht, dass sie nie wiederauftauchen würden. Nach den Ereignissen des heutigen Morgens musste Stone sogar davon ausgehen.
Alle Gesetzeshüter beteuerten, jedes gewaltsam beendete Leben verdiene denselben Aufwand an Ermittlungen, ganz egal, wer der Verblichene gewesen sei. In Wirklichkeit aber nahm die Beharrlichkeit der Täterfahndung mit der Wichtigkeit des Opfers zu. Und dieser Faustregel zufolge war abzusehen, dass man in Stones Fall ein ganzes Heer an Fahndern aufbot.
Als er schließlich zu der Überzeugung gelangte, dass keine unmittelbare Gefahr drohte, kroch er unter dem Zaun an der Rückseite des Friedhofs hindurch und schlich zu einem großen Grabstein. Er kippte ihn um und legte auf diese Weise eine kleine Grube im Erdboden frei. Er nahm die in der Grube versteckte Blechdose heraus, steckte sie in den Kleidersack und richtete den Grabstein wieder auf. Liebevoll tätschelte er das Schild mit der Grabnummer. Der eingemeißelte Name des Verstorbenen, der hier ruhte, war verwittert und nicht mehr zu entziffern, doch Stone hatte Recherchen über sämtliche Personen angestellt, die auf dem Mount Zion Cemetery beigesetzt worden waren; deshalb wusste er, dass es sich bei diesem Grab um die letzte Ruhestätte eines gewissen Samuel Washington handelte – ein befreiter Sklave, der sein Leben geopfert hatte, um seinesgleichen ebenfalls zur Freiheit zu verhelfen. Stone fühlte sich diesem Mann irgendwie verwandt, weil auch er wusste, was es hieß, unfrei zu sein.
Stone betrachtete das Friedhofsgärtnerhäuschen. Annabelle Conroy hatte, so wusste er, zeitweise darin gewohnt. Vor dem Friedhofstor parkte noch ihr Mietwagen. Einmal, als Annabelle vor ein paar Monaten vorübergehend nicht da gewesen war, hatte Stone das Häuschen betreten: Im Innern sah es jetzt viel besser aus als während der Zeit, als er es bewohnt hatte. Aber ihm war völlig klar, dass er nie mehr auf dem Mount Zion Cemetery zu Hause sein konnte, es sei denn in Rückenlage und zwei Meter unter der Oberfläche. Indem er heute, am frühen Morgen, zweimal das Gewehr abgefeuert hatte, war er zum meistgesuchten Mann Amerikas geworden.
Stone fragte sich, wo Annabelle heute Abend wohl sein mochte. Hoffentlich freute sie sich des Lebens. Allerdings wusste er, dass seine anderen Freunde sich leicht zusammenreimen konnten, was passiert war, denn die Meldungen über die beiden Todesfälle waren in sämtlichen Nachrichten. Stone hoffte, dass seine Freunde vom Camel Club deshalb nicht weniger gut von ihm dachten.
Eigentlich war diese Sorge der einzige Grund, warum er sich am heutigen Abend hier aufhielt: Er wollte vermeiden, dass sie ihn abzupassen versuchten. Das FBI war keineswegs unfähig. Letzten Endes würden die Agenten auch hier wieder auf den Busch klopfen.
Nach allem, was der Camel Club für ihn getan hatte, wünschte Stone sich sehnlichst, seinerseits mehr für den Club tun zu können. Er hatte sogar erwogen, sich der Polizei zu stellen. Aber wer spaziert schon gerne zu seiner eigenen Hinrichtung? Stone hatte nicht die Absicht, es seinen Gegenspielern so leicht zu machen. Wenn sie siegen wollten, mussten sie sich schon ein bisschen anstrengen.
Er hatte den mitgebrachten Brief sorgfältig formuliert. Ein Geständnis enthielt das Schreiben nicht, denn damit hätte er seine Freunde in eine umso schlimmere Bredouille gebracht. Sicher, Stone steckte in einem klassischen Dilemma, aber er schuldete den anderen etwas. Er hätte wissen müssen, dass ein Leben, wie er es geführt hatte, nur zu einem einzigen möglichen Abschluss führen konnte.
Einem Abgang wie diesem.
Stone zog den Brief aus der einen Tasche, ein Messer aus einer anderen. Dann wickelte er den Brief mit einer Kordel um den Messergriff. Schließlich holte er Schwung und schleuderte das Messer aus dem kleinen Garten, in dem er Beobachtungsposten bezogen hatte, in Richtung des Häuschens. Mit dumpfem Pochen schlug die Klinge in einen Stützbalken der Veranda ein.
»Lebt wohl.«
Nun galt es nur noch einen Ort zu besuchen.
Augenblicke später zwängte Stone sich in Gegenrichtung unter dem Zaun hindurch. Er ging zur U-Bahn-Station Foggy Bottom und stieg in einen Zug. Nach der Fahrt und einem halbstündigen Fußmarsch betrat Stone einen anderen Friedhof, was ziemlich bedrückend hätte sein müssen, doch Stone machte es nichts aus. Er fühlte sich bei den Toten wohler als unter den Lebenden, denn Tote stellten nie unbequeme Fragen.
Sogar im Finstern fand er rasch das Grab, das er suchte. Er kniete nieder, wischte ein paar Blätter zur Seite und betrachtete den Grabstein.
Hier ruhte Milton Farb, das bisher einzige verstorbene Mitglied des Camel Club. Auch als Toter sollte Milton für immer Teil dieser informellen Gruppe von Verschwörungstheoretikern sein, für die es nur um eines ging: um die Wahrheit.
Zu dumm nur, dass Stone, ihr Anführer, sich nicht an diesen Grundsatz gehalten hatte.
Deshalb lag Milton Farb jetzt hier.
Verzeih mir, alter Freund. Es war meine Schuld.
Nur Stones wegen hatte der brillante, aber allzu quirlige Milton hier seine ewige Ruhe gefunden. Es hatte ihn unter dem Capitol erwischt. Ein großkalibriges Geschoss hatte ihn buchstäblich aus dem Leben gerissen. Der Schmerz, der Stone des toten Freundes wegen erfüllte, war beinahe so unerträglich wie die Trauer, die er beim Tod seiner Ehefrau empfunden hatte.
Stones Augen wurden feucht, als er sich an den tragischen letzten Abend Miltons im Besucherzentrum des Capitols erinnerte. Ihm stand noch deutlich das schreckliche Bild vor Augen, wie Milton ihn, von der Kugel getroffen, angeblickt hatte – mit großen, unschuldigen, flehentlichen Augen. Die Erinnerung an die letzten Atemzüge seines Freundes würde Stone bis an den Tag seines Todes begleiten.
Stone hatte Milton nur noch rächen können. Und das hatte er getan: Er hatte mehrere schwer bewaffnete, top ausgebildete und sehr viel jüngere Männer noch am selben Abend in den Räumlichkeiten des Besucherzentrums getötet. Doch Stone konnte sich kaum noch daran erinnern, so sehr hatte Miltons schockierender Tod alles überschattet. Außerdem hatte Stones brutaler Gegenschlag den Verlust Miltons nicht im Entferntesten wettmachen können.
Aus diesem Grund – zum Teil jedenfalls – hatte Stone am heutigen Morgen abermals getötet. Und noch immer empfand er den Verlust Miltons als ungerächt. So wie den Tod seiner Frau. Und den Verlust seiner Tochter.
Behutsam und mit äußerster Sorgfalt klaubte Stone einen Brocken Gras und Lehm aus der Grabstätte des Freundes, senkte die Blechdose in das Erdloch, breitete das Gras wieder darüber, trat es fest und beseitigte sämtliche Spuren, die darauf hingewiesen hätten, dass sich hier jemand zu schaffen gemacht hatte. Dann richtete er sich zu voller Größe auf und salutierte vor seinem toten Freund.
Wenig später schlenderte Stone zur U-Bahn und fuhr zur Union Station, wo er vom Großteil seines restlichen Bargelds eine Zugfahrkarte in den Süden erwarb. Im Bahnhof hatten mehrere Polizisten Stellung bezogen, sowohl in Uniform als auch in Zivil; keiner von ihnen entging Stones geübtem Auge. Der Großteil der Einsatzkräfte hielt sich zweifellos auf den drei örtlichen Flugplätzen auf, um den Mörder eines bekannten US-Senators und des nationalen Geheimdienstchefs abzufangen. Das allgemein verachtete amerikanische Eisenbahnnetz hingegen verdiente offenbar keine große Aufmerksamkeit, als hielten Mörder es für unter ihrer Würde, die altersschwachen Gleise zu befahren. Stone konnte es nur recht sein.
Dreißig Minuten später stieg er mit Ziel New Orleans in den Crescent. Er hatte diese Entscheidung spontan gefällt, als sein Blick auf die Anzeigetafel fiel. Der Zug hatte mehrere Stunden Verspätung, andernfalls hätte er ihn verpasst. Obwohl von Natur aus nicht abergläubisch, hatte Stone darin ein Omen gesehen. Bevor er seinen Platz aufsuchte, zwängte er sich in eine enge Toilette, rasierte den Bart ab und ließ die Brille verschwinden.
Wie er gehört hatte, gab es in New Orleans aufgrund der Verwüstungen durch Hurrikan Katrina noch immer eine große Nachfrage nach Bauarbeitern. Und Leute, die verzweifelt Arbeitskräfte suchten, fragten nicht nach so heiklen Dingen wie Sozialversicherungsnummer und festem Wohnsitz. In diesem Stadium seines Daseins wollte Stone mit Fragen oder Zahlen, die seine wahre Identität enthüllen konnten, nichts zu tun haben. Sein Plan sah vor, mit einer Menschenmasse zu verschmelzen, die nach einem Albtraum, den sie nicht zu verantworten hatte, um einen Neuaufbau rang. Stone konnte die Situation dieser Menschen gut nachvollziehen; im Grunde bemühte er sich um genau das Gleiche, nur mit dem Unterschied, dass er seinen ganz persönlichen Albtraum durch seine beiden letzten Schüsse selbst heraufbeschworen hatte.
Während der Zug durch die Dunkelheit ratterte, schaute Stone zum Fenster hinaus. Er betrachtete das darin sichtbare Spiegelbild der jungen Frau, die neben ihm saß und einen Säugling im Arm hielt. Ihre Füße standen auf einer verbeulten Reisetasche und einem Kopfkissenbezug, der anscheinend Fläschchen, Windeln und Kleidung für das Kind enthielt. Beide schliefen; der Säugling lag mit der Brust an den Busen der Mutter geschmiegt. Stone drehte den Kopf und betrachtete das Kind, sein Dreifachkinn und die knubbeligen Fäustchen. Plötzlich öffnete der Säugling die Augen und sah ihn an. Es überraschte Stone, dass er nicht quäkte; tatsächlich gab er keinen Laut von sich.
Auf der anderen Seite des Mittelgangs verzehrte ein Mann, so dünn wie eine Eisenbahnschiene, einen Cheeseburger, den er im Bahnhof gekauft hatte. Zwischen seine knochigen, von geflickten Jeans bedeckten Knie hatte er sich eine Flasche Bier geklemmt. Neben ihm hatte ein junger, hochgewachsener, gutaussehender Bursche mit braunen Locken und Dreitagebart im ansonsten glatten Gesicht Platz genommen. Er besaß den sehnigen Körperbau und die geschmeidigen Bewegungen eines Highschool-Quarterbacks, der er offenbar einst gewesen war, wie seine Studentenjacke zeigte, auf der es von Abzeichen und Aufklebern nur so wimmelte. Anhand der aufgestickten Jahreszahl erkannte Stone, dass der Bursche die Highschool seit mehreren Jahren nicht mehr besuchte – eine lange Zeit, um vergangenem Ruhm nachzuhängen. Aber vielleicht hatte er sonst nichts mehr. Auf Stone wirkte der Mann, als wäre er der Überzeugung, dass die Welt ihm alles schuldete, ihre Versprechen aber nicht eingelöst hatte. Während Stone ihn beobachtete, stand er auf, schob sich am Cheeseburger-Esser vorbei, strebte zum Heck des Waggons und entschwand durch die Verbindungstür in den hinteren Teil des Zuges.
Stone hob die Hand und tippte behutsam gegen die winzige Faust des Säuglings, der mit einem kaum vernehmlichen Gurren darauf reagierte. Das Kind hatte noch sein ganzes Leben vor sich, während Stones Leben sich dem Ende zuneigte.
Aber erst einmal mussten sie ihn kriegen. Er würde es einer Obrigkeit, die sich oft herzlos gerade gegenüber jenen Menschen zeigte, die ihr am treuesten und unter stumm erlittenen Opfern dienten, so schwer wie möglich machen.
Stone lehnte sich in den Sitz zurück und beobachtete, wie Washington in der Ferne zurückblieb, während der Zug dahinratterte.
KAPITEL 3
Joe Knox las in der kleinen Bibliothek seines Stadthauses im nördlichen Virginia in einem Buch, als das Telefon läutete. Der Anrufer wählte seine Worte sparsam, und aus langer Erfahrung unterbrach Knox ihn nicht. Nach dem Anruf legte Knox das Buch beiseite, zog den Regenmantel und die Stiefel an, nahm die Schlüssel seines verschrammten, zehn Jahre alten Range Rovers und begab sich hinaus in das hässliche Wetter, um sich mit einer ebenso hässlichen Aufgabe zu befassen.
Knox, ein Mittfünfziger, war eins achtzig groß und muskulös. Er ließ sein ausdünnendes Haar noch immer beim Frisör schneiden und glatt nach hinten kämmen. Außerdem hatte er hellgrüne Augen, die in seinem Fall das menschliche Gegenstück eines Ultraschall-Diagnosegeräts darstellten: Ihnen entging nichts. Er hielt das Lenkrad des Rovers mit kräftigen Fingern, die früher, als er noch im Dienst des Vaterlands stand, auf fast jede Art von Abzug gedrückt hatten, den es gab.
Knox fuhr durch die abgeschiedene, waldreiche Gegend, in der er lebte, nach McLean, Virginia, und von dort in Richtung Maryland. Schließlich roch er das Meer und konnte sich endlich eine Vorstellung vom Tatort machen. So etwas gehörte zu seiner alltäglichen Arbeit.
Drei Stunden später umrundete Knox ein anderes Auto, während dicke Regentropfen fielen. Carter Gray hing noch im Sicherheitsgurt, nachdem ihm offenbar die Kugel eines Weitschuss-Scharfschützengewehrs den Schädel zertrümmert und sein Leben beendet hatte. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde die Obduktion diesen Eindruck bestätigen. Während Polizei- und FBI-Teams sowie Mitarbeiter der Gerichtsmedizin umherschwirrten wie Schmeißfliegen, kauerte Joe Knox sich vor den weißen Grabstein mit der US-Flagge, mit denen jemand den Straßenrand garniert hatte. Offensichtlich hatte Gray die beiden Gegenstände gesehen und aus Neugier die Seitenscheibe gesenkt – und damit einen verhängnisvollen Fehler begangen.
Grabstein und US-Flagge. Genau wie auf dem Nationalfriedhof Arlington. Ein interessantes und möglicherweise aufschlussreiches Indiz.
An dem abgesenkten Seitenfenster erkannte Knox, dass der Wagen nicht gepanzert war. Gepanzerte Limousinen hatten eine Verglasung, die so dick war wie früher die Scheiben von Telefonzellen, und ließen sich nicht öffnen. In dieser Beziehung hatte Gray sich einen zweiten Fehler geleistet.
Du hättest eine Panzerlimousine beantragen sollen, Carter Gray. Du warst wichtig genug.
Die Geheimdienstbranche war kein Baseballspiel, das wusste Knox. Man brauchte nie mehr als zwei Versuche, um jemanden zu erledigen.
Knox spähte in die Ferne und verfolgte im Geiste die Flugbahn des Projektils an den Herkunftsort zurück. Niemand von der Begleitmannschaft hatte den Schützen gesehen, also musste Knox sich die potentielle Schussbahn so weit denken, dass Optik und Gewehrmündung für das bloße Auge unsichtbar blieben.
Tausend Meter Entfernung? Fünfzehnhundert? Und das Weichziel befand sich in einem Fahrzeug, in dem man dieses Ziel bei diesigem Licht und Nieselregen nur durch ein kaum sechzig mal sechzig Zentimeter großes Fenster ausmachen konnte. Und doch war die Kugel geradewegs ins Hirn des Opfers eingeschlagen.
Ein unglaublicher Schuss, wie man es auch dreht und wendet. Da war kein Glück im Spiel. Hier war ein Profi am Werk gewesen.
Knox richtete sich auf und nickte einem Uniformierten zu. Sein Dienstausweis baumelte an einem Trageband um seinen Hals. Nachdem alle gesehen hatten, in welchem offiziellen Rahmen er sich betätigte, war man ihm gegenüber beinahe unterwürfig geworden und machte gleichzeitig einen großen Bogen um ihn, als hätte er eine ansteckende Krankheit.
Vielleicht ist es in gewisser Weise tatsächlich so.
Der Polizist öffnete den Wagenschlag des Escalade, und Knox schaute hinein und besah sich die Leiche. Der Schuss hatte die Mitte der rechten Schläfe getroffen. Es gab keine Austrittswunde. Das Projektil steckte noch im Gehirn. Man würde es erst bei der Obduktion herausholen. Aber Knox brauchte keinen Autopsiebericht, um zu wissen, was den Mann getötet hatte. Auf Teilen des Fahrzeuginnern sah er Blut sowie kleine Stücke vom Schädelknochen. Knox bezweifelte, dass die Regierung den Wagen je wieder in Dienst nehmen würde. Wahrscheinlich würde er den gleichen Weg gehen wie John F. Kennedys Limousine. Man mochte es Pech nennen, schlechtes Karma, was auch immer, aber kein anderer VIP würde jemals den Hintern auf den Platz des Toten setzen, ob der Sitz nun sterilisiert worden war oder nicht.
Gray wirkte nicht etwa wie ein Schlafender: Er sah tatsächlich wie der Tote aus, der er war. Beim Einschlag hatte die kinetische Wucht des Projektils ihm die Brille von der Nase geschleudert mit dem Ergebnis, dass Gray nun jeden Blick zu erwidern schien, der auf ihn fiel.
Ohne den Handschuh abzustreifen, schloss Knox ihm die Lider. Er tat es aus Respekt. Er hatte Gray gut gekannt. Er war mit den Auffassungen und Methoden dieses Mannes nicht immer einverstanden gewesen, aber er hatte stets Achtung vor Gray gehabt. Er hoffte, dass Gray für ihn das Gleiche getan hätte, wäre ihre Situation jetzt umgekehrt gewesen.
Die Akten, in denen Gray in den letzten Augenblicken seines irdischen Daseins gelesen hatte, waren von der CIA bereits beschlagnahmt worden. Nationale Sicherheit stand sogar über Mordermittlungen. Knox bezweifelte, dass es zwischen dem Mord und dem, was der CIA-Chef im Moment seines Todes gelesen hatte, einen Zusammenhang gab, doch völlig auszuschließen war es nicht.
Aber wenn man in den letzten Augenblicken seines Lebens die Gedanken dieses Mannes hätte lesen können, was dann? Als er den Grabstein und die Fahne erblickt hatte?
Sein Gefühl sagte Knox, dass Gray genau gewusst hatte, wer ihn töten würde. Und möglicherweise wussten andere Leute in der CIA es auch. Falls ja, hatten sie offenbar vor, ihn seine Arbeit allein machen zu lassen. Knox fragte sich nach dem Grund, ließ den Gedanken dann aber fallen. Was man in Langley hinter verschlossenen Türen trieb, war eine heikle Angelegenheit und oft nicht zu ergründen. Verlassen konnte man sich nur auf eins: Die Tatsachen waren oft so verwickelt, wie man es in manchen Thrillern lesen konnte.
Knox wandte sich von der Leiche ab und grübelte über die Fakten nach, während er hinaus auf den Atlantik starrte.
Vor mehr als sechs Monaten war Grays Wohnsitz in die Luft gesprengt worden, er selbst nur knapp dem Tod entronnen. Auf der Hinfahrt hatte man Knox über eine abhörsichere Leitung einige Informationen übermittelt. Die Verdächtigen beim damaligen Sprengstoffanschlag galten im jetzigen Mordfall nicht als verdächtig. Diese Klarstellung kam von ganz oben, sodass Knox nichts anderes übrig blieb, als sie zur Kenntnis zu nehmen. Doch er gedachte diesen Sachverhalt im Hinterkopf zu behalten. Nach seinem Verständnis hing die Wahrheit nicht von irgendwelchen Voraussetzungen oder Bedingungen ab. Diesem Grundsatz blieb er treu – auch deshalb, weil er die Wahrheit vielleicht irgendwann als Waffe brauchte, um den eigenen Hals zu retten.
Er fuhr zu Grays Villa und unterzog das Interieur einer kurzen Besichtigung, ohne etwas Interessantes zu entdecken; dann spazierte er zu einem Kliff an der Seeseite des Grundstücks. Dort schaute er auf die tobenden Fluten der Bucht hinunter, ehe er den Blick auf die heranrückende Unwetterfront richtete, die die in der Nähe stattfindende Morduntersuchung nicht unbedingt erleichtern würde. Knox betrachtete den Baumgürtel, der sich rechts vom Haus erstreckte, und erkannte rasch, dass man auf diesem Weg zu der Landstraße gelangte, die Grays Fahrzeugkolonne benutzt hatte.
Er drehte sich zu der Klippe um.
Und stellte sich die Frage, ob es möglich sein könnte.
Setzte man voraus, dass der richtige Mann es versuchte, gab es auf diese Frage nur eine Antwort.
Ja.
Er stieg wieder in den Rover und machte sich auf die Fahrt zum zweiten Tatort.
Zum Tatort der Ermordung Roger Simpsons.
Der Bundesstaat Alabama hatte einen Senator weniger.
Und noch ohne die Umstände der Ermordung Simpsons zu kennen, wusste Knox dank seines Gespürs, dass er nur einen Mörder suchen musste.
Nur einen.
KAPITEL 4
Kaum hatte Annabelle die vordere Veranda betreten, als sie es sah. Alex Ford bemerkte es ebenfalls. Sie kamen gerade vom Abendessen bei Nathan’s in Georgetown. Das Restaurant war zu ihrem bevorzugten Treffpunkt geworden.
Annabelle zog das Messer aus dem Pfosten und entrollte den Brief. Dann schaute sie sich um, als rechnete sie damit, der Verfasser könne noch in der Nähe sein.
Sie und Alex setzten sich vor den kalten Kamin, wo Annabelle das Schreiben las. Als sie fertig war, reichte sie es Alex und wartete stumm, bis er es ebenfalls gelesen hatte.
»Er empfiehlt, dass du packst und ausziehst. Weil wahrscheinlich Leute kommen werden, um Fragen zu stellen. Wenn du möchtest, kannst du bei mir unterschlüpfen.«
»Wir wussten doch vom ersten Moment an, dass er es war, oder?«, meinte Annabelle.
Alex betrachtete den Brief. »›Ich habe in meinem Leben vieles bedauert‹«, las er vor, »›und ich habe jede Bürde getragen. Aber Miltons Tod war meine alleinige Schuld. Deshalb habe ich getan, was zu tun war, und die bestraft, die bestraft werden mussten. Doch mich selbst zu bestrafen wird mir niemals gelingen, denn keine Strafe ist hart genug. Wenigstens ist John Carr endlich tot. Das macht mich sehr glücklich.‹« Alex hob den Blick. »Klingt nach einem Mann, der getan hat, was nach seiner Überzeugung getan werden musste.«
»Er bittet uns, Reuben und Caleb zu informieren.«
»Das übernehme ich.«
»Du weißt, dass diese Männer es nicht besser verdient hatten«, sagte Annabelle. »Wegen all der Vorkommnisse, in die Finn uns in der Nacht von Miltons Tod eingeweiht hat.«
»Niemand hat das Recht, einen Mord zu begehen, Annabelle«, widersprach Alex. »Das ist Vigilantentum. Es ist verwerflich und falsch.«
»Unter allen Umständen?«
»Jede Ausnahme bringt die Regel vollständig zu Fall.«
»Das ist deine Meinung.«
»Verbrenn den Brief, Annabelle«, forderte Alex sie auf.
»Was?«
»Verbrenn ihn, bevor ich es mir anders überlege.«
»Wieso?«
»Er enthält zwar kein Geständnis, aber Hinweise. Ich kann selbst nicht glauben, dass ich so etwas sage. Verbrenn ihn. Am besten sofort.«
Annabelle benutzte ein Streichholz, um das Schreiben anzuzünden, und warf das entflammte Papier in den Kamin.
»Oliver hat mir mehr als einmal das Leben gerettet«, fuhr Alex fort. »Er war der anständigste, verlässlichste Mensch, dem ich je begegnet bin.«
»Ich wollte, er wäre geblieben, um sich mit uns auszusprechen.«
»Ich bin froh, dass er es nicht getan hat.«
»Warum?«, fragte Annabelle gereizt.
»Womöglich hätte ich ihn festnehmen müssen.«
»Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Eben hast du noch behauptet, er wäre der anständigste Mensch, dem du jemals begegnet bist.«
»Ich bin Gesetzeshüter, Annabelle. Freund oder nicht, ich habe einen Eid geschworen.«
»Aber du wusstest doch vorher, dass er schon Menschen getötet hatte, und hattest anscheinend kein Problem damit.«
»Sicher, aber das waren Liquidierungen auf Befehl der amerikanischen Regierung.«
»Und dadurch ist es in deinen Augen in Ordnung? Weil irgendein Politiker es befohlen hat?«
»Oliver war Soldat. Er war darauf gedrillt, Befehle zu befolgen.«
»Er hatte trotzdem Gewissensbisse. Denn einige der Leute, die er auf Befehl umbringen musste, waren unschuldig. Du hast selbst gesehen, wie sehr es ihn bedrückt hat.«
»Ich respektiere seine moralischen Empfindungen. Er hatte aber keine dienstliche Berufung zum Moralapostel.«
Annabelle stand auf und starrte Alex an. »Diesmal hat er zwei Kerle erledigt, die es wirklich verdient hatten, aber nun bist du plötzlich bereit, ihn festzunehmen, weil er keinen Regierungsauftrag hatte?«
»So einfach ist es nicht, Annabelle.«
Sie schüttelte sich das lange Haar aus dem Gesicht. »Doch, ist es«, erwiderte sie barsch.
»Hör mal …«
Sie ging zur Tür und öffnete sie. »Lass uns den Abend beenden, bevor wir etwas sagen, das wir nachher bereuen. Oder bevor ich etwas sage. Außerdem muss ich packen.«
»Wohin gehst du?«
»Ich lasse es dich wissen«, antwortete Annabelle in einem Tonfall, der bei Alex starke Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihres Versprechens hervorrief.
Alex machte Anstalten, etwas zu erwidern, stand dann aber ebenfalls auf. Seine Miene war düster. Ohne ein weiteres Wort ging er hinaus.
Annabelle knallte hinter ihm die Tür zu. Im Schneidersitz nahm sie vor dem Kamin Platz und betrachtete die schwarzen Fetzen der letzten Nachricht, die Oliver Stone an sie und die anderen gerichtet hatte. Tränen rannen ihr über die Wangen, als sie an den Inhalt des Schreibens dachte.
Sie blickte zur Tür. In den vergangenen Monaten waren Alex und sie sich sehr nahegekommen. Als die Ermordung Grays und Simpsons bekannt geworden war, hatten sie und Alex sofort die Wahrheit geahnt. Doch sie beide hatten über ihre Empfindungen geschwiegen – vielleicht, weil sie befürchteten, ihr unausgesprochener Verdacht, dass Stone die beiden Männer getötet hatte, würde zur Gewissheit, indem sie ihn aussprachen. Nun war dieser Verdacht zur Gewissheit geworden, und ihre unterschiedliche Einschätzung von Stones Handlungsweise hatte einen Keil zwischen sie getrieben.
Annabelle packte ihre wenigen Habseligkeiten zusammen, schloss das Friedhofsgärtnerhäuschen ab – nach ihrer Überzeugung zum letzten Mal –, schwang sich ins Auto und fuhr zu einem Hotel in der Nähe.
Im Zimmer entkleidete sie sich und legte sich ins Bett. Sie musste weg von hier. Hier hielt sie nichts mehr. Da Oliver fort war, ihr Vater nicht mehr lebte und Alex sich als anders erwies, als sie ihn eingeschätzt hatte, war sie wieder ganz auf sich allein gestellt.
Das schien ihre Bestimmung zu sein.
Ich drück dir die Daumen, Oliver Stone.
In einem war Annabelle sich vollkommen sicher: Stone brauchte alles Glück, das er bekommen konnte.
Vielleicht galt das für sie alle.
KAPITEL 5
Eigentlich hätte Joe Knox lieber daheim in seinem Stadthaus gesessen, sich ein Bier oder einen Glenlivet gegönnt und vor dem knisternden Kaminfeuer das Buch zu Ende gelesen. Aber jetzt war er hier. Der Stuhl war unbequem, die Räumlichkeit kühl und schlecht beleuchtet, das Warten unerfreulich. Sein Blick ruhte auf der Wand gegenüber, doch in Gedanken weilte er fern dieser Örtlichkeit.
Die Besichtigung des Tatorts in Roger Simpsons Haus hatte nicht allzu viel Zeit beansprucht. Wie seinen früheren Chef bei der CIA hatte der Tod auch Simpson im Sitzen ereilt – statt im Polstersitz eines Autos allerdings auf einem zur Leiter ausklappbaren Stuhl in der Küche, die nun über und über mit dem Blut des Toten bespritzt war. Der Schuss war aus einem Rohbau auf der anderen Straßenseite abgegeben worden. Der Zeitpunkt der Hinrichtung – Knox hegte die feste Überzeugung, dass es sich um nichts anderes handelte – war auf die späten Abendstunden anzusetzen. Deshalb gab es so gut wie keine Augenzeugen.
Der einzige interessante Gegenstand war die Zeitung gewesen. Simpson war durch die Morgenausgabe der ehrwürdigen Washington Post hindurch erschossen worden, und die Kugel hatte ihn mitten in die Brust getroffen. Das war ungewöhnlich. Wie im Fall Gray geschehen, zielten die meisten Scharfschützen auf das Hirn, verließen sich gewissermaßen auf den goldenen Schuss unter allen möglichen Schüssen. Zwar konnte bei Verwendung geeigneter Munition auch ein Körpertreffer tödlich sein, doch in der Welt eines professionellen Killers genoss der Kopfschuss den gleichen Ruf wie ein treuer Hund: Er ließ einen nie im Stich.
Gray in den Kopf. Simpson in die Brust. Warum der Unterschied?
Und warum bei Simpson durch die Zeitung?
Diese Fragen hatten Knox ins Grübeln gebracht. Nicht dass ein paar Zeitungsblätter die Kugel hätten ablenken können, doch der Schütze hatte mehr oder weniger raten müssen, wo genau das Projektil einschlug. Und was, wenn Simpson ein dickes Buch vor dem Brustkorb gehabt hätte oder ein Feuerzeug in der Brusttasche? Dadurch hätte der Schuss misslingen können. Und die Mehrzahl der Scharfschützen, die Knox gekannt hatte, hielten nichts vom Raten, allenfalls im Hinblick auf die Frage, wen sie als Nächsten umlegen sollten.
Doch als er die Zeitung untersuchte, war ihm klar geworden, weshalb der Schütze die Brust seines Opfers aufs Korn genommen hatte: In die Zeitung war das Foto eines Menschen geklebt worden. Das Projektil hatte der abgebildeten Person den Kopf zerstäubt. Bei genauerem Hinsehen erkannte Knox, dass der Rest des Fotos den Oberkörper einer Frau zeigte. Wer sie war, ließ sich durch keinerlei Kennzeichnung oder Beschriftung feststellen. Er hatte mit dem Zeitungsboten gesprochen und sich erkundigt, ob ihm etwas Verdächtiges aufgefallen sei, aber der Mann hatte verneint. Und einen Hausmeister oder Verwalter gab es hier nicht.
Doch der Mörder hatte das Foto in die Zeitung geklebt, da hatte Knox keinen Zweifel.
Und das wiederum konnte nur eines bedeuten: Der Mord war aus persönlichen Motiven erfolgt. Der Mörder hatte gewollt, dass Simpson sah, warum er sterben musste und wer die Tat verübte. Es war ähnlich wie mit dem Grabstein und der Fahne bei Gray.
Knox’ widerwillige Bewunderung für den Todesschützen nahm weiter zu. So genau zu zielen, dass der Schuss das kleine Foto traf, erforderte ein unglaubliches Auge, höchste Geschicklichkeit, sorgfältige Planung und ein Maß an Selbstvertrauen, das nicht einmal die professionellsten Scharfschützen besaßen.
Knox hatte die Gerichtsmedizin angewiesen, ihn zu informieren, sollte bei der Untersuchung der Schusswunde irgendetwas Ungewöhnliches entdeckt werden. Es war so gut wie sicher, dass es nicht gelingen würde, die verbrannten Überreste des Fotos zu rekonstruieren, die das Hochgeschwindigkeitsgeschoss in die Brusthöhle des Senators gejagt hatte. Aber man konnte nie wissen. Aus Erfahrung wusste Knox, dass es oft Kleinigkeiten und unerwartete Dinge waren, mit denen man einen Verbrecher zur Strecke brachte.
Er straffte sich und stellte das Nachdenken über Gewehrschüsse und Leichen ein, als er hörte, wie sich Schritte durch den schmalen Korridor näherten. Zwei Männer kamen herein, beide im Anzug, beide mit grimmigen Mienen. Einer hatte einen großen Tresoreinsatz dabei. Mit lautem Dröhnen setzte er ihn auf dem Tisch ab. Dadurch verlieh er der Situation eine zusätzliche Dramatik, die sie gar nicht mehr brauchte, wenigstens aus Knox’ Sicht.
Der ältere Mann war sehr groß und breitschultrig und hatte einen dichten weißen Haarschopf. Dennoch sah man ihm an, dass im Lauf der Jahrzehnte zahllose Krisen an ihm gezehrt und ihn zerfressen hatten. Das Leben hatte ihm nichts geschenkt, das sah man an seiner schleppenden Gangart, an jeder Falte des Gesichts und den gekrümmten Schultern. Sein Name lautete Macklin Hayes. Er war ein ehemaliger Dreisternegeneral des Heeres, der schon vor langem zum Geheimdienst gewechselt war, allerdings noch enge Verbindungen zum militärischen Nachrichtendienst pflegte. Nie hatte Knox gehört, dass jemand diesen Mann liebevoll »Mack« nannte. Auf diesen Gedanken kam man erst gar nicht.
Hayes nickte ihm zu. »Danke, Knox, dass Sie gekommen sind.«
»Ich hatte ja wohl keine Wahl, oder, General?«
»Hat irgendeiner von uns eine Wahl?«
Knox zog es vor, nicht darauf zu antworten, und wartete.
»Sie verstehen den Ernst der Lage?«, fragte Hayes.
»So gut, wie es in der kurzen Zeit möglich sein kann, seit ich an dieser Scheißsache arbeite.«
Hayes klopfte auf den Deckel des Behälters. »Alles Übrige ist da drin. Lesen Sie. Verschaffen Sie sich einen Überblick. Merken Sie sich alles. Wenn die Kuh vom Eis ist, müssen Sie es vergessen. Verstanden?«
Knox nickte bedächtig. Diese Besonderheit verstehe ich allemal.
»Haben Sie schon irgendwelche Schlussfolgerungen gezogen?«, fragte der jüngere Mann.
Knox kannte den Knaben nicht und wunderte sich über dessen Anwesenheit. Vielleicht hatte er bloß die Aufgabe, den Behälter zu tragen. Doch er hatte eine Frage gestellt und erwartete wahrscheinlich eine Antwort.
»Zwei Morde mit ausgesprochenem Hinrichtungscharakter, begangen von ein- und demselben Schützen, der sein Handwerk versteht, vermutlich ein Exsoldat, der gegen Gray und Simpson irgendeinen Groll hegte und ihnen etwas heimzahlen wollte. Er hat für Gray einen Grabstein mit Nationalflagge hingestellt und für Simpson das Foto einer Frau in die Morgenzeitung geklebt. Erst hat er den Senator erschossen und ist dann sofort nach Maryland geeilt, um Gray zu erledigen, wahrscheinlich, damit der nichts von Simpsons Tod erfährt und gewarnt wird.«
»Sind Sie sicher, dass es nicht zwei Schützen waren?«, erkundigte sich der jüngere Mann. »Und hinsichtlich der Reihenfolge?«
»Derzeit bin ich mir noch über gar nichts sicher. Sie haben nach einer vorläufigen Einschätzung gefragt, und das ist sie.«
»Und der Fluchtweg? Der Täter kann unmöglich auf der Straße entwischt sein. Da wäre er gesehen worden.«
Knox zögerte. »Er ist von der Klippe ins Meer gesprungen.«
Hayes ergriff das Wort. »Anscheinend sind Sie nicht der Einzige, der diesen Verdacht hat.«
»Wer ist der andere?«
»Lesen Sie die Unterlagen.«
In Knox’ Bauch entwickelte sich Sodbrennen, aber er schwieg auch zu dieser Antwort. »Hat Gray in den Tagen vor seinem Tod irgendwas Außergewöhnliches gesagt?«
»Ungefähr sechs Monate vor seiner Ermordung war er in ungewöhnliche Vorgänge verstrickt, aber von welcher Art sie waren, ist so geheim, dass nicht einmal ich in vollem Umfang eingeweiht bin. Wie Sie selbst wissen, hat Gray nie viel durchblicken lassen. Außerdem war er damals zeitweilig Privatmann, also sind unsere Informationen schon deshalb unvollständig. Es ist alles ein bisschen verworren.«
Knox nickte. Gray und Geheimnistuerei waren Brüder gewesen. »Gibt es einen Zusammenhang mit den einstigen Verdächtigen, die jetzt angeblich unbeteiligt sind? Ich muss gestehen, diese Mitteilung kam mir ein bisschen aus heiterem Himmel.«
»Wir gehen nicht alle mit dieser Maßgabe konform«, erklärte der Jüngere.
Knox schaute vom Jüngeren zum Alten. »Was soll das heißen? Sind den Ermittlungen Grenzen gesetzt?«
Hayes verzog das Gesicht zu einem undeutbaren Lächeln. In Las Vegas könnte der Mann, überlegte Knox, beim Pokern ein Vermögen einheimsen.
»Schwer zu sagen. Wie mein Kollege schon angemerkt hat, ist man in den Führungsetagen geteilter Meinung darüber.«
»Und was bedeutet das für mich?«
»Dass Sie vorsichtig sein müssen, Knox, sehr vorsichtig.« Hayes tippte auf den Behälter. »Ich habe einiges Material sammeln können, das Sie hier finden, darunter außerdienstliche Erkenntnisse.«
»Sie meinen Informationen, die Sie mir eigentlich gar nicht zugänglich machen dürften?« Knox vermisste sein Buch und das gemütliche Stadthaus immer mehr.
»Könnte sein.«
»Ich bin nicht scharf darauf, mir bei diesen Ermittlungen einen Genickschuss einzufangen.«
»Ich auch nicht.«
»Das ist mir kein großer Trost, Sir, denn während Sie sich den Rücken freihalten, bin ich voraussichtlich bald tot.«
»Ich möchte, dass Sie alles lesen, nach Hause fahren und nachdenken. Dann rufen Sie mich an.«
»Um Ihnen Antworten zu geben oder Fragen zu stellen?«
»Beides, will ich hoffen.«
»Wahrscheinlich hat der Täter längst das Weite gesucht.« Echte Profis setzen sich so schnell und effektiv ab, wie sie töten.
Leise trommelte Hayes mit den langen, knochigen Fingern auf die Tischplatte. Für Knox schien seine Hand in der schwachen Beleuchtung einem kleinen Kraken zu ähneln. »Vielleicht.« Hayes stand auf. Sein Begleiter tat es ihm nach: Meister und Marionette. »Lesen Sie, überlegen Sie, rufen Sie an. Schönen Abend noch, Knox. Und viel Glück.«
Knox blickte den beiden nach, bis sie im Korridor verschwanden – ein Flugzeugträger und sein getreuer Zerstörer, die durch die stürmische See der amerikanischen Geheimdienstszene dampften.
Er öffnete den Deckel des Tresorbehälters, nahm eine Handvoll Unterlagen heraus und machte sich ans Lesen.
Viel Glück, sagte die Kobra, bevor sie zubiss.
Heute war einer jener Tage, an denen Knox sich wünschte, er hätte dem Vorbild seines Vaters nachgeeifert und wäre Klempner geworden.
KAPITEL 6
Plötzlich störten Geräusche, die ganz nach einer Schlägerei klangen, Stones kurzes Nickerchen. Er zwinkerte sich wach und sah sich um. Die Frau auf dem Nebensitz beruhigte ihren weinenden Säugling. Über mehrere Sitzreihen hinweg erkannte Stone die Quelle des Lärms.
Es waren einer gegen drei, und alle Beteiligten waren Mittzwanziger, also in einem Alter, in dem Testosteronschübe regelmäßig sämtliche Sicherheitsventile überfluteten. Mehrere Passagiere riefen halbherzige Aufforderungen, die Prügelei zu beenden, doch niemand hob den Hintern vom Sitz, um einzugreifen. Stone hielt Ausschau nach dem Zugbegleiter, sah aber nirgends eine Uniform.
Den Burschen, der die Schläge einstecken musste, hatte Stone bereits im Zug bemerkt: Es war der ehemalige Highschool-Quarterback mit seinem bitteren Zorn auf Gott und die Welt. Soeben musste er eine krachende Rechte auf seine bereits geschwollene linke Wange einstecken. Einer seiner Gegner packte ihn und hielt ihn fest. Blut lief ihm aus der Nase, als er sich zu befreien versuchte. Er trat, spuckte und wand sich, konnte sich aber nicht losreißen. Schon verpasste ihm der dritte Bursche hohnlachend einen Tritt in den Unterleib, sodass Mr. Quarterback einknickte.
Okay, das reicht jetzt.
Stone sprang auf. Als der Schläger ausholte, um abermals draufloszudreschen, packte Stone dessen Handgelenk und gab dem Arm einen kräftigen Ruck, der den Burschen fast von den Füßen riss. Er fuhr herum und stierte Stone an. Sein Zorn wich plötzlicher Belustigung.
Der Junge war zwar mindestens zehn Zentimeter kleiner als Stone, aber auch fast 40 Jahre jünger und 25 Kilo schwerer.
»Habt ihr heute Freigang im Pflegeheim, alter Sack?«, spottete der Schläger und schwang die Fäuste. »Soll ich dir auch die Fresse polieren?« Er tänzelte und hüpfte auf der Stelle. An seinem Bauch klingelte Blech. Auch an seinen fuchtelnden Schwabbelarmen klimperte Leichtmetall. Nur mit Mühe konnte Stone sich ein Lachen verkneifen.
»Lasst ihn los, und alles ist in Ordnung.«
»Der Typ ist ein Falschspieler!«, krähte einer der beiden anderen, packte dem Quarterback ins Haar und zerrte dessen Kopf hoch. »Er hat uns beim Pokern beschissen.«
»Okay, und ihr habt ihm eine tüchtige Lektion erteilt. Also könnt ihr jetzt Schluss machen.«
»Willst du uns rumkommandieren, du wandelnde Leiche?«, schnauzte der Dicke, der Stone mit den Fäusten bedrohte.
»Kommt, Jungs, macht Feierabend. Ihr habt’s ihm gezeigt. Ihr habt ihn grün und blau geschlagen.«
»Aber dich noch nicht, du blöder alter Socken.«
»Ich möchte nur Frieden stiften.« Stones Blick streifte die übrigen Fahrgäste; viele von ihnen gehörten zu den älteren Semestern. »Ihr habt die Leute ziemlich übel erschreckt.«
»Interessiert uns ’n Scheiß.« Der Dicke zeigte mit dem Finger auf Stone. »So, und du wirst dich jetzt entschuldigen, Opa, weil du uns belästigt hast, und dann ziehst du Leine und setzt dich wieder hin, sonst muss ich dich nämlich in den Arsch treten. Verdammt, das könnt ich eigentlich auch so machen, weil ich Lust drauf hab!«
Der Tag war lang gewesen, und Stone hatte ohnehin schlechte Laune, weil er sich nicht einmal zehn Minuten Schlaf gönnen durfte. »Du allein?«, fragte er. »Oder helfen dir die zwei Luschen?«
Der Junge grinste. »Nun hör sich einer den alten Knacker an! Dich schaff ich allein, Opa. Ich sag dir was. Ich benutze nur eine Hand, damit es länger dauert, dir den klapprigen Arsch aufzureißen.« Er vollführte einen kurzen Haken, dem Stone auswich. »Ohooo, sieh mal an, der alte Sack kommt in Fahrt! Bist du ’n guter Tänzer, Opa?« Urplötzlich trat der Rowdy zu. Stone packte das Bein und behielt es in eiserner Umklammerung. Die Visage des Stämmigen, der auf einem Bein hopste, lief puterrot an. »Lass mich los, oder ich scheiß dir vor ’n Koffer! Lass los!«
»Du hast noch eine Chance«, sagte Stone.
Der Rüpel drosch mit der Faust zu. Und schlug daneben.
Stones Ellbogen hingegen verfehlte seine Schläfe nicht. Auch nicht die Faust, die dem Jungen das Nasenbein zerschmetterte. Der Schläger brach zusammen, stöhnte und wand sich auf dem Fußboden.
Die beiden anderen ließen vom Ex-Quarterback ab und stürzten sich auf Stone. Einer brach zusammen, als hätte eine Axt ihn gespalten, als Stones Fuß seinen Unterleib traf und sein Gesicht auf Stones Knie krachte. Der Dritte bekam die Faust, die zuerst in seine Magengrube rammte und dann als Aufwärtshaken gegen sein Kinn schmetterte, nie zu sehen. Er schlug neben seinen Kumpel auf den Fußboden des Waggons und presste stöhnend die Hände auf Bauch und Gesicht.
»Verdammt, was geht hier vor?«
Stone drehte sich um. Der Zugbegleiter kam durch den Mittelgang gerannt, Sprechfunkgerät und Fahrkartenentwerter in den Händen. Die Dienstmütze wippte auf seinem Kopf.
Bevor Stone ein Wort sagen konnte, fing einer der Lümmel, die er soeben niedergeschlagen hatte, zu zetern an. »Der alte Knacker hat uns überfallen!«
Augenblicklich meldeten sich die anderen Fahrgäste zu Wort und trugen ihre Beobachtungen des Vorfalls vor. Allerdings plapperten sie heillos durcheinander.
Der gestresste Zugbegleiter betrachtete die jämmerlichen Gestalten auf dem Fußboden und wandte sich dann Stone zu. »Sie stehen als Einziger noch«, stellte er scharfsinnig fest. »Haben Sie diese Fahrgäste zusammengeschlagen?«
»Erst nachdem ich von ihnen angegriffen wurde«, antwortete Stone. »Sie haben behauptet, der da hätte beim Pokern betrogen.« Er deutete auf den Ex-Quarterback, der auf dem Fußboden saß und sich die blutige Nase hielt. »Sie haben den Mann misshandelt und sind dann auch mir gegenüber tätlich geworden.« Er wies auf die stöhnenden Kampfunfähigen zu seinen Füßen. »Wie Sie sehen, ist das Ergebnis nicht so ausgefallen, wie sie es wohl erhofft haben.«
»Na schön«, sagte der Zugbegleiter. »Zeigen Sie mir Ihre Papiere.«
»Sie sollten sich von diesen Schlägern die Ausweise zeigen lassen. Ich bin der gute Samariter. Fragen Sie die anderen Fahrgäste.«
»Das mag ja sein, aber ich fange mit Ihnen an. Was sagen Sie nun?«
Stone hatte nicht die Absicht, dem Mann seinen Ausweis zu zeigen; er wusste, die Kontrolle würde in irgendwelchen Dateien vermerkt, wo jene Leute, die ihm ans Fell wollten, die Informationen entdecken und für ihre Zwecke nutzbar machen konnten. Außerdem war sein Ausweis gefälscht und konnte einer elektronischen Überprüfung nicht standhalten.
»Ich schlage vor, Sie fangen mit denen an. Ich setz mich wieder an meinen Platz, in Ordnung? Im Grunde habe ich mit der ganzen Sache ja gar nichts zu tun.«
»Entweder Sie weisen sich aus, oder ich verständige die Polizei, die sich dann beim nächsten Halt mit Ihnen befasst.« Der Zugbegleiter zeigte auf die jungen Männer. »Das Gleiche gilt für Sie.«
Der Ex-Quarterback stieß ein Ächzen aus und spuckte Blut.
»Er muss in ärztliche Behandlung«, meinte Stone. Er kniete sich neben den jungen Mann und legte ihm eine Hand auf die Schulter, doch der Bursche stieß sie fort.
»Verdammt noch mal, ich brauche keine Hilfe von einem wie Ihnen!«
»Ich glaube, wir müssen einen Notarzt rufen«, sagte Stone zum Zugbegleiter, wobei er sich aufrichtete.
»Wenn er ärztliche Behandlung wünscht, wird dafür gesorgt, aber ich warte noch immer auf Ihren Ausweis, Sir«, entgegnete der Amtrak-Mitarbeiter hartnäckig.
Du willst einfach nicht aufgeben, wie?
»Beim nächsten Halt steig ich aus diesem Scheißzug aus«, jammerte der Quarterback. Mit zittrigen Beinen erhob er sich.
»Soll mir recht sein«, sagte der Zugbegleiter. »Von mir aus können Sie alle aussteigen.«
»Wo halten wir denn das nächste Mal?«, fragte Stone.
Der Mann beantwortete ihm die Frage. »Und entweder weisen Sie sich jetzt aus, oder ich benachrichtige die Polizei.«
Stone überlegte einen Moment. »Wie wär’s, wenn ich beim nächsten Halt ebenfalls aussteige?«
»Meinetwegen«, sagte der Zugbegleiter, wobei er Stone eindringlich musterte; seine Miene bezeugte Argwohn. Er winkte den Burschen zu, die noch auf dem Boden hockten. »Sie setzen sich jetzt alle wieder auf Ihre Plätze und bleiben dort, oder ich sorge dafür, dass Sie ins Gefängnis wandern. Das ist mein voller Ernst.«
»Und wenn ich diesen Dreckskerl verklagen will?«, heulte der Dicke, den Stone als Ersten zu Boden geschickt hatte. Vorwurfsvoll zeigte er auf seinen Bezwinger.
»Toll. Und er«, der Zugbegleiter zeigte auf den Ex-Quarterback, »verklagt Sie.« Dann deutete er auf Stone. »Und dieser Mann kann Sie und Ihre Kumpels verklagen, denn nach allem, was ich von den anderen Fahrgästen zu hören kriege, haben Sie ihn zuerst angegriffen. Also, wie wollen Sie es haben, Sie Klugscheißer?«
Dem Stämmigen schlotterten die Hamsterbacken. »Okay, okay. Schwamm drüber.«
»Das ist das Klügste, was ich bisher von Ihnen gehört habe. Und wenn Sie noch einmal Krawall machen, dann gefälligst nicht in meinem Zug. Legen Sie sich lieber nicht mit Amtrak an, Bürschchen!« Der Zugbegleiter drehte sich um und stapfte davon.
Innerlich schäumte Stone, als er sich wieder auf seinen Platz setzte. Warum hatte er sich bloß in diese Keilerei verwickeln lassen? Nun musste er die Fahrt abkürzen.
Die Frau auf dem Nebensitz beugte sich zu ihm hinüber. »Das war sehr mutig von Ihnen. Wo haben Sie so zu kämpfen gelernt?«
»Bei den Pfadfindern«, sagte Stone zerstreut.
Sie machte große Augen. »Die Pfadfinder? Sie scherzen.«
»Vor dem Ersten Weltkrieg waren wir Pfadfinder noch richtig harte Typen, Ma’am.«
Er grinste matt, und die Frau lachte. »Der war gut«, meinte sie.
Stones Lächeln verflog.
Eigentlich nicht. Jetzt bin ich nämlich am Arsch.
KAPITEL 7
Caleb Shaw und Reuben Rhodes waren schon niedergedrückter Stimmung gewesen, bevor Alex Ford in Calebs protziger Eigentumswohnung erschien und ihnen die jüngsten Neuigkeiten mitteilte. Nun sank ihre Gemütsverfassung auf den Tiefstpunkt.
Caleb schenkte sich einen Sherry ein und stopfte sich mit Höchstgeschwindigkeit fettige Kartoffelchips in den Mund, eine seiner zahlreichen nervösen Angewohnheiten. »Wie viele Tragödien sollen wir denn noch ertragen müssen?«, rief er.
»Also hat er Simpson und Gray umgelegt?«, erkundigte sich Reuben.
»Er hat es in dem Brief nicht ausdrücklich erwähnt«, antwortete Alex, »aber es sieht ganz so aus.«
»Die Schweine hatten es verdient«, sagte Reuben trotzig.
»Trotzdem war es Mord, Reuben«, stellte Alex klar.
»Denk mal daran, was sie ihm angetan haben. Und hat einer von ihnen dafür gesessen? Verflucht noch mal, nein. Ich finde …«
Alex schien darüber diskutieren zu wollen, so, wie er es bei Annabelle versucht hatte, entschied sich dann aber dagegen.
»Was glaubst du, wo er ist?«, fragte Caleb.
»Auf der Flucht«, erklärte Alex. »Ihr solltet euch nicht wundern, wenn das FBI bei euch klingelt, um euch mit Fragen zu löchern.«
»In dem Fall weiß ich von nichts«, sagte Reuben energisch.
»Sei lieber vorsichtig«, warnte ihn Alex. »Ein Verfahren wegen Strafvereitelung kann dir ein paar Jahre Knast einbringen.«
»Ich sage nichts, was diesen Lumpen helfen könnte, Oliver zu schnappen. Und von dir erwarte ich das Gleiche, Alex.«
»Ich bin in einer etwas anderen Situation«, erwiderte Alex trotzig.
»Bist du denn nicht Olivers Freund? Hat er dir nicht das Leben gerettet?«
»Doch. Und ich habe ihm die gleiche Gefälligkeit erwiesen, falls du’s vergessen hast.«
»Und ist er nicht der Grund, weshalb man dir wegen Zerschlagung eines Spionagerings eine außerplanmäßige Beförderung gewährt hat?«
»Ich verstehe, was du mir sagen willst, Reuben.«
»Nein, offensichtlich nicht«, widersprach der Hüne, stand auf und trat vor den hochgewachsenen Secret-Service-Agenten hin. »Denn wenn du denen was erzählst, das ihnen hilft, Oliver zu erwischen, bist du ein mieser Verräter.«
»So einfach ist das nicht, Reuben. Ich bin immerhin noch Bundespolizist. Ich habe einen Eid geleistet, Recht und Gesetz zu schützen.«
»Und was denkt Annabelle über deine Einstellung?«, fragte Reuben.
»Zum Teufel, was geht das dich an?«
»Sie fand es bestimmt genauso erbärmlich wie ich, oder?«
»Leute, Leute!«, sagte Caleb beschwichtigend. »Oliver wollte ganz bestimmt nicht, dass diese Sache einen Keil zwischen uns treibt.«
»Es gibt keinen Keil, Caleb«, hielt Reuben ihm entgegen. »Es gibt nur einen richtigen und einen falschen Weg, um jemandes Freund zu sein. Und ich möchte, dass unserem Superbullen hier klar wird, auf wessen Seite er zu stehen hat.«
Alex starrte Reuben in die Augen. »Soll das eine Drohung sein?«
»Wegen Simpson und Gray musste Oliver durch die Hölle gehen. Ich bin froh, dass die Kerle tot sind! Ich hätte denen auch ’ne Kugel verpasst!«
»Dann wärst du jetzt im Knast.«