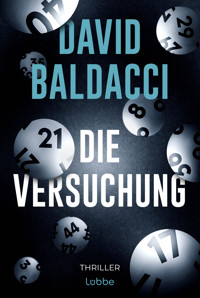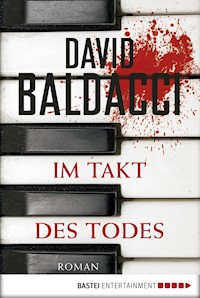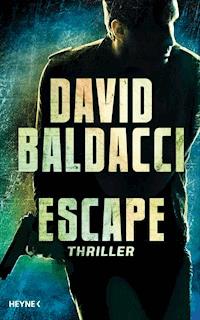7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine winterliche Reise mit Bestsellerautor David Baldacci
Eine Eisenbahnfahrt von Washington bis nach Los Angeles, wie einst Mark Twain sie unternahm, damit will Tom Langdon seine Freundin zu Weihnachten überraschen. An Bord lernt er eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Menschen kennen. Mit im Gepäck hat ein jeder von ihnen Sorgen und Träumen, Ängste und Hoffnungen. Während sich an Bord dramatische und amüsante Verwicklungen entspinnen, fährt der Zug durch das Land, hinauf zu den Rocky Mountains. Ein Unwetter zieht herauf. Wird der Zug sein Ziel erreichen? Und welches Geschenk wird die Weihnachtszeit für die Passagiere bereithalten?
David Baldacci hat eine berührende Geschichte für alle geschrieben, "die Eisenbahnzüge und Weihnachten lieben"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
INHALT
CoverÜber den AutorTitelImpressumWidmungKapitel 1DER CAPITOL LIMITED Von Washington, D.C. nach ChicagoKapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18DER SOUTHWEST CHIEF Von Chicago nach Los AngelesKapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33DanksagungÜBER DEN AUTOR
David Baldacci, geboren 1960, war Strafverteidiger und Wirtschaftsanwalt, eher er 1996 mit Der Präsident (verfilmt als Absolute Power) seinen ersten Weltbestseller veröffentlichte. Seine Bücher wurden in fünfundvierzig Sprachen übersetzt und erschienen in mehr als achtzig Ländern. Damit zählt er zu den Top-Autoren des Thriller-Genres. Er lebt mit seiner Familie in Virginia, nahe Washington, D.C.
DAVID BALDACCI
Das GESCHENK
ROMAN
Ins Deutsche übertragen von Uwe Anton
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe: The Christmas Train
Copyright © 2002 by Columbus Rose, Ltd.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2003 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Wolfgang Neuhaus/Helmut W. Pesch
Titelbild © zefa/Svenja-Foto
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförd
Alle Rechte, auch die der fotomechanischen und elektronischen Wiedergabe, vorbehalten.
ISBN 978-3-8387-1717-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Dieser Roman ist allen gewidmet, die Eisenbahnzüge und Weihnachten lieben.
KAPITEL 1
Tom Langdon war Journalist und Globetrotter. Das Vagabundenleben lag ihm im Blut. Wo andere Unbeständigkeit und Gefahr für ihr Leben sahen, fühlte Tom sich von allumfassender Freiheit und Unabhängigkeit angelockt. Den größten Teil seines Berufslebens hatte er in fremden Ländern zugebracht und über Kriege, Aufstände, Hungersnöte, Epidemien und praktisch sämtliche Katastrophen und alles Elend auf Erden berichtet. Dabei hatte Tom stets ein sehr schwieriges Ziel verfolgt, das sich jedoch in schlichte Worte kleiden ließ: Er hatte die Welt verändern wollen, indem er die allgemeine Aufmerksamkeit auf deren Schattenseiten und Missstände lenkte. Und er liebte das Abenteuer.
Doch nachdem er immer wieder über Schrecknisse, Gewalt und Tod berichtet hatte und mit ansehen musste, wie die Lebensbedingungen der Menschen sich mehr und mehr verschlechterten, war er desillusioniert nach Amerika zurückgekehrt. Auf der Suche nach einem Gegenmittel für seine hartnäckige Melancholie hatte er begonnen, gleichermaßen oberflächliche wie belanglose Artikel für Frauen- und Wohnzeitschriften, Hobby- und Gartenratgeber und ähnliche Publikationen zu schreiben. Doch nachdem er ausgiebig die Wunder des Kompostierens und die innere Befriedigung gepriesen hatte, die einem ein selbst verlegter Holzfußboden verschafft, konnte er nicht gerade von sich behaupten, die private und berufliche Erfüllung gefunden zu haben.
Nun stand Weihnachten vor der Tür, und Toms größtes und dringendstes Problem bestand darin, von der Ostküste nach Los Angeles zu gelangen, um dort die Feiertage zu verbringen. Der Grund für diese Reise war fast so alt wie die Menschheit: In LA wohnte Toms Freundin, Lelia Gibson. Sie hatte als Filmschauspielerin angefangen, doch nach Jahren unzähliger Auftritte in drittklassigen Horrorfilmen hatte sie sich aufs Synchronisieren und Sprechen von Kommentaren verlegt. Anstatt sich auf der Leinwand zerstückeln zu lassen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, lieferte sie die Stimmen für eine Reihe weithin beliebter Samstagvormittags-Cartoons. In der Kinderfernseh-Industrie war man sich einig, dass niemand die Stimmen vertrottelter Waldschrate und ähnlich putziger, schrulliger Wesen mit größerer Fertigkeit und stimmlicher Vielfalt wiederzugeben vermochte als Goldkehlchen Lelia Gibson. Als Beweis konnte sie eine Vitrine voller Trophäen und Auszeichnungen, ein exorbitantes Einkommen und einen ansehnlichen Anteil an Vermarktungsrechten vorweisen.
Tom und Lelia hatten sich während eines Nachtflugs von Südostasien in die Vereinigten Staaten kennen gelernt und auf Anhieb blendend verstanden. Anfangs hatte Tom gemeint, die beiderseitige Sympathie hätte am vielen Alkohol gelegen, den sie konsumiert hatten, doch als die Wirkung zwei Stunden nach der Landung in Los Angeles verflog, war Lelia noch immer sehr attraktiv für Tom – wenn auch ein wenig verrückt und exzentrisch –, und auch Lelia schien sich noch immer von Tom angezogen zu fühlen. Er blieb über Nacht in Kalifornien, sodass sie einander noch besser kennen lernten. Einige Zeit später besuchte Lelia ihn an der Ostküste; dann flog Tom zu ihr an die Westküste, woraus sich eine rundum zufrieden stellende Zwei-Küsten-Beziehung entwickelte.
Es mag einem seltsam erscheinen, dass eine erfolgreiche Hollywood-Millionärin sich in einen nomadisierenden Zeitgenossen verknallt hatte, der Reisepässe verbrauchte wie andere Menschen Papiertaschentücher, der in dreißig Sprachen fluchen konnte und der finanziell ständig auf wackligen Beinen stand. Doch Lelia hatte die Männer in ihrer unmittelbaren Umgebung satt. Wie sie es einmal diplomatisch ausdrückte: Sie alle waren verlogener Abschaum und absolut unzuverlässig. Tom aber sei ein Zeitungsmensch, erklärte Lelia, und habe von daher zumindest gelegentlich mit der Wahrheit zu tun. Außerdem liebte Lelia sein auf verwegene Art gutes Aussehen. Vermutlich glaubte sie, die tiefen Furchen in Toms Gesicht seien die Spuren abenteuerlicher Reportagen, die er, von Kugeln umschwirrt, in schwülfeuchten Urwäldern und auf glutheißem Wüstensand gemacht hatte. In Wahrheit musste Tom den Kopf zwecks Befolgung örtlicher Sicherheitsvorschriften viel häufiger in den Sand stecken.
In atemlosem Staunen lauschte Lelia, wenn Tom ihr von den weltbewegenden Ereignissen erzählte, über die er berichtet hatte. Er seinerseits verfolgte voller Bewunderung die Professionalität, mit der Lelia ihre Cartoonstimmen-Karriere vorantrieb. Außerdem lebten sie nicht das ganze Jahr zusammen – ein für Tom entscheidender Vorteil, blieb es ihm und Lelia auf diese Weise erspart, die ungezählten Schwierigkeiten zu meistern, mit denen Paare sich herumschlagen mussten, die einen gemeinsamen Haushalt führten.
Er war einmal für kurze Zeit verheiratet gewesen, hatte aber keine Kinder. Heute würde seine Ex-Frau nicht einmal ein R-Gespräch von ihm entgegennehmen, wenn er auf der Straße läge und verblutete. Tom war einundvierzig und hatte vor zwei Monaten seine Mutter durch einen Schlaganfall verloren; sein Vater war bereits mehrere Jahre vorher gestorben. Als Einzelkind war er nun ganz allein – und das hatte ihn zum Nachdenken gebracht. Die Hälfte seines Erdendaseins war verstrichen, und was hatte er vorzuweisen? Eine gescheiterte Ehe, keine Nachkommen, eine eher lockere Beziehung mit einer kalifornischen Synchronstimmen-Königin, eine LKW-Ladung Zeitungsartikel und ein paar Journalistenpreise. Ganz gleich, wie man es betrachtete, alles in allem war es eine armselige Rechtfertigung für seine Existenz.
Tom hatte einmal die Gelegenheit gehabt, mit einer anderen Frau ein anderes und schöneres Leben zu führen, doch die Beziehung war unerklärlicherweise in die Brüche gegangen. Inzwischen war ihm mit schmerzlicher Gewissheit klar, dass es der größte Fehler seines Lebens gewesen war, Eleanor Carter nicht geheiratet zu haben. Trotzdem fuhr Tom – grundsätzlich ein aktiver Mensch und erneut von Fernweh getrieben – mit der Eisenbahn zu Weihnachten nach LA und seiner Geliebten Lelia.
Warum mit dem Zug, könnte man fragen, wo es doch jede Menge günstige Flüge gab, mit denen er sein Ziel in einem Bruchteil der Zeit erreicht hätte. Nun, ein normaler Mensch kann nur eine begrenzte Anzahl der auf Flughäfen vorgeschriebenen Sicherheitschecks mit widerwärtigen Detektorstäben ertragen, die ihm in geheiligte Körperregionen geschoben werden, oder mit der Aufforderung, vor Fremden die Hose herunterzulassen, oder mit dem Durchwühlen des Handgepäcks. Irgendwann platzt jedem der Kragen, so wie Tom auf dem Flughafen La Guardia, wo er in die Luft gegangen war wie der Vesuv beim Untergang Pompejis.
Tom war gerade aus Italien eingeflogen, wo er für eines seiner derzeit bevorzugten, eher oberflächlichen Themen recherchiert hatte. Diesmal war es um die Weinherstellung gegangen, und um die Mühen eines Schnellkurses über Bodenqualität und Traubenfäule leichter ertragen zu können, hatte Tom mehr vom Gegenstand seiner journalistischen Untersuchungen konsumiert, als ihm gut getan hatte. Deshalb war er müde, verkatert und missgelaunt gewesen. Er hatte nur drei Stunden im Apartment eines Freundes in New York geschlafen, ehe er zum Flughafen gefahren war, um eine Maschine nach Texas zu nehmen, wo er einen Artikel über Teenager-Schönheitswettbewerbe auf dem Lande schreiben sollte. Tom hatte den Job angenommen, weil einen gestandenen Reporter wie ihn so schnell nichts mehr schrecken konnte.
Jedenfalls war in der Sicherheitsschleuse am Flughafen La Guardia der Suchstab gegen diverse empfindliche Teile von Toms Anatomie geklatscht, die zu berühren für besagten Suchstab tabu war, sei es nun in freundlicher Absicht oder aus anderen Gründen. Währenddessen war es einem anderen Sicherheitsmenschen gelungen, jeden – aber auch wirklich jeden – Gegenstand aus Toms Koffer aufs Transportband zu kippen. Hilflos hatte Tom mit ansehen müssen, wie seine persönlichsten Utensilien vor den neugierigen Blicken plötzlich überaus interessierter, wildfremder Menschen vorüberglitten.
Wie um diesem unerquicklichen Vorfall zu einem grandiosen Finale zu verhelfen, wurde Tom davon in Kenntnis gesetzt, dass aufgrund seiner Identität, seiner Haarfarbe, der Wahl seiner Kleidung oder der Form seiner Nase ein Großalarm ausgelöst worden sei. (Was genau zu beanstanden war, hatte man ihm nicht erklären können.) Statt nach Dallas zu fliegen, müsse er sich daher der Gesellschaft einer ganzen Kompanie Angehöriger diverser Organisationen wie des FBI und der CIA, der Drogenfahndung und der New Yorker Polizei erfreuen, und zwar für eine nicht näher genannte Zeitspanne. Als unbestimmter Hinweis stand die Angabe »fünf bis zehn Stunden« im Raum. Dies – in Verbindung mit der unfreundlichen Manipulation intimer Körperstellen – überschritt für Tom deutlich die Grenze zum Erträglichen. Und so kam es zum unvermeidlichen Ausbruch, und die Lava schoss hervor.
Tom Langdon maß eins fünfundachtzig und schleppte zwei Zentner kräftiger und explosiver Muskeln mit sich herum. Außerdem drang ihm echter Rauch aus den Ohren. Zum Vulkanausbruch gehörte außerdem, dass er in einer Sprache brüllte, die er üblicherweise im Umkreis von vier Meilen um jede Kirche niemals in den Mund nehmen würde, als er sich auf die Sicherheitsmannschaft stürzte, den verdammten Suchstab packte und mittendurch brach. Wenngleich der Jubel und die Hochrufe anderer Passagiere, die gehört und gesehen hatten, wie übel ihm mitgespielt worden war, Toms Laune spürbar besserte, war er an diesem Tag nicht allzu stolz auf seinen Gefühlsausbruch.
Dankenswerterweise hatte die Strafrichterin, vor der Tom zu erscheinen hatte, vor kurzem ähnlich übergründliche Flughafen-Sicherheitsmaßnahmen über sich ergehen lassen müssen, sodass sie und Tom, nachdem er seine Aussage gemacht hatte, einen viel sagenden, wissenden Blick wechselten. Hinzu kam, dass der Alarm, der an der Sicherheitsschleuse ausgelöst worden war, sich als eindeutig falsch erwiesen hatte. Daher bekam Tom nur eine strenge Verwarnung und die Anweisung aufgebrummt, an einem Gewalt-Kompensationskurs teilzunehmen, was er auch vorhatte – aber erst, wenn seine schier unstillbare Gier verflogen war, den Burschen mit dem Suchstab zu Hackfleisch zu verarbeiten.
Die andere Folge seines Ausbruchs war jedoch das Verbot, in den nächsten zwei Jahren irgendein Flugzeug zu betreten, das innerhalb der Vereinigten Staaten unterwegs war. Tom hätte nie damit gerechnet, dass eine solch drakonische Strafe überhaupt möglich war – bis man ihm den entsprechenden Paragraphen in der mikroskopisch kleinen Schrift der Beförderungsbedingungen der Fluglinie zeigte, direkt unter dem ebenso winzigen Abschnitt mit der Überschrift: »Haftungsgrenze für verloren gegangenes Reisegepäck – fünfzig Dollar«.
Und in diesem Moment kam Tom die Erleuchtung: Kein Flugzeug mehr benutzen zu können – seine bisher übliche, weil unabdingbare Art zu reisen – war ein Omen. Es musste so etwas wie ein Zeichen Gottes sein. Deshalb würde er für die Reise nach Los Angeles den Zug nehmen. Er würde eine Geschichte darüber schreiben, wie es war, in der Weihnachtszeit auf Schienen von Küste zu Küste zu rollen. Und abgesehen davon, dass er die Feiertage mit Lelia verbringen konnte, hatte er ein grandioses Motiv für eine solche Reise: Tom zählte zu dem Zweig der Langdon, der in Elmira im Staate New York ansässig war. Wer in der Literaturgeschichte bewandert ist, weiß vielleicht, dass zu den Elmira-Langdons auch jene reizende, unverwüstliche, letztendlich jedoch aus eigener Entscheidung tragische Olivia Langdon zählte, die sich bleibenden Ruhm erwarb, indem sie jenen geschwätzigen Erzähler, zum Jähzorn neigenden Zeitgenossen und produktiven Schriftsteller heiratete, den seine Freunde als Samuel Clemens kannten und der als Mark Twain zu Weltruhm gelangte.
Tom wusste von dieser familiären Verbindung, seit er alt genug war, um seinen Namen in Blockbuchstaben zu schreiben. Diese Verbindung hatte ihn stets davon träumen lassen, sich seinen Lebensunterhalt mit Worten zu verdienen. Denn auch Mark Twain war Journalist gewesen. Er hatte in Nevada angefangen, beim Territorial Enterprise in Virginia City, ehe er zu Ruhm und Reichtum gelangte – bevor er dann Bankrott ging, um später erneut zu Ruhm und Reichtum zu gelangen.
Tom seinerseits war zweimal von Terroristengruppen gekidnappt und ein halbes Dutzend Mal um ein Haar getötet worden, als er über zahllose Gefechte und Kriege, Staatsstreiche und Revolutionen berichtete, mit denen »zivilisierte« Gesellschaften ihre Differenzen austragen und beilegen. Tom hatte erlebt, wie Hoffnung durch Terror, Terror durch Wut und Wut durch – nun, durch nichts ersetzt wurde. Die Wut schien immer gegenwärtig zu sein und allen ständig teuflische Probleme zu bereiten.
Zwar hatte Tom bedeutende Preise gewonnen, doch nach eigener Einschätzung war er Journalist, kein Schriftsteller. Er war kein Mann, der die Fähigkeit besaß, erinnerungswürdige Prosa zu schaffen, die mit ihrer Jahrhunderte überdauernden Kraft unverrückbar und in erhabener Schönheit dastand. Er war kein Mark Twain. Aber schon diese unbedeutende verwandtschaftliche Verbindung zum Schöpfer von Huckleberry Finn, Leben auf dem Mississippi und Ein Yankee aus Connecticut an König Artus’ Hof – zu einem Schriftsteller, dessen Werk zeitlos war – sorgte dafür, dass Tom sich wunderbarerweise, wenn auch ein wenig eitel, als etwas Besonderes fühlte.
Kurz bevor Toms Vater starb, hatte er seinen Sohn gebeten, etwas zu beenden, das Mark Twain der Legende zufolge nie geschafft hatte. Wie Toms Vater erzählte, hatte Twain, der wahrscheinlich mehr gereist war als alle seine Zeitgenossen, während seiner späteren, den so genannten dunkleren Lebensjahren einst eine weihnachtliche Eisenbahnfahrt quer über den Kontinent unternommen. Offensichtlich wollte er angesichts der Tragödien, die ihn und seine Familie heimgesucht hatten, in der Welt noch einmal etwas Schönes, Gutes sehen. Angeblich hatte er sich umfangreiche Notizen über diese Reise gemacht, sie aus irgendeinem Grund aber nie zu einer Geschichte verarbeitet. Genau darum war Tom von seinem Vater gebeten worden: Mach die Eisenbahnfahrt, mein Sohn, schreib die Geschichte, beende, was Mark Twain nicht beendet hat, und mach dem Langdon-Zweig der Familie alle Ehre.
Damals hatte Tom gerade eine hektische vierundzwanzigstündige Flugzeug-Odyssee aus Übersee hinter sich gebracht, um seinen Dad noch einmal zu sehen, ehe dieser starb. Als Tom die gemurmelte Bitte seines Vaters hörte, verschlug es ihm die Sprache. Zu Weihnachten in einer Eisenbahn quer durchs Land fahren, um etwas zu beenden, das Mark Twain angeblich nicht beendet hatte? Anfangs hatte Tom geglaubt, sein Vater habe in den letzten Zügen gelegen und fantasiert; deshalb war der Wunsch von Langdon senior bisher unerfüllt geblieben. Nun aber, da Tom sich auf dem heimatlichen Kontinent nicht mehr per Flugzeug fortbewegen konnte – es sei denn, man hätte ihm die Fingerabdrücke abgenommen und ihm Handschellen angelegt –, würde er endlich die Eisenbahnfahrt für seinen alten Herrn machen. Und vielleicht auch für sich selbst.
Auf fast dreitausend Meilen Amerika würde er versuchen, sich selbst zu finden. Er würde diese Reise in der Weihnachtszeit unternehmen, weil sie allgemein als Zeit der Erneuerung galt und für Tom die vielleicht letzte Chance war, seinem Leben, das er so sehr verpfuscht zu haben schien, doch noch zu einer gewissen Bedeutung zu verhelfen.
Er würde es auf jeden Fall versuchen.
Hätte Tom gewusst, wie nachhaltig das Ereignis, das ihm zwei Stunden nach Besteigen des Zuges widerfuhr, sein Leben verändern sollte, wäre er wohl lieber zu Fuß nach Kalifornien gegangen.
KAPITEL 2
Als Tom vor der Union Station in Washington, D.C., wo seine Reise begann, aus dem Taxi stieg, dachte er an die wenigen Eisenbahnfahrten, die er innerhalb der Vereinigten Staaten unternommen hatte. Sie alle hatten ihn entlang des Nordostkorridors geführt – auf Strecken zwischen Washington, New York und Boston –, mit modernster Amtrak-Technik, den Acela-Hochgeschwindigkeitszügen. Schnell, schnittig und geräumig, konnten diese Züge es durchaus mit ihren europäischen Vettern aufnehmen. Sie verfügten über raffinierte Glastüren, die aufglitten, sobald man sich ihnen näherte, wodurch Tom sich stets an die Kommandobrücke des Raumschiffs Enterprise erinnert fühlte. Und in der Tat – als er das erste Mal mit dem Acela fuhr und die Türen sich automatisch für ihn öffneten, hielt er unwillkürlich nach einem Vulkanier in der Dienstuniform der Sternenflotte Ausschau.
Tom hatte ein Schlafwagenabteil im Capitol Limited reserviert, der ihn von D.C. nach Chicago bringen würde. Allerdings musste er einen weiteren Fernzug benutzen, um an die Westküste zu gelangen: Der Capitol Limited bewältigte das erste Teilstück, und der ehrwürdige Southwest Chief befuhr den zweiten und viel längeren Abschnitt. Der Capitol Limited hatte eine sagenumwobene Geschichte, da er Teil der berühmten Baltimore- und Ohio-Linie war. Die B&O war die erste zivile Eisenbahngesellschaft in den Vereinigten Staaten gewesen und konnte auch für sich in Anspruch nehmen, die erste Linie gewesen zu sein, die Fahrgäste befördert hatte.
Der »Cap«, wie der Limited liebevoll genannt wurde, hatte schon immer als stilvollster und elegantester Fernreisezug der USA gegolten. Er hatte sich früher eines Speisewagens rühmen können, in dem Gerichte wie Hummer Newburg auf kostbarem Porzellan aufgetragen worden waren; die Getränke wurden in echten Kristallgläsern ausgeschenkt, und es gab spektakuläre zweistöckige Aussichtswagen, von denen man aus hoher Warte beobachten konnte, wie die Landschaft vorüberzog. Außerdem zog der Cap die riesigen Pullman-Waggons mit den legendären Pullman-Begleitern, die gewaltige Trinkgelder einstrichen, wie man sich erzählte. In seiner langen Geschichte hatte der Cap Könige und Prinzen, Präsidenten und Filmstars, Politiker und Industriemagnaten von Chicago nach D.C. und zurück befördert. Die Geschichten, die von diesen Reisen erzählt wurden, machten einen großen Teil der Legenden aus, welche die Eisenbahn umrankten. Tom hätte eine steile Karriere als Gesellschaftsreporter machen können; er hätte nichts anderes tun müssen, als über die frivolen Späße und Abenteuer der Fahrgäste auf dieser Strecke zu schreiben.
Aufgrund der familiären Verbindung und des großen Interesses seines Vaters an Mark Twain hatte Tom sich in das Leben, das Werk und den Witz des Schriftstellers vertieft. Als Vorbereitung auf seine Transkontinentalreise hatte er noch einmal Die Arglosen im Ausland gelesen, Twains Schilderung einer fünf Monate währenden Fahrt auf dem Dampfschiff Quaker City von Europa ins Heilige Land. Für Tom war es eins der spaßigsten und respektlosesten Reisebücher, die je geschrieben worden waren. Wenn man sich Sam Clemens – damals eine grobknochige Erscheinung frisch aus dem Wilden Westen und noch weit entfernt von dem weltberühmten, feinsinnigen Vertreter der schreibenden Zunft, zu dem er sich später entwickeln sollte – in Gesellschaft einer Schiffsladung frommer Bewohner des Mittleren Westens auf ihrem ersten Ausflug in die Alte Welt vorstellen kann, wird schnell deutlich, welche ungeahnte Konstellationen sich daraus ergeben konnten. Tom ging zwar nicht nach Übersee, doch in vieler Hinsicht kam er sich wie ein Pilger im eigenen Land vor; denn ironischerweise hatte er von der gesamten restlichen Welt mehr gesehen als von Amerika.
Der Capitol Limited würde D.C. um genau 16:05 Uhr verlassen, zwischen Washington und Chicago zwölfmal halten und am nächsten Morgen pünktlich um 9:19 Uhr in der Windy City eintreffen. In Chicago hatte Tom Aufenthalt bis zum Nachmittag; dann würde er in den Southwest Chief steigen und nach LA weiterfahren. Es war ein guter Plan, und er brachte ihn mehr in Schwung, als ein Artikel über die beste Methode, die Stechpalme im eigenen Garten zu beschneiden, oder den günstigsten Zeitpunkt, die heimische Sickergrube auszupumpen, es je vermocht hatte.
Tom holte die Fahrkarten vom Schalter, vertraute seine Skiausrüstung dem Angestellten vom Gepäckservice an – Lelia und Tom wollten die Weihnachtsfeiertage auf den bestens präparierten Schneehängen von Tahoe verbringen – und bewunderte die Pracht der Union Station, die beinahe der Abrissbirne zum Opfer gefallen wäre, ehe sie wieder zum Leben erweckt worden war. Ende der Sechziger- bis Anfang der Siebzigerjahre hatte das Gebäude als Nationales Besucherzentrum gedient – im Grunde bloß eine armselige Dia-Schau in einer Riesenbruchbude, die keiner mehr besuchte. Nach dieser als Verlust abzuschreibenden Investition von 30 Millionen Dollar wurde das besucherlose Besucherzentrum bis auf einen winzigen und an vielen Stellen undichten Teil des Gebäudes geschlossen – einen Teil, in dem man tatsächlich in einen Zug steigen konnte.
Im Jahre 1945, bei der Rückkehr aus dem Zweiten Weltkrieg, war Toms Vater auf dem Heimweg durch dieses Bahnhofsgebäude geschritten. Als Tom nun durch die reichhaltig verzierten, großzügigen Marmorhallen schlenderte, stellte er sich vor, wie sein Vater voller Optimismus in die Sicherheit des Zivillebens zurückgekehrt war, nachdem er mitgeholfen hatte, die Welt vor der Tyrannei zu bewahren – mit nicht mehr als einem Gewehr und jugendlichem Schwung. Irgendwie erschien es passend, dass Tom seine Reise ausgerechnet hier begann, da sein Vater an dieser Stelle ein Leben abgeschlossen und ein neues angefangen hatte. Was das betraf, konnte der Sohn nur hoffen, es dem Vater ähnlich erfolgreich nachzumachen.
Tom nahm sich ein paar Minuten Zeit, um sich die beeindruckende, weihnachtlich geschmückte Modelleisenbahn anzuschauen, die am westlichen Ende der Haupthalle aufgebaut worden war. Dort wimmelte es von Kindern und Erwachsenen, die von den Modellzügen angelockt wurden, welche bis ins kleinste Detail ihren großen Vorbildern nachgebaut waren und durch sorgfältig gestaltete städtische und ländliche Szenerien flitzten. Eisenbahnzüge hatten unleugbar eine starke nostalgische Anziehungskraft, der sich nicht einmal jene Amerikaner entziehen konnten, die noch nie in einem solchen Zug gesessen hatten. Bei diesem Gedanken musste Tom unwillkürlich grinsen, während die kleinen Waggons auf ihren winzigen Gleisen vorüberratterten.
Der Cap würde in Kürze zum Einsteigen freigegeben werden; daher begab Tom sich in die Abreisehalle. Wenngleich in manchen Bahnhöfen eine gründliche Gepäckkontrolle vorgenommen wurde, konnte man hier noch in praktisch letzter Minute erscheinen und in den Waggon steigen. Es gab keine Sicherheitskontrollen, keine aufdringlichen Detektorstäbe und keine Fragen von der Sorte, ob man einem Fremden gestattet habe, einem eine handliche Atombombe ins Handgepäck zu legen, während man auf der Herrentoilette war – als würde man eine solche Information freiwillig preisgeben! Anders als am Flughafen stieg man hier einfach ein und fuhr mit. In der modernen Welt der unzähligen Regeln und Vorschriften war diese Verfahrensweise überaus erfrischend.
Tom suchte sich einen Sitzplatz in der Wartehalle des Cap und machte sich daran, seine Mitpassagiere zu studieren. Als er mit dem Acela nach New York gefahren war, waren fast alle Fahrgäste Geschäftsleute gewesen, elegant gekleidet und ausgestattet mit sämtlichen modernen Waffen, die Wirtschaftskonzerne ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellten: Handys, Palm Pilots, Laptops, Earsets, Laserpointern, plutoniumbetriebenen Technospielereien und Kombinationen aus separater Festplatte und Mini-PC in Brillenform. Es waren Leute mit einer Mission, begierig, endlich loszufahren, und als die Türen sich öffneten, um die Massen einsteigen zu lassen, stürmten sie wie besessen den Zug. Tom wurden beinahe die Kleider vom Leib gerissen, weil er nicht schnell genug war. Eine kleine, aber zu allem entschlossene Top-Managerin attackierte ihn, als wäre er die böse Konkurrenz, wobei sie das offenbar einzige Ziel verfolgte, Tom die Eingeweide herauszureißen.
Die Gruppe, die auf den Cap wartete, war um einiges bunter. Da waren weiße Amerikaner, schwarze Amerikaner, eingeborene Amerikaner, Muslime in traditioneller Kleidung, Amerikaner asiatischer Herkunft – eine hübsche Kollektion ethnischer Zugehörigkeit und Herkunft, ziemlich gleichmäßig aufgeteilt in Männlein und Weiblein.
Ein hübsches junges Paar, das neben Tom saß, trank Cola light, hielt Händchen und wirkte äußerst nervös. Vielleicht war dies ihre erste größere Reise. Tom war in jungen Jahren so oft unterwegs gewesen, dass er ihre Unsicherheit und Unruhe sehr gut nachvollziehen konnte. Zu seiner anderen Seite saß ein älterer Geistlicher, der die Füße auf seine Reisetasche gelegt hatte und ein Nickerchen machte.
Dem Priester gegenüber hatte sich eine schlanke Frau mit ausgesprochen kantigen äußeren Formen niedergelassen, eher ein geometrisches Gebilde aus Haut und Knochen. Ihr Alter konnte Tom nur erahnen, da sie einen langen bunten Schal einem Turban gleich um den Kopf geschlungen hatte. Sie trug Holzschuhe, so groß wie Fünfzehn-Kilo-Hanteln. Auf dem Sitz neben ihr waren Tarotkarten ausgebreitet, die sie eingehend studierte. Sobald jemand an ihr vorbeiging, schaute sie mit einem Blick auf, der zu sagen schien: »Ich weiß alles über dich.« Es konnte einem ein bisschen auf die Nerven gehen. Tom hatte sich mal von einem alten Mann auf den Virgin Islands die Hand lesen lassen. Der Alte hatte Tom ein langes Leben mit einem Stall voller Kinder, einer liebenden Ehefrau und allen denkbaren Annehmlichkeiten prophezeit. Tom hatte oft daran gedacht, den Scharlatan noch einmal ausfindig zu machen und sein Geld zurückzuverlangen.
Er beobachtete eine ältere Dame, die sich mittels einer Gehhilfe vorwärts bewegte. Sie erinnerte ihn an seine Mutter. Nach ihrem Schlaganfall hatte sie nicht mehr sprechen können; deshalb hatte Tom ein eigenes System der Verständigung entwickelt. Er hatte ein Foto auf ihre Brust gelegt, das sie als junge Frau und ihn als Kind zeigte, und sie hatte es mit ihrer gesunden Hand ergriffen. Das bedeutete, dass alles in Ordnung war und dass sie noch immer am Leben um sie her teilnahm. Nie würde Tom vergessen, wie er ihr das Foto gegeben und acht Stunden lang darauf gewartet hatte, dass sie danach griff. Sie tat es nicht. Am Tag darauf war sie gestorben.
Ein paar Minuten später nahmen Tom und die anderen Passagiere ihr Gepäck und begaben sich auf den Bahnsteig. Der Capitol Limited rief nach ihnen.
KAPITEL 3
Draußen war es bitterkalt, und die dicken Wolken verhießen Schnee oder zumindest Schneeregen. Bei einem solchen Wetter mussten Flugpassagiere meist mit Startverzögerungen und vereisten Tragflächen rechnen, doch für den unerschütterlichen Cap hatten solche Unbilden der Witterung keine Bedeutung – sein Ziel hieß weiterhin Chicago. Toms Lebensgeister unternahmen einen Höhenflug; der Beginn jeder Reise ließ seinen Adrenalinspiegel gewaltig steigen. Sein letzter veröffentlichter Artikel – er war in einem Gesundheitsmagazin erschienen – hatte die wundersame Wirksamkeit einer sechswöchigen Diät behandelt, die ausschließlich aus reifen Pflaumen und der ständigen unmittelbaren Nähe zur nächsten Toilette bestand. Deshalb war Tom jetzt geradezu begierig auf alles, was auch nur halbwegs ein Abenteuer zu werden versprach.
Er ging zum vorderen Zugende und sah die beiden dieselelektrischen Lokomotiven, die den Cap ziehen würden. Er hatte einiges über diese Ungetüme gelesen. Es waren P-42er von General Electric, jeweils fantastische 130 Tonnen schwer und ausgestattet mit 16 Zylindern, die 4250 PS erzeugten. Während Toms Blick auf diesen mächtigen Lokomotiven ruhte, stellte er sich vor, wie wirkungsvoll sie auf dem verstopfen Washingtoner Autobahnring einzusetzen wären: Was eine P-42 nicht überholen konnte, rollte sie platt.
Als er auf einem Nebengleis zurückging, erblickte er einen alten, jagdgrünen Eisenbahnwaggon, der sein Interesse weckte. Ein Amtrak-Angestellter hielt sich in der Nähe auf. Tom erkundigte sich bei ihm, um was für einen Waggon es sich handelte. »Das ist der alte Eisenbahnwaggon von Franklin D. Roosevelt, der Marco Polo, Zug Nummer sieben«, antwortete der Eisenbahner. »Er gehört jetzt der Norfolk and Southern. Dort, auf dem Gleis, bewirten sie immer ihre VIPs.«
Während sie den Wagen betrachteten, hielt eine Stretchlimousine unter dem Fußgängertunnel unweit des ehemaligen Roosevelt-Waggons.
Tom zeigte auf die Limousine. »Gibt Roosevelt heute ein frühes Abendessen? Mal wieder mit Churchill und Stalin?«, fügte er mit einem Grinsen hinzu.
Der Mann verstand den Witz nicht. »Nee, das ist irgendein hohes Tier, das mit dem Cap Limited fährt. Die bringen die Promis immer auf diesem Weg her. Unter dem Bahnhof ist ’ne Rampe, da kann die Limousine dann wieder rausfahren. Wir bieten diesen Service, wenn Fahrgäste unbemerkt bleiben wollen, ähnlich wie auf Flughäfen, wo schon mal Filmstars ohne Aufsehen in die Maschinen geschmuggelt werden.«
»Wer ist denn dieses hohe Tier, das in meinen Zug steigt? Wahrscheinlich irgendein Politiker, stimmt’s?«
Der Mann sah Tom kopfschüttelnd an. Er schien ein Eisenbahnveteran zu sein und konnte sicherlich jede Menge sensationelle Geschichten erzählen, wenn Tom nur die Zeit gehabt hätte, ihm zuzuhören. »Wenn ich Ihnen das verraten würde, wär’s ja kein Geheimnis mehr, oder?«
Tom wartete noch ein paar Sekunden, um zu sehen, wer aus der Limousine stieg, doch niemand ließ sich blicken. Allerdings waren die Aussichten, den Betreffenden irgendwann doch noch zu Gesicht zu bekommen, sehr günstig, denn sobald der Star sich im Zug befand, würde er Schwierigkeiten haben, sich ständig zu verstecken. Was brauchte ein Reporter mehr als einen Zug in voller Fahrt, einen Kugelschreiber, Papier, ein gutes Fernglas und vielleicht noch die Zusicherung, vor gerichtlichen Klagen verschont zu werden, um jeden Tag mindestens einen VIP an die Öffentlichkeit zu zerren?
Diesmal bestand die Anordnung des Cap – in der Eisenbahnersprache »Wagenstand« genannt – aus zwei Lokomotiven, einem Gepäckwagen, drei Personenwagen, einem Speisewagen, zwei Schlafwagen und einem kombinierten Liege- und Übergangswagen. Im Übergangswagen war der größte Teil des Zugbegleitpersonals untergebracht. Der Wagen verfügte über verschiedene Treppen und Türen, die es ermöglichten, von den Doppelstock-Waggons in die normalen, einstöckigen Waggons zu gelangen – daher die Bezeichnung »Übergangswagen«. Tom ging weiter bis zu einem Schlafwagenbegleiter, dem er seine Fahrkarte zeigte.
»Einen Schlafwagen weiter, Sir. Regina wird sich um Sie kümmern«, erklärte der Angestellte.
Tom setzte seinen Weg fort. Regina stand vor einem imponierend großen, ungefähr fünf Meter hohen, doppelstöckigen Eisenbahnwaggon, der in der Amtrak-Sprache »Superliner« genannt wurde. Diese Superliner waren die schwersten Personenwaggons der Welt. Zwar wurden Eisenbahnen von vielen Leuten als antiquiertes Transportmittel betrachtet, für Tom jedoch hatten sie unbestreitbar etwas Besonderes. Er hatte die meisten klassischen Spannungsromane gelesen, die in Eisenbahnen spielten, und hier waren sämtliche Elemente für eine dramatische Geschichte vorhanden: die Romantik gediegenen, gemächlichen Reisens in einem geschlossenen Raum sowie eine ganze Reihe potenzieller Übeltäter aus allen Bereichen des Lebens. Am spannendsten fand Tom jene Eisenbahn-Thriller, in denen die Fahrgäste in der Dunkelheit lagen, kaum zu atmen wagten und die Decken bis an die Nase hochgezogen hatten, weil sie spürten, dass jeden Moment etwas Schreckliches passieren würde. Und tatsächlich – nicht mehr lange, und die Spannung erreichte ihren Höhepunkt: Es gab einen Lichtblitz, einen Schrei und einen dumpfen Laut, wenn ein Körper zu Boden polterte. In den frühen Morgenstunden wurde dann die Leiche, die Augen weit aufgerissen und die Haut kreideweiß, von einer unglaublich beschränkten jungen Reisenden entdeckt, die sich ungefähr zehn Minuten lang die Seele aus dem Leib schrie, während ein Paar düsterer Augen sie aus einer finsteren Ecke anstarrte. Tom konnte nicht begreifen, dass es Leute gab, denen bei einem solchen Szenarium kein wohliger Schauer des Gruselns über den Rücken lief.
Regina hatte makellose dunkelbraune Haut und schien viel zu jung zu sein, um in einem Zug oder sonstwo zu arbeiten. Für Tom sah sie wie eine High-School-Anfängerin aus, die sich für den ersten Schulball und ihren ersten ernsthaften Kuss herausgeputzt hatte. Sie war groß und schlank und sehr sympathisch, und die Arbeit machte ihr offensichtlich großen Spaß. Sie trug eine rot-weiße Mütze, wie sie häufig von Weihnachtsmännern in Einkaufszentren getragen werden, und war gerade dem nervösen jungen Paar behilflich, das Tom Händchen haltend im Wartesaal hatte sitzen sehen. Der Geistliche hatte bereits die Einstiegsformalitäten hinter sich und wuchtete seine schwere Reisetasche in den Zug. Nachdem Regina das Paar abgefertigt hatte, trat Tom vor und zeigte ihr seine Fahrkarte.
Sie suchte seinen Namen auf ihrer Liste und hakte ihn ab.
»In Ordnung, Mr Langdon, Sie wohnen in der oberen Etage in Abteil D. Dort rechts die Treppe hinauf und dann nach links den Gang entlang.«
Tom bedankte sich bei ihr und setzte vorsichtig einen Fuß aufs Trittbrett des erhabenen Capitol Limited. Seine Erfahrungen mit Schlafwagen beschränkten sich darauf, dass er mehrere Male den Film Der unsichtbare Dritte von Alfred Hitchcock und mit dem tadellos eleganten Cary Grant, einer sexy Eva Marie Saint und einem sehr finsteren James Mason in den Hauptrollen gesehen hatte. Die meisten Fans dieses Films erinnern sich am besten an die berühmte Szene mit dem Flugzeug, das den armen Cary mit Schädlingsbekämpfungsmittel besprüht. In der Szene steht Cary in seinem perfekt maßgeschneiderten eleganten grauen Anzug allein inmitten einer unendlich weiten, einsamen Farmlandschaft und wartet auf den mysteriösen George Kaplan, mit dem er dort verabredet ist und den es natürlich gar nicht gibt. Ein paar verschlagene Zeitgenossen bei der CIA hatten Kaplans Identität für ihre eigenen üblen Machenschaften erfunden. Diese Typen hatten immer eine Lüge auf den Lippen, um die Welt für die Demokratie sicherer zu machen. Doch um der Gerechtigkeit die Ehre zu geben: Es geschah stets mit bester Absicht und einzig und allein auf Kosten der Steuerzahler.
Die Filmszene hingegen, an die Tom sich am besten erinnerte, war die Kussszene in Eva Marie Saints geräumigem Schlafwagenabteil. Cary und Eva gingen dabei richtig heiß und heftig zur Sache, sogar nach heutigen Maßstäben. Als Tom die Szene als junger Mann gesehen hatte, waren seine Hormone in Aufruhr geraten, und ihm waren die wildesten Gedanken über alle möglichen Frauen gekommen – jedenfalls über Frauen, die aussahen wie Eva Marie Saint.
Eingedenk dieses Films wusste Tom, dass sein Schlafwagenabteil elegant eingerichtet und geräumig sein musste, Platz für zwei Betten hatte und über einen Arbeitsbereich, einen kleinen Vorraum zum Empfang von Besuchern, ein vollständig ausgestattetes Badezimmer mit Whirlpool und möglicherweise über einen Patio oder einen Balkon verfügte. Von Quartieren für Bedienstete ganz zu schweigen. Schließlich musste es einen Grund dafür geben, weshalb Cary und Eva am Ende des Films ihre Flitterwochen in eben diesem Schlafwagenabteil verbrachten. Es war größer als jede Wohnung, in der Tom je gelebt hatte.
Er stieg die Treppe hinauf, die Regina ihm gezeigt hatte. Mit dem Gepäck bereitete der Aufstieg einige Schwierigkeiten, da die Treppe scharfe Neunzig-Grad-Kehren vollführte. Tom zog den verheißungsvollen Schluss, dass diese Raumersparnis sich durch die enorm großen Schlafabteile erklärte. Dann schaute er hoch und erkannte, dass er ein beachtliches Hindernis vor sich hatte.
Die Frau war schon älter und schien mit einer Art Nachthemd bekleidet zu sein, obwohl es noch keine vier Uhr nachmittags war. Sie befand sich am oberen Ende der Treppe und machte Anstalten, herunterzusteigen. Tom stand auf der vorletzten Stufe. Er brauchte nur noch einen Schritt zu tun, nur noch eine kleine, winzige, letzte Stufe zu überwinden, ehe er sich in sein rollendes Penthouse zurückziehen und weiter von Eva Marie Saint träumen konnte.
»Gestatten Sie«, sagte er höflich.
»Ich komme schon«, verkündete die Frau mit einer dröhnenden Baritonstimme, die den kampferprobten, zähen ehemaligen Kriegsberichterstatter auf geradezu beängstigende Art und Weise einschüchterte.
»Wenn Sie mich nur kurz vorbeilassen würden …«, sagte er. Aber das stand außer Frage. Die Frau war nicht annähernd so groß wie Tom, dafür aber – taktvoll ausgedrückt – deutlich breiter.
»Hi, Regina«, rief die Frau hinunter.
»Hi, Agnes Joe«, erwiderte Regina.
Da keiner von beiden bereit war, zurückzuweichen, vereinigten Tom und Agnes Joe sich in einem seltsam unbeholfenen Tango, einen Fuß vor, einen zurück. Auf der steilen Treppe rief dieses Tänzchen bei Tom allerdings einen Anflug von Übelkeit hervor.
Schließlich meinte er: »Agnes Joe, ich bin Tom Langdon. Ich habe Abteil D. Wenn Sie nur für einen winzigen Moment zurücktreten könn …«
Er schaffte es nicht, den Satz zu beenden, denn statt seiner Bitte nachzukommen und ihm Platz zu machen, versetzte Agnes Joe ihm einen leichten Stoß. Genau genommen war es ein massiger Unterarm, der gegen die rechte Seite seines Kopfes geschmettert wurde, wodurch Tom, bereits aus dem Gleichgewicht geraten, die Treppe hinunterstolperte und rücklings auf dem Boden des Waggons landete.
Agnes Joe wuchtete ihre Körpermassen die Treppe hinunter und war immerhin höflich genug, über Toms lang hingestreckten Körper hinwegzusteigen. Tom hatte seine Zweifel, dass Mark Twain seinerzeit die transamerikanische Eisenbahnfahrt auf ähnliche Weise begonnen hatte. Agnes Joe ging zu Regina, die damit beschäftigt war, einigen anderen Leuten beim Einsteigen behilflich zu sein, und die glücklicherweise nichts vom Geschehen mitbekommen hatte, wofür Tom überaus dankbar war. Immerhin hatte ihn soeben eine ältere Dame knallhart auf die Bretter geschickt.
»Das ist für dich, Schätzchen. Vielen Dank, dass du mein Gepäck versorgt hast.« Agnes Joe drückte Regina einen Schein in die Hand.
Tom rappelte sich auf, funkelte die ältere Frau wütend an und ging ebenfalls zu Regina.
»Ich kümmere mich um Ihr Gepäck, Mr Langdon. Stellen Sie es ruhig da drüben hin, bis ich die Fahrkarten der anderen Passagiere kontrolliert habe.«
»Vielen Dank. Und sagen Sie Tom zu mir.« Er reichte Regina eine Hand voll Dollar. Sie bedankte sich mit einem reizenden Lächeln. Tom beobachtete Agnes Joe, die sich mühsam wieder die Treppe hinaufwuchtete.
»Arbeiten Sie schon lange in diesem Zug?«, fragte er Regina.
»Vier Jahre.«
»Das ist ja eine halbe Ewigkeit.«
»Aber nein. Ein paar Kollegen sind zwanzig Jahre mit dem Cap gefahren.«
Tom drehte sich zu Agnes Joe um, die immer noch auf derselben Stufe stand. Ihre Beine bewegten sich, aber sie schien nicht an Höhe zu gewinnen. Es war faszinierend, ihr zuzuschauen. Irgendwie erinnerte ihre Körpermasse an einen langsam fließenden Lavasee.
»Offensichtlich kennen Sie Agnes Joe.«
»Ja, klar. Soviel ich weiß, reist sie schon seit ungefähr zehn Jahren mit diesem Zug.«
»Zehn Jahre! Dann muss sie diese Strecke geradezu lieben.«
Regina lachte. »Ich glaube, sie ist unterwegs, um ihre Familie zu besuchen. Agnes Joe ist nett.«
Tom rieb sich die Seite seines Kopfes, wo die nette Agnes Joe ihn voll erwischt hatte. »Fährt sie auch in diesem Schlafwagen?«
»Ja, gleich neben Ihnen.«
Freude, schöner Götterfunken, dachte Tom.
Er ging zurück zur Treppe, wo Agnes Joe unerklärlicherweise immer noch auf derselben Stufe verharrte.
»Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«
»Alles okay, Süßer. Lassen Sie mir nur ein wenig Zeit.«
»Vielleicht sollte ich mich an Ihnen vorbeischlängeln und Sie von vorn hochziehen.«
Tom wollte eigentlich nichts anderes, als an ihr vorbeikommen, die Beine in die Hand nehmen und sich mit Eva Marie in seiner feudalen Suite einschließen, während Cary Grant draußen Wache hielt.
»Ich brauche nur Platz, Sonnyboy.«
Die letzte Bemerkung wurde durch einen wuchtigen Ellbogenstoß unterstrichen, der irgendwie Toms linke Niere traf. Als der Schmerz so weit abgeklungen war, dass er seinen Oberkörper wieder aufrichten konnte, war Agnes Joe verschwunden. Stöhnend schlurfte Tom zu Abteil D. Zum Teufel auch, in diesem Augenblick kam er sich wieder vor wie ein Kriegsberichterstatter.
KAPITEL 4
Als Tom die Tür zu Abteil D öffnete, musste er daran denken, dass Der unsichtbare Dritte für nicht jugendfrei erklärt worden wäre, hätten Cary und Eva Marie Saint die Kussszene an diesem Ort gedreht. Tom konnte die genauen Ausmaße seiner Luxusbehausung nicht schätzen, aber nach zwei normal langen Schritten prallte er bereits an die gegenüberliegende Wand. Es gab weder einen kleinen Vorraum noch einen Arbeitsbereich oder einen Schreibtisch und, soweit er erkennen konnte, auch keine Doppelbetten, und er war sich einigermaßen sicher, dass der Patio und der Balkon, der Whirlpool und die Quartiere für Bedienstete ebenfalls ins Reich der Fabel gehörten.
Er sah ein Waschbecken mit Wandspiegel und eine Steckdose für einen Elektrorasierer. Das Schränkchen darunter war bestens gefüllt. Tom erblickte Toilettenpapier, also musste hier irgendwo auch eine Toilette versteckt sein. Es gab einen winzigen Wandschrank, in den er seinen Mantel hängen konnte, und einen größeren Spiegel an der anderen Wand gegenüber einer Vorrichtung, die er als Bett identifizieren zu können glaubte, sowie einem Etwas, das aussah wie ein Hochbett. Dann gab es einen Stuhl und einen Klapptisch mit eingelegtem Schachbrettmuster, den er als Schreibtisch benutzen konnte. Und dann war da noch das große Panoramafenster, das einen einladenden Blick auf die Natur draußen lieferte, wo ein paar vereinzelte Schneeflocken, die lautlos herabschwebten, Tom in einen Anflug von Weihnachtsstimmung versetzten. Die Abteiltür ließ sich verriegeln; ein dicker Vorhang vor der Tür vermittelte den Eindruck von Privatsphäre. Gar nicht mal so übel, sagte sich Tom. Was die Geräumigkeit anging, schlug dieses Arrangement sogar die erste Klasse in einem Flugzeug um Längen.
Dieser Eindruck hielt sich, bis Tom die Tür öffnete und seine persönliche Toilette besichtigen durfte. Genau genommen war es Toilette und Dusche, dem Schild draußen an der Tür zufolge. Er sollte im selben Raum pinkeln und duschen? Während seiner Tätigkeit als Reporter in Übersee hatte er schon mit Kamelspucke duschen müssen, aber das hatte er sich schließlich nicht freiwillig ausgesucht.
Sein wahres Problem jedoch war ausreichend Platz. Tom betrachtete seine nicht gerade zierliche Figur und unterzog dann die Toilettendusche einem prüfenden Blick. Dann machte er einen halben Schritt hinein und sondierte die Lage. Er war ziemlich sicher, dass er sich in die Kabine hineinzwängen konnte. Sobald er drin war, müssten drei oder vier starke Männer mit schwerem Gerät bereitstehen, um ihn wieder herauszuhieven. Und zweifellos würde dann Agnes Joe schon darauf warten, sich die einzige heile Niere vorzunehmen, die ihm geblieben war.
Tom hatte von der unglücklichen Frau gelesen, die während eines Transatlantikfluges die unverzeihliche Sünde begangen hatte, die Spülung der Passagiertoilette zu betätigen, während sie noch auf dem Becken saß. Diese scheinbar harmlose Aktion sorgte durch den Saugeffekt des Wassers aus irgendeinem Grund für ein gewaltiges Vakuum, das die Dame regelrecht auf dem Toilettensitz festklebte. (Tom hätte den Flugzeugingenieuren am liebsten einen Brief geschrieben und sich erkundigt, warum sie eine solche Möglichkeit nicht in Betracht gezogen und entsprechende Tests gemacht hatten.) Die Frau verbrachte die gesamte restliche Flugzeit in aufrecht sitzender Haltung, bis die Maschine landete und eine Elitemannschaft, bewaffnet mit großen Spachteln und Babyöl, die Toilette stürmte und die arme Gefangene befreite. Wäre Tom das passiert, hätte er wahrscheinlich lieber seinen Hintern riskiert und sich um jeden Preis selbst aus dieser prekären Lage befreit.
Er verdrängte diese unschönen Gedanken, drehte sich um und wollte sich setzen, als er an der Wand gegenüber vom Bett etwas Helles vorbeihuschen sah. Zuerst nahm er es gar nicht bewusst wahr, weil alles so schnell ging. Dann geschah es ein zweites Mal. Es war Agnes Joe. Wie war das möglich? Das war eine sehr seltsame Definition des Begriffs Privatabteil. Dann sah er das Problem: Die Wände zwischen den Abteilen ließen sich öffnen, wahrscheinlich zwecks Wartungsarbeiten oder zur Neuaufteilung der Räumlichkeiten. Doch der Effekt war in diesem Fall, dass Tom ins Abteil seiner Nachbarin blicken konnte. Er hatte schon mit den oben erwähnten schmutzigen und spuckenden Kamelen und Wüstennomaden, die das erste und letzte Mal bei ihrer Geburt gebadet hatten, und mit verschiedenen anderen ungewaschenen Individuen biwakiert, wobei ihm heftiges Geschützfeuer den Wecker ersetzt hatte. Aber er hatte noch nie neben einer Agnes Joe geschlafen, und er hatte wirklich nicht den Wunsch, jetzt damit anzufangen.
Während er zu der Wand ging, um sie an Ort und Stelle zu schieben oder zu drücken, lugte er durch den Spalt zwischen den beiden Abteilen und sah sich plötzlich Auge in Auge mit Agnes Joe.
»Falls Sie bei mir den Spanner spielen wollen, Sonnyboy – vergessen Sie ’s lieber«, sagte sie. »Außerdem wollen Sie sich meine Antiquitäten bestimmt nicht unbedingt angucken. Suchen Sie sich etwas Weibliches, das eher Ihrem zarten Alter entspricht, Süßer.«
Okay, dachte Tom, die Lady scheint so etwas wie die Stadtexzentrikerin zu sein, nur dass diese Stadt sich auf Schienen bewegt. Er beschloss mitzuspielen.
»Ihre Antiquitäten sehen aber noch ganz ordentlich aus.«
»Vorsicht! Zwingen Sie mich nicht, Regina zu holen.«
»Warum wollen Sie unsere nette Zweisamkeit durch einen Dritten stören?«
»Hören Sie bloß mit dem Süßholzraspeln auf. Das verfängt bei mir nicht, weil ich nicht zu dieser Sorte Frauen gehöre. Aber wir können nach dem Abendessen im Salonwagen einen Drink nehmen und einander besser kennen lernen.« Sie klimperte tatsächlich mit den Wimpern.
»Nur ein Volltrottel würde ein solches Angebot ausschlagen.«
Sie schenkte ihm ein schelmisches Lächeln. »Tut mir Leid, dass ich Sie die Treppe runtergeworfen habe, Tom. Mir muss die Hand ausgerutscht sein.«
»Da es nun mal passiert ist, bin ich froh, dass es wenigstens Ihre Hand war.«
Er drehte sich um und sah Regina mit seinem Gepäck dastehen. Sie blickte zur Trennwand und schüttelte den Kopf. »Ist die Wand schon wieder aufgesprungen? Ich habe den Wartungsdienst gebeten, den Schaden zu beheben.«
»Hi, Regina«, rief Agnes Joe durch die Öffnung. Sie deutete mit einem Kopfnicken auf Tom. »Nimm dich vor diesem Knaben in Acht. Der hat es faustdick hinter den Ohren.«
»Okay.«
Tom schob die Wand wieder in ihre vorgeschriebene Position zurück.
Regina zuckte bedauernd mit den Achseln. »Tut mir Leid, dass Sie Ihrer Nachbarin ungewollt über den Weg gelaufen sind.«
»Schon gut. Mir kommt sie ziemlich harmlos vor.«
Regina reagierte mit einem warnenden Blick darauf. »Da wäre ich mir an Ihrer Stelle nicht zu sicher.« Sie brachte seine Koffer herein, stellte sie auf die Couch, die sich zur Nacht offensichtlich in ein Bett verwandeln ließ, und holte einen Notizblock hervor.
»Ich nehme auch gleich die Reservierungen fürs Abendessen entgegen. Der Speisewagen öffnet um halb sechs. Wenn Sie Ihre Mahlzeit nicht dort einnehmen wollen, können Sie auch im Café im Salonwagen einen Imbiss bestellen. Das ist der Wagen hinter dem Speisewagen. Das Café ist in der unteren Etage. Die Treppe dorthin ist ungefähr in der Mitte, auf der rechten Seite. Sie müssen Tyrone – er ist der Salonwagenbegleiter – nur Ihre Fahrkarte zeigen und ihm sagen, Sie hätten nicht im Speisewagen gegessen. Dort ist für Schlafwagenpassagiere alles gratis.«
»Ich esse im Speisewagen. Wie wär es mit sieben Uhr?«
Regina notierte die Zeit und seinen Namen.