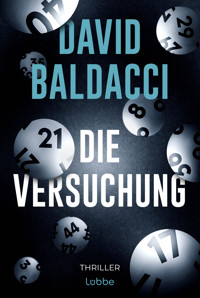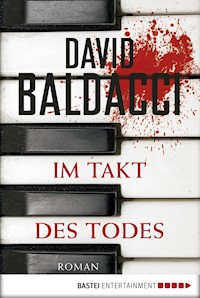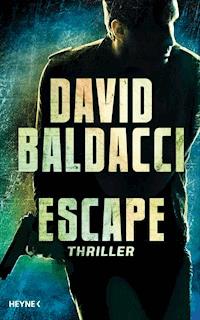Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sean King & Michelle Maxwell
- Sprache: Deutsch
David Baldaccis erfolgreichstes Ermittler-Duo in seinem 1. Fall
Sean King war Agent des Secret Service. Sein Auftrag: Schutz eines Präsidentschaftskandidaten. Sein Fehler: Für den Bruchteil einer Sekunde lässt er sich ablenken, und die Kugel des Mörders findet ihr Ziel.
Acht Jahre später. Ein neuer Wahlkampf. Eine junge Agentin. Auch sie begeht einen Fehler, und der Mann, den sie schützen soll, wird vor ihren Augen entführt.
Michell Maxwells einzige Chance, einen zweiten Mord zu verhindern, liegt in dem alten, ungelösten Fall von damals - und der Antwort auf die alles entscheidende Frage:
Was hat Sean King in jenem Augenblick gesehen?
Packende Thriller-Unterhaltung von Bestsellerautor David Baldacci - Der erste Band um das Ermittler-Duo King und Maxwell.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 47 min
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
INHALT
CoverÜber den AutorTitelImpressumWidmungProlog · September 1996Kapitel 1 · Acht Jahre späterKapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 38Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Kapitel 44Kapitel 45Kapitel 46Kapitel 47Kapitel 48Kapitel 49Kapitel 50Kapitel 51Kapitel 52Kapitel 53Kapitel 54Kapitel 55Kapitel 56Kapitel 57Kapitel 58Kapitel 59Kapitel 60Kapitel 61Kapitel 62Kapitel 63Kapitel 64Kapitel 65Kapitel 66Kapitel 67Kapitel 68Kapitel 69Kapitel 70Kapitel 71Kapitel 72Kapitel 73Kapitel 74Kapitel 75EpilogDanksagungÜber den Autor
David Baldacci, geboren 1960, lebt in der Nähe von Washington, D.C. Er war Strafverteidiger und Wirtschaftsjurist, bevor er mit dem Thriller Der Präsident (verfilmt als Absolute Power) weltbekannt wurde. Seitdem hat er zahlreiche weitere Thriller verfasst, die alle auf den Bestsellerlisten standen, sowie Romane wie Das Versprechen, eine bewegende Familiengeschichte aus seinem Heimatstaat Virginia. Baldaccis Werke wurden in 37 Sprachen übersetzt und erschienen in über 80 Ländern.
DAVID BALDACCI
IM BRUCHTEIL DER SEKUNDE
ROMAN
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Split Second
Copyright © 2003 by Columbus Rose, Ltd.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2005 by by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Helmut W. Pesch
Umschlaggestaltung: Guido Klütsch, Köln, unter Verwendung eines Fotos von Scott Austin, Photonica und Guido Klütsch
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN: 978-3-8387-1715-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Meinem Vater, der größten Inspiration, die einem Sohn zuteil werden kann
PROLOG September 1996
Es dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde, doch für Sean King, den Agenten des Secret Service, war es der längste Sekundenbruchteil seines Lebens.
Sie befanden sich auf Wahlkampfreise und hatten in einem Nest Station gemacht, das so abgelegen war, dass man hätte glauben können, es sei nur über Satellitentelefon zu erreichen. Ein Nullachtfünfzehn-Hotel, ein kurzes Treffen mit lokalen Anhängern und Politgrößen. Sean musterte die Menge, während ihm sein Ohrstöpsel in unregelmäßigen Abständen unwichtige Informationen in den Gehörgang wisperte. Es war drückend schwül in dem großen Versammlungssaal, und es wimmelte nur so von aufgeregten Menschen, die mit »Wählt-Clyde-Ritter«-Plakaten herumfuchtelten. Immer wieder wurden dem unentwegt lächelnden Kandidaten Babys entgegengestreckt. King hasste das, weil sich hinter den kleinen Körpern problemlos Handfeuerwaffen verstecken ließen, bis es zu spät war. Doch ein Kind folgte auf das andere, und Clyde küsste sie alle. King, der das potenziell brandgefährliche Spektakel mit gespannter Aufmerksamkeit überwachte, hatte das Gefühl, in seinem Magen entstehe spontan ein akutes Geschwür.
Die Menge rückte näher, direkt an die Samtkordel, die als Absperrung diente und die Tabuzone markierte. King reagierte darauf, indem er ein Stück näher an Ritter heranrückte. Er streckte den Arm aus und legte seine Hand leicht auf den verschwitzten Hemdrücken, um den Kandidaten im Falle eines Falles sofort zu Boden reißen zu können. Dass er sich unmittelbar vor ihn stellte, war nicht gut möglich, schließlich gehörte der Kandidat dem Volk. Ritter verhielt sich immer gleich: Er schüttelte Hände, winkte, lächelte, sonderte rechtzeitig eine zitierbare Äußerung für die 18-Uhr-Nachrichten ab und spitzte auch schon wieder die Lippen, um das nächste dralle Baby zu küssen. Und die ganze Zeit über stand King schweigend dabei, die Hand auf dem schweißdurchtränkten Hemd, ließ die Menge nicht aus den Augen und hielt nach möglichen Gefahren Ausschau.
Weiter hinten im Saal ertönte ein Zwischenruf, den Ritter humorvoll parierte. Sein Witz kam an, die Leute lachten, oder doch wenigstens die meisten. Es gab allerdings auch einige unter den Besuchern, die Ritter und die Politik, die er vertrat, hassten. Gesichter lügen nicht, jedenfalls nicht für jene, die gelernt haben, sie zu lesen. King konnte Mienen ebenso gut lesen, wie er mit einer Pistole umgehen konnte. In seiner gesamten beruflichen Laufbahn hatte er kaum jemals etwas anderes getan, als die Herzen und Seelen von Männern und Frauen an ihren Augen und an ihrer Körpersprache abzulesen.
Zwei Männer waren ihm aufgefallen. Sie standen keine vier Meter von ihm entfernt auf der rechten Seite und sahen aus wie potenzielle Unruhestifter. Allerdings trugen sie beide kurzärmelige Hemden und enge Hosen, in denen sich keine Waffen verbergen ließen, sodass sie nicht ganz so hoch auf der Risikoskala einzuordnen waren. Attentäter zogen normalerweise unförmige, weite Kleidung und kleine Handfeuerwaffen vor. Dennoch murmelte King ein paar Worte in sein Mikrofon, um Kollegen auf seine Beobachtung aufmerksam zu machen. Dann glitt sein Blick kurz zu der großen Uhr an der rückwärtigen Wand des Versammlungssaals. Es war 10.32 Uhr. In wenigen Minuten würden sie bereits auf dem Weg ins nächste Städtchen sein, wo das Händegeschüttel, die genormten politischen Statements, das Abküssen von Babys und Mienenlesen wieder von vorne anfing.
Ein neues Geräusch, ein neuer Anblick erregte Kings Aufmerksamkeit, etwas vollkommen Unerwartetes, und er, der hinter dem wahlkämpfenden Ritter der Menge gegenüberstand, war der einzige Mensch im Raum, der es sehen konnte. Ein, zwei, drei Herzschläge lang – viel zu lange – konnte er seine Augen nicht davon lösen, aber wer wollte ihm daraus, dass er von diesem Anblick nicht loskam, einen Vorwurf machen?
Jeder, wie sich herausstellen sollte, einschließlich er selbst.
King hörte das Peng. Es klang wie ein zu Boden gefallenes Buch. Er spürte die Feuchtigkeit an seiner Hand, dort, wo sie Ritters Rücken berührt hatte. Nur handelte es sich jetzt nicht mehr nur um Schweiß. Ein stechender Schmerz durchzuckte seine Hand. Das Projektil hatte ihm an der Stelle, wo es aus dem Körper des Kandidaten ausgetreten war, ein Stück von seinem Mittelfinger abgerissen, bevor es in die Wand hinter ihm einschlug. Als Ritter umfiel, kam sich King vor wie ein dahinrasender Komet, der trotz seiner Höllengeschwindigkeit noch eine Milliarde Lichtjahre Wegstrecke vor sich hat.
Gekreisch klang aus der Menge, doch gleich darauf schien es sich in ein nicht enden wollendes, seelenloses Stöhnen aufzulösen. Gesichter dehnten sich zu Fratzen, wie man sie sonst nur im Karneval sieht. Dann, schlagartig und mit der Wucht einer explodierenden Granate, schien alles vor Kings Augen zu verschwimmen. Füße hasteten vorbei, Körper wanden sich, und von allen Seiten drang Geschrei auf ihn ein. Die Menschen schoben, zogen, zerrten und duckten sich mit einem einzigen Ziel: Nichts wie fort von hier! Und in Kings Kopf wiederholte sich immer wieder ein einziger Gedanke: Nie ist das Chaos größer, als wenn vor den Augen einer arglosen Menge der Tod schnell und gewaltsam zuschlägt.
Der Kandidat lag vor ihm auf dem Hartholzboden. Die Kugel war direkt durchs Herz gegangen. King riss sich vom Anblick des soeben Verstorbenen los und fixierte den Schützen, einen hoch gewachsenen, gut aussehenden Brillenträger in einer Tweedjacke. Der Smith-&-Wesson-Revolver, Kaliber 44, war noch immer auf die Stelle gerichtet, an der Ritter eben noch gestanden hatte, als warte er darauf, dem Opfer, sofern es sich wieder aufrappeln sollte, den Fangschuss zu geben. Die Sicherheitsleute versuchten, sich durch die außer Rand und Band geratene Menge zu kämpfen, kamen aber nicht durch, sodass King und der Mörder wie isoliert einander gegenüberstanden.
King richtete seine Pistole auf die Brust des Attentäters. Ohne Warnung und ohne den Killer auf seine ihm von der amerikanischen Verfassung eingeräumten Rechte hinzuweisen, drückte er ab, wie es ihm die Pflicht gebot – einmal, und gleich danach ein zweites Mal, obwohl der erste Schuss schon gereicht hätte. Der Mann brach an Ort und Stelle zusammen und sagte kein einziges Wort; es war, als habe er damit gerechnet, für seine Tat sterben zu müssen, und diese Bedingung stoisch akzeptiert, wie es sich für einen guten Märtyrer gehört. Und alle Märtyrer lassen Menschen wie King zurück, die fortan mit dem Vorwurf leben müssen, dass sie die Tat zugelassen haben. Im Grunde waren an jenem Tag drei Menschen gestorben – und einer von ihnen war King.
Sean Ignatius King, geboren am 1. August 1960, starb am 26. September 1996 in einem Ort, von dem er bis zu diesem letzten Tag seines Lebens nicht einmal den Namen kannte. Und doch erging es ihm viel schlimmer als den anderen Gefallenen: Sie wurden sorgfältig in ihre Särge gebettet und fortan von ihren Lieben betrauert – oder zumindest von jenen, die das liebten, wofür die Toten gestanden hatten. Dem baldigen Ex-Agenten King war solches Glück nicht beschieden: Seine denkwürdige Bürde blieb auch nach seinem Tod noch quicklebendig.
KAPITEL 1 Acht Jahre später
Die Wagenkolonne bog auf den von Bäumen beschatteten Parkplatz ein, hielt an und spuckte zahlreiche Menschen aus, denen sichtlich zu heiß war und die alle müde und entsprechend schlecht gelaunt wirkten. Die kleine Armee marschierte auf den hässlichen, weiß verputzten Backsteinbau zu. Das Gebäude hatte zu verschiedenen Zeiten schon den verschiedensten Zwecken gedient. Derzeit beherbergte es ein verlottertes Bestattungsunternehmen, das nur deshalb noch florierte, weil es in einem Umkreis von fast fünfzig Kilometern das einzige war und die Toten natürlich irgendwo hin mussten. Dem Anlass entsprechend ernst dreinblickende Herren in schwarzen Anzügen standen neben den aufgebahrten, ebenso schwarzen Särgen. Ab und zu traten Trauernde aus der Tür und schluchzten still in vorgehaltene Taschentücher. Ein alter Mann in einem zerlumpten Anzug, der ihm viel zu groß war, und mit einem schmierigen, ramponierten Stetson saß vor dem Eingang auf einer Bank und schnitzte. Es war genau der richtige Ort für eine solche Szenerie: Ein Inbild ländlicher Provinzialität, wo es nichts als Stock-Car-Rennen und das ewige Geleier von Country-Balladen gab.
Als der Tross, in dessen Mitte feierlich ein großer, gut aussehender Mann schritt, an ihm vorbeikam, blickte der Alte neugierig auf, schüttelte den Kopf und grinste, wobei er die wenigen nikotinfleckigen Zähne zeigte, die ihm noch verblieben waren. Dann zog er einen Flakon aus seiner Tasche, nahm einen erfrischenden Schluck und wandte sich wieder seiner Schnitzkunst zu.
Im Gleichschritt folgte dem hoch gewachsenen Mann eine Frau Anfang dreißig. Früher hatte das Gürtelholster mit der schweren Pistole unangenehm an ihrer Hüfte gescheuert und die Haut darunter wund gerieben. Zur Behebung des Problems hatte sich die Frau an dem kritischen Punkt eine zusätzliche Schicht Stoff in die Bluse genäht. Eine gewisse Irritation war zwar immer noch geblieben, aber damit konnte sie leben, wie mit anderen Irritationen auch. Sie hatte zufällig gehört, wie einige ihrer männlichen Kollegen darüber witzelten, dass eigentlich alle weiblichen Agenten links und rechts Schulterholster tragen sollten, denn dann sähen sie auch ohne teure Brustoperationen knackig aus – nun ja, an Testosteronmangel hatte ihr Gewerbe noch nie gelitten.
Die Agentin Michelle Maxwell lebte stets auf der Überholspur. Noch gehörte sie nicht zum inneren Kreis der Leibwächter im Weißen Haus, die den Präsidenten der Vereinigten Staaten bewachten, aber viel fehlte ihr dazu nicht mehr. Obwohl sie erst knapp neun Jahre beim Secret Service war, hatte sie es bereits zur Einsatzleiterin gebracht. Die meisten Agentinnen und Agenten verbrachten zehn Jahre mit Fahndungsarbeit im Außendienst, ehe sie wenigstens schichtweise im Personenschutz eingesetzt wurden – Michelle Maxwell aber war es gewohnt, früher ans Ziel zu kommen als andere.
Ihre derzeitige Aufgabe war sozusagen die Generalprobe vor dem fast sicheren Ruf ins Weiße Haus, und Michelle war beunruhigt. Dieser Aufenthalt war nicht eingeplant gewesen – es hatte also kein Vorab-Team und nur begrenzte Hintergrundinformationen gegeben. Andererseits hatte so eine Reiseplanänderung in letzter Sekunde den Vorteil, dass niemand vor Ort mit dem Besuch rechnen konnte.
Vor dem Haupteingang legte Michelle dem hoch gewachsenen Mann resolut die Hand auf den Arm und bat ihn zu warten, bis sie und ihre Leute das Gebäude überprüft hätten.
Im Leichenschauhaus war es still. In der Luft hing der Geruch von Tod und Verzweiflung, konzentriert vor allem in jenen Nischen des Leidens vor den Särgen in den verschiedenen Aufbahrungsräumen. An bestimmten Schlüsselstellen auf dem Weg ihres Schützlings hatte Michelle Agenten postiert – »Füße verteilt«, wie es im Jargon der Dienste hieß. Wenn man es richtig anstellte, wirkte bereits die einfache Postierung eines Bewaffneten mit Sprechfunkgerät im Eingangsbereich eines Gebäudes Wunder.
Sie sprach ein paar Worte in ihr Walkie-Talkie, und der hoch gewachsene Mann, John Bruno, wurde hereingeführt. Michelle geleitete ihn durch den Flur, verfolgt von Blicken aus den einzelnen Aufbahrungsnischen. Ein Politiker im Wahlkampf und sein Tross waren wie eine Herde Elefanten: Nirgendwo konnten sie leise auftreten. Wo sie mit ihrer Horde von Leibwächtern, Stabschefs, Sprechern, Redenschreibern, PR-Leuten, Assistenten und anderen Hilfskräften durch die Landschaft stampften, wuchs bald kein Gras mehr. Sie boten eine Show, die, wenn sie nicht gerade zum Lachen reizte, so doch zumindest erhebliche Sorgen um die Zukunft des Landes erweckte.
John Bruno bewarb sich um das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und hatte nicht die geringste Chance, gewählt zu werden. Der Mann, dem man seine fünfundsechzig Lebensjahre ganz und gar nicht ansah, kandidierte für keine der großen Parteien, sondern als Unabhängiger. Dank der Unterstützung eines kleinen, aber lautstarken Prozentsatzes von Wählern, der so gut wie alles satt hatte, was der politischen Mitte lieb und teuer war, war es ihm gelungen, sich in jedem einzelnen Bundesstaat für die Präsidentschaftswahlen zu qualifizieren. Und damit stand er unter dem Schutz des Secret Service, wenngleich die Zahl der ihm zugebilligten Sicherheitskräfte nicht so hoch war wie die der aussichtsreicheren Kandidaten. Michelles Aufgabe bestand darin, dafür zu sorgen, dass Bruno bis zur Wahl am Leben blieb. Mittlerweile zählte sie die Tage.
John Bruno, ein knallharter ehemaliger Staatsanwalt, hatte sich im Laufe seines Lebens eine Menge Feinde gemacht, von denen sich zurzeit keineswegs alle hinter Schloss und Riegel befanden. Seine politische Botschaft war simpel: Er verkündete, er wolle das Volk von der Last der Regierung und der Verwaltung befreien und dem freien Unternehmertum freie Hand lassen. Und was war mit den Armen und Schwachen, die in einer Gesellschaft ungezügelten Wettbewerbs unter die Räder kamen? Nun ja, bei allen anderen Arten auf dieser Erde gingen die Schwachen eben zugrunde, während die Starken obsiegten – warum also sollte das ausgerechnet beim Homo sapiens anders sein? Es war im Wesentlichen diese Einstellung, die dem Kandidaten Bruno jede Siegeschance nahm. Amerika liebte seine starken Kerle, war aber nicht bereit, sich jemanden an die Spitze zu wählen, der keinerlei Mitleid mit den Mühseligen und Beladenen an den Tag legte – schließlich war es durchaus möglich, dass diese eines Tages die Mehrheit bildeten.
Die Schwierigkeiten begannen, als Bruno mit seinem Stabschef, zwei Assistenten, Michelle und dreien ihrer Sicherheitskräfte im Schlepptau die Leichenhalle betrat. Die Witwe, die vor dem Sarg ihres Ehemanns saß, blickte abrupt auf. Da sie verschleiert war, konnte Michelle ihre Miene nicht erkennen, ging jedoch davon aus, dass sie die Horde von Eindringlingen in die heiligen Hallen mit Überraschung quittierte. Die alte Dame erhob sich und zog sich, sichtbar zitternd, in eine Ecke zurück.
Unvermittelt drehte sich der Kandidat zu Michelle um und fauchte sie an: »Er war ein guter Freund von mir, und ich habe nicht vor, hier eine Truppenparade zu veranstalten. Raus mit Ihnen! Verschwinden Sie!«
»Ich bleibe«, fauchte Michelle zurück. »Nur ich.«
Bruno schüttelte den Kopf. Es kam immer wieder zu solchen Konfrontationen zwischen ihnen. Er wusste, dass seine Kandidatur ein hoffnungsloses Unterfangen war – und hängte sich gerade deshalb umso mehr ins Zeug. Seine Kampagne war ein brutaler Parforceritt – und die Logistik seiner Bewachung ein Albtraum.
»Nein, das ist eine Privatsache!«, blaffte er und warf einen Blick auf die zitternde alte Frau in der Ecke. »Mein Gott, Sie erschrecken sie ja zu Tode. Das ist einfach widerlich.«
Michelle versuchte es noch einmal, aber Bruno ließ sich nicht von seinem Vorhaben abbringen. Unter Verwünschungen drängte er sie alle wieder aus dem Raum. Was sollte ihm in einer Leichenhalle schon passieren? Sollte ihn etwa die achtzigjährige Witwe des Verstorbenen plötzlich anspringen? Oder der Tote wieder lebendig werden? Michelle spürte, dass ihr Schützling ernsthaft zornig war, weil sie ihn wertvolle Wahlkampfminuten kostete. Aber die Idee, hierher zu kommen, war schließlich nicht auf ihrem Mist gewachsen – nur interessierte Bruno dieses Argument in seiner gegenwärtigen Stimmung überhaupt nicht.
Keinerlei Erfolgschancen – und doch bildete sich dieser Mann weiß Gott was ein. Am Wahltag würden ihm die Wähler, einschließlich Michelle, einen Denkzettel erteilen, der einem Tritt in den Hintern gleichkam.
Sie machte einen Kompromissvorschlag: zwei Minuten für ihr Team zur Durchsuchung des Raumes. Bruno stimmte zu, und ihre Männer schwärmten sofort aus. Insgeheim kochte Michelle vor Wut, sagte sich aber, es sei besser, noch ein paar Pfeile im Köcher zu behalten für die wirklich bedeutsamen Schlachten, die noch auf sie zukamen.
Hundertzwanzig Sekunden später kamen ihre Leute wieder heraus und berichteten, dass alles in Ordnung sei. Der Raum hatte nur eine Tür, durch den man ihn betreten und verlassen konnte. Keine Fenster. Außer der alten Dame und dem Toten sei niemand anwesend. Die Raumtemperatur sei kühl. Das war nicht perfekt, ging aber in Ordnung. Michelle nickte dem Kandidaten zu. Bruno sollte sein Tête-à-tête mit dem Verstorbenen haben, und danach konnte die Karawane weiterziehen.
Bruno betrat die Leichenhalle, schloss die Tür hinter sich und ging auf den offenen Sarg zu. An der gegenüberliegenden Wand befand sich ein zweiter, allerdings leerer Sarg. Von einem hüfthohen Berg wunderschöner Blumen umgeben, ruhte der Sarg mit dem Verstorbenen auf einer Art Sockel, der mit einem vorhangartigen weißen Stoff verkleidet war. Bruno erwies dem Toten seine Reverenz, murmelte »Mach’s gut, Bill!«, und wandte sich dann der Witwe zu, die inzwischen wieder auf ihren Stuhl zurückgekehrt war. Er ging vor ihr in die Knie, und sie reichte ihm die rechte Hand. Bruno drückte sie sanft.
»Es tut mir Leid, Mildred, wirklich sehr Leid. Er war ein guter Mann.«
Die Trauernde sah ihn unter ihrem Schleier hervor an, lächelte und schlug den Blick wieder nieder. Brunos Gesichtsausdruck veränderte sich. Er sah sich vorsichtig um, obwohl die einzige andere Person im Raum nicht mehr in einem Zustand war, der es ihr ermöglicht hätte, zu lauschen. »Du erwähntest noch etwas anderes, worüber du mit mir unter vier Augen sprechen wolltest«, sagte Bruno.
»Ja«, bestätigte die Witwe mit leiser Stimme.
»Ich fürchte, ich habe nicht viel Zeit, Mildred. Worum geht es denn?«
Wie zur Antwort legte sie die linke Hand auf seine Wange, und dann berührten ihre Finger plötzlich seinen Hals. Bruno zog eine Grimasse, als er den scharfen Stich spürte, der seine Haut durchdrang. Einen Augenblick später sank er bewusstlos zu Boden.
KAPITEL 2
Michelle ging im Flur auf und ab, sah auf ihre Armbanduhr und lauschte der tristen Musik, die über eine Lautsprecheranlage das gesamte Gebäude erfüllte. Wer noch nicht todtraurig, deprimiert oder gar selbstmordgefährdet hierher kommt, ist nach fünfminütiger Berieselung mit dieser Musik auf jeden Fall so weit, dachte sie. Dass Bruno die Tür hinter sich geschlossen hatte, ärgerte sie maßlos, aber sie hatte es ihm durchgehen lassen. Eigentlich war es ihr untersagt, eine Schutzperson auch nur eine Sekunde lang aus den Augen zu lassen, doch die Realität schlug den Vorschriften immer wieder Schnippchen. Zum fünften Mal fragte sie einen ihrer Mitarbeiter: »Sind Sie sich absolut sicher, dass der Raum sauber ist?« Der Mann nickte.
Sie wartete noch ein paar Augenblicke, dann ging sie zur Tür und klopfte an. »Mr Bruno? Wir müssen weiter, Sir!« Als sie keine Antwort bekam, seufzte sie unhörbar auf. Michelle wusste, dass die anderen Agenten ihres Kommandos, die allesamt mehr Dienstjahre auf dem Buckel hatten als sie, genau aufpassten, wie sie sich verhielt. Nur sieben Prozent der annähernd 2400 Agenten im Außendienst waren Frauen, und nur ganz wenige bekleideten Führungspositionen. Nein, leicht war ihr Job bestimmt nicht.
Sie klopfte wieder. »Sir?« Sekunden tickten vorbei, ohne dass etwas geschah. Michelle spürte, wie sich ihre Magenmuskeln anspannten. Sie drehte am Türknopf und blickte ungläubig auf. »Die ist ja abgeschlossen!«
Ein Kollege starrte sie an, genauso perplex wie sie. »Na, dann hat er sich offenbar eingeschlossen.«
»Mr Bruno, ist alles in Ordnung?« Michelle hielt kurz inne und setzte dann hinzu: »Sir, entweder Sie antworten mir jetzt, oder wir kommen rein.«
»Augenblick noch!« Das war unverkennbar Brunos Stimme.
»Okay, Sir, aber wir müssen jetzt definitiv los.«
Nach zwei weiteren Minuten schüttelte Michelle den Kopf und klopfte erneut an die Tür. Keine Antwort. »Sir, wir haben bereits Verspätung.« Sie warf Fred Dickers, Brunos Stabschef, einen Blick zu und sagte: »Fred, wollen Sie ’s mal versuchen?«
Dickers und sie hatten sich schon vor längerer Zeit zusammengerauft. Da sie jeden Tag an die zwanzig Stunden miteinander auskommen mussten, blieb ihnen auch nicht viel anderes übrig. Dass sie ständig gleicher Meinung waren, hieß dies noch lange nicht, und so weit würde es auch nie kommen, doch in der aktuellen Frage stimmten sie überein.
Dickers nickte und rief: »John! Ich bin’s, Fred. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Sind schon verdammt spät dran.« Er klopfte an die Tür. »John, hörst du mich?«
Wieder spürte Michelle ihre Magenmuskulatur. Irgendetwas war hier faul. Sie winkte Dickers beiseite und klopfte selber wieder an. »Warum haben Sie die Tür abgeschlossen, Sir?« Keine Antwort. Auf Michelles Stirn bildete sich ein erster Schweißtropfen. Sie zögerte einen Moment, dachte scharf nach und brüllte dann gegen die Tür: »Sir, Ihre Frau ist am Telefon! Eines Ihrer Kinder hat einen schweren Unfall gehabt!«
Die Antwort ließ ihr einen kalten Schauer über den Rücken laufen. »Augenblick noch!«
»Brecht die Tür auf! Brecht die Tür auf!«, schrie sie die anderen Agenten an.
Sie warfen sich mit den Schultern dagegen, ein Mal, zwei Mal. Dann gab die Tür nach, und sie stürmten den Raum.
Einen Raum, der leer war – bis auf einen Toten.
KAPITEL 3
Ein Trauerzug hatte sich in Bewegung gesetzt und rollte langsam die alleeartige Zufahrt entlang, die zur Straße führte. Er umfasste nur etwa ein Dutzend Fahrzeuge. Noch ehe der letzte Wagen das Gelände verlassen hatte, stürmten Michelle und ihr Team aus dem Haupteingang des Bestattungsinstituts und schwärmten in alle Richtungen aus.
»Sperren Sie das gesamte Gebiet ab!«, befahl sie den Agenten, die vor Brunos Wagenkolonne postiert waren. Dann sprach sie in ihr Walkie-Talkie: »Ich brauche Verstärkung, egal woher. Hauptsache, sie kommt sofort. Und verbinden Sie mich mit dem FBI.« Ihr Blick fiel auf den letzten Wagen des abfahrenden Trauerzugs. Ihr war klar, dass wegen dieses Vorfalls Köpfe rollen würden, vor allem ihr eigener. Doch im Augenblick dachte sie nur an eines: John Bruno musste wieder her, und zwar vorzugsweise lebendig.
Aus den Transportern der Medien quollen Reporter und Fotografen. Obwohl John Bruno bewusst gewesen war, dass sich ein paar Fotos von ihm am Sarg des Verstorbenen gut gemacht hätten, und trotz entsprechender Interventionen von Seiten Fred Dickers’ hatte er Rückgrat bewiesen und der Presse den Zugang zur Leichenhalle untersagt. Jetzt brach die Meute los, mit der vollen Wucht ihrer journalistischen Leidenschaft: Hatte sie sich zuvor murrend gefügt, witterte sie nun eine Story von weitaus größerer Brisanz, als sie der Beileidsbesuch eines Präsidentschaftskandidaten am Sarg eines alten Freundes je hätte bieten können.
Ehe die Reporter Michelle erreichten, packte diese einen Uniformierten am Arm, der auf sie zugelaufen war und offenbar auf Instruktionen wartete. »Sind Sie ein Kollege aus dem Ort?«, fragte sie ihn.
Er nickte. Seine Augen waren weit aufgerissen, das Gesicht bleich. Der Mann sah aus, als würde er gleich in Ohnmacht fallen oder sich zumindest in die Hosen machen.
Michelle deutete auf die Straße. »Wessen Trauerzug ist das?«
»Harvey Killebrews. Sie bringen ihn zum Friedhof.«
»Halten Sie den Zug auf!«
Der Mann stierte sie dusselig an. »Aufhalten? Ich?«
»Jemand ist entführt worden. Und das da…« Wieder deutete Michelle in die Richtung, in der der Trauerzug verschwunden war. »Das da wäre eine optimale Gelegenheit, den Entführten aus dem Weg zu schaffen – meinen Sie nicht?«
»Ach ja«, erwiderte der Mann langsam. »Das könnte wohl sein.«
»Also sorgen Sie dafür, dass jedes einzelne Fahrzeug gründlich durchsucht wird, vor allem der Leichenwagen.«
»Der Leichenwagen? Aber entschuldigen Sie, Ma’am, da ist doch Harvey drin!«
Michelle musterte seine Uniform. Er war nur ein Hilfspolizist, aber sie konnte es sich jetzt nicht leisten, wählerisch zu sein. Nach einem Blick auf das Namensschildchen an seiner Brust sagte sie sehr ruhig: »Officer Simmons, wie lange sind Sie schon im… äh… im Wach- und Schließgewerbe tätig?«
»Ungefähr einen Monat, Ma’am. Aber ich bin berechtigt, Waffen zu tragen. Bin Jäger, schon seit meinem achten Lebensjahr. Schieß Ihnen die Flügel von ’ner Mücke weg, wenn’s drauf ankommt.«
»Sehr gut.« Einen Monat! So, wie der Bursche aussah, glaubte sie ihm noch nicht einmal das. »Okay, Simmons, hören Sie zu: Ich halte es für gut möglich, dass der Entführte bewusstlos ist – und für den Transport eines Bewusstlosen wäre ein Leichenwagen doch genau das Richtige, meinen Sie nicht auch?« Er nickte, anscheinend begriff er endlich, worauf sie hinauswollte. Ihr Mund verzog sich, und ihre Stimme klang nun knallhart wie ein Pistolenschuss. »Und jetzt ab mit Ihnen! Sie stoppen umgehend diesen Leichenzug und durchsuchen die Fahrzeuge!«
Simmons rannte sofort los. Michelle befahl einigen ihrer Leute, ihm bei dem Einsatz zu helfen und dafür zu sorgen, dass alles glatt ging. Eine andere Gruppe schickte sie in die Leichenhalle, die gründlich durchsucht werden sollte. Es war nicht ganz auszuschließen, dass Bruno irgendwo im Gebäude versteckt worden war.
Sie kämpfte sich durch die Reporter- und Fotografenmeute und bestimmte das Bestattungsinstitut zu ihrer Einsatzzentrale. Dann telefonierte sie wieder, studierte Landkarten der Umgebung und koordinierte die Fahndung. Sie legte einen inneren Ring um den Tatort mit einem Radius von einer Meile um das Bestattungsinstitut herum fest. Und dann kam der Anruf, den sie gerne vermieden hätte, der sich aber nicht länger hinausschieben ließ: Sie wählte die Nummer ihrer Vorgesetzten und sprach die Worte aus, die von nun an untrennbar mit ihrem Namen und ihrer gescheiterten Karriere beim Secret Service verbunden bleiben sollten.
»Hier spricht Agentin Michelle Maxwell, Einsatzleiterin Personenschutz John Bruno. Wir haben – ich habe – unsere Schutzperson verloren… ja, verloren. John Bruno ist offenbar entführt worden. Die Fahndung läuft, die örtlichen Polizeibehörden und das FBI sind informiert.« Sie hatte das Gefühl, das Fallbeil sause bereits auf ihren Nacken zu.
Michelle schloss sich dem Trupp an, der auf der Suche nach Bruno das Bestattungsinstitut vom Keller bis zum Dachgeschoss durchkämmte und dabei das Interieur buchstäblich in seine Einzelteile zerlegte. Ein solches Vorgehen am Tatort vor Eintreffen der Spurensicherung war, milde ausgedrückt, problematisch. Aber sie konnten sich jetzt nicht über die bevorstehenden Ermittlungen den Kopf zerbrechen; sie mussten den vermissten Kandidaten suchen.
In der Leichenhalle, aus der Bruno verschwunden war, wandte sich Michelle an einen der Männer, die den Raum vor Brunos Eintritt überprüft hatten. »Wie, zum Teufel, konnte das passieren?«, fuhr sie ihn an.
Der Angesprochene war ein Secret-Service-Veteran und ein guter Mann obendrein. Ungläubig schüttelte er den Kopf. »Der Raum war sauber, Mick«, sagte er. »Echt sauber.«
Bei der Arbeit kam es immer wieder vor, dass Michelle »Mick« genannt wurde. Sie hatte nichts dagegen: Irgendwie war sie auf diese Weise den Jungs näher, ihnen ähnlicher, und das war – wie sie sich zähneknirschend eingestand – gar nicht so übel.
»Haben Sie die Witwe überprüft? Sie befragt?«
Der Mann sah sie skeptisch an. »Sollten wir etwa eine alte Frau in die Mangel nehmen, deren Ehemann zwei Meter weiter im Sarg liegt? Wir haben ihre Handtasche angesehen, ja, aber eine intime Leibesvisitation war nun wirklich nicht angebracht.« Er atmete tief durch. »Wir hatten exakt zwei Minuten Zeit. Jetzt nennen Sie mir mal irgendwen, der so einen Job in zwei Minuten perfekt erledigen kann.«
Michelle versteifte sich, als ihr die Bedeutung dieser Worte bewusst wurde. Alle Beteiligten würden versuchen, die eigene Haut und den Pensionsanspruch zu retten. Im Nachhinein sah es verdammt schwach aus, dass sie nur zwei Minuten für die Sicherheitsüberprüfung genehmigt hatte. Michelles Blick fiel auf den Türknopf, mit dem die Tür von innen verriegelt worden war.
Zwei Meter weiter im…? Sie sah sich nach dem kupferfarbenen Sarg um und ließ den Bestattungsunternehmer rufen, der kurz darauf zu ihr kam. Er war jetzt noch viel blasser, als bei Leuten seiner Zunft gemeinhin üblich. Michelle fragte ihn, ob es sich bei dem Toten tatsächlich um Bill Martin handele. Ja, sagte der Mann.
»Und Sie sind sich ganz sicher, dass die Frau an seinem Sarg seine Witwe war?«
»Was für eine Frau?«, wollte er wissen.
»Eine Frau in Schwarz saß hier im Raum. Sie war verschleiert.«
»Ich weiß nicht, ob diese Frau Mrs Martin war oder jemand anders. Ich habe sie nicht hereinkommen sehen.«
»Ich brauche Mrs Martins Telefonnummer. Außerdem dürfen weder Sie noch Ihre Angestellten das Gebäude verlassen, bis das FBI eingetroffen ist und seine Ermittlungen abgeschlossen hat.«
Der Mann wurde noch blasser im Gesicht – sofern das überhaupt möglich war. »Das FBI?«
Michelle ließ ihn gehen, und ihr Blick fiel auf den Sarg und den Fußboden davor. Sie bückte sich, um ein paar Rosenblütenblätter aufzuheben, die heruntergefallen waren. Dabei geriet ihr Kopf auf Augenhöhe mit dem Sockel, auf dem der Sarg ruhte. Michelle beugte sich über die Blumen und zog vorsichtig den vorhangartigen Stoff beiseite, der den Sockel verdeckte. Eine Vertäfelung kam zum Vorschein. Michelle klopfte dagegen. Es klang hohl. Nachdem sie sich Handschuhe übergestreift hatte, hob sie mit einem Kollegen eines der Holzpaneele ab und legte einen Hohlraum frei, in dem sich problemlos ein ausgewachsener Mann verstecken konnte. Michelle schüttelte den Kopf über sich selbst. Das hatte sie gründlich versiebt.
Einer ihrer Leute trat zu ihr und zeigte ihr ein technisches Gerät in einem durchsichtigen Plastikbeutel. »Eine Art digitales Tonbandgerät«, sagte er.
»Brunos Stimme! Damit haben sie uns also geleimt!«
»Sie müssen eine Rede von ihm oder so etwas mitgeschnitten haben. Den Ausruf ›Augenblick noch!‹ hielten sie dann offenbar für am besten geeignet, uns noch eine Weile zu vertrösten, weil er auf alle möglichen Fragen Antwort gibt. Sie haben ihn mit Ihrer Bemerkung über Brunos Kinder ausgelöst. Irgendwo muss noch eine Wanze versteckt sein…«
»… weil das Gerät ja sonst auf meinen Ruf hin nicht angesprungen wäre«, ergänzte Michelle.
»Genau.« Der Mann deutete auf die gegenüberliegende Wand, wo gerade ein Teil der gepolsterten Verkleidung entfernt worden war. »Da hinten ist eine Tür, die zu einem geheimen Durchgang führt.«
»Dann sind sie also dort hinaus.« Michelle gab dem Agenten den Plastikbeutel zurück. »Stellen Sie das Gerät wieder genau dort hin, wo Sie es gefunden haben. Ich habe keine Lust, mich vom FBI darüber aufklären zu lassen, dass man an einem Tatort nichts verändern darf.«
»Es muss doch einen Kampf gegeben haben«, sagte der Agent. »Wie ist es möglich, dass wir keinen Ton gehört haben?«
»Na wie schon, bei dieser Totenmusik, die hier überall plärrt?«, gab Michelle scharf zurück.
Sie betraten den verborgenen Gang. Die rollbare Bahre mit dem leeren Sarg war an der Tür zurückgelassen worden, die nach draußen hinter das Gebäude führte. Nach der Rückkehr in die Leichenhalle ließ Michelle noch einmal den Bestattungsunternehmer kommen und zeigte ihm den Gang.
Der Mann wirkte völlig perplex. »Davon habe ich nichts gewusst«, sagte er.
»Wie bitte?«, fragte Michelle ungläubig.
»Wir arbeiten hier erst seit zwei Jahren – das heißt, seitdem das einzige andere Bestattungsinstitut weit und breit dicht gemacht hat. Das Gebäude konnten wir nicht übernehmen, weil es unter den Hammer kam. Das Haus hier war schon alles Mögliche, bevor wir es anmieteten und in ein Bestattungsunternehmen umwandelten. Die gegenwärtigen Eigentümer haben nur einige wenige bauliche Verbesserungen vorgenommen. Gerade dieser Raum hier, die Leichenhalle, ist kaum verändert worden. Von dieser Tür und dem Gang dahinter hatte ich keine Ahnung.«
»Sie vielleicht nicht, aber jemand anders«, erwiderte Michelle schroff. »Am Ende des Gangs befindet sich eine Tür, die nach draußen führt, zur Rückseite des Gebäudes. Wollen Sie mir weismachen, dass Sie auch von dieser Tür keine Ahnung haben?«
»Der rückwärtige Teil des Hauses dient als Lager. Man kommt durch mehrere Türen von innen da rein.«
»Haben Sie da hinten ein Fahrzeug stehen sehen?«
»Nein, aber da komme ich ja auch nie hin.«
»Ist sonst jemandem irgendetwas aufgefallen?«
»Da muss ich mich erst erkundigen.«
»Nein, ich werde mich erkundigen.«
»Ich versichere Ihnen, dass wir ein absolut seriöses Unternehmen sind.«
»Sie haben geheime Gänge und Außentüren im Haus, von denen Sie keine Ahnung haben. Haben Sie denn keine Angst vor Einbrechern und dergleichen?«
Er sah sie mit leerem Blick an und schüttelte den Kopf. »Wir sind hier nicht in der Großstadt. Hier hat es noch nie ein Verbrechen gegeben.«
»Mit dieser Glückssträhne ist es jetzt vorbei. Können Sie mir Mrs Martins Telefonnummer geben?«
Er gab sie ihr, doch als sie die Nummer wählte, ging niemand an den Apparat.
Eine Weile lang stand Michelle mutterseelenallein mitten im Raum. Ihre ganze Arbeit, all die Jahre, in denen sie sich und allen anderen bewiesen hatte, dass sie ihr Fach beherrschte – alles für die Katz! Ihr blieb nicht einmal der Trost, mit ihrem Körper eine dem Kandidaten zugedachte tödliche Kugel abgefangen zu haben. Michelle Maxwell war nun Geschichte – und wusste genau, dass ihre Rolle beim Secret Service ebenfalls Geschichte war. Mit ihrer Karriere war es aus und vorbei.
KAPITEL 4
Der Trauerzug wurde angehalten und jedes Fahrzeug durchsucht, auch der Leichenwagen. Bei dem Toten handelte es sich tatsächlich um Harvey Killebrew, einen treu sorgenden Vater, Großvater und Ehemann, was jeder bestätigen konnte, der den Leichnam nach der Öffnung des Sarges sah. Die Trauergäste waren nahezu ausnahmslos Herrschaften älteren Semesters, die angesichts der vielen bewaffneten Männer sichtlich verängstigt waren. Obwohl keiner von ihnen auch nur im Entferntesten den Eindruck erweckte, ein Entführer zu sein, wurde die gesamte Kavalkade samt Leichenwagen zum Bestattungsinstitut zurückbeordert.
Hilfspolizist Simmons wandte sich an einen Secret-Service-Agenten, der gerade seinen Wagen bestieg, um die Karawane zurückzugeleiten, und fragte ihn: »Was soll ich jetzt tun, Sir?«
»Ich brauche jemanden, der die Straße hier im Auge behält. Sie halten jeden an, der aus der Stadt raus oder in die Stadt rein will, und überprüfen sorgfältig seine Papiere. Sobald es möglich ist, schicken wir Ihnen Verstärkung. Bis dahin ist das Ihr Job, verstanden?«
Simmons wirkte hochgradig nervös. »Das ist ’n echt dickes Ding, was?«
»Das ist das dickste Ding Ihres Lebens, mein Junge. Hoffentlich geht es gut aus. Leider habe ich da meine Zweifel.«
Neal Richards, auch er ein Agent, stieß zu ihnen und sagte: »Ich bleibe auch hier, Charlie. Ich halte es nicht für ideal, ihn hier allein zu lassen.«
Charlie sah seinen Kollegen prüfend an und fragte ihn: »Sind Sie sicher, Neal, dass Sie nicht mit zurück zum Rudel wollen? Keine Lust?«
Richards lächelte grimmig und erwiderte: »Ich habe keine Lust, Michelle Maxwell jetzt über den Weg zu laufen. Ich bleib bei dem Jungen hier.« Er kletterte in den Lieferwagen neben Simmons, der das Gefährt quer zur Fahrtrichtung parkte und damit die Straße blockierte. Sie sahen noch den sich allmählich entfernenden Trauergästen und Sicherheitsagenten nach und konzentrierten sich dann auf die Umgebung. Kein Mensch war zu sehen. Simmons’ Hand umklammerte fest den Griff seiner Dienstpistole, wobei die schwarzen Lederhandschuhe quietschende Geräusche von sich gaben. Dann beugte er sich vor, drehte mit der Linken den Ton des Polizeifunks lauter, sah den altgedienten Secret-Service-Agenten nervös an und sagte: »Ich weiß, dass Sie mir wahrscheinlich nichts sagen dürfen – aber was ist da hinten eigentlich passiert?«
Richards würdigte ihn keines Blickes. »Stimmt, das kann ich Ihnen nicht sagen.«
»Ich bin hier aufgewachsen«, sagte Simmons, »und kenne wirklich jeden Quadratmeter in der Gegend. Wenn ich jemanden rausschmuggeln wollte, würde ich ’s über den Waldweg probieren, der einen knappen Kilometer weiter von der Straße abzweigt. Wenn Sie diese Abkürzung nehmen und auf der anderen Seite wieder rauskommen, haben Sie mir nichts, dir nichts sieben oder acht Kilometer Vorsprung.«
Jetzt sah Richards ihn doch an und sagte mit gedehnter Stimme: »Ach ja, sind Sie sich da ganz sicher?« Er lehnte sich etwas zur Seite und griff in seine Jackentasche.
Sekundenbruchteile später sackte Secret-Service-Agent Neal Richards mit dem Gesicht voran auf dem breiten Sitz des Lieferwagens zusammen. In der Mitte seines Rückens war ein kleines rotes Loch, und der Kaugummistreifen, den er gerade aus seiner Jackentasche gezogen hatte, steckte noch zwischen den verkrampften Fingern seiner rechten Hand. Simmons drehte sich um. Hinten, auf der Ladefläche, schraubte eine Frau den Schalldämpfer von einer kleinkalibrigen Pistole. Sie hatte sich in einer Nische unter dem doppelten Boden des Fahrzeugs versteckt gehalten. Das Rauschen des Polizeifunks hatte das leise Klappern übertönt, das sich beim Herauskrabbeln nicht vermeiden ließ. »Kleinkaliber Dumdum«, sagte sie. »Ich wollte, dass es im Körper stecken bleibt. Macht nicht so eine Schweinerei.«
Simmons lächelte. »Dieser Charlie hatte schon Recht, das ist echt ein dickes Ding.« Er nahm dem toten Agenten das Sprechfunkgerät ab und warf es mit Schwung in den angrenzenden Wald. Dann fuhr er los, stadtauswärts, und bog nach ungefähr einem Kilometer in einen verkrauteten Waldweg ein. Die Leiche von Agent Richards warfen sie in eine überwucherte Schlucht gleich neben dem Pfad. Simmons hatte den Mann nicht belogen: Dieser Weg war die ideale Fluchtroute. Nach weiteren hundert Metern und zwei Kurven erreichten sie eine aufgelassene Scheune mit offen stehendem Tor und teilweise eingefallenem Dach. Simmons fuhr hinein, sprang aus dem Wagen und schloss die Tore. Neben ihnen stand ein weißer Pickup.
Die Frau, die hinten aus dem Lieferwagen stieg, sah jetzt nicht mehr wie eine alte Witwe aus. Sie war blond, jung, schlank, aber durchtrainiert und trug Jeans und einen weißen Pulli. Sie hatte in ihrem kurzen Leben schon viele Falschnamen benutzt, gegenwärtig war sie »Tasha«. Simmons war schon gefährlich genug, doch Tasha war absolut tödlich, denn sie verfügte über die wichtigste Eigenschaft des eiskalten Killers: Sie hatte kein Gewissen.
Simmons zog seine Uniform aus und stand nun in Jeans und T-Shirt da. Er griff sich ein Schminkköfferchen, das im Laderaum des Lieferwagens verstaut war, streifte die Perücke, die dazu passenden Koteletten und Augenbrauen sowie die anderen Accessoires seiner Gesichtsmaske ab. Er war es gewesen, der sich in dem Hohlraum unter Bill Martins Sarg verborgen gehalten hatte. Er hatte Tasha geholfen, John Bruno hinauszutragen, und war danach in die Rolle von »Officer Simmons« geschlüpft.
Als Nächstes holten sie die große Kiste, in der Bruno lag, von der Ladefläche. Für den Fall, dass sich jemand dafür interessiert hätte, besagte die Deckelaufschrift, dass sich Fernmeldegeräte darin befanden. Vor dem Rückfenster des Pickups stand ein großer Werkzeugkasten. Tasha und Simmons legten Bruno dort hinein, schlossen den Deckel und sperrten den Kasten ab. Deckel und Seitenwände enthielten einige Luftlöcher, außerdem war das Innere gepolstert. Mit Heuballen, die in einer Ecke der Scheune gestapelt waren, bedeckten die beiden den Werkzeugkasten, jedenfalls zum größten Teil. Dann sprangen sie in die Kabine, setzten sich Kappen mit der Aufschrift »John Deere«, einer Firma für Landwirtschaftsmaschinen, auf, starteten den Motor und ließen die Scheune hinter sich. Über einen anderen verkrauteten Wald- und Wiesenweg erreichten sie nach etwa drei Kilometern wieder eine größere Landstraße.
Ein unaufhaltsamer Strom von Streifenwagen, schwarzen Limousinen und schweren Geländewagen kam ihnen entgegen, alle zweifellos unterwegs zum Tatort. Ein junger Polizist lächelte der hübschen Frau auf dem Beifahrersitz des Pickups im Vorbeifahren sogar zu. Tasha bedachte ihn mit einem schmachtenden Blick und winkte zurück, während der entführte Präsidentschaftskandidat noch immer bewusstlos im Werkzeugkasten unter dem Heu lag.
Drei Kilometer Vorsprung hatte der alte Mann, der am Eingang des Bestattungsinstituts gesessen hatte, als die Wahlkampftruppe des Kandidaten vorgefahren war. Er hatte seine Schnitzerei beendet und war ein paar Minuten bevor das Gelände von Michelle Maxwell weiträumig abgeriegelt worden war, davongefahren. Jetzt saß er allein in seinem uralten Buick mit dem röhrenden Auspufftopf. Seine Kollegen hatten ihn gerade über den problemlosen Abtransport des Politikers informiert. Einziges Opfer dabei war ein Secret-Service-Agent. Er hatte das Pech gehabt, sich mit einem Mann zusammenzutun, den er offensichtlich für vollkommen harmlos hielt.
Jetzt ging es endlich los! Endlich, nach all der Zeit und den enormen Vorarbeiten, ging es jetzt los!
Die Freude darüber ließ ihn strahlen.
KAPITEL 5
Der rote Ford Explorer hielt tief im Wald neben einem großen Blockhaus aus Zedernholz, das sich durchaus sehen lassen konnte: Obwohl nur von einem einzigen Menschen bewohnt, war es eher eine repräsentative Lodge als ein einfaches Familienquartier fürs Wochenende. Der Fahrer stieg aus und reckte sich. Es war noch früh am Tage; gerade erst war die Sonne aufgegangen.
Sean King stieg die breite, handgezimmerte Holztreppe empor, schloss die Tür auf und begab sich sofort in die Küche, um Kaffee aufzusetzen. Während der durchlief, sah King sich um, betrachtete mit Zufriedenheit die passgenauen Ecken und Balken sowie das ausgewogene Größenverhältnis zwischen Fenster- und Wandflächen. Nahezu vier Jahre lang hatte er nur in dem kleinen Wohnwagen gehaust, der hier auf dem sechs Hektar großen Waldgrundstück in den Blue Ridge Mountains, etwa sechzig Kilometer westlich von Charlottesville gelegen, abgestellt war. Das Haus hatte er in dieser Zeit fast ohne jede Hilfe selbst gebaut.
Das Mobiliar bestand aus Ledersesseln, üppigen Polstersofas, Holztischen, Orientteppichen, kupfernen Lampen, schmucklosen Regalen mit ausgewählter Literatur, aus Öl- und Pastellbildern, die überwiegend von Künstlern aus der Umgebung stammten, sowie einer Fülle von anderen Gegenständen, die man im Laufe eines Lebens sammelt oder erbt. Und King, der mit seinen mittlerweile vierundvierzig Jahren schon mindestens zwei Leben hinter sich hatte, verspürte nicht die geringste Lust, sich noch ein weiteres Mal neu zu erfinden.
Er ging ins Obergeschoss und über den Holzsteg, der um das ganze Haus herum lief, in sein Schlafzimmer. Auch hier hatte alles seine Ordnung, alles war an seinem Platz, und kein Millimeter Raum war verschwendet worden.
King zog seine Polizistenuniform aus und ging unter die Dusche, um sich den Schweiß einer arbeitsreichen Nacht abzuspülen. Er rasierte sich, wusch sich die Haare und ließ die Operationsnarbe an seinem Mittelfinger vom heißen Wasser aufweichen. An das kleine Souvenir aus seiner Zeit als Secret-Service-Agent hatte er sich längst gewöhnt.
Wäre er beim Service geblieben, so würde er jetzt vermutlich statt in einem schönen Holzhaus im malerischen Herzen Virginias in einem schuhschachtelgroßen Appartement in einer stumpfsinnigen Schlafsiedlung jenseits des Washingtoner Beltway wohnen und wäre nach wie vor mit seiner einstigen Frau verheiratet. Mit Sicherheit würde er sich um diese Morgenstunde nicht für den Gang in die eigene florierende Anwaltspraxis fertig machen, und mit absoluter Sicherheit wäre er kein ehrenamtlicher Hilfspolizist, der einmal pro Woche in seiner ländlichen Heimatgemeinde den Nachtdienst übernahm. Stattdessen müsste er alle Nase lang irgendwo hinfliegen und irgendwelchen Politikern dabei zuschauen, wie sie grinsten und logen und Kleinkinder küssten, sich endlos in Geduld üben und jeden Moment darauf gefasst sein, dass jemand versuchte, seinen Schützling umzubringen. Was für eine groteske Existenz, samt Vielflieger-Bonus und so vielen Aufputschtabletten, wie er wollte!
Er zog sich Anzug und Krawatte an, kämmte sich die Haare, trank seinen Kaffee auf der verglasten Veranda vor der Küche und las dabei die Zeitung. Die erste Seite wurde beherrscht von der Berichterstattung über die Entführung John Brunos und die Fahndungsarbeit des FBI. King las alles sorgfältig durch und merkte sich die wichtigsten Einzelheiten. Dann schaltete er den Fernsehapparat ein, suchte und fand einen Nachrichtensender und bekam gerade noch mit, wie eine Reporterin über den Tod des altgedienten Secret-Service-Agenten Neal Richards berichtete. Er hinterließ eine Frau und vier Kinder.
Das war alles zweifellos tragisch und traurig, doch wenigstens kümmerte sich der Secret Service um die Hinterbliebenen. Neal Richards’ Familie konnte mit voller Unterstützung rechnen. Den Verlust wog das zwar nicht auf, doch es war wenigstens etwas.
Die Reporterin berichtete weiter, dass seitens des FBI bisher noch keine Stellungnahme vorläge. »Kein Wunder«, sagte King zu sich selbst; das war absolut nicht üblich. Dennoch würde über kurz oder lang irgendwas durchsickern. Irgendjemand würde den Mund nicht halten, ein Bekannter würde mit dem Aufgeschnappten zu einem Bekannten bei der Post oder der Times rennen, und damit wüsste alle Welt Bescheid. Auch wenn diese Informationen mit der Wirklichkeit nicht mehr viel zu tun hätten. Der Medienmoloch hatte einen unstillbaren Appetit, und keine Organisation konnte es sich leisten, ihn am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen, nicht einmal das FBI.
Er richtete sich auf und starrte die Frau auf dem Fernsehbildschirm an, die neben einer Gruppe von Leuten vor einem Podium stand. Das war die Secret-Service-Seite der Affäre, das spürte er instinktiv. Er kannte diese Sorte nur allzu gut. Die Frau wirkte professionell und souverän und verfügte über jene gespannte Wachsamkeit, die King nur allzu vertraut war. Und da war noch etwas in ihrem Ausdruck, etwas, was er sich zunächst nicht erklären konnte. Ein inneres Feuer auf jeden Fall, das hatten sie ja alle in dieser Branche, der eine mehr, der andere weniger. Aber da war noch etwas – ein unterschwelliger Trotz vielleicht?
Der Secret Service unterstütze das FBI in jeder Hinsicht, sagte einer der Männer, und selbstverständlich würden auch interne Untersuchungen angestellt. King wusste, dass diese Aufgabe von einer speziellen Kommission übernommen würde – er hatte das nach der Ermordung Ritters alles am eigenen Leib erfahren müssen. Wenn er die bürokratische Doppelzüngigkeit richtig interpretierte, so bedeutete dies, dass man die Schuldigen längst ausgemacht hatte. Sie würden öffentlich bekannt gegeben, sobald die beteiligten Parteien sich darüber einig waren, mit welchem Unterton man die entsprechenden unangenehmen Nachrichten verkaufen wollte.
Die Pressekonferenz war vorbei. Die Frau entfernte sich vom Podium und stieg in einen schwarzen Pkw. Auf Anordnung des Service stehe sie für Fragen der Presse nicht mehr zur Verfügung, sagte die Berichterstatterin – nicht ohne sie freundlicherweise vorher noch als Michelle Maxwell zu identifizieren, Leiterin der Personenschutzeinheit, die John Bruno verloren hatte.
Wieso führen sie sie dann überhaupt der Presse vor, fragte sich King. Warum vor dem Raubtierkäfig mit frischem Fleisch herumwedeln? Es dauerte nur Sekunden, bis ihm die Antwort einfiel: Der künftige Sündenbock brauchte ein Gesicht. Der Secret Service hatte mehrfach bewiesen, dass er seine Leute zu schützen verstand. Es war ja nicht das erste Mal, dass seine Agenten Mist gebaut hatten. Man beurlaubte sie, nahm sie damit aus der Schusslinie und versetzte sie später auf einen anderen Posten. In diesem Fall verhielt es sich offenbar anders: Wahrscheinlich war der politische Druck so stark, dass Köpfe rollen mussten, oder zumindest einer. »Hier, liebe Leute, hier habt ihr die Verantwortliche« – so oder so ähnlich mochte man an zuständiger Stelle gedacht haben. »Packt sie euch ruhig, auch wenn die Ergebnisse der offiziellen Untersuchungen noch auf sich warten lassen.« Mit einem Mal verstand King den unterschwelligen Trotz in den Zügen der Frau. Sie wusste genau, was gespielt wurde. Die Lady war Zuschauerin bei ihrer eigenen Hinrichtung und fühlte sich nicht wohl in dieser Rolle.
King schlürfte seinen Kaffee, mampfte eine Scheibe Toast und sagte zu der bereits von der Bildfläche verschwundenen Agentin: »Kein Wunder, dass dich das alles ankotzt, Michelle. Sie schicken dich auf jeden Fall in die Wüste, da kannst du Gift drauf nehmen.«
Plötzlich erschien Michelle Maxwell wieder im Bild, und man erfuhr mehr über ihren Hintergrund. Die Frau war als ehemaliges Mitglied der amerikanischen Studentenmannschaften im Basketball und in der Leichtathletik nicht nur ein sportliches Ass, sondern auch ein akademisches Schwergewicht: In nur drei Jahren hatte sie ihr Kriminalistik-Studium an der Georgetown University durchgezogen. Und als wäre dies alles noch nicht genug, hatte sie ihre beachtlichen sportlichen Talente noch in einer weiteren Sportart unter Beweis gestellt und bei den olympischen Spielen eine Silbermedaille im Rudern gewonnen… Eine akademisch gebildete Sportlerin, in der Tat sehr anregend, dachte King. Michelle Maxwell hatte ein Jahr lang bei der Polizei in ihrem Heimatstaat Tennessee gearbeitet, sich dann dem Secret Service angeschlossen und dort die Karriereleiter doppelt so schnell wie üblich erklommen. Im Augenblick jedoch spielte sie die schöne Rolle des Sündenbocks.
Und schön ist sie, auch als Sündenbock, dachte King – und stockte. Schön? Ja, und doch verriet das Bild auch maskuline Qualitäten. Da war zum Beispiel ihr energischer, fast ein wenig ausladender Gang. Oder ihre beeindruckende Schulterbreite – kein Wunder bei so viel Ruderei. Oder ihre markante Kieferpartie, die auf eine sich immer wieder durchsetzende, verbissene Hartnäckigkeit deutete. Dennoch wies sie auch unleugbar feminine Züge auf. Sie war über eins fünfundsiebzig groß, trotz der breiten Schultern schlank und hatte hübsche, zarte Kurven. Ihr glattes, schwarzes Haar trug sie schulterlang, noch den Vorschriften des Service entsprechend, aber doch schick. Sie hatte hohe, kräftige Wangenknochen und grün schimmernde, intelligente Augen, denen garantiert nur sehr wenig entging. Ohne einen solchen Röntgenblick konnte man im Secret Service gleich einpacken.
Der Gesamteindruck, den Michelle Maxwell vermittelte, war nicht der einer klassischen Schönheit. Aber man erkannte deutlich, dass sie das Mädchen war, das schon immer schneller und gescheiter war als alle Jungen. In der High School waren höchstwahrscheinlich alle männlichen Wesen ganz versessen darauf gewesen, sie entjungfern zu dürfen, aber King war überzeugt, dass das niemandem gelungen war – es sei denn zu Maxwells eigenen Bedingungen.
Na ja, sagte er in Gedanken zu der Frau auf dem Bildschirm, es gibt ein Leben nach dem Service… Du kannst noch einmal von vorn anfangen und dich unter anderen Vorzeichen neu profilieren. Du kannst, allen Unkenrufen zum Trotz, sogar ein halbwegs glückliches Leben führen. Nur vergessen wirst du nicht können. Tut mir Leid für dich, Michelle Maxwell, aber auch in diesem Punkt spreche ich aus Erfahrung…
Er sah auf seine Armbanduhr. Es war höchste Zeit. Sein Brotberuf rief nach ihm: Testamente und Pachtverträge ausfertigen und sich die Arbeit nach dem gültigen Stundensatz bezahlen lassen. Das war zwar nicht annähernd so spannend wie seine frühere Tätigkeit, doch in dieser Phase seines Lebens hatte Sean King überhaupt nichts gegen langweilige Routinearbeit einzuwenden. Was er an Aufregungen schon hinter sich hatte, reichte noch für mehrere weitere Leben.
KAPITEL 6
King fuhr sein Lexus-Cabriolet mit offenem Verdeck aus der Garage und trat zum zweiten Mal innerhalb von acht Stunden die Fahrt zur Arbeit an. Die kurvenreiche Bergstraße bot atemberaubende Ausblicke; hier und da zeigte sich Wild. Verkehr gab es kaum, jedenfalls nicht, bevor er auf den Highway Richtung Stadt einbog. Seine Kanzlei lag an der Main Street, die ihren Namen zu Recht trug, war sie doch die einzige einigermaßen ernst zu nehmende Straße im Herzen von Wrightsburg, einer kleinen und relativ jungen Gemeinde auf halbem Wege zwischen den erheblich größeren Städten Lynchburg und Charlottesville.
Er stellte den Wagen auf dem Parkplatz hinter dem zweistöckigen, aus weißem Klinker erbauten Haus ab, in dem das »Anwaltsbüro und Notariat King & Baxter« untergebracht war, wie das Firmenschild am Eingang stolz verkündete. King hatte an der nur dreißig Autominuten entfernten Universität von Virginia Rechtswissenschaften studiert, bis er nach zwei Jahren den Bettel hinschmiss und sich für eine Karriere beim Secret Service entschied. Damals hatte er sich nach einem Leben gesehnt, das mehr Aufregung versprach als jenes, das ihm ein Stapel juristischer Lehrbücher und die sokratische Methode bieten konnten. Er konnte sich nicht beklagen: Sein Quantum an Abenteuern hatte er gehabt.
Nachdem sich der durch die Ermordung Clyde Ritters aufgewirbelte Staub gelegt hatte, war King aus dem Secret Service ausgeschieden, an die Universität zurückgekehrt, hatte sein Studium abgeschlossen und eine Ein-Mann-Kanzlei in Wrightsburg eröffnet. Inzwischen hatte er einen Geschäftspartner gefunden und sich in jeder Hinsicht eingelebt: Er war ein angesehener Jurist und mit vielen prominenten und einflussreichen Bürgern der Region befreundet. Er diente seiner Gemeinde als ehrenamtlicher Hilfspolizist und auf anderen Gebieten. Als einer der begehrtesten Junggesellen weit und breit ging er mit Frauen aus, die ihm gefielen, und ließ es bleiben, wenn sie ihm nicht gefielen. Er verfügte über einen großen, sehr gemischten Bekanntenkreis und einen kleinen harten Kern echter Freunde. Seine Arbeit machte ihm Spaß, er genoss seine Freizeit und ließ sich ansonsten kaum aus der Ruhe bringen. Sein Leben bewegte sich in einem sorgfältig aufgebauten, unspektakulären Rahmen, und er war damit vollkommen zufrieden.
Als er aus dem Lexus stieg, erblickte er die Frau und überlegte, ob er nicht schleunigst wieder hinter dem Steuer verschwinden sollte, aber es war bereits zu spät. Sie hatte ihn gesehen und kam sofort auf ihn zu.
»Hallo, Susan«, sagte er und holte seine Aktentasche vom Beifahrersitz.
»Sie sehen müde aus«, sagte sie. »Ich weiß wirklich nicht, wie Sie das alles schaffen.«
»Was schaffen?«
»Tagsüber viel beschäftigter Anwalt, nachts Polizist.«
»Freiwilliger Hilfspolizist, Susan, und das nur einmal in der Woche. Ehrlich gesagt, das Aufregendste, was vergangene Nacht passiert ist, war, dass ich einem Opossum ausweichen musste. Fast hätte ich es erwischt.«
»Ich wette, dass Sie beim Secret Service tagelang ohne Schlaf auskommen mussten. Wie aufregend, aber sicherlich auch furchtbar anstrengend!«
»Nein, eigentlich nicht«, sagte er und machte sich auf den Weg ins Büro. Sie folgte ihm.
Susan Whitehead war Anfang vierzig, geschieden, attraktiv, reich und offenbar fest entschlossen, ihn zu ihrem vierten Ehemann zu machen. King hatte sie bei ihrer letzten Scheidung anwaltlich vertreten und kannte daher aus erster Hand ihre unglaubliche Launenhaftigkeit und Rachsucht. Seine Sympathien lagen eindeutig beim armen Gatten Nummer drei, einem schüchternen, verschlossenen Mann, der hoffnungslos unter ihrer Knute gestanden hatte. Eines Tages war er ausgebrochen und hatte sich in Las Vegas vier Tage lang dem Suff, dem Spiel und dem Sex hingegeben – und das war der Anfang vom Ende gewesen. Inzwischen war er ärmer, aber zweifellos auch glücklicher. King hatte nicht die geringste Lust, an seine Stelle zu treten.
»Ich gebe am Samstagabend eine kleine Dinnerparty und würde mich sehr über Ihren Besuch freuen«, sagte Susan.
Er rief sich seinen Terminkalender ins Gedächtnis, stellte fest, dass er am Samstagabend noch nichts vorhatte und sagte, ohne mit der Wimper zu zucken: »Tut mir Leid, aber da bin ich schon ausgebucht. Trotzdem vielen Dank. Vielleicht ein andermal.«
»Sie sind oft ausgebucht, Sean«, erwiderte sie leise. »Ich hoffe doch sehr, dass irgendwann mal eine Lücke für mich frei ist.«
»Ein Anwalt und seine Klientin sollten sich persönlich nicht zu nahe kommen, Susan, das ist nicht gut.«
»Aber ich bin doch gar nicht mehr Ihre Klientin.«
»Trotzdem, es ginge nicht gut, glauben Sie mir.« Er stand jetzt vor der Haustür und schloss auf, bevor er hinzufügte: »Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.« Dann ging er hinein, verharrte einige Sekunden lang im Foyer, atmete erleichtert auf, als er merkte, dass sie nicht hinter ihm hergefegt kam, und ging die Treppe zu den Büroräumen hinauf. Er war fast immer der Erste am Arbeitsplatz. Sein Partner, Phil Baxter, war der Strafverteidiger der Kanzlei, während King sich auf die anderen Gebiete konzentrierte: Testamente, Stiftungen, Immobilien, Geschäftsverträge – lauter ständig sprudelnde Geldquellen. In stillen Ecken und Winkeln rund um Wrightsburg hatte sich viel verborgener Wohlstand eingenistet. Filmstars, schwerreiche Unternehmer, Schriftsteller und andere betuchte Seelen waren hier zu Hause. Sie liebten die Gegend wegen ihrer landschaftlichen Schönheit, ihrer Einsamkeit, ihrer Diskretion und wegen der örtlichen Infrastruktur in Form von guten Restaurants, guten Einkaufsmöglichkeiten, einer lebendigen Kulturszene und einer Universität von Weltrang im benachbarten Charlottesville.
Phil Baxter war kein Frühaufsteher – das Gericht öffnete ja auch erst um zehn Uhr –, aber er arbeitete oft bis spät in die Nacht. King war das genaue Gegenteil: Normalerweise war er um fünf Uhr nachmittags zu Hause, bosselte in seiner Werkstatt herum, ging zum Fischen oder fuhr mit dem Boot hinaus auf den See gleich hinter seinem Haus. Von daher passten sie recht gut zusammen.
King öffnete die Bürotür und trat ein. Die Sekretärin, die in Personalunion auch als Empfangsdame fungierte, war um diese Zeit ebenfalls noch nicht da; es war noch nicht einmal acht Uhr.
Der umgestürzte Stuhl war das Erste, was ihm auffiel, und gleich danach die vielen Dinge, die eigentlich auf den Schreibtisch der Sekretärin gehörten, nun aber kreuz und quer über den Boden verstreut lagen. Automatisch glitt seine Hand zu seinem Pistolenholster – nur trug er keines bei sich, und er erst recht keine Pistole. Das Einzige, was er mit sich führte, war ein von ihm selbst aufgesetzter Testamentsnachtrag in seiner Aktentasche, doch mit dem konnte er allenfalls die künftigen Erben erschrecken. Also hob er einen massiven Briefbeschwerer vom Boden auf und blickte sich um. Das, was er als Nächstes sah, ließ ihn erstarren.
Vor der Tür zu Baxters Büro befand sich eine Blutlache auf dem Boden. King ging ein paar Schritte darauf zu, den Briefbeschwerer schlagbereit in der Hand. Mit der anderen Hand holte er sein Handy aus der Tasche, wählte 911, gab klar und deutlich seine Beobachtungen zu Protokoll und steckte das Mobiltelefon wieder ein. Er wollte schon die Tür zum Büro öffnen, da fiel ihm gerade noch rechtzeitig ein, dass er keine Fingerabdrücke verwischen durfte. Also zog er ein Taschentuch aus der Hosentasche. Vorsichtig drehte er den Türknopf. Seine Muskeln waren angespannt, zum Angriff bereit, und doch sagte ihm sein Instinkt, dass der Raum leer war. Er spähte in das noch dunkle Zimmer und knipste mit dem Ellenbogen das Licht an.
Die Leiche lag direkt vor ihm auf der Seite. Eine Schusswunde mitten in der Brust und die entsprechende Austrittswunde auf dem Rücken waren die einzigen erkennbaren Verletzungen. Der Tote war nicht Phil Baxter, sondern ein anderer Mann – ein Mann, den King gut kannte, sehr gut sogar. Und sein gewaltsamer Tod war dazu angetan, Sean Kings friedliche Existenz in ihren Grundfesten zu erschüttern.
Er hatte die ganze Zeit die Luft angehalten, nun atmete er aus. Schlagartig war ihm klar, was nun auf ihn zukam. »Jetzt geht das alles wieder von vorne los«, murmelte er.
KAPITEL 7
Der Mann saß in seinem Buick und beobachtete, wie Polizeifahrzeuge vor Kings Kanzleigebäude vorfuhren und die Uniformierten ins Haus stürmten. Sein Äußeres hatte sich, seit er nach dem Abtransport von John Bruno die Rolle des alten Schnitzers vor dem Bestattungsinstitut aufgegeben hatte, sehr verändert. An jenem Tag hatte er einen Anzug getragen, der ihm um zwei Nummern zu groß war, und dementsprechend klein und abgezehrt ausgesehen. Auch die schlechten Zähne, der Schnurrbart, der Flachmann, die Schnitzerei und der Batzen Kaugummi im Mund hatten zu der raffinierten Inszenierung gehört, die auf ihn aufmerksam machen sollte. Jeder, der ihn so sah, bekam einen unauslöschlichen Eindruck von ihm und seinem Wesen – und zwar einen in jeder Hinsicht falschen. Und genau das war der Zweck der Übung gewesen.
Inzwischen hatte er sich wesentlich verjüngt, um etwas mehr als dreißig Jahre vielleicht. Ebenso wie King hatte er sich neu erfunden. Er kaute an einem Butterbrötchen, schlürfte schwarzen Kaffee und dachte in aller Ruhe darüber nach, wie King wohl auf die Entdeckung der Leiche in seinem Büro reagiert hatte. Am Anfang natürlich mit einem heillosen Schrecken, dann vielleicht verärgert, aber nicht überrascht – nein, überrascht bestimmt nicht, wenn man es genau bedachte.
Der Mann schaltete das Radio ein, das immer auf den lokalen Sender eingestellt war, und erwischte gerade noch die Acht-Uhr-Nachrichten. Sie begannen mit dem Entführungsfall Bruno, der derzeit vermutlich überall auf der Welt für Schlagzeilen sorgte und in Amerika, zumindest vorübergehend, selbst den Ereignissen im Nahen Osten und den Football-Ergebnissen die Schau stahl.
Während sich der Mann Butter und Sesamkörner von den Fingern leckte, berichtete der Reporter über Michelle Maxwell, die Einsatzleiterin beim Secret Service, die inzwischen offiziell beurlaubt worden war. Er wusste, was das bedeutete: Sie stand bereits mit einem Fuß im Grab ihrer Karriere.
Die Frau war also erst einmal weg vom Fenster – zumindest offiziell. Aber inoffiziell? Weil er diese Frage nicht beantworten konnte, hatte er sich ihre Züge genau eingeprägt, als sie an jenem Tag an ihm vorübergegangen war. Es war nicht auszuschließen, dass er es noch einmal mit ihr zu tun bekommen würde. Ihr Hintergrund war ihm inzwischen bestens vertraut, doch je mehr Informationen er über sie besaß, desto besser. Eine Frau wie diese verkroch sich in einer solchen Situation entweder daheim im stillen Kämmerlein und pflegte ihre Verbitterung – oder aber sie ging in die Offensive und scheute dabei auch vor Risiken nicht zurück. Nach dem Wenigen zu schließen, das er von ihr gesehen hatte, durfte die zweite Möglichkeit die wahrscheinlichere sein.