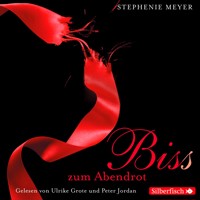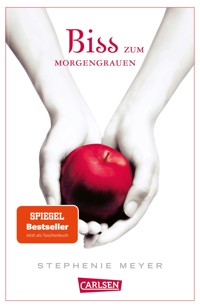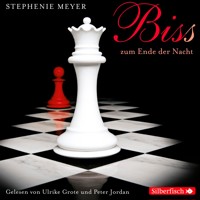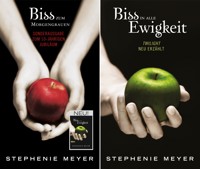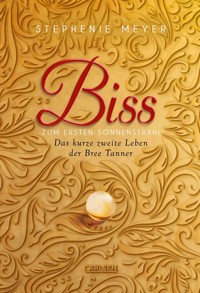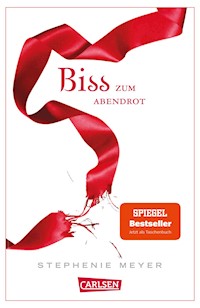
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Zwischen Vampiren und Werwölfen Bellas Leben ist in Gefahr. Ein offensichtlich blutrünstiger Vampir sinnt auf Rache. Und seine Spuren führen zu Bella. Aber damit nicht genug: Nachdem sie wieder mit Edward zusammen ist, muss sie sich zwischen ihrer Liebe zu ihm und ihrer Freundschaft mit Jacob entscheiden – doch damit könnte sie den uralten Kampf zwischen Vampiren und Werwölfen neu entfachen. Bella und Edwards ungewöhnliche Liebesgeschichte Als die 17-jährige Bella Swan aus dem sonnigen Phoenix ins regnerische Forks zieht, erwartet sie wenig von der beschaulichen Kleinstadt. Doch dann trifft sie Edward Cullen, einen Mitschüler mit faszinierend blassen Augen und einer Aura, die Bella sofort in ihren Bann zieht. Edward ist geheimnisvoll, zurückhaltend, unglaublich attraktiv – und ein Vampir! Bella kann nicht anders: Sie fühlt sich trotz – oder vielleicht gerade wegen – seiner dunklen Geheimnisse zu ihm hingezogen. Doch was bedeutet es, als Mensch einen Vampir zu lieben? Mit der "Twilight"-Saga hat Stephenie Meyer eine der populärsten Fantasy-Romance-Serien der letzten Jahrzehnte erschaffen. Insbesondere die Kombination aus romantischer Liebesgeschichte und übernatürlichen Elementen wie Vampiren und Werwölfen begeistert die breite Fangemeinschaft. Zwischen 2008 und 2012 wurden die Biss-Bände mit Kristen Stewart und Robert Pattinson erfolgreich verfilmt. Der dritte Band der weltberühmten Fantasy-Serie für Fans von paranormaler Romance und Vampirgeschichten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 812
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Die packende Liebesgeschichte zwischen Edward und Bella geht weiter! - Teil 3 von Spiegel-Bestseller-Autorin Stephenie Meyer
Bellas Leben ist in Gefahr. Ein offensichtlich blutrünstiger Vampir sinnt auf Rache. Und seine Spuren führen zu Bella. Aber damit nicht genug: Nachdem sie wieder mit Edward zusammen ist, muss sie sich zwischen ihrer Liebe zu ihm und ihrer Freundschaft mit Jacob entscheiden – doch damit könnte sie den uralten Kampf zwischen Vampiren und Werwölfen neu entfachen …
Dies ist Band 3 der international erfolgreichen »Biss«-Saga. Alle Bände auf einen Blick:
Biss zum Morgengrauen
Biss zur Mittagsstunde
Biss zum Abendrot
Biss zum Ende der Nacht
Biss zur Mitternachtssonne
Biss zum ersten Sonnenstrahl – Das kurze zweite Leben der Bree Tanner
Endlich gibt es auch Band 5 der weltweit geliebten Fantasy-Romance-Serie: »Biss zur Mitternachtssonne« und wir erfahren die Geschichte aus Edwards Sicht!
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Danksagung
Vita
Für meinen Mann Pancho,für deine Geduld und Liebe, deine Freundschaft, deinen Humorund deine Bereitschaft, auswärts zu essen.Und für meine Kinder Gabe, Seth und Eli,durch die ich jene Liebe erfahre,
Feuer und EisSo mancher sagt, die Welt vergeht in Feuer,so mancher sagt, in Eis.Nach dem, was ich von Lust gekostet,halt ich’s mit denen, die das Feuer vorziehn.Doch müsst sie zweimal untergehn,kenn ich den Hass wohl gut genug,zu wissen, dass für die Zerstörung Eisauch bestens istund sicher reicht.
Vorwort
All unsere Versuche, noch einen Ausweg zu finden, waren vergebens gewesen.
Mit Eis im Herzen sah ich zu, wie er sich anschickte, mich zu verteidigen. Er wirkte hochkonzentriert und siegessicher, obwohl die anderen in der Überzahl waren. Ich wusste, dass wir nicht mit Hilfe rechnen konnten – seine Familie kämpfte in diesem Moment genauso um ihr Leben wie er um unseres.
Würde ich je erfahren, wie dieser andere Kampf ausgegangen war? Wer gewonnen und wer verloren hatte? Würde ich lange genug leben?
Es sah nicht danach aus.
Der Blick aus schwarzen Augen verlangte heftig nach meinem Tod, lauerte darauf, dass mein Beschützer einen einzigen Moment nicht aufpasste. Ein Moment, in dem ich ganz sicher sterben würde.
Irgendwo, in den Tiefen des kalten Waldes, heulte ein Wolf.
Das rechte Maß
Bella,
ich weiß nicht, warum Du Charlie Briefchen für Billy mitgibst – als ob wir zwölf wären. Wenn ich mit Dir reden wollte, würde ich doch ans
Es war Deine Entscheidung, oder? Du kannst nicht beides haben, wenn
Was ist so schwer daran zu verstehen, dass wir Todfeinde
Ich weiß, dass ich mich idiotisch aufführe, aber es geht eben nicht
Wir können keine Freunde sein, wenn Du die ganze Zeit mit einer Horde
Wenn ich zu viel an Dich denke, wird es nur noch schlimmer, also schreib mir nicht mehr
Ja, du fehlst mir auch. Sehr sogar. Aber das ändert nichts. Tut mir leid.
Jacob
Ich fuhr mit den Fingern über das Blatt und spürte, wo er mit dem Füller so fest aufgedrückt hatte, dass die Seite fast eingerissen wäre. Ich sah ihn vor mir, wie er diese Zeilen schrieb – wie er die wütenden Buchstaben in seiner unordentlichen Schrift hinkritzelte und alles wieder durchstrich, was ihm nicht gefiel, vielleicht sogar die Feder mit seiner zu großen Hand zerbrach; das würde die Tintenkleckse erklären. Ich stellte mir vor, wie er vor Wut die Augenbrauen zusammenzog und die Stirn runzelte. Wäre ich dabei gewesen, hätte ich vielleicht gelacht. Pass auf, dass du nicht platzt, Jacob, hätte ich gesagt. Spuck’s einfach aus.
Aber als ich die Worte, die ich bereits auswendig konnte, noch einmal las, war mir ganz und gar nicht zum Lachen zu Mute. Seine Antwort auf meinen flehenden Brief – den ich über Charlie und Billy hatte überbringen lassen, wie eine Zwölfjährige, da hatte er Recht – war nicht weiter überraschend. Noch ehe ich den Brief öffnete, hatte ich gewusst, was drinstand.
Überraschend war, wie sehr mich jede durchgestrichene Zeile verletzte – als wären die Ober- und Unterlängen der Buchstaben lauter kleine Messer. Hinter jedem wütenden Satzanfang verbarg sich ein tiefer Schmerz; Jacobs Kummer tat mir noch mehr weh als mein eigener.
Plötzlich drang mir ein unverkennbarer Geruch aus der Küche ins Bewusstsein – eine qualmende Herdplatte. In einem anderen Haus wäre die Tatsache, dass jemand kochte, vielleicht kein Grund zur Panik gewesen.
Ich schob den zerknitterten Brief in die hintere Hosentasche und stürmte die Treppe hinunter. Ich kam gerade noch rechtzeitig.
Das Glas mit Spaghettisoße, das Charlie in die Mikrowelle gestellt hatte, war gerade bei der ersten Umdrehung, als ich die Tür aufriss und es herausnahm.
»Was hab ich falsch gemacht?«, wollte Charlie wissen.
»Erst den Deckel abnehmen, Dad. Metall gehört nicht in die Mikrowelle.« Schnell schraubte ich den Deckel ab, kippte die Hälfte der Soße in eine Schale, schob die Schale in die Mikrowelle und das Glas in den Kühlschrank. Dann stellte ich die Zeit ein und drückte den Startknopf.
Charlie sah mir mit geschürzten Lippen zu. »Hab ich wenigstens die Nudeln richtig gekocht?«
Ich schaute in den Topf, der auf dem Herd stand – da kam der Geruch her, der mich alarmiert hatte. »Ab und zu umrühren kann nicht schaden«, sagte ich freundlich. Ich nahm einen Löffel und versuchte den matschigen Haufen, der am Boden des Topfes klebte, zu entklumpen.
Charlie seufzte.
»Ist heute was Besonderes?«, fragte ich.
Er verschränkte die Arme vor der Brust und schaute durch die nach hinten gelegenen Fenster hinaus in den strömenden Regen. »Ich weiß nicht, was du meinst«, grummelte er.
Ich verstand die Welt nicht mehr. Charlie und Kochen? Und wieso war er so schlecht gelaunt? Edward war doch noch gar nicht hier; normalerweise sparte mein Vater sich dieses Benehmen für meinen Freund auf, um ihm mit jedem Wort und jeder Geste zu demonstrieren, dass er nicht willkommen war. Charlie hätte sich gar nicht so anstrengen müssen – Edward wusste sowieso, was er dachte.
Während ich rührte, musste ich mir beim Gedanken an das Wort »Freund« auf die Wange beißen, weil ich schon wieder kribbelig wurde. Das Wort passte nicht, ganz und gar nicht. Es müsste etwas sein, was nach Ewigkeit klang … Doch Begriffe wie Schicksal und Fügung klangen so aufgeblasen, wenn man sie in einer normalen Unterhaltung benutzte.
Edward hatte ein anderes Wort im Kopf, und dieses Wort machte mich so kribbelig. Wenn ich nur daran dachte, rollten sich mir schon die Fußnägel hoch.
Verlobte. Brrr. Bei der Vorstellung bekam ich das Gruseln.
»Hab ich was verpasst? Seit wann machst du denn Abendessen?«, fragte ich Charlie. Der Nudelklumpen schwappte im Kochwasser herum, als ich hineinstach. »Oder besser gesagt, versuchst Abendessen zu machen?«
Charlie zuckte die Achseln. »Es gibt kein Gesetz, das es mir verbietet, in meinem eigenen Haus zu kochen.«
»Wenn es eins gäbe, würdest du’s ja kennen«, sagte ich und schaute grinsend auf den Stern an seiner Lederjacke.
»Ha. Guter Witz.« Er zog die Jacke aus, als hätte mein Blick ihn daran erinnert, dass er sie immer noch anhatte, und hängte sie an den Kleiderhaken, der für ihn reserviert war. Sein Pistolengurt hing schon dort – den hatte er seit Wochen nicht mehr umgeschnallt, wenn er zur Wache fuhr. In der kleinen Stadt Forks in Washington war schon länger nichts Beunruhigendes mehr passiert; die geheimnisvollen Riesenwölfe waren in den ständig verregneten Wäldern nicht mehr gesichtet worden …
Schweigend stocherte ich in den Nudeln herum und dachte, dass Charlie mir schon sagen würde, was er auf dem Herzen hatte, wenn er so weit war. Mein Vater war kein Freund großer Worte, und die Tatsache, dass er versucht hatte, ein gemeinsames Abendessen auf die Beine zu stellen, zeigte, dass er ungewöhnlich viele Worte im Kopf hatte.
Ich schaute gewohnheitsmäßig auf die Uhr – das tat ich um diese Zeit alle fünf Minuten. Keine halbe Stunde mehr.
Die Nachmittage waren das Schlimmste. Seit mein ehemaliger bester Freund (und Werwolf) Jacob Black meinem Vater verraten hatte, dass ich heimlich Motorrad gefahren war – damit ich Hausarrest bekam und mich nicht mehr mit meinem Freund (und Vampir) Edward Cullen treffen konnte –, durfte ich Edward nur noch abends von sieben bis halb zehn treffen, und auch das nur bei mir zu Hause und unter den zuverlässig grimmigen Blicken meines Vaters.
Das war eine Steigerung des etwas milderen Hausarrests, den ich mir eingehandelt hatte, als ich ohne Erklärung für drei Tage verschwunden und von einer hohen Klippe gesprungen war. Natürlich traf ich Edward weiterhin in der Schule, das konnte Charlie nicht verhindern. Außerdem verbrachte Edward fast jede Nacht in meinem Zimmer, aber davon hatte Charlie keine Ahnung. Edwards Talent, leise und behände durchs Fenster in mein Zimmer im ersten Stock hereinzuklettern, war fast so nützlich wie seine Fähigkeit, Charlies Gedanken zu lesen.
Obwohl ich nur nachmittags von Edward getrennt war, wurde ich jedes Mal ganz unruhig und die Stunden zogen sich endlos. Trotzdem ertrug ich die Strafe klaglos. Erstens wusste ich, dass ich sie verdient hatte, und zweitens konnte ich es meinem Vater jetzt nicht antun auszuziehen, wo doch bald eine Trennung von sehr viel längerer Dauer anstand. Aber davon ahnte er noch nichts.
Ächzend setzte mein Vater sich an den Tisch und faltete die feuchte Zeitung auseinander. Kurz darauf schnalzte er missbilligend mit der Zunge.
»Dad, ich weiß gar nicht, wieso du überhaupt noch Zeitung liest. Du regst dich doch nur auf.«
Er beachtete mich nicht, sondern murrte über der Zeitung weiter vor sich hin. »Deshalb will alle Welt in einer Kleinstadt leben! Es ist unglaublich.«
»Was haben die Großstädte jetzt schon wieder verbrochen?«
»Seattle ist auf dem besten Weg, die Hauptstadt der Mörder zu werden. Allein in den letzten beiden Wochen fünf unaufgeklärte Morde. Kannst du dir vorstellen, in so einer Stadt zu leben?«
»Ich glaube, da steht Phoenix auf der Liste noch weiter oben, Dad. Ich hab schon mal in so einer Stadt gelebt.« Und ich war noch nie so nah dran gewesen, selbst einem Mord zum Opfer zu fallen, wie seit meinem Umzug in diese harmlose Kleinstadt. Auch jetzt schwebten mehrere Todesdrohungen über mir … Der Löffel in meiner Hand zitterte und das Wasser schwappte bedenklich.
»Keine zehn Pferde würden mich dahin kriegen«, sagte Charlie.
Ich gab es auf, das Abendessen retten zu wollen, und beschloss es einfach zu servieren. Ich musste ein Steakmesser nehmen, um eine Portion Spaghetti für Charlie und dann eine für mich abzuschneiden, während er mir beschämt zuschaute. Er schaufelte sich Soße über seine Portion und machte sich darüber her. Ich versteckte meinen Spaghettiklumpen so gut es eben ging unter der Soße und folgte seinem Beispiel ohne große Begeisterung. Eine Weile aßen wir schweigend. Charlie las immer noch Zeitung, also griff ich nach meiner abgenutzten Ausgabe von Sturmhöhe und las dort weiter, wo ich beim Frühstück stehengeblieben war, um mich ins England des achtzehnten Jahrhunderts zu versetzen, während ich darauf wartete, dass er loslegte.
Ich war gerade bei Heathcliffs Rückkehr angelangt, als Charlie sich räusperte und die Zeitung auf den Boden warf.
»Du hast Recht«, sagte Charlie. »Es gibt einen Grund für das hier.« Er zeigte mit der Gabel auf die Nudelpampe. »Ich wollte mit dir reden.«
Ich legte das Buch beiseite; es war so zerlesen, dass der Einband gar nicht mehr richtig hielt. »Das hättest du mir doch einfach sagen können.«
Er nickte und zog die Augenbrauen zusammen. »Ja. Ich werd’s mir fürs nächste Mal merken. Ich dachte mir, es stimmt dich milde, wenn ich dir das Kochen abnehme.«
Ich lachte. »Das hast du geschafft – dank deiner Kochkünste bin ich jetzt so mild wie der Winter in Kalifornien. Was gibt’s, Dad?«
»Also, es geht um Jacob.«
Ich merkte, wie meine Miene hart wurde. »Was ist mit ihm?«, fragte ich mit steifen Lippen.
»Immer mit der Ruhe, Bella. Ich weiß, dass du sauer bist, weil er dich verraten hat, aber da hatte er Recht. Er hat verantwortungsvoll gehandelt.«
»Verantwortungsvoll«, sagte ich abfällig. »Ah ja. Also, was ist mit Jacob?«
Die Frage hallte in meinem Kopf wider, sie war gar nicht so banal, wie es schien. Was war mit ihm? Mit meinem ehemaligen besten Freund, der jetzt mein … was war er eigentlich? Mein Feind? Bei dem Gedanken erschrak ich.
Charlie war plötzlich auf der Hut. »Nicht sauer werden, ja?«
»Sauer?«
»Na ja, es hat auch mit Edward zu tun.«
Ich kniff die Augen zusammen.
Charlie klang jetzt angriffslustiger. »Ich lasse ihn doch ins Haus, oder?«
»Ja«, gab ich zu. »Für kurze Zeit. Du könntest mich natürlich auch ab und zu mal kurz rauslassen«, fügte ich hinzu – nur im Spaß, denn ich wusste, dass der Hausarrest bis zum Ende des Schuljahrs galt. »In letzter Zeit war ich doch ziemlich brav.«
»Tja, also, genau darauf wollte ich hinaus …« Und plötzlich verzog Charlie das Gesicht zu einem Grinsen. Mit den Lachfältchen sah er zwanzig Jahre jünger aus.
Das Grinsen machte mir ein wenig Hoffnung, aber ich wollte mich nicht zu früh freuen. »Jetzt versteh ich nichts mehr, Dad. Reden wir jetzt über Jacob, über Edward oder über meinen Hausarrest?«
Wieder blitzte das Grinsen auf. »Gewissermaßen über alles drei.«
»Und wo ist der Zusammenhang?«, fragte ich vorsichtig.
»Also gut.« Er seufzte und hob die Hände, als wollte er sich ergeben. »Ich dachte mir, du hast vielleicht eine Strafmilderung wegen guter Führung verdient. Für dein Alter bist du erstaunlich hart im Nehmen.«
Ich zog die Augenbrauen hoch und sagte schnell: »Im Ernst? Dann bin ich also frei?«
Wie kam das so plötzlich? Ich war mir sicher gewesen, dass ich Hausarrest haben würde, bis ich endgültig auszog, und Edward hatte nichts in Charlies Gedanken gelesen, was auf einen Wandel hindeutete …
Charlie hob einen Finger. »Unter einer Bedingung.«
Meine Begeisterung verpuffte. »Na super«, stöhnte ich.
»Bella, das ist kein Befehl, sondern eine Bitte, ja? Du bist frei. Aber ich hoffe, dass du mit dieser Freiheit … vernünftig umgehst.«
»Was soll das heißen?«
Er seufzte wieder. »Ich weiß, dass du nichts lieber willst, als deine gesamte Zeit mit Edward zu verbringen …«
»Mit Alice verbringe ich auch Zeit«, wandte ich ein. Für Edwards Schwester galten keine besonderen Besuchszeiten, sie konnte kommen und gehen, wie es ihr passte. Charlie fraß ihr aus der Hand.
»Das stimmt«, sagte er. »Aber du hast noch andere Freunde außer den Cullens, Bella. Jedenfalls war das einmal so.«
Wir sahen uns lange an.
»Wann hast du das letzte Mal mit Angela Weber gesprochen?«, fragte er.
»Freitag beim Mittagessen«, sagte ich, ohne zu zögern.
Bevor Edward zurückgekehrt war, hatten sich meine Schulfreunde in zwei Gruppen gespalten. Ich teilte diese Gruppen gern in Gut und Böse ein. Wir und die anderen war eine andere mögliche Bezeichnung. Die Guten waren Angela, ihr Freund Ben Cheney und Mike Newton; alle drei hatten mir großzügig verziehen, dass ich durchgedreht war, als Edward mich verlassen hatte. Lauren Mallory war die Wortführerin der anderen, und alle Übrigen, darunter Jessica Stanley, meine erste Freundin in Forks, gehörten zu ihrer Anti-Bella-Fraktion.
Seit Edward wieder an der Schule war, waren die Fronten noch klarer.
Edwards Rückkehr hatte mich Mikes Freundschaft gekostet, aber Angela blieb treu an meiner Seite, und auch auf Ben konnte ich zählen. Während die meisten Leute die Cullens instinktiv ablehnten, saß Angela beim Mittagessen jeden Tag tapfer neben Alice. Nach ein paar Wochen schien sie sich dort sogar ganz wohl zu fühlen. Dem Charme der Cullens konnte man sich kaum entziehen – wenn man ihnen erst mal Gelegenheit gab, charmant zu sein.
»Und außerhalb der Schule?«, fragte Charlie in meine Gedanken hinein.
»Außerhalb der Schule hab ich mich mit niemandem getroffen, Dad. Ich hab Hausarrest, hast du das vergessen? Und außerdem hat Angela auch einen Freund. Sie ist immer mit Ben zusammen. Wenn ich jetzt wirklich frei bin«, fügte ich mit zweifelndem Unterton hinzu, »können wir ja vielleicht mal zu viert ausgehen.«
»Okay. Aber …« Er zögerte. »Du und Jake, ihr wart doch früher unzertrennlich, und jetzt …«
Ich fiel ihm ins Wort. »Komm mal zur Sache, Dad. Was genau ist deine Bedingung?«
»Ich finde es nicht gut, dass du alle anderen links liegenlässt, nur weil du einen Freund hast«, sagte er streng. »Das ist nicht nett, und ich glaube, dein Leben wäre ausgeglichener, wenn noch ein paar andere Leute darin vorkämen. Was letzten September passiert ist …«
Ich zuckte zusammen.
»Na ja«, sagte er abwehrend. »Wenn es neben Edward Cullen noch etwas anderes in deinem Leben gegeben hätte, wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen.«
»Es wär genauso schlimm gewesen«, murmelte ich.
»Vielleicht, vielleicht auch nicht.«
»Wolltest du nicht zur Sache kommen?«, erinnerte ich ihn.
»Nutz deine neue Freiheit, um dich auch mit deinen anderen Freunden zu treffen. Ein bisschen Ausgewogenheit.«
Ich nickte langsam. »Ausgewogenheit ist immer gut. Muss ich da bestimmte Quoten erfüllen?«
Er verzog das Gesicht, schüttelte jedoch den Kopf. »Ich will es nicht zu kompliziert machen. Du sollst nur deine Freunde nicht vergessen …«
Dieses Dilemma beschäftigte mich schon seit einiger Zeit. Meine Freunde. Menschen, die ich zu ihrem eigenen Besten nach dem Schulabschluss nie wiedersehen durfte.
Sollte ich mich also mit ihnen treffen, solange es noch ging? Oder sollte ich mich lieber jetzt schon zurückziehen, damit es nachher nicht so plötzlich kam? Beim Gedanken an die zweite Möglichkeit wurde mir ganz elend.
»… vor allem Jacob«, fügte Charlie hinzu, noch ehe ich den Gedanken zu Ende gedacht hatte.
Womit das Dilemma noch größer wurde. Ich suchte einen Moment nach den richtigen Worten. »Das mit Jacob … könnte schwierig werden.«
»Die Blacks gehören praktisch zur Familie«, sagte er, streng und väterlich zugleich. »Und Jacob war ein sehr, sehr guter Freund für dich.«
»Ich weiß.«
»Fehlt er dir denn gar nicht?«, fragte Charlie frustriert.
Plötzlich hatte ich einen Kloß im Hals, ich musste mich zweimal räuspern, bevor ich antworten konnte. »Doch, er fehlt mir«, gab ich mit gesenktem Blick zu. »Sehr sogar.«
»Wo ist dann das Problem?«
Das konnte ich nicht so einfach erklären. Es verstieß gegen die Regeln, dass normale Leute – Menschen wie Charlie und ich – über die Welt voller Mythen und Monster Bescheid wussten, die im Verborgenen um uns herum existiert. Ich wusste alles über diese Welt – und das hatte mich ganz schön in Schwierigkeiten gebracht. Ich wollte nicht, dass Charlie ähnliche Schwierigkeiten bekam.
»Mit Jacob gibt es einen … Konflikt«, sagte ich langsam. »Was unsere Freundschaft angeht. Freundschaft ist für Jake nicht immer genug.« Das stimmte zwar, war jedoch völlig unbedeutend im Vergleich zu der Tatsache, dass Jacobs Werwolfrudel Edwards Vampirfamilie zutiefst verabscheute – und damit auch mich, da ich fest vorhatte, Teil dieser Familie zu werden. Dieses Problem konnten wir nicht mit Briefen klären, und Jacob weigerte sich, am Telefon mit mir zu sprechen. Mein Plan, dem Werwolf höchstpersönlich gegenüberzutreten, kam wiederum bei den Vampiren gar nicht gut an.
»Kann Edward nicht ein bisschen Konkurrenz vertragen?«, sagte Charlie sarkastisch.
Ich warf ihm einen finsteren Blick zu. »Es gibt keine Konkurrenz.«
»Du verletzt Jake, wenn du ihm so aus dem Weg gehst. Er wäre bestimmt lieber nur mit dir befreundet als gar nichts.«
Aha, jetzt ging ich ihm auf einmal aus dem Weg?
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jake nicht mit mir befreundet sein will.« Die Worte brannten in meinem Mund. »Wie kommst du überhaupt darauf?«
Jetzt blickte Charlie verlegen drein. »Kann sein, dass Billy und ich heute darauf zu sprechen kamen …«
»Du und Billy, ihr seid richtige Klatschtanten«, sagte ich und stach mit der Gabel wütend in den Spaghettikloß auf meinem Teller.
»Billy macht sich Sorgen um Jacob«, sagte Charlie. »Es geht ihm ziemlich schlecht … Er ist sehr unglücklich.«
Ich fuhr zusammen, blickte jedoch nicht von meinem Teller auf.
»Und du warst immer so glücklich, wenn du einen Tag mit ihm verbracht hattest.« Charlie seufzte.
»Ich bin jetzt glücklich«, stieß ich zwischen den Zähnen hervor.
Der Widerspruch zwischen meinen Worten und meinem Ton löste die Spannung. Charlie prustete los, und ich konnte nicht anders, als mitzulachen.
»Okay, okay«, sagte ich. »Ausgewogenheit.«
»Und Jacob«, sagte er.
»Ich werd’s versuchen.«
»Gut. Versuch das richtige Maß zu finden, Bella. Ach ja, du hast übrigens Post«, sagte Charlie und beendete das Thema damit ohne große Umschweife. »Neben dem Herd.«
Ich rührte mich nicht, meine Gedanken kreisten immer noch um Jacob. Bestimmt war es sowieso nur Werbung; ich hatte erst gestern ein Päckchen von meiner Mutter bekommen, und jetzt erwartete ich nichts.
Charlie schob den Stuhl zurück, stand auf und reckte sich. Er trug seinen Teller zur Spüle, aber bevor er ihn abwusch, warf er mir einen dicken Umschlag zu. Der Brief sauste über den Tisch und rumste gegen meinen Ellbogen.
»Hm, danke«, murmelte ich und wunderte mich darüber, dass Charlie mich so drängte. Da sah ich den Absender – der Brief kam von der Universität Alaska Southeast. »Das ging ja schnell. Wahrscheinlich hab ich da auch wieder den Bewerbungsschluss verpasst.«
Charlie lachte in sich hinein.
Ich drehte den Umschlag um und sah Charlie wütend an. »Der ist ja offen.«
»Ich war neugierig.«
»Ich bin schockiert, Sheriff. Das ist ein Fall fürs FBI.«
»Ach, guck doch endlich rein.«
Ich zog den Brief heraus, außerdem ein Faltblatt mit einem Kursprogramm.
»Gratuliere«, sagte er, bevor ich auch nur ein Wort gelesen hatte. »Deine erste Zusage.«
»Danke, Dad.«
»Wir müssen über die Finanzierung sprechen. Ich habe einiges zur Seite gelegt, und …«
»Nein, nein, kommt gar nicht in Frage. Deine Altersvorsorge behältst du mal schön für dich. Ich hab doch mein Collegegeld.« Oder das, was davon übrig war – und es war von vornherein nicht besonders viel gewesen.
Charlie runzelte die Stirn. »Manche Unis sind aber ziemlich teuer, Bella. Ich möchte dich gern unterstützen. Du musst nicht unbedingt weit weg nach Alaska, nur weil es da billiger ist.«
Es war überhaupt nicht billiger. Aber weit weg war es wirklich, und der Himmel über Juneau war an durchschnittlich dreihunderteinundzwanzig Tagen im Jahr bewölkt. Ersteres war gut für mich, Letzteres für Edward.
»Das krieg ich schon hin. Außerdem kann ich ja einen Zuschuss beantragen. Es ist ganz leicht, ein Stipendium zu kriegen.« Ich hoffte, dass der Bluff nicht allzu durchsichtig war. Ich hatte mich noch gar nicht richtig informiert.
»Und …«, setzte Charlie an, dann verzog er den Mund und wandte den Blick ab.
»Was und?«
»Nichts. Ich dachte nur …« Er zog die Stirn in Falten. »Ich frag mich nur, was Edward nächstes Jahr vorhat.«
»Ach so.«
»Und?«
Ein dreimaliges schnelles Klopfen an der Tür rettete mich. Charlie verdrehte die Augen und ich sprang auf.
»Ich komme!«, rief ich, während Charlie etwas murmelte, das sich anhörte wie »bleib bloß weg«. Ich beachtete ihn nicht und ging zur Tür, um Edward hereinzulassen.
Ich riss die Tür auf – ich konnte es kaum abwarten – und da war er, mein persönlicher Engel.
Nach all der Zeit war ich immer noch nicht immun gegen seine Schönheit; nie würde ich irgendetwas an ihm für selbstverständlich nehmen. Ich ließ den Blick über seine blassen Züge schweifen: das markante Kinn, die weich geschwungenen, vollen Lippen, die sich jetzt zu einem Lächeln verzogen, die gerade, schmale Nase, die ausgeprägten Wangenknochen, die sanft gebogene Marmorstirn, teilweise von bronzefarbenem Haar verdeckt, das jetzt dunkler aussah vom Regen …
Die Augen hob ich mir bis zum Schluss auf, weil ich wusste, dass ich, wenn ich sie sah, nicht mehr denken konnte. Sie waren groß, warm wie flüssiges Gold und umrahmt von dichten schwarzen Wimpern. Es war ein merkwürdiges Gefühl, in seine Augen zu schauen – als wenn meine Knochen butterweich würden. Mir war ein bisschen schwindelig, aber das lag vielleicht daran, dass ich vergessen hatte zu atmen. Schon wieder.
Für dieses Gesicht würde jedes männliche Model der Welt seine Seele geben. Und möglicherweise entsprach das auch genau dem Preis, der dafür verlangt würde: eine Seele.
Nein. Bestimmt nicht. Sofort schämte ich mich für diesen Gedanken, und wie so oft war ich froh, dass meine – und nur meine – Gedanken für Edward unergründlich waren.
Ich suchte seine Hand und seufzte, als seine kalten Finger meine fanden. Als er mich berührte, empfand ich eine eigenartige Erleichterung – als würde mir ganz plötzlich ein Schmerz genommen.
»Hi.« Ich lächelte ein wenig über die zurückgenommene Begrüßung.
Er hob unsere verschränkten Hände und strich mir mit dem Handrücken über die Wange. »Wie war der Nachmittag?«
»Zog sich.«
»Bei mir auch.«
Er legte mein Handgelenk an sein Gesicht, unsere Finger waren immer noch miteinander verschränkt. Er schloss die Augen, als er meine Haut mit der Nase streifte, und lächelte leise, ohne die Augen zu öffnen. Er genoss das Bouquet, obwohl er dem Wein entsagte, wie er es einmal ausgedrückt hatte.
Ich wusste, dass der Geruch meines Blutes – das für ihn so viel süßer roch als das anderer Menschen, wie Wein im Vergleich zu Wasser für einen Alkoholiker – bei ihm einen brennenden Durst auslöste, der regelrecht schmerzte. Das ließ ihn im Gegensatz zu früher jedoch nicht mehr zurückschrecken. Ich konnte nur ahnen, was für übermenschliche Kräfte diese einfache Geste ihn kostete.
Es machte mich traurig, dass es so schwer für ihn war. Ich tröstete mich damit, dass ich ihm nicht mehr lange solche Schmerzen bereiten würde.
Da hörte ich Charlie kommen, demonstrativ stampfend, um seine Abneigung gegen den Besuch zu betonen. Edward riss die Augen auf und ließ die Hand sinken, ohne meine loszulassen.
»Guten Abend, Charlie.« Edward war immer ausgesprochen höflich, obwohl Charlie das gar nicht verdiente.
Charlie grunzte etwas Unverständliches und blieb mit verschränkten Armen neben uns stehen. In letzter Zeit übertrieb er es mit der väterlichen Fürsorge.
»Ich habe dir noch einige Bewerbungsformulare mitgebracht«, sagte Edward und hielt einen dicken braunen Umschlag hoch. Um den kleinen Finger trug er eine Rolle Briefmarken wie einen Ring.
Ich stöhnte. Waren etwa noch Colleges übrig, die ich nicht angeschrieben hatte? Und wie schaffte er es, immer weitere zu finden, die noch Bewerbungen annahmen? Ich war so spät dran.
Er lächelte, als könnte er meine Gedanken doch lesen; offenbar sprach mein Gesicht Bände. »Bei einigen ist die Frist noch nicht abgelaufen. Und manche sind bereit, eine Ausnahme zu machen.«
Die Gründe dafür konnte ich mir schon denken. Und auch, welche Summen dafür geflossen waren.
Edward lachte über mein Gesicht.
»Sollen wir?«, sagte er und zog mich zum Küchentisch.
Charlie schnaubte verärgert und ging uns hinterher, obwohl er sich über die Pläne für den heutigen Abend nicht beklagen konnte. Schließlich nervte er mich jeden Tag mit der College-Frage.
Schnell räumte ich den Tisch ab, während Edward einen erschreckend hohen Stapel Formulare ordnete. Als ich Sturmhöhe auf die Anrichte legte, hob er eine Augenbraue. Ich wusste, was er dachte, aber ehe er eine Bemerkung machen konnte, sagte Charlie: »Ach Edward, apropos College-Bewerbungen.« Sein Ton war noch unfreundlicher als sonst – im Allgemeinen vermied er es, Edward direkt anzusprechen, und wenn es doch einmal sein musste, ärgerte er sich enorm. »Bella und ich haben gerade darüber gesprochen, wie es nach der Schule weitergeht. Hast du dich schon entschieden, wo du studieren willst?«
Edward lächelte und sagte freundlich: »Noch nicht. Ich habe bereits einige Zusagen, doch die Entscheidung ist noch nicht gefallen.«
»Wo bist du angenommen?«, wollte Charlie wissen.
»In Syracuse … Harvard … Dartmouth … und heute bekam ich eine Zusage von der Universität Alaska Southeast.« Edward wandte leicht den Kopf und blinzelte mir zu. Ich unterdrückte ein Kichern.
»Harvard? Dartmouth?«, murmelte Charlie. Er konnte seine Bewunderung nicht verhehlen. »Das ist ja ganz schön … das ist nicht übel. Na, aber die Universität Alaska … Die kommt ja wohl nicht ernsthaft in Frage, wenn du auf eine der Elite-Unis gehen kannst. Ich meine, dein Vater möchte doch bestimmt …«
»Carlisle ist mit allem einverstanden, was ich mache«, sagte Edward gelassen.
»Hmpf.«
»Weißt du was, Edward?«, sagte ich fröhlich und spielte sein Spiel mit.
»Was denn, Bella?«
Ich zeigte auf den dicken Umschlag, der auf der Anrichte lag. »Ich hab auch gerade eine Zusage für Alaska gekriegt!«
»Gratuliere!« Er grinste. »So ein Zufall.«
Charlies Augen wurden schmal, und er schaute abwechselnd zu Edward und zu mir. »Na gut«, murmelte er dann. »Ich gucke jetzt das Spiel, Bella. Halb zehn dann.«
Das war sein üblicher Spruch.
»Öhm, Dad? Hatten wir nicht gerade darüber gesprochen, dass ich keinen Hausarrest mehr …?«
Er seufzte. »Ja. Okay, dann also halb elf. Wenn am nächsten Tag Schule ist, ist das die Grenze.«
»Bella hat keinen Hausarrest mehr?«, fragte Edward. Das konnte ihn nicht ernsthaft überraschen, aber er ließ sich nichts anmerken. Er klang aufrichtig erfreut.
»Unter Vorbehalt«, sagte Charlie. »Was geht dich das an?«
Ich funkelte ihn an, aber das sah er nicht.
»Es ist nur, weil Alice unbedingt bummeln gehen möchte«, sagte Edward, »und sicher würde auch Bella gern einmal wieder in die Stadt gehen.« Er lächelte mir zu.
Aber Charlie sagte grollend »Nein!« und lief rot an.
»Dad! Wieso denn nicht?«
Er musste sich anstrengen, um die Zähne auseinanderzubekommen. »Ich will nicht, dass du jetzt nach Seattle fährst.«
»Hä?«
»Ich hab dir doch von der Geschichte erzählt, die in der Zeitung stand – in Seattle ist eine Mörderbande unterwegs, und ich möchte, dass du denen aus dem Weg gehst, klar?«
Ich verdrehte die Augen. »Dad, die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, ist größer als die, dass ausgerechnet, wenn ich in Seattle …«
»Kein Problem, Charlie«, sagte Edward. »Ich meinte gar nicht Seattle. Ich dachte eigentlich an Portland. Ich möchte auch nicht, dass Bella in Seattle unterwegs ist. Natürlich nicht.«
Ich schaute ihn ungläubig an, aber er hatte Charlies Zeitung in der Hand und war ganz in die Titelseite vertieft.
Bestimmt wollte er meinen Vater nur beschwichtigen. Es war eine absurde Vorstellung, irgendwelche Menschen, und wären sie noch so gefährlich, könnten mir etwas anhaben, wenn Alice oder Edward dabei waren.
Edwards Strategie ging auf. Charlie starrte ihn noch einen Augenblick an, dann zuckte er die Schultern. »Gut.« Er ging in Richtung Wohnzimmer, etwas eiliger jetzt – wahrscheinlich wollte er den Hochball nicht verpassen.
Ich wartete, bis der Fernseher lief, damit Charlie mich nicht hören konnte.
»Was …«, setzte ich an.
»Warte mal«, sagte Edward, ohne von der Zeitung aufzublicken. Sein Blick blieb an der Titelseite hängen, während er mir die erste Bewerbung über den Tisch schob. »Ich glaub, für die hier kannst du denselben Text noch mal verwenden. Die Fragen sind identisch.«
Also lauschte Charlie wohl doch noch. Ich seufzte und begann damit, die allgemeinen Angaben einzutragen: Name, Adresse, Sozialversicherungsnummer … Nach einer Weile blickte ich auf, aber jetzt starrte Edward nachdenklich aus dem Fenster. Erst als ich mich wieder über das Bewerbungsformular beugte, fiel mir der Name der Universität ins Auge.
Ich schnaubte und schob die Blätter beiseite.
»Was ist?«
»Das ist doch lächerlich. Dartmouth?«
Edward nahm die Bewerbungsblätter und legte sie sanft wieder vor mich hin. »Ich glaube, New Hampshire würde dir gefallen«, sagte er. »Für mich gibt es ein komplettes Angebot von Abendkursen, und die Wälder eignen sich hervorragend zum Wandern. Es gibt dort viele wilde Tiere.« Er zauberte das schiefe Lächeln auf sein Gesicht, von dem er wusste, dass ich es unwiderstehlich fand.
Ich holte tief Luft.
»Wenn du unbedingt willst, kannst du es mir auch zurückzahlen«, versprach er. »Ich kann dir sogar Zinsen berechnen.«
»Als ob ich da ohne Bestechung überhaupt angenommen würde. Oder ist das Teil des Darlehens? Der neue Cullen-Trakt der Bibliothek? Bah! Warum müssen wir darüber schon wieder diskutieren?«
»Bella, würdest du bitte einfach die Bewerbung ausfüllen? Das kann ja nicht schaden.«
Ich biss die Zähne zusammen. »Weißt du was? Ich glaub nicht, dass ich das mache.«
Ich wollte die Blätter nehmen und sie zerknüllen, um sie anschließend in den Mülleimer zu pfeffern, aber da waren sie schon nicht mehr da. Ich starrte eine Weile auf den leeren Tisch, dann schaute ich Edward an. Es war ihm nicht anzusehen, dass er sich bewegt hatte, aber vermutlich hatte er die Bewerbung schon in die Jacke gesteckt.
»Was hast du damit vor?«, fragte ich.
»Ich kann deine Unterschrift besser als du selbst. Und die Texte hast du ja bereits geschrieben.«
»Jetzt treibst du es aber zu weit.« Ich sprach ganz leise, für den unwahrscheinlichen Fall, dass Charlie nicht völlig von seinem Spiel gefangen war. »Ich brauche mich nirgendwo anders mehr zu bewerben. Ich bin in Alaska angenommen. Die Studiengebühren für das erste Semester hab ich schon fast zusammen. Als Alibi ist Alaska genauso gut wie jede andere Uni. Es ist völlig unnötig, einen Haufen Geld zum Fenster rauszuwerfen, ganz egal, wem es gehört.«
Jetzt guckte er gequält. »Bella …«
»Fang nicht damit an. Ich weiß, dass ich das Prozedere Charlie zuliebe durchlaufen muss, aber wir wissen beide, dass ich im nächsten Jahr nicht in der Verfassung sein werde, auf eine Uni zu gehen. Ich werde überhaupt nicht in der Nähe von Menschen sein können.«
Ich wusste nur ganz grob über die ersten Jahre eines Vampirs Bescheid. Edward hatte nie Genaueres erzählt – es war nicht gerade sein Lieblingsthema –, aber ich wusste, dass es nicht leicht werden würde. Selbstbeherrschung musste man offenbar erst lernen. Es kam nur ein Fernstudium in Frage.
»Ich dachte, der Zeitpunkt wäre noch nicht entschieden«, sagte Edward sanft. »Ein oder zwei Semester am College würden dir sicher gefallen. Dort kannst du viele neue Erfahrungen machen.«
»Die mache ich dann eben danach.«
»Dann werden es aber keine menschlichen Erfahrungen mehr sein, Bella. Du bekommst keine zweite Chance, ein Mensch zu sein.«
Ich seufzte. »Edward, sei doch vernünftig, was den Zeitpunkt angeht. Wir dürfen kein Risiko eingehen, es ist einfach zu gefährlich.«
»Bis jetzt besteht keine Gefahr«, sagte er.
Ich schaute ihn wütend an. Keine Gefahr, soso. Nur eine sadistische Vampirfrau, die hinter mir her war, um den Tod ihres Gefährten zu rächen, vermutlich auf möglichst langsame, qualvolle Weise. Warum sich wegen Victoria Sorgen machen? Ah ja, und dann waren da noch die Volturi, die königliche Vampirfamilie mit ihrer Wache, die es zur Bedingung gemacht hatte, dass mein Herz in naher Zukunft auf die eine oder andere Weise aufhörte zu schlagen, weil kein Mensch von ihrer Existenz wissen durfte. Alles kein Grund zur Panik.
Selbst wenn Alice aufpasste – und Edward verließ sich darauf, dass sie uns mit ihren Zukunftsvisionen rechtzeitig warnen konnte –, war es Wahnsinn, ein Risiko einzugehen.
Außerdem hatte ich diesen Streit bereits gewonnen. Wir hatten vereinbart, dass meine Verwandlung bald nach dem Schulabschluss stattfinden sollte, und bis dahin waren es nur noch ein paar Wochen.
Als mir bewusst wurde, wie wenig Zeit mir noch blieb, zog sich mein Magen plötzlich zusammen. Natürlich war die Verwandlung notwendig – sie war der Schlüssel zu dem, was ich mir am meisten auf der Welt wünschte –, aber gleichzeitig musste ich an Charlie denken, der im Zimmer nebenan saß und sein Spiel guckte, so wie jeden Abend. Und dann gab es noch meine Mutter Renée, im sonnigen Florida, die mich drängte, ich solle den Sommer mit ihr und ihrem neuen Mann am Meer verbringen. Und Jacob, der, im Gegensatz zu meinen Eltern, sofort Bescheid wüsste, wenn ich zum Studieren weit weg ziehen würde. Selbst wenn meine Eltern lange keinen Verdacht schöpfen würden, selbst wenn ich mich mit Reisekosten, Prüfungen oder Krankheit herausreden könnte, um sie nicht besuchen zu müssen – Jacob wüsste Bescheid.
Für einen Augenblick überschattete der Gedanke daran, wie angeekelt Jacob sein würde, alles andere.
»Bella«, murmelte Edward. Offenbar sah er mir an, dass mich etwas bedrückte. »Es eilt ja nicht. Ich werde es nicht zulassen, dass dir jemand etwas antut. Du kannst dir alle Zeit der Welt lassen.«
»Ich will mich aber beeilen«, flüsterte ich und lächelte mühsam. Ich versuchte die Sache ins Lächerliche zu ziehen. »Ich will auch ein Monster werden.«
Mit zusammengebissenen Zähnen sagte er: »Du weißt ja nicht, was du da sagst.« Plötzlich knallte er die feuchte Zeitung zwischen uns auf den Tisch. Er stach mit dem Finger auf die Überschrift des Aufmachers:
WEITERE OPFER –POLIZEI GEHT VON BANDE AUS
»Was hat das denn damit zu tun?«
»Monster sind kein Witz, Bella.«
Ich starrte wieder auf die Schlagzeile, dann schaute ich in sein ernstes Gesicht. »Du meinst … der Mörder ist ein Vampir?«, flüsterte ich.
Er lächelte bitter. Er sprach leise und ohne Wärme. »Du würdest dich wundern, Bella, wie oft unseresgleichen hinter den Schreckensmeldungen in euren Nachrichten steckt. Wenn man die Anzeichen kennt, ist es leicht zu durchschauen. Die Informationen hier lassen darauf schließen, dass in Seattle ein neugeborener Vampir frei herumläuft. Blutrünstig, wild und ungebremst. Wie wir alle es waren.«
Ich schaute wieder auf die Zeitung und wich seinem Blick aus.
»Wir beobachten die Lage schon seit einigen Wochen. Alles deutet darauf hin – das unerklärliche Verschwinden von Menschen, immer nachts, die nur dürftig verborgenen Leichen, der Mangel an weiteren Beweisen … Ja, ein Neuling. Und niemand scheint sich seiner anzunehmen …« Er holte tief Luft. »Nun ja, das sollte eigentlich nicht unser Problem sein. Wir würden es gar nicht weiter beachten, wenn es sich nicht so nah an unserem Zuhause abspielen würde. Wie gesagt, so etwas passiert ständig. Die Tatsache, dass es Monster gibt, hat eben auch monströse Folgen.«
Ich versuchte, nicht auf die Namen in dem Bericht zu achten, doch sie sprangen mir entgegen, als wären sie fettgedruckt. Die fünf Menschen, deren Leben vorüber war und deren Familien jetzt um sie trauerten. Diese Namen zu lesen, war etwas anderes, als abstrakt über Mord nachzudenken. Maureen Gardiner, Geoffrey Campbell, Grace Razi, Michelle O’Connell, Ronald Albrook. Menschen, die Eltern gehabt hatten und Kinder und Freunde und Haustiere und eine Arbeit und Hoffnungen und Pläne und Erinnerungen und eine Zukunft …
»Bei mir wäre das nicht so«, flüsterte ich, halb zu mir selbst. »Das würdest du nicht zulassen. Wir ziehen in die Antarktis.«
Edward schnaubte. »Pinguine. Delikat.«
Ich lachte ein zittriges Lachen und fegte die Zeitung vom Tisch, um die Namen nicht mehr sehen zu müssen; mit einem dumpfen Geräusch landete sie auf dem Linoleumfußboden. Natürlich machte Edward sich Gedanken über die Jagdmöglichkeiten. Er und seine »vegetarische« Familie, die sich alle dem Schutz menschlichen Lebens verschrieben hatten, stillten ihren Durst lieber mit großen Raubtieren. »Dann also Alaska, wie geplant. Aber es muss schon abgelegener sein als Juneau – irgendwo, wo es Grizzlybären in rauen Mengen gibt.«
»Noch besser«, sagte er. »Dort gibt es auch Polarbären. Die sind sehr wild. Und die Wölfe werden in der Gegend ziemlich groß.«
Ich stieß einen Schreckenslaut aus.
»Was ist?«, fragte er. Ich hatte mich noch nicht wieder gefasst, da hatte Edward schon begriffen, und sein ganzer Körper schien zu erstarren. »Ach so. Dann lassen wir die Wölfe lieber beiseite, wenn es dich bei der Vorstellung graust.« Sein Ton war steif und förmlich, seine Schultern straff.
»Edward, er war mein bester Freund«, murmelte ich. Es tat weh, in der Vergangenheit von ihm zu sprechen. »Natürlich macht mir das etwas aus.«
»Bitte verzeih meine Gedankenlosigkeit«, sagte er, immer noch sehr förmlich. »Ich hätte das nicht sagen sollen.«
»Schon gut.« Ich starrte auf meine Hände, die ineinander verkrallt auf dem Tisch lagen.
Einen Moment schwiegen wir beide, dann fasste er mir mit einem kühlen Finger unters Kinn und hob mein Gesicht an. Sein Blick war jetzt viel weicher.
»Es tut mir leid. Wirklich.«
»Ich weiß. Ich weiß auch, dass das etwas anderes ist. Ich hätte nicht so reagieren sollen. Es ist nur … also, ich hatte schon an Jacob gedacht, bevor du kamst.« Ich zögerte. Seine bernsteinfarbenen Augen schienen sich bei Jacobs Namen ein wenig zu verdunkeln. Jetzt wurde meine Stimme flehend. »Charlie sagt, Jake geht es nicht gut. Er leidet, und … das ist meine Schuld.«
»Du hast nichts falsch gemacht, Bella.«
Ich holte tief Luft. »Ich muss versuchen, es wiedergutzumachen, Edward. Das bin ich ihm schuldig. Und außerdem hat Charlie es zur Bedingung gemacht …«
Während ich sprach, veränderte sich sein Gesichtsausdruck, wurde wieder hart und statuenhaft.
»Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass du dich schutzlos in die Nähe eines Werwolfs begibst, Bella, das weißt du. Und wenn einer von uns ihr Gebiet betreten würde, wäre das gegen den Vertrag. Möchtest du, dass wir einen Krieg anfangen?«
»Natürlich nicht!«
»Dann brauchen wir nicht weiter darüber zu reden.« Er ließ die Hand sinken und wandte den Blick ab. Er suchte nach einer Möglichkeit, das Thema zu wechseln. Sein Blick blieb an etwas hinter mir hängen und er lächelte, obwohl er immer noch wachsam aussah.
»Es freut mich, dass Charlie dir Ausgang gewährt – du musst dringend eine Buchhandlung aufsuchen. Ich kann es nicht glauben, dass du schon wieder Sturmhöhe liest. Kannst du es noch nicht auswendig?«
»Nicht jeder hat so ein fotografisches Gedächtnis wie du«, sagte ich kurz angebunden.
»Fotografisches Gedächtnis hin oder her, ich begreife nicht, was dir daran gefällt. Die Figuren sind furchtbare Menschen, die einander das Leben zur Hölle machen. Es ist mir ein Rätsel, weshalb man Heathcliff und Cathy mit Paaren wie Romeo und Julia oder Elizabeth Bennett und Mr Darcy auf eine Stufe stellt. Es ist keine Liebesgeschichte, sondern eine Hassgeschichte.«
»Mit den Klassikern hast du’s wohl nicht so«, sagte ich schnippisch.
»Vielleicht weil mich das Alte nicht beeindruckt.« Er lächelte, sichtlich zufrieden, weil er mich abgelenkt hatte. »Im Ernst, warum liest du es immer wieder?« Echtes Interesse blitzte in seinen Augen auf; er versuchte wieder einmal zu verstehen, wie mein Denken funktionierte. Über den Tisch hin weg nahm er mein Gesicht in die Hände. »Was gefällt dir so daran?«
Seine ehrliche Neugier war entwaffnend. »Ich weiß nicht genau«, sagte ich und versuchte zusammenhängend zu denken. Ohne es zu wollen, verwirrte er mich mit seinem Blick. »Ich glaube, es hat mit der Unausweichlichkeit zu tun. Dass nichts sie trennen kann – weder Cathys Egoismus noch Heathcliffs Boshaftigkeit, am Ende nicht einmal der Tod …«
Er sah nachdenklich aus, während er meine Worte abwog. Nach einer Weile lächelte er neckend. »Dennoch glaube ich, es wäre eine bessere Geschichte, wenn einer von beiden wenigstens eine gute Eigenschaft hätte.«
»Vielleicht ist das gerade der springende Punkt«, sagte ich. »Ihre Liebe ist ihre einzige gute Eigenschaft.«
»Ich hoffe, du bist vernünftiger – und verliebst dich nicht in jemanden, der so … boshaft ist.«
»Es ist ein bisschen zu spät, sich Gedanken darüber zu machen, in wen ich mich verliebe«, sagte ich. »Aber obwohl mich niemand vorher gewarnt hat, finde ich, dass ich das ganz gut hingekriegt habe.«
Er lachte leise. »Es freut mich, dass du so darüber denkst.«
»Und ich hoffe, du bist klug genug, dich von Frauen fernzuhalten, die so selbstsüchtig sind. Catherine ist das eigentliche Problem, nicht Heathcliff.«
»Ich werde mich hüten«, versprach er.
Ich seufzte. Ablenkungsmanöver waren seine Spezialität.
Ich legte meine Hand auf seine und zog sie an mein Gesicht. »Ich muss Jacob sehen.«
Er schloss die Augen. »Nein.«
»Es ist wirklich nicht gefährlich«, sagte ich, jetzt wieder flehend. »Früher hab ich immer den ganzen Tag mit ihnen in La Push verbracht, und es ist nie irgendwas passiert.«
Aber das stimmte nicht ganz; meine Stimme versagte, als mir auffiel, dass ich nicht die Wahrheit sagte. Es war nicht richtig, dass nie irgendwas passiert war. Eine blitzartige Erinnerung – ein riesiger grauer Wolf, der zum Sprung ansetzte und die dolchartigen Zähne bleckte – und meine Handflächen wurden feucht vor Panik.
Edward hörte, wie mein Herz schneller schlug, und nickte, als hätte ich die Lüge eingestanden. »Werwölfe sind unberechenbar. Häufig werden Menschen verletzt, die sich in ihrer Nähe aufhalten. Manche kommen sogar ums Leben.«
Ich wollte widersprechen, aber ein Bild ließ mich verstummen. Ich sah das Gesicht von Emily Young vor mir, das einmal so schön gewesen war und jetzt von drei dunklen Narben entstellt wurde, die von ihrem rechten Auge bis zum Mund verliefen und ihn für immer zu einer schiefen Grimasse verzerrten.
Edward wartete grimmig, aber siegesgewiss, bis ich meine Stimme wiedergefunden hatte.
»Du kennst sie nicht«, flüsterte ich.
»Ich kenne sie besser, als du glaubst, Bella. Ich war beim letzten Mal dabei.«
»Beim letzten Mal?«
»Vor über siebzig Jahren kamen wir den Wölfen erstmals in die Quere … Da hatten wir uns gerade in der Nähe von Hoquiam niedergelassen. Alice und Jasper waren damals noch nicht bei uns. Wir waren trotzdem in der Überzahl, doch das hätte sie nicht von einem Kampf abgehalten, wäre Carlisle nicht gewesen. Ihm gelang es, Ephraim Black davon zu überzeugen, dass ein friedliches Nebeneinander möglich sei, und schließlich schlossen wir den Vertrag.«
Beim Namen von Jacobs Urgroßvater erschrak ich.
»Wir glaubten, mit Ephraim sei die Linie ausgestorben«, murmelte Edward; er schien jetzt mehr zu sich selbst zu sprechen. »Dass der genetische Trick, der die Verwandlung möglich macht, verlorengegangen sei …« Er brach ab und sah mich vorwurfsvoll an. »Es scheint wirklich eine Art Fluch zu sein, der von Tag zu Tag mächtiger wird. Ist dir klar, dass deine unglaubliche Anziehungskraft auf alles Gefährliche stark genug war, um ein Rudel ausgestorbener mutierter Hunde ins Leben zurückzuholen? Wenn wir etwas davon in Flaschen abfüllen könnten, stünde uns eine Waffe mit vernichtender Wirkung zur Verfügung.«
Ich überging die Stichelei, weil ich seine Behauptung so ungeheuerlich fand – meinte er das im Ernst? »Aber ich hab sie doch nicht ins Leben zurückgeholt! Weißt du das denn nicht?«
»Was soll ich wissen?«
»Ich habe gar nichts damit zu tun. Die Werwölfe sind zurückgekommen, weil die Vampire zurückgekommen sind.«
Edward starrte mich an, er war so perplex, dass er sich nicht rühren konnte.
»Jacob hat mir erzählt, dass die Dinge in Gang gekommen sind, weil deine Familie hierhergezogen ist. Ich dachte, das wüsstest du …«
Seine Augen wurden schmal. »Das glauben sie?«
»Edward, betrachte es mal logisch. Vor siebzig Jahren kamt ihr hierher und die Werwölfe sind aufgetaucht. Jetzt seid ihr zurückgekommen, und wieder tauchen die Werwölfe auf. Glaubst du, das ist Zufall?«
Er blinzelte, und sein Blick war jetzt nicht mehr so starr. »Diese Theorie wird Carlisle interessieren.«
»Theorie«, spottete ich.
Er schwieg eine Weile und schaute aus dem Fenster in den Regen; vermutlich dachte er darüber nach, dass die Bewohner von La Push sich durch die Anwesenheit seiner Familie in riesige Hunde verwandelten.
»Interessant, aber nicht besonders relevant«, murmelte er. »Es ändert nichts an der Lage.«
Das war leicht zu übersetzen: keine Freundschaft mit Werwölfen.
Ich wusste, dass ich mit Edward Geduld haben musste. Er war nicht unvernünftig, das nicht, aber er verstand mich einfach nicht. Er hatte keine Ahnung, wie viel ich Jacob Black zu verdanken hatte – mein Leben und meinen Verstand vermutlich noch dazu.
Ich sprach nicht gern über diese Zeit der Leere, schon gar nicht mit Edward. Als er mich damals verlassen hatte, wollte er nur mich und meine Seele retten. Ich machte ihn weder für all die Dummheiten verantwortlich, die ich in seiner Abwesenheit angestellt hatte, noch für das Leid, das ich durchgemacht hatte.
Aber er selbst fühlte sich verantwortlich.
Also musste ich die Worte, mit denen ich meine Beweggründe erklären wollte, genau abwägen.
Ich stand auf und ging um den Tisch herum. Er breitete die Arme aus und ich setzte mich auf seinen Schoß und schmiegte mich in seine kühle, steinerne Umarmung. Er schaute auf seine Hände, während ich sprach.
»Hör mir mal einen Moment zu. Es geht hier nicht darum, dass ich aus einer Laune heraus bei einem alten Freund vorbeischauen will. Jacob leidet.« Bei dem Wort brach meine Stimme. »Ich muss einfach versuchen, ihm zu helfen – ich kann ihn nicht im Stich lassen, wenn er mich braucht. Nur weil er nicht immer ein Mensch ist … Er war ja auch für mich da, als ich … selber kein richtiger Mensch war. Du weißt ja gar nicht, wie es war …« Ich zögerte. Edward hatte die Arme jetzt fest um mich geschlungen, er hatte die Hände so fest zu Fäusten geballt, dass die Sehnen hervortraten. »Wenn Jacob mir nicht geholfen hätte … Ich weiß nicht, wie du mich dann vorgefunden hättest. Ich möchte es wiedergutmachen. Das bin ich ihm schuldig, Edward.«
Ich schaute ihn wachsam an. Er hatte die Augen geschlossen, der Kiefer war angespannt.
»Ich werde mir nie verzeihen, dass ich dich verlassen habe«, flüsterte er. »Und wenn ich hunderttausend Jahre lebe.«
Ich legte eine Hand an sein kaltes Gesicht und wartete, bis er seufzte und die Augen aufschlug.
»Du wolltest ja nur das Richtige tun. Und bei jemand weniger Verrücktem als mir hätte das bestimmt geklappt. Außerdem bist du jetzt ja da. Das ist das Einzige, was zählt.«
»Wäre ich nicht fortgegangen, würdest du nicht dein Leben aufs Spiel setzen wollen, um einen Hund zu trösten.«
Ich zuckte zusammen. Von Jacob war ich solche Schimpfwörter gewohnt, Blutsauger, Parasiten … Wenn Edward mit seiner Samtstimme fluchte, klang es noch gröber.
»Ich weiß nicht, wie ich es am besten ausdrücken soll«, sagte er düster. »Ich fürchte, es klingt hart. Doch ich war zu nahe dran, dich zu verlieren. Ich kenne das Gefühl, dich verloren zu haben. Ich lasse es nicht zu, dass du dich in Gefahr begibst.«
»Du musst mir vertrauen. Mir passiert schon nichts.«
Er sah wieder gequält aus. »Bitte, Bella«, flüsterte er.
Ich starrte in seine plötzlich brennenden goldenen Augen. »Bitte was?«
»Bitte, tu es für mich. Bitte gib Acht, dass dir nichts passiert. Ich tue, was ich kann, aber ein wenig Hilfe könnte ich schon brauchen.«
»Ich geb mein Bestes«, murmelte ich.
»Hast du überhaupt eine Ahnung, wie viel du mir bedeutest? Hast du eine Vorstellung davon, wie sehr ich dich liebe?« Er zog mich noch fester an seine harte Brust und legte das Kinn auf meinen Kopf.
Ich drückte die Lippen an seinen schneekalten Hals. »Ich weiß, wie sehr ich dich liebe«, sagte ich.
»Du vergleichst ein Bäumchen mit einem ganzen Wald.«
Ich verdrehte die Augen, aber das konnte er nicht sehen. »Unmöglich.«
Er küsste mich aufs Haar und seufzte.
»Keine Werwölfe.«
»Das kann ich dir nicht versprechen. Ich muss Jacob sehen.«
»Dann werde ich es verhindern müssen.«
Er schien sehr zuversichtlich, dass ihm das nicht weiter schwerfallen dürfte.
Und ich war mir sicher, dass er Recht hatte.
»Wir werden ja sehen«, sagte ich dennoch. »Er ist immer noch mein Freund.«
Ich spürte Jacobs Brief in meiner Tasche, als wöge er plötzlich fünf Kilo. Ich hatte die Worte im Ohr, und Jacob schien Edward zuzustimmen – was er in Wirklichkeit nie tun würde.
Aber das ändert nichts. Tut mir leid.
Ausweichmanöver
Mir war seltsam leicht ums Herz, als ich vom Spanischunterricht zur Cafeteria ging, nicht nur, weil ich mit dem traumhaftesten Menschen der Welt Händchen hielt, obwohl das sicherlich dazu beitrug.
Vielleicht war es das Bewusstsein, dass ich meine Strafe abgesessen hatte und wieder frei war.
Oder vielleicht hatte es gar nichts mit mir zu tun. Vielleicht war es das Gefühl von Freiheit, das über der ganzen Schule lag. Die Ferien rückten näher, und vor allem für die Abschlussklasse lag ein Prickeln in der Luft.
Die Freiheit war so nah, dass man sie greifen und schmecken konnte. Alles zeugte davon. Die Wände der Cafeteria waren mit Aushängen tapeziert und die Mülleimer trugen bunte Röcke aus überquellenden Flugblättern: Werbung für Jahrbücher und Klassenringe, für Abschlusskleider, Hüte und Quasten; neonfarbene Slogans, mit denen die Schüler der unteren Jahrgänge sich als Klassensprecher bewarben; unheilvolle rosenumkränzte Reklamezettel für den diesjährigen Abschlussball. Der Ball war am kommenden Wochenende, aber Edward hatte mir hoch und heilig versprochen, mich dort nicht noch einmal hinzuschleppen. Diese menschliche Erfahrung hatte ich schließlich schon gemacht.
Nein, es war wohl doch meine persönliche Freiheit, die mir heute so ein beschwingtes Gefühl gab. Dass das Schuljahr zu Ende ging, freute mich nicht so sehr wie die anderen. Ehrlich gesagt, war ich so aufgeregt, dass mir fast übel wurde, wenn ich nur daran dachte. Ich versuchte, nicht daran zu denken.
Aber es war schwer, ein so allgegenwärtiges Thema wie den Schulabschluss zu meiden.
»Hast du deine Karten schon verschickt?«, fragte Angela, als Edward und ich uns an den Tisch setzten. Sie hatte die glatten hellbraunen Haare nachlässig zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, anstatt sie wie üblich offen zu tragen, und ihr Blick war leicht panisch.
Auch Alice und Ben waren schon da, sie saßen links und rechts von Angela. Ben war in ein Comicheft vertieft, die Brille rutschte ihm fast von der schmalen Nase. Alice betrachtete mein langweiliges Jeans-und-T-Shirt-Outfit auf eine Weise, die mich verunsicherte. Wahrscheinlich überlegte sie schon wieder, wie sie mich verwandeln konnte. Ich seufzte. Mein Desinteresse an Mode war ihr ein ständiger Dorn im Auge. Wenn ich sie ließe, würde sie mich jeden Tag – vielleicht sogar mehrmals täglich – anziehen wie eine übergroße, dreidimensionale Anziehpuppe.
»Nein«, sagte ich zu Angela. »Bei mir lohnt sich das nicht. Renée weiß, wann die Abschlussfeier ist. Wem sonst sollte ich es mitteilen?«
»Und du, Alice?«
Alice lächelte. »Schon erledigt.«
»Du Glückliche.« Angela seufzte. »Meine Mutter hat unzählige Cousinen und Cousins, und sie erwartet, dass ich jedem eine Karte schreibe. Ich krieg bestimmt eine Sehnenscheidenentzündung. Ich kann es nicht länger vor mir herschieben, aber mir graut schon davor.«
»Ich helf dir«, sagte ich. »Wenn meine Klaue dich nicht stört.«
Das würde Charlie gefallen. Aus dem Augenwinkel sah ich Edward lächeln. Ihm gefiel es auch – dass ich Charlies Bedingungen erfüllte, ohne dass Werwölfe ins Spiel kamen.
Angela sah erleichtert aus. »Das ist supernett von dir. Sag Bescheid, wenn es dir passt, dann komme ich vorbei.«
»Wenn du nichts dagegen hast, komm ich lieber zu dir – zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf. Charlie hat gestern Abend den Hausarrest aufgehoben.« Ich grinste, als ich die gute Nachricht verkündete.
»Echt?«, sagte Angela, und Überraschung spiegelte sich in ihren sanften braunen Augen. »Du meintest doch, du wärst für den Rest deines Lebens eingesperrt.«
»Ich bin mindestens so überrascht wie du. Vor dem Schulabschluss hätte ich nie damit gerechnet.«
»Das ist ja toll, Bella! Wir müssen unbedingt ausgehen, um das zu feiern.«
»O ja, das klingt gut.«
»Was sollen wir machen?«, fragte Alice, und beim Gedanken an die vielen Möglichkeiten leuchtete ihr Gesicht. Alice’ Ideen gingen mir in der Regel eine Spur zu weit, und auch jetzt sah ich es in ihrem Blick – ihren Hang, völlig über die Stränge zu schlagen.
»Egal, was du im Sinn hast, Alice, so frei bin ich nicht.«
»Frei ist frei, oder?«, sagte sie.
»Bestimmt gibt es für mich immer noch Grenzen – innerhalb der USA müssten wir wohl schon bleiben.«
Angela und Ben lachten, aber Alice sah ernsthaft enttäuscht aus.
»Was unternehmen wir denn nun heute Abend?«, sagte sie.
»Nichts. Wir warten lieber erst mal ein paar Tage, um sicherzugehen, dass Charlie es ernst meint. Außerdem haben wir morgen ja Schule.«
»Dann feiern wir am Wochenende.« Alice’ Begeisterung ließ sich nicht dämpfen.
»Klar«, sagte ich, damit sie zufrieden war. Ich wollte auf keinen Fall etwas allzu Ausgefallenes unternehmen, ich wollte Charlie nicht gleich überfordern. Er sollte erst mal sehen, wie reif und verantwortungsbewusst ich war, ehe ich ihn um irgendeinen Gefallen bat.
Angela und Alice fingen sofort an zu überlegen, was wir alles unternehmen könnten, und auch Ben legte seinen Comic beiseite, um mit zu planen. Meine Gedanken schweiften ab. Erstaunlicherweise freute ich mich über die neu gewonnene Freiheit jetzt gar nicht mehr so sehr wie vorhin. Während sie darüber sprachen, was man in Port Angeles oder in Hoquiam machen könnte, merkte ich, wie meine Laune sank.
Schon bald wurde mir klar, woher meine innere Unruhe rührte.
Seit dem Abschied von Jacob im Wald hinter unserem Haus quälte mich ein bestimmtes Bild. In regelmäßigen Abständen tauchte es wieder auf, wie ein nerviger Wecker, der alle halbe Stunde klingelt, das Bild von Jacobs schmerzverzerrtem Gesicht. Das war meine letzte Erinnerung an ihn.
Als sich das Bild jetzt wieder in meine Gedanken drängte, wusste ich, weshalb ich mit meiner Freiheit nicht zufrieden war. Sie war nicht vollständig.
Zwar konnte ich fahren, wohin ich wollte – aber nicht nach La Push; ich konnte tun und lassen, was ich wollte – aber Jacob durfte ich nicht sehen. Missmutig starrte ich auf den Tisch. Es musste doch irgendeinen Weg geben.
»Alice? Alice!«
Angelas Stimme riss mich aus meinen Gedanken. Sie bewegte die Hand vor Alice’ starrem, ausdruckslosem Gesicht hin und her. Diesen Ausdruck kannte ich – und sofort fuhr mir der Schreck in die Glieder. Alice’ leerer Blick verriet mir, dass sie etwas ganz anderes sah als die alltägliche Szene in der Cafeteria, etwas, was auf seine Weise jedoch genauso real war. Etwas, was in der Zukunft lag und bald, sehr bald eintreten würde. Ich spürte, wie mir das Blut aus dem Gesicht wich.
Da lachte Edward, ein scheinbar ganz natürliches, entspanntes Lachen. Angela und Ben schauten ihn an, aber ich wandte den Blick nicht von Alice. Plötzlich zuckte sie zusammen, als hätte ihr jemand unter dem Tisch einen Tritt versetzt.
»Hältst du um diese Zeit schon ein Nickerchen, Alice?«, neckte Edward sie.
Jetzt war Alice wieder ganz da. »Entschuldigung. Ich hab wohl geträumt.«
»Besser träumen als an die beiden Schulstunden denken, die noch vor uns liegen«, sagte Ben.
Alice beteiligte sich jetzt noch lebhafter an dem Gespräch als zuvor – einen Tick zu lebhaft. Ich sah, wie Edward und sie einen kurzen Blick tauschten; ehe es jemand bemerkte, schaute Alice wieder zu Angela. Edward war schweigsam, gedankenverloren spielte er mit einer Strähne meines Haars.
Ich wartete ungeduldig auf eine Gelegenheit, Edward zu fragen, was Alice in ihrer Vision gesehen hatte, aber wir hatten den ganzen Nachmittag keinen Moment für uns.
Es kam mir komisch vor, fast so, als lege er es darauf an. Nach dem Mittagessen ging er langsam, bis Ben ihn eingeholt hatte, und sprach mit ihm über irgendwelche Hausaufgaben, von denen ich wusste, dass er sie schon erledigt hatte. Und dann war zwischen den einzelnen Stunden immer irgendjemand dabei, während wir sonst meistens ein paar Minuten für uns hatten. Als es zum Schulschluss klingelte, ging Edward ausgerechnet neben Mike Newton her, der auch auf dem Weg zum Parkplatz war, und fing ein Gespräch mit ihm an. Ich ging langsamer, aber Edward schleppte mich mit.
Verwirrt hörte ich zu, wie Mike Edwards ungewöhnlich freundliche Fragen beantwortete. Offenbar hatte Mike Ärger mit seinem Wagen.
»… aber die Batterie hab ich grad erst ausgewechselt«, sagte Mike. Er schaute zu seinem Wagen und dann wieder zu Edward. Er sah misstrauisch aus – und verwirrt, genau wie ich.
»Vielleicht liegt es an den Kabeln?«, sagte Edward.
»Vielleicht. Ich hab echt überhaupt keine Ahnung von Autos«, gab Mike zu. »Irgendwer muss sich den Wagen mal ansehen, aber ihn zu Dowling’s zu bringen, kann ich mir nicht leisten.«
Ich machte den Mund auf, um meinen persönlichen Mechaniker zu empfehlen, klappte ihn aber sofort wieder zu. Mein Mechaniker hatte zu tun – er musste als riesiger Wolf herumlaufen.
»Ich kenne mich ein wenig aus – ich könnte ihn mir mal anschauen, wenn du willst«, bot Edward an. »Ich will nur vorher Alice und Bella nach Hause bringen.«
Mike und ich starrten Edward mit offenem Mund an.
»Öh … danke«, murmelte Mike, als er sich wieder gefasst hatte. »Aber ich muss jetzt zur Arbeit. Vielleicht ein andermal.«
»Jederzeit.«
»Bis dann.« Mike stieg ins Auto und schüttelte fassungslos den Kopf.
Edwards Volvo, in dem Alice schon wartete, stand nur zwei Wagen weiter.
»Was war das denn?«, sagte ich leise, als Edward mir die Beifahrertür aufhielt.
»Ich wollte ihm nur helfen«, sagte Edward.
Und dann plapperte Alice, die auf der Rückbank saß, was das Zeug hielt.
»So ein guter Mechaniker bist du nun auch wieder nicht, Edward. Vielleicht sollte Rosalie heute Abend einen Blick darauf werfen, damit du besser dastehst, wenn Mike deine Hilfe annehmen will. Obwohl es ja ganz lustig wäre, sein Gesicht zu sehen, wenn Rosalie auftauchen würde, um ihm zu helfen. Aber da Rosalie ja eigentlich auf einem College an der Westküste sein müsste, ist das vielleicht keine so gute Idee. Zu schade. Andererseits, für Mikes Auto reicht dein Geschick vielleicht so gerade. Nur die Feinheiten eines guten italienischen Sportwagens gehen über deinen Horizont. Apropos Italien und Sportwagen, du bist mir immer noch einen gelben Porsche schuldig. Ich wollte eigentlich nicht bis Weihnachten darauf warten …«
Nach einer Weile schaltete ich ab und nahm ihre Stimme nur noch als summendes Hintergrundgeräusch wahr. Ich hatte den Eindruck, dass Edward meinen Fragen aus dem Weg gehen wollte. Na gut. Früher oder später würde er doch mit mir allein sein. Es war nur eine Frage der Zeit.
Das schien auch Edward klar zu sein und er ließ Alice wie üblich am Anfang der Cullen-Auffahrt aussteigen. Ich hatte schon halb erwartet, er würde sie bis zur Tür bringen und hineinbegleiten.
Beim Aussteigen sah Alice ihn durchdringend an. Edward wirkte völlig gelassen.
»Bis später«, sagte er. Und nickte ihr fast unmerklich zu.
Alice drehte sich um und verschwand zwischen den Bäumen.