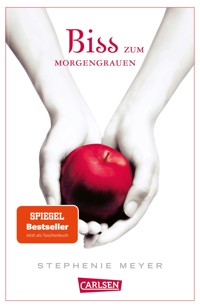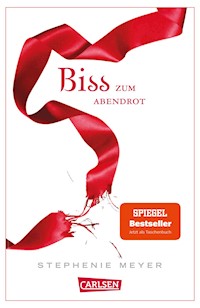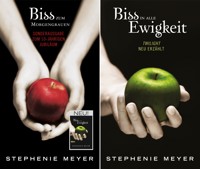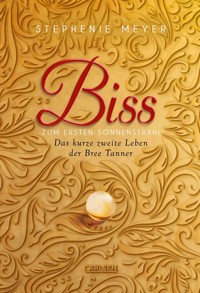
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Noch mehr fesselnde Geschichten aus der Welt der Vampire - von Weltbestseller-Autorin Stephenie Meyer An ihr erstes Leben kann Bree sich kaum erinnern. Was jetzt zählt, sind ihre übermenschlichen Kräfte und der unstillbare Durst nach Blut – denn Bree ist ein Vampir. Und sie hält sich an die Regeln: Sei wachsam, bleib im Hintergrund, kehre immer vor Sonnenaufgang zurück ins Dunkel. Doch dann erfährt Bree, dass ihr neues Leben auf einer Lüge beruht. Dass sie Teil eines Spiels ist, dessen Dimensionen sie nicht mal ahnen kann. Und dass sie niemandem trauen kann. Außer – vielleicht – Diego. Alle Bände der »Biss«-Saga auf einen Blick: Biss zum Morgengrauen Biss zur Mittagsstunde Biss zum Abendrot Biss zum Ende der Nacht Biss zur Mitternachtssonne Biss zum ersten Sonnenstrahl – Das kurze zweite Leben der Bree Tanner
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Außerdem von Stephenie Meyer bei CARLSEN erschienen: ›Biss zum Morgengrauen‹›Biss zur Mittagsstunde‹ ›Biss zum Abendrot‹ ›Biss zum Ende der Nacht‹›Seelen‹ CARLSEN-Newsletter: Tolle neue Lesetipps kostenlos per E-Mail! Unsere Bücher gibt es überall im Buchhandel und auf carlsen.de Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt. Veröffentlicht im Carlsen Verlag Oktober 2017 Alle deutschen Rechte CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2010, 2012, 2017 Originalcopyright © 2010 by Stephenie Meyer Originalverlag: Little Brown and Company, New York, N.Y. Originaltitel: ›The Short Second Life of Bree Tanner: An Eclipse Novella‹ Aus dem Englischen von Katharina Diestelmeier Umschlaggestaltung und -typografie: formlabor unter Verwendung von Bildern von shutterstock.com: © DVARG © Anita Ponne © dwph Satz und E-Book-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN: 978-3-646-92829-7
Für Asya Muchnick und Meghan Hibbett
Einleitung
Alle Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben ihre eigene Herangehensweise an einen Text. Wir werden alle auf unterschiedliche Art und Weise inspiriert und motiviert; bei jedem sind es andere Gründe, die dazu führen, dass bestimmte Figuren bleiben, während andere in einer Unzahl nicht weiter beachteter Dateien verschwinden. Ich persönlich habe bisher noch nicht herausgefunden, warum einige meiner Figuren ein so starkes Eigenleben entwickeln, aber ich bin jedes Mal froh darüber. Über diese Figuren zu schreiben, fällt mir am leichtesten, und daher sind es normalerweise ihre Geschichten, die ich zu Ende bringe.
Bree ist so eine Figur und sie ist der Hauptgrund, warum ihr diese Geschichte jetzt in den Händen haltet und sie nicht im Gewirr der verschollenen Ordner in meinem Computer begraben liegt. (Die beiden anderen Gründe heißen Diego und Fred.) Ich fing an, über Bree nachzudenken, als ich dabei war, Biss zum Abendrot zu überarbeiten. Zu überarbeiten, nicht zu schreiben – beim Schreiben von Biss zum Abendrot hatte ich meine Ich-Erzählungs-Scheuklappen aufgesetzt; alles, was Bella nicht sehen, hören, fühlen, schmecken oder anfassen konnte, war unerheblich. Diese Geschichte beruht ausschließlich auf ihrer Erfahrung.
Der nächste Schritt war der, sich von Bella zu lösen und zu sehen, wie die Geschichte funktionierte. Meine Lektorin Rebecca Davis hatte großen Anteil daran und sie stellte mir eine Menge Fragen über die Dinge, die Bella nicht wissen konnte, und darüber, wie wir die wichtigen Stellen jener Geschichte verdeutlichen könnten. Da Bree die einzige Neugeborene ist, die Bella zu sehen bekommt, war es ihre Perspektive, die ich einnahm, als ich überlegte, was hinter den Kulissen vor sich ging. Ich begann darüber nachzudenken, wie das Leben mit den Neugeborenen im Keller ablief und wie es war, auf klassische Vampirart zu jagen. Ich stellte mir die Welt so vor, wie Bree sie erlebte. Das war einfach. Bree war von Anfang an eine sehr deutliche Figur und auch einige ihrer Freunde erwachten mühelos zum Leben. Normalerweise versuche ich kurze Zusammenfassungen der Dinge zu schreiben, die an anderen Stellen der Geschichte passieren, und bringe schließlich Dialoge zu Papier. In diesem Fall aber stellte ich fest, dass ich statt einer Zusammenfassung einen Tag in Brees Leben beschrieb.
Als ich Brees Geschichte verfasste, schlüpfte ich zum ersten Mal in die Rolle einer Erzählerin, die ein »echter« Vampir war – eine Jägerin, ein Monster. Ich betrachtete uns Menschen durch ihre roten Augen; und plötzlich waren wir erbärmlich und schwach, leichte Beute, der keine größere Bedeutung zukam als die einer leckeren Mahlzeit. Ich spürte, wie es sich anfühlte, allein unter Feinden zu sein, immer auf der Hut, und nichts sicher zu wissen, außer dass das eigene Leben ständig in Gefahr ist. Ich musste in eine völlig andere Vampirwelt eintauchen: die Welt der Neugeborenen. Deren Leben hatte ich bisher noch nicht erkundet – selbst dann nicht, als Bella schließlich ein Vampir wurde. Bella war nie so eine Neugeborene wie Bree. Es war aufregend und düster und schließlich tragisch. Je näher ich dem unausweichlichen Ende kam, desto stärker wünschte ich mir, ich hätte Biss zum Abendrot ein wenig anders enden lassen.
Ich bin gespannt, was ihr von Bree haltet. Sie ist so eine kleine, scheinbar belanglose Figur in Biss zum Abendrot. Aus Bellas Perspektive lebt sie gerade mal fünf Minuten. Und doch ist ihre Geschichte für das Verständnis des Romans ungemein wichtig. Als ihr die Szene in Biss zum Abendrot gelesen habt, in der Bella Bree anstarrt und darüber nachdenkt, ob so wohl ihre Zukunft aussieht, habt ihr da überlegt, was Bree so weit gebracht hat? Als Bree zurückstarrt, habt ihr euch da gefragt, wie Bella und die Cullens in ihren Augen aussehen? Wahrscheinlich nicht. Aber selbst wenn, könnte ich wetten, dass ihr nicht hinter ihre Geheimnisse gekommen seid.
Ich hoffe, dass ihr Bree genauso ins Herz schließen werdet wie ich, auch wenn das in gewisser Weise ein grausamer Wunsch ist. Denn ihr wisst bereits, dass die Geschichte nicht gut für sie endet. Aber wenigstens werdet ihr jetzt die ganze Wahrheit erfahren. Und feststellen, dass keine Perspektive je belanglos ist.
Viel Spaß dabei, Stephenie
Die Schlagzeile sprang mir sofort ins Auge: SEATTLE UNTER BELAGERUNG – ZAHL DER TODESOPFER STEIGT WEITER. Die war mir bisher noch nicht begegnet. Ein Zeitungsjunge musste den kleinen metallenen Automaten gerade neu bestückt haben. Er hatte Glück, dass er jetzt nicht mehr in der Nähe war.
Großartig. Riley würde fuchsteufelswild werden. Ich würde dafür sorgen, nicht in seiner Reichweite zu sein, wenn er diese Zeitung zu Gesicht bekam. Sollte er doch jemand anderem den Arm abreißen.
Ich stand im Schatten, verborgen hinter der Ecke eines heruntergekommenen dreistöckigen Gebäudes, und versuchte nicht aufzufallen, während ich darauf wartete, dass jemand eine Entscheidung traf. Um niemandem in die Augen zu sehen, starrte ich die Wand neben mir an. Das Erdgeschoss des Gebäudes hatte früher einmal einen inzwischen längst geschlossenen Plattenladen beherbergt; die Fenster, deren Scheiben dem Wetter oder randalierenden Straßengangs zum Opfer gefallen waren, waren mit Sperrholz vernagelt. Darüber befanden sich Wohnungen – die vermutlich leer standen, denn es fehlten die üblichen menschlichen Schlafgeräusche. Das überraschte mich nicht – das Haus sah aus, als würde es bereits beim ersten heftigen Windstoß zusammenbrechen. Die Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite der dunklen, schmalen Straße waren genauso baufällig.
Der gewöhnliche Schauplatz für eine Nacht in der Stadt also.
Ich wollte mich nicht laut bemerkbar machen, aber ich wünschte, irgendjemand würde endlich eine Entscheidung treffen. Ich hatte großen Durst und es war mir ziemlich egal, ob wir den Weg rechts oder links über das Dach nahmen. Ich wollte einfach ein paar Pechvögel finden, die noch nicht mal genug Zeit haben würden, zu denken: Zur falschen Zeit am falschen Ort.
Leider hatte mich Riley heute mit zwei der denkbar unfähigsten Vampire losgeschickt. Riley schien sich nie groß darum zu kümmern, wie er die Jagdgruppen zusammenstellte. Und es scherte ihn auch nicht besonders, dass weniger von uns zurückkamen, wenn er die Falschen zusammen losschickte. Heute hatte ich Kevin erwischt und einen blonden Jungen, dessen Namen ich nicht mal kannte. Sie gehörten beide zu Raouls Gruppe, daher verstand es sich von selbst, dass sie bescheuert waren. Und gefährlich. Aber jetzt im Moment vor allem bescheuert.
Anstatt sich zu entscheiden, wo unsere Jagd stattfinden sollte, verstrickten sie sich plötzlich in eine Diskussion darüber, wessen Lieblingsheld den besseren Jäger abgeben würde. Der namenlose Blonde war für Spider-Man. Er sauste die Backsteinwand des Durchgangs, in dem wir standen, hinauf und summte dazu die Titelmelodie der Zeichentrickserie. Ich seufzte frustriert. Würden wir je auf die Jagd gehen?
Eine kaum wahrnehmbare Bewegung links von mir erregte meine Aufmerksamkeit. Es war der Vierte, den Riley mit unserer Jagdgruppe losgeschickt hatte, Diego. Ich wusste nicht viel über ihn, nur dass er älter war als die meisten anderen. Es hieß, er sei Rileys rechte Hand. Das machte ihn in meinen Augen auch nicht sympathischer als die anderen Schwachköpfe.
Diego blickte mich an. Er musste meinen Seufzer gehört haben. Ich sah weg.
Kopf einziehen und Mund halten – so blieb man in Rileys Bande am Leben.
»Spider-Man ist ein jämmerlicher Loser«, rief Kevin dem blonden Jungen zu. »Ich zeig dir, wie ein echter Superheld jagt.« Er grinste breit. Seine Zähne leuchteten im Schein einer Straßenlaterne.
Kevin sprang mitten auf die Straße, gerade als ein Auto um die Ecke bog, dessen Scheinwerfer den rissigen Asphalt in blau-weißem Schimmer erstrahlen ließen. Er ruckte einmal mit angewinkelten Armen nach hinten und brachte sie dann langsam vor seinem Körper zusammen wie ein Wrestler, der sich in Szene setzt. Das Auto kam näher, wahrscheinlich rechnete der Fahrer damit, dass Kevin schließlich aus dem Weg gehen würde, wie es ein normaler Mensch getan hätte. Wie er es eigentlich auch tun sollte.
»Hulk wütend!«, brüllte Kevin. »Hulk … zerstören!«
Er sprang auf das Auto zu, bevor es bremsen konnte, packte es an der vorderen Stoßstange und drehte es um, so dass es mit einem Kreischen aus sich verbiegendem Metall und zersplitterndem Glas kopfüber auf dem Asphalt landete. Im Inneren schrie eine Frau.
»O Mann«, sagte Diego kopfschüttelnd. Er sah gut aus mit seinen dunklen, dichten Locken, den großen strahlenden Augen und vollen Lippen, aber wer von uns sah nicht gut aus? Sogar Kevin und die anderen von Raouls Idioten sahen gut aus. »Kevin, wir sollen uns unauffällig verhalten. Riley hat gesagt …«
»Riley hat gesagt!«, ahmte Kevin ihn mit hoher schriller Stimme nach. »Leg dir mal ein bisschen mehr Rückgrat zu, Diego. Riley ist nicht hier.«
Kevin sprang über den Honda, der auf dem Dach lag, und zerschlug das Fenster auf der Fahrerseite, das bis dahin aus unerfindlichen Gründen heil geblieben war. Er angelte durch die zerbrochene Scheibe hindurch und am Airbag vorbei, der schon wieder die Luft verlor, nach der Fahrerin.
Ich drehte ihm den Rücken zu, hielt den Atem an und tat mein Bestes, um einen klaren Kopf zu behalten.
Ich ertrug es nicht, Kevin beim Trinken zuzusehen. Dazu war ich selbst zu durstig, aber ich wollte auch keinen Streit mit ihm anfangen. Ich konnte nun wirklich darauf verzichten, auf Raouls Abschussliste zu geraten.
Diese Probleme hatte der blonde Junge nicht. Er stieß sich von den Backsteinen über unseren Köpfen ab und landete geschmeidig hinter mir. Ich hörte, wie er und Kevin sich anknurrten und dann ein nasses, sattes Reißen, als die Schreie der Frau abbrachen. Wahrscheinlich hatten sie sie in zwei Hälften gerissen.
Ich versuchte nicht darüber nachzudenken. Aber ich nahm die Hitze und das Tropfen von Blut hinter mir wahr und meine Kehle begann fürchterlich zu brennen, obwohl ich gar nicht atmete.
»Ich verschwinde«, hörte ich Diego murmeln.
Er duckte sich in eine Lücke zwischen den dunklen Häusern und ich heftete mich an seine Fersen. Wenn ich nicht schnell hier wegkam, würde ich mich mit Raouls Schwachköpfen um einen Körper streiten, durch den inzwischen sowieso nicht mehr viel Blut fließen konnte. Und dann wäre ich vielleicht diejenige, die heute nicht zurückkam.
Ah, wie meine Kehle brannte! Ich biss die Zähne zusammen, um nicht vor Schmerzen laut zu schreien.
Diego flitzte durch eine schmale Sackgasse voller Müll und huschte dann – als er das Ende erreichte – die Wand hinauf. Ich krallte die Finger in die Ritzen zwischen den Backsteinen und zog mich hinter ihm hoch.
Auf dem Dach rannte Diego los, er sprang leichtfüßig über die anderen Dächer hinweg auf die Lichter zu, die sich im Sund spiegelten. Ich blieb dicht hinter ihm. Ich war jünger als er und daher stärker – es war gut, dass wir Jüngeren die Stärksten waren, sonst hätten wir nicht mal eine Woche in Rileys Haus überlebt. Ich hätte ihn leicht überholen können, aber ich wollte sehen, wo er hinrannte, und ich wollte ihn nicht hinter mir haben.
Diego hielt lange Zeit nicht an; wir hatten schon beinahe den Industriehafen erreicht. Ich konnte hören, wie er leise vor sich hin murmelte.
»Idioten! Als hätte Riley nicht gute Gründe für die Anweisungen, die er uns gibt. Selbstschutz, zum Beispiel. Ist ein Hauch gesunder Menschenverstand wirklich zu viel verlangt?«
»Hey«, rief ich. »Gehen wir irgendwann heute noch mal auf die Jagd? Meine Kehle steht schon in Flammen.«
Diego landete am Rand eines großen Fabrikdachs und wirbelte herum. Ich sprang ein paar Meter zurück, ich war auf der Hut, aber er wirkte nicht aggressiv und kam auch nicht auf mich zu.
»Ja, klar«, sagte er. »Ich wollte nur einen gewissen Abstand zwischen mich und diese Geistesgestörten bringen.«
Er lächelte ganz freundlich und ich starrte ihn an.
Dieser Diego war nicht wie die anderen. Er war irgendwie … ruhig. Ich glaube, das wäre das richtige Wort. Normal. Na ja, jetzt nicht mehr normal, aber früher einmal. Seine Augen waren von einem dunkleren Rot als meine. Er musste schon eine ganze Weile hier sein, genau, wie ich gehört hatte.
Von der Straße drangen die nächtlichen Geräusche eines der verwahrlosteren Viertel von Seattle zu uns herauf. Ein paar Autos, Musik mit dröhnenden Bässen, einige wenige Leute, die mit nervösen, schnellen Schritten unterwegs waren, ein Betrunkener, der in der Ferne falsch sang.
»Du bist Bree, stimmt’s?«, fragte Diego. »Eine von den Neulingen.«
Das gefiel mir nicht. Neulinge. Egal. »Ja, ich bin Bree. Aber ich bin nicht mit der letzten Gruppe gekommen. Ich bin schon fast drei Monate alt.«
»Ganz schön cool, wenn man bedenkt, wie jung du bist«, sagte er. »Nicht viele hätten es geschafft, einfach so von der Unfallstelle zu verschwinden.« Er sagte das wie ein Kompliment, so, als wäre er ernsthaft beeindruckt.
»Wollte nicht mit Raouls Deppen aneinandergeraten.«
Er nickte. »Du sagst es. Diese Typen sorgen nur für Negativschlagzeilen.«
Schräg. Diego war schräg. Es klang, als führte er ein ganz normales altmodisches Gespräch mit mir. Ohne Feindseligkeit, ohne Misstrauen. Als würde er nicht darüber nachdenken, wie leicht oder wie schwer es wäre, mich jetzt sofort umzubringen. Er redete einfach nur mit mir.
»Wie lange bist du schon bei Riley?«, fragte ich neugierig.
»Seit elf Monaten jetzt.«
»Wow! Dann bist du ja älter als Raoul.«
Diego verdrehte die Augen und spuckte Gift über die Kante des Gebäudes. »Ja, ich kann mich noch erinnern, als Riley dieses Gesocks mitgebracht hat. Seitdem ist alles immer schlimmer geworden.«
Ich schwieg einen Moment und überlegte, ob er alle, die jünger waren als er, für Gesocks hielt. Nicht, dass es mir etwas ausgemacht hätte. Was irgendjemand über mich dachte, machte mir schon lange nichts mehr aus. Es war nicht mehr nötig. In Rileys Worten war ich jetzt eine Göttin. Stärker, schneller, besser. Kein anderer zählte.
Dann stieß Diego einen leisen Pfiff aus.
»Na also. Es braucht nur ein bisschen Hirn und Geduld.« Er zeigte nach unten über die Straße.
Halb versteckt in einem nachtschwarzen Durchgang beschimpfte ein Mann eine Frau und ohrfeigte sie, während eine andere Frau schweigend zusah. Von ihren Kleidern her zu schließen, waren es ein Zuhälter und zwei seiner Mädchen.
Das war es, was Riley uns gesagt hatte. Dass wir Jagd auf den »Abschaum« machen sollten. Die Menschen nehmen, nach denen niemand suchen würde, diejenigen, die nicht auf dem Weg nach Hause zu einer wartenden Familie waren, diejenigen, die man nicht als vermisst melden würde.
Genau so hatte er uns auch ausgewählt. Mahlzeiten und Götter, beide hatten zum Abschaum gehört.
Im Unterschied zu manchen anderen tat ich immer noch, was Riley uns sagte. Nicht, weil ich ihn mochte. Dieses Gefühl war schon lange verschwunden. Sondern weil das, was er uns sagte, so klang, als wäre es richtig. Was für einen Sinn hatte es, Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu lenken, dass ein Haufen neugeborener Vampire Seattle als seine Jagdgründe beanspruchte? Wie sollte uns das helfen?
Ich hatte überhaupt nicht an Vampire geglaubt, bevor ich selbst einer geworden war. Wenn auch der Rest der Welt nicht wusste, dass es Vampire gab, hieß das, dass alle anderen Vampire auf intelligente Art jagten, so wie Riley es uns eingeschärft hatte. Dafür gab es wahrscheinlich einen guten Grund.
Und genau, wie Diego sagte, brauchte es nur ein bisschen Hirn und Geduld, um auf intelligente Art zu jagen.
Natürlich machten wir alle trotzdem genug Fehler und dann las Riley davon in der Zeitung und stöhnte und schrie uns an und zertrümmerte Sachen – wie zum Beispiel Raouls geliebte Videospielkonsole. Davon wurde Raoul so wütend, dass er irgendjemand anderen in Stücke riss und verbrannte. Das wiederum machte Riley noch viel wütender und er veranstaltete mal wieder eine Suchaktion, um alle Feuerzeuge und Streichhölzer zu beschlagnahmen. Nach ein paar solcher Runden schleppte Riley noch mehr in Vampire verwandelten Abschaum an, um die zu ersetzen, die draufgegangen waren. Es war ein endloser Kreislauf.
Diego sog die Luft durch die Nase – ein tiefer, langer Zug – und ich beobachtete, wie sein Körper sich veränderte. Er kauerte sich auf das Dach, mit einer Hand an der Kante. Seine ganze seltsame Freundlichkeit verschwand und er wurde zum Jäger.
Das war etwas, das ich kannte, etwas, womit ich mich wohlfühlte, weil ich es verstand.
Ich schaltete mein Gehirn ab. Wir waren zum Jagen hier. Ich holte tief Luft und atmete den Geruch der drei da unten ein. Es waren nicht die einzigen Menschen in der Gegend, aber die, die uns am nächsten waren. Wen man jagen wollte, musste man entscheiden, bevor man seine Beute roch. Jetzt war es zu spät, um noch irgendetwas zu ändern.
Diego ließ sich von der Dachkante fallen und verschwand aus meinem Blickfeld. Das Geräusch seiner Landung war zu leise, um die Aufmerksamkeit der drei Menschen im Durchgang zu erregen.
Ein leises Knurren drang zwischen meinen Zähnen hervor. Meins. Das Blut war meins. Das Feuer in meiner Kehle loderte auf und ich konnte an nichts anderes denken.
Ich stieß mich vom Dach ab und schoss über die Straße, so dass ich direkt neben der weinenden Blondine landete. Ich konnte Diego dicht hinter mir spüren, daher knurrte ich ihn warnend an, während ich das überraschte Mädchen an den Haaren packte. Ich zerrte sie zur Wand des Durchgangs und stellte mich mit dem Rücken dagegen. In Verteidigungshaltung, für alle Fälle.
Dann dachte ich nicht länger an Diego, denn ich konnte die Hitze unter ihrer Haut spüren und das Pochen ihres Pulsschlags ganz dicht unter der Oberfläche hören.
Sie öffnete den Mund, um zu schreien, aber meine Zähne durchtrennten ihre Luftröhre, bevor ein Laut herausdringen konnte. Man hörte nur das Gurgeln von Luft und Blut in ihrer Lunge und ein leises Stöhnen, das ich nicht unterdrücken konnte.
Das Blut war warm und süß. Es löschte das Feuer in meiner Kehle, linderte die nagende, kribbelnde Leere in meinem Magen. Ich saugte und schluckte und nahm alles andere nur undeutlich wahr.
Ich hörte dasselbe Geräusch von Diego – er hatte sich über den Mann hergemacht. Die andere Frau lag bewusstlos auf dem Boden. Keiner von beiden hatte noch ein Geräusch von sich gegeben. Diego war gut.
Das Problem mit den Menschen war, dass sie nie genug Blut in sich hatten. Es kam mir so vor, als wäre das Mädchen schon Sekunden später ausgetrocknet. Frustriert schüttelte ich ihren schlaffen Körper. Meine Kehle begann bereits erneut zu brennen.
Ich ließ den aufgebrauchten Körper zu Boden fallen und kauerte mich an die Wand, überlegte, ob ich es schaffen könnte, mir das bewusstlose Mädchen zu schnappen und mit ihr abzuhauen, bevor Diego mich einholte.
Diego war bereits fertig mit dem Mann. Er sah mich mit einem Ausdruck an, den ich nur als … verständnisvoll bezeichnen konnte. Aber vielleicht lag ich damit auch völlig falsch. Ich konnte mich an niemanden erinnern, der mir je mit Verständnis begegnet wäre, deshalb wusste ich auch nicht genau, wie das aussah.
»Nimm sie dir«, erklärte er und wies mit dem Kopf zu dem schlaffen Mädchen auf dem Boden.
»Machst du Witze?«
»Nee, mir reicht’s erst mal. Wir haben genug Zeit, heute Nacht noch mehr zu jagen.«
Während ich ihn aufmerksam auf kleinste Anzeichen für eine List hin beobachtete, stürzte ich nach vorn und griff mir das Mädchen. Diego machte keine Anstalten, mich zurückzuhalten. Er wandte sich leicht ab und sah in den schwarzen Himmel hinauf.
Ich grub meine Zähne in ihren Hals und hielt meinen Blick weiterhin auf ihn gerichtet. Diese hier schmeckte sogar noch besser als die andere. Ihr Blut war vollkommen sauber. Das Blut des blonden Mädchens hatte den bitteren Nachgeschmack gehabt, den Drogen mit sich brachten – ich war so sehr daran gewöhnt, dass es mir kaum aufgefallen war. Ich bekam selten richtig sauberes Blut zu trinken, weil ich mich an die Abschaumregel hielt. Diego schien sich auch an die Regeln zu halten. Er musste gerochen haben, worauf er da verzichtete.
Warum hatte er das getan?
Als der zweite Körper leer war, fühlte sich meine Kehle besser an. Ich hatte viel Blut getrunken. Wahrscheinlich würde ich ein paar Tage lang kein Brennen verspüren.
Diego wartete immer noch und pfiff leise durch die Zähne. Als ich den Körper mit einem dumpfen Schlag zu Boden fallen ließ, wandte er sich mir zu und lächelte.
»Äh, danke«, sagte ich.
Er nickte. »Du sahst so aus, als hättest du es nötiger als ich. Ich kann mich noch erinnern, wie schwierig es am Anfang ist.«
»Wird es irgendwann einfacher?«
Er zuckte die Achseln. »In gewisser Weise.«
Wir sahen uns einen Augenblick lang an.
»Warum versenken wir die Leichen nicht im Sund?«, schlug er vor.
Ich bückte mich, nahm die tote Blondine und warf mir ihren schlaffen Körper über die Schulter. Als ich gerade nach der anderen greifen wollte, kam Diego mir zuvor, den Zuhälter bereits auf dem Rücken.
»Hab sie«, sagte er.
Ich folgte ihm die Mauer hinauf und dann hangelten wir uns an den Trägern der Autobahnbrücke entlang. Die Scheinwerfer der Autos unter uns erfassten uns nicht. Ich dachte daran, wie dumm die Menschen waren, wie blind, und ich war froh, dass ich nicht zu den Ahnungslosen gehörte.
Von der Dunkelheit verborgen, kamen wir zu einem leeren Dock, das jetzt in der Nacht verschlossen war. Diego zögerte keine Sekunde am Ende der Betonmauer, sondern sprang mit seiner klobigen Last einfach von der Kante herab und verschwand im Wasser. Ich tauchte hinter ihm ein.
Er schwamm so geschmeidig und schnell wie ein Hai und schoss immer tiefer und weiter in den schwarzen Sund hinaus. Plötzlich hielt er an, als er gefunden hatte, wonach er suchte – einen riesigen, schlammigen Felsbrocken auf dem Meeresgrund, an dem Seesterne und Müll festhingen. Wir mussten über dreißig Meter tief sein – einem Menschen wäre es hier unten pechschwarz vorgekommen. Diego ließ die Leichen los. Sie schaukelten sanft neben ihm in der Strömung, während er seine Hand in den schmutzigen Sand am Fuß des Felsens schob. Einen Augenblick später hatte er einen Halt gefunden und hievte den Felsbrocken von seinem Platz. Sein Gewicht ließ ihn bis zur Taille in den dunklen Meeresboden einsinken.
Er blickte auf und nickte mir zu.
Ich schwamm zu ihm hinunter und angelte auf dem Weg mit einer Hand nach seinen Leichen. Ich stieß die Blondine in das schwarze Loch unter dem Felsen, dann schob ich das zweite Mädchen und den Zuhälter hinterher. Ich trat leicht auf die Körper, um sicherzugehen, dass sie festsaßen, dann paddelte ich aus dem Weg. Diego ließ den Felsbrocken fallen. Er wackelte ein bisschen, passte sich dem neuen, unebenen Untergrund an. Diego strampelte sich aus dem Dreck frei, schwamm zur Oberfläche des Felsbrockens und drückte ihn runter, um den Widerstand darunter flach zu pressen.
Er schwamm ein paar Meter zurück, um sein Werk zu begutachten.
Perfekt, formte ich mit den Lippen. Diese drei Leichen würden nie wieder auftauchen. Riley würde nie einen Bericht über sie in den Nachrichten hören.
Diego grinste und hielt die Hand hoch.
Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass ich einschlagen sollte. Zögernd schwamm ich vor, klatschte meine Handfläche gegen seine und ruderte dann schnell zurück, um einen gewissen Abstand zwischen uns zu bringen.
Diego setzte eine eigenartige Miene auf, dann schoss er wie eine Kugel an die Wasseroberfläche.
Verwirrt flitzte ich hinter ihm her. Als ich an die Luft kam, erstickte er beinahe an seinem Gelächter.
»Was ist?«
Eine Weile konnte er nicht antworten. Schließlich platzte er heraus: »Das war der mieseste High Five, den ich je gesehen habe.«
Ich rümpfte verärgert die Nase. »Konnte ja nicht wissen, ob du mir gleich den Arm abreißt oder so.«
Diego schnaubte. »Das würde ich nicht tun.«
»Jeder andere schon«, gab ich zurück.
»Das stimmt allerdings«, pflichtete er mir bei, plötzlich gar nicht mehr so amüsiert. »Lust auf einen weiteren Beutezug?«
»Was für eine Frage!«
Wir kamen unter einer Brücke aus dem Wasser und stießen zufällig auf zwei Obdachlose, die dort in alten, dreckigen Schlafsäcken auf einer Matratze aus alten Zeitungen schliefen. Keiner von beiden wachte auf. Ihr Blut hatte einen sauren Beigeschmack vom Alkohol, aber es war immer noch besser als nichts. Wir vergruben sie ebenfalls im Sund, unter einem anderen Felsen.
»Tja, jetzt reicht’s mir wieder für ein paar Wochen«, sagte Diego, als wir aus dem Wasser raus waren und tropfend auf dem Rand eines anderen leeren Docks standen.
Ich seufzte. »Ich schätze, das ist der einfachere Teil, stimmt’s? Ich werde das Brennen schon in ein paar Tagen wieder spüren. Und dann wird mich Riley wahrscheinlich wieder mit einer Handvoll von Raouls Mutanten losschicken.«
»Ich kann mitkommen, wenn du willst. Riley lässt mich eigentlich machen, was ich will.«
Ich dachte über das Angebot nach, einen Augenblick lang misstrauisch. Aber Diego schien wirklich nicht so zu sein wie der Rest. Mit ihm zusammen fühlte ich mich anders. Als müsste ich nicht so auf der Hut sein.
»Das wäre prima«, räumte ich ein. Es gefiel mir nicht, das zu sagen. Machte mich zu verletzlich oder so.
Aber Diego sagte bloß: »Alles klar«, und lächelte mich an.
»Wie kommt’s, dass Riley dir so viele Freiheiten lässt?«, fragte ich, als ich darüber nachdachte, wie die beiden zueinander standen. Je mehr Zeit ich mit Diego verbrachte, desto weniger konnte ich mir vorstellen, dass er so eng mit Riley war. Diego war so … freundlich. Überhaupt nicht wie Riley. Aber vielleicht hatte es was damit zu tun, dass Gegensätze sich anziehen.
»Riley weiß, er kann darauf vertrauen, dass ich hinter mir aufräume. Apropos, macht’s dir was aus, wenn wir eben noch was erledigen?«
Ich fing an, diesen Typen lustig zu finden. Ich war neugierig auf ihn und wollte sehen, was er vorhatte.
»Nee, schon okay«, sagte ich.
Er lief über das Dock zur Straße hin, die durch den Hafen führte. Ich folgte ihm. Ich konnte ein paar Menschen riechen, aber ich wusste, dass es zu dunkel war und wir so schnell waren, dass sie uns nicht sehen konnten.
Er beschloss erneut den Weg über die Dächer zu nehmen. Nach ein paar Sprüngen erkannte ich unseren eigenen Geruch. Er verfolgte unsere frühere Spur zurück.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: