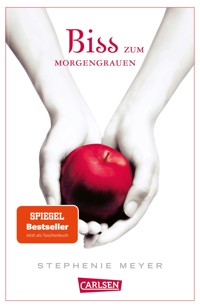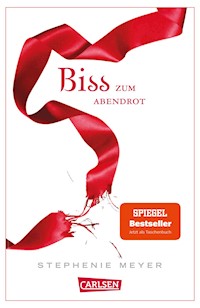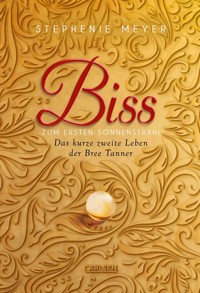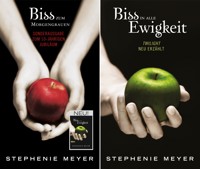11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Twilight-Saga geht weiter Für immer mit Edward zusammen zu sein – Bellas Traum scheint wahr geworden! Doch nach einem kleinen, aber blutigen Zwischenfall findet er ein jähes Ende. Edward muss sie verlassen. Für immer. Bella zerbricht beinahe daran, nur die Freundschaft zu Jacob gibt ihr Kraft. Da erfährt Bella, dass Edward in höchster Gefahr schwebt. Sie muss zu ihm, rechtzeitig, bis zur Mittagsstunde. Zwischen Tag und Nacht: Bella und Edwards ungewöhnliche Liebesgeschichte Als die 17-jährige Bella Swan aus dem sonnigen Phoenix ins regnerische Forks zieht, erwartet sie wenig von der beschaulichen Kleinstadt. Doch dann trifft sie Edward Cullen, einen Mitschüler mit faszinierend blassen Augen und einer Aura, die Bella sofort in ihren Bann zieht. Edward ist geheimnisvoll, zurückhaltend, unglaublich attraktiv – und ein Vampir! Bella kann nicht anders: Sie fühlt sich trotz – oder vielleicht gerade wegen – seiner dunklen Geheimnisse zu ihm hingezogen. Doch was bedeutet es, als Mensch einen Vampir zu lieben? Mit der "Twilight"-Saga hat Stephenie Meyer eine der populärsten Fantasy-Romance-Serien der letzten Jahrzehnte erschaffen. Insbesondere die Kombination aus romantischer Liebesgeschichte und übernatürlichen Elementen wie Vampiren und Werwölfen begeistert die breite Fangemeinschaft. Zwischen 2008 und 2012 wurden die Biss-Bände mit Kristen Stewart und Robert Pattinson erfolgreich verfilmt. Der zweite Band der weltberühmten Fantasy-Serie für Fans von paranormaler Romance und Vampirgeschichten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Die packende Liebesgeschichte zwischen Edward und Bella geht weiter! - Teil 2 von Spiegel-Bestseller-Autorin Stephenie Meyer
Für immer mit Edward zusammen zu sein – Bellas Traum scheint wahr geworden! Doch nach einem kleinen, aber blutigen Zwischenfall findet er ein jähes Ende. Edward muss sie verlassen. Für immer. Bella zerbricht beinahe daran, nur die Freundschaft zu Jacob gibt ihr Kraft. Da erfährt Bella, dass Edward in höchster Gefahr schwebt. Sie muss zu ihm, rechtzeitig, bis zur Mittagsstunde …
Dies ist Band 2 der international erfolgreichen »Biss«-Saga. Alle Bände auf einen Blick:
Biss zum Morgengrauen
Biss zur Mittagsstunde
Biss zum Abendrot
Biss zum Ende der Nacht
Biss zur Mitternachtssonne
Biss zum ersten Sonnenstrahl – Das kurze zweite Leben der Bree Tanner
Endlich gibt es auch Band 5 der weltweit geliebten Fantasy-Romance-Serie: »Biss zur Mitternachtssonne« und wir erfahren die Geschichte aus Edwards Sicht!
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Danksagung
Vita
Für meinen Vater, Stephen Morgan –Niemand hat je eine so liebevolle und bedingungslose Unterstützung erfahren wie ich von dir.Ich liebe dich auch.
So wilde Freude nimmt ein wildes EndeUnd stirbt im höchsten Sieg, wie Feur und PulverIm Kusse sich verzehrt.Romeo und Julia, 2. Akt, 6. Szene
Vorwort
Ich kam mir vor wie in einem schrecklichen Albtraum, in dem man rennt und rennt; die Lunge droht schon zu bersten, aber man kommt einfach nicht schnell genug voran. Immer langsamer schienen sich meine Beine zu bewegen, während ich mich durch die dichte Menge kämpfte, doch die Zeiger der riesigen Turmuhr wurden nicht langsamer. Ebenso unaufhaltsam wie unbarmherzig bewegten sie sich unerbittlich auf das Ende zu – das Ende allen Seins.
Doch das hier war kein Traum, und anders als in einem Albtraum rannte ich nicht um mein eigenes Leben; ich rannte, um etwas unendlich viel Wertvolleres zu retten. Mein eigenes Leben bedeutete mir im Augenblick wenig.
Alice hatte gesagt, es könnte gut sein, dass wir beide hier starben. Vielleicht hätten wir bessere Chancen, wenn sie nicht vom grellen Sonnenlicht aufgehalten würde – so konnte nur ich über den strahlend hellen Platz mit den vielen Menschen laufen.
Und ich kam nicht schnell genug voran.
Deshalb kümmerte es mich auch nicht, dass wir von so gefährlichen Feinden umzingelt waren. Als die Uhr zu schlagen begann und ich das Vibrieren der Schläge unter meinen schwerfälligen Füßen spürte, wusste ich, dass ich zu spät kam – und ich war froh zu wissen, dass die Blutsauger nur auf den richtigen Moment warteten. Denn wenn ich hier versagte, wollte ich nicht länger leben.
Wieder schlug die Uhr und die Sonne stand im Zenit und brannte mit aller Kraft.
Die Geburtstagsparty
Ich war mir zu neunundneunzig Komma neun Prozent sicher, dass es ein Traum war.
Erstens stand ich in einem hellen Sonnenstrahl – so ein gleißendes Sonnenlicht gab es in meiner nieseligen neuen Heimat Forks, Washington, einfach nicht –, und zweitens sah ich meine Oma Marie. Sie war schon seit sechs Jahren tot, ein schlagendes Argument dafür, dass es sich um einen Traum handelte.
Oma hatte sich kaum verändert; ihr Gesicht sah genauso aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Die Haut war weich und runzelig, mit tausend Fältchen, die sich sanft um die Wangenknochen schmiegten. Wie eine getrocknete Aprikose, die von einem wolkengleichen Büschel dicker weißer Haare umgeben war.
Unsere Münder – ihrer klein und knittrig – verzogen sich im selben Moment zu derselben Andeutung eines überraschten Lächelns. Offenbar hatte auch sie nicht damit gerechnet, mich zu sehen.
Ich wollte sie gerade etwas fragen; ich hatte so viele Fragen: Was machte sie hier in meinem Traum? Was hatte sie die letzten sechs Jahre getan? Ging es Opa gut und hatten sie einander dort, wo sie jetzt waren, gefunden? Doch sie öffnete den Mund im selben Moment wie ich, also hielt ich inne, um sie zuerst reden zu lassen. Auch sie stockte und dann lächelten wir beide über die kleine Ungeschicklichkeit.
»Bella?«
Das war nicht die Stimme meiner Oma, und wir drehten uns beide um. Ich brauchte nicht hinzuschauen, um zu wissen, wer da zu uns gestoßen war; diese Stimme würde ich überall erkennen – würde sie erkennen und ihr antworten, ob ich wach war oder schlief … selbst wenn ich tot wäre, garantiert. Die Stimme, für die ich durchs Feuer gehen oder, weniger dramatisch, für die ich tagtäglich durch den kalten, niemals endenden Regen waten würde.
Edward.
Obwohl ich mich immer wahnsinnig freute, ihn zu sehen – ob ich wach war oder nicht –, und obwohl ich mir fast sicher war zu träumen, geriet ich in Panik, als Edward durch das grelle Sonnenlicht auf uns zukam.
In Panik geriet ich deshalb, weil Oma nicht wusste, dass ich einen Vampir liebte – niemand wusste davon –, wie also sollte ich den Umstand erklären, dass die leuchtenden Sonnenstrahlen auf seiner Haut in tausend Regenbogenscherben zersplitterten, als wäre er ein Kristall oder ein Diamant?
Oma, vielleicht ist dir aufgefallen, dass mein Freund glitzert. Das ist bei ihm immer so in der Sonne. Mach dir deswegen keine Gedanken …
Was machte er hier bloß? Der einzige Grund dafür, dass er in Forks, der verregnetsten Stadt der Welt lebte, war der, dass er sich dort im Freien aufhalten konnte, ohne das Geheimnis seiner Familie preiszugeben. Doch jetzt war er hier und kam anmutig auf mich zugeschlendert – mit diesem wunderschönen Lächeln auf seinem Engelsgesicht –, so als wären wir allein.
In diesem Moment wäre ich sehr gern nicht die Einzige gewesen, bei der seine geheimnisvolle Gabe nicht wirkte, während ich normalerweise dankbar dafür war, dass er meine Gedanken nicht hören konnte, als würde ich sie laut aussprechen. Doch jetzt wäre es mir sehr lieb gewesen, wenn er die Warnung hören könnte, die ich ihm in Gedanken zuschrie.
Ich schaute panisch zu Oma und sah, dass es zu spät war. Sie drehte sich gerade um und starrte mich an, und sie sah genauso erschrocken aus wie ich.
Edward, der immer noch so schön lächelte, dass mir das Herz in der Brust zu zerspringen schien, legte mir den Arm um die Schultern und wandte sich zu meiner Großmutter.
Ich wunderte mich darüber, wie Oma guckte. Sie sah gar nicht entsetzt aus, stattdessen schaute sie mich verlegen an, als ob sie darauf wartete, dass ich sie ausschimpfte. Und sie stand ganz merkwürdig da – sie hielt einen Arm gebeugt in die Luft. Als würde sie jemandem, den ich nicht sehen konnte, ihren Arm umlegen, jemand Unsichtbarem …
Erst jetzt, als ich das Gesamtbild erfasste, fiel mir der riesige Goldrahmen auf, der die Gestalt meiner Großmutter umgab. Immer noch verständnislos, hob ich die Hand, die nicht um Edwards Mitte lag, um Oma zu berühren. Sie ahmte die Bewegung exakt nach, wie ein Spiegelbild. Doch dort, wo unsere Finger sich hätten berühren müssen, war nur kaltes Glas …
Mit einem Mal wurde der Traum zu einem Albtraum.
Das war nicht meine Oma.
Das war ich. Ich im Spiegel. Ich – uralt, welk und faltig.
Edward stand neben mir, er hatte kein Spiegelbild, war quälend schön und für immer siebzehn.
Er drückte seine eiskalten, perfekten Lippen an meine runzlige Wange.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag«, flüsterte er.
Ich schrak hoch, riss die Augen auf und schnappte nach Luft. Dumpfes graues Licht, das vertraute Licht eines trüben Morgens, schob sich vor das gleißende Sonnenlicht aus meinem Traum.
Nur ein Traum, sagte ich mir. Es war nur ein Traum. Ich atmete tief ein und zuckte sofort wieder zusammen, als der Wecker losging. Der kleine Kalender in der Ecke des Displays verriet mir, dass heute der dreizehnte September war.
Nur ein Traum, aber in gewisser Hinsicht doch ziemlich prophetisch. Heute war mein Geburtstag, ich war offiziell achtzehn Jahre alt.
Diesen Tag hatte ich schon seit Monaten gefürchtet.
Während des ganzen traumhaften Sommers – es war der schönste Sommer meines Lebens, der schönste Sommer der gesamten Menschheit und der verregnetste Sommer in der Geschichte der Halbinsel Olympic – hatte dieses trostlose Datum im Hinterhalt gelauert und nur darauf gewartet, mich einzuholen.
Und jetzt, wo es so weit war, fand ich es noch schlimmer als erwartet. Ich spürte, dass ich älter war. Ich wurde jeden Tag älter, aber das hier war anders, schlimmer, quantifizierbar. Ich war achtzehn.
Und Edward würde nie achtzehn sein.
Als ich mir die Zähne putzte, war ich fast überrascht, dass sich das Gesicht im Spiegel nicht verändert hatte. Ich starrte mich an und suchte nach Anzeichen drohender Falten in meiner alabasterglatten Haut. Doch die einzigen Falten hatte ich auf der Stirn, und ich wusste, dass sie verschwinden würden, wenn ich mich entspannen könnte. Aber das gelang mir nicht. Meine Augenbrauen standen in einer sorgenvollen Linie über meinen ängstlichen braunen Augen.
Es war nur ein Traum, sagte ich mir wieder. Nur ein Traum … aber auch mein schlimmster Albtraum.
Das Frühstück ließ ich ausfallen, weil ich so schnell wie möglich aus dem Haus wollte. Ich schaffte es nicht, meinem Vater ganz aus dem Weg zu gehen, deshalb musste ich ein paar Minuten gute Laune spielen. Ich gab mir alle Mühe, mich über die Geschenke, die ich mir ausdrücklich verbeten hatte, zu freuen, doch jedes Mal, wenn ich lächeln musste, hätte ich auf der Stelle losheulen können.
Auf der Fahrt zur Schule versuchte ich mich wieder zusammenzureißen. Aber die Vision meiner Großmutter – ich weigerte mich, darin mich selbst zu sehen – ließ sich nicht so leicht verscheuchen. Ich war richtig verzweifelt, bis ich auf den vertrauten Parkplatz hinter der Forks High School fuhr und Edward entdeckte, der reglos an seinem blitzblanken Volvo lehnte wie die Marmorstatue irgendeines vergessenen heidnischen Schönheitsgottes. Er war noch unvergleichlich viel schöner als in meinem Traum. Und er wartete dort auf mich, genau wie jeden Tag.
Auf der Stelle schwand meine Verzweiflung und machte ungläubigem Staunen Platz. Nach einem halben Jahr mit ihm konnte ich es noch immer nicht fassen, dass ich ein solches Glück verdiente.
Seine Schwester Alice stand neben ihm, auch sie wartete auf mich.
Natürlich waren Edward und Alice nicht richtig miteinander verwandt (in Forks hieß es, alle Cullen-Geschwister seien von Dr. Carlisle Cullen und seiner Frau Esme adoptiert worden, da die beiden eindeutig zu jung waren, um fast erwachsene Kinder zu haben), doch ihre Haut war von genau der gleichen Blässe, ihre Augen hatten den gleichen eigenartigen Goldschimmer und die gleichen tiefen bläulichen Schatten darunter. Ebenso wie Edwards Gesicht war auch ihres auffallend schön. Für jemanden, der, wie ich, Bescheid wusste, verrieten diese Ähnlichkeiten, was sie waren.
Als ich Alice dort warten sah – ihre bernsteinfarbenen Augen leuchteten erwartungsvoll und sie hielt ein kleines silbernes Päckchen in den Händen –, runzelte ich die Stirn. Ich hatte Alice gesagt, dass ich absolut nichts zum Geburtstag haben wollte und dass sie ihn auch nicht weiter beachten sollte. Offenbar ignorierte sie meine Wünsche.
Ich schlug die Tür meines Chevy-Transporters, Baujahr 53, zu – ein Rostregen schwebte auf den nassen Asphalt – und ging langsam zu den beiden hinüber. Alice stürmte mir entgegen, ihr Elfengesicht glühte unter den schwarzen Stachelhaaren.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Bella!«
»Scht!«, zischte ich und schaute mich auf dem Parkplatz um, ob es auch niemand gehört hatte. Auf gar keinen Fall wollte ich an diesem schwarzen Tag gefeiert werden.
Sie achtete gar nicht darauf. »Möchtest du das Geschenk lieber jetzt auspacken oder später?«, fragte sie eifrig, während wir zusammen zu Edward gingen.
»Keine Geschenke«, murmelte ich protestierend.
Endlich schien sie zu kapieren, in welcher Stimmung ich war. »Na gut … dann also später. Hat dir das Album gefallen, das deine Mutter dir geschickt hat? Und der Fotoapparat von Charlie?«
Ich seufzte. Natürlich wusste sie, was ich zum Geburtstag bekommen hatte. Edward war in seiner Familie nicht der Einzige mit außergewöhnlichen Talenten. Sobald meine Eltern sich ein Geschenk überlegt hatten, wusste Alice es auch schon.
»Ja. Ganz super.«
»Also, ich finde, es ist eine schöne Idee. Dein letztes Jahr an der Highschool hast du nur einmal. Das ist doch Grund genug, alles festzuhalten.«
»Wie oft hattest du schon dein letztes Jahr?«
»Das kann man nicht vergleichen.«
Jetzt waren wir bei Edward angelangt, der mir eine Hand hinhielt. Ich ergriff sie ungeduldig und vergaß für einen Moment meine trübe Stimmung. Seine Haut war so glatt, hart und eiskalt wie immer. Er drückte leicht meine Hand. Ich schaute in seine klaren Topasaugen, und mein Herz zog sich ziemlich unsanft zusammen. Als er die Aussetzer in meinem Herzschlag hörte, lächelte er wieder.
Er hob die freie Hand und zeichnete mit der kühlen Fingerspitze die Konturen meiner Lippen nach. »Dann ist es also wie besprochen und ich darf dir nicht zum Geburtstag gratulieren, habe ich das recht verstanden?«
»Ja. Das hast du recht verstanden.« Ich konnte nie so ganz seinen perfekten, formellen Tonfall nachahmen. Man merkte, dass er ihn aus einem anderen Jahrhundert hatte.
»Ich wollte nur noch einmal nachfragen.« Er fuhr sich mit der Hand durch das zerzauste bronzefarbene Haar. »Es hätte ja sein können, dass du deine Meinung geändert hast. Die meisten Leute freuen sich über solche Sachen wie Geburtstage und Geschenke.«
Alice lachte, ein silbriges Lachen, wie ein Windspiel. »Natürlich wirst du dich freuen. Heute werden alle nett zu dir sein und versuchen, es dir recht zu machen, Bella. Was kann schon Schlimmes passieren?« Das war eine rein rhetorische Frage.
»Dass ich älter werde«, antwortete ich, und meine Stimme war nicht so fest, wie sie sein sollte.
Edwards Lächeln wurde zu einer harten Linie.
»Achtzehn ist nicht besonders alt«, sagte Alice. »Warten Frauen für gewöhnlich nicht, bis sie neunundzwanzig sind, bevor sie sich über Geburtstage aufregen?«
»Ich bin älter als Edward«, murmelte ich.
Er seufzte.
»Rein formal betrachtet«, sagte sie, immer noch in leichtem Ton. »Aber nur ein kleines Jährchen.«
Und ich dachte … wenn ich mir der Zukunft sicher sein könnte, wenn ich sicher wäre, dass ich für immer mit Edward zusammenbleiben könnte und mit Alice und den restlichen Cullens (und das vorzugsweise nicht als verschrumpelte alte Dame) … dann würden mir ein oder zwei Jahre Altersunterschied nicht so viel ausmachen. Aber Edward schloss die Möglichkeit, dass ich verwandelt werden könnte, kategorisch aus. Die Möglichkeit, dass ich so werden könnte wie er – unsterblich.
Eine Sackgasse, wie er es nannte.
Ehrlich gesagt verstand ich nicht so recht, was Edward dagegen hatte. Was war so toll daran, sterblich zu sein? Es kam mir nicht so schrecklich vor, ein Vampir zu sein – jedenfalls nicht, wenn man es so machte wie die Cullens.
»Um wie viel Uhr kommst du zu uns?«, fragte Alice, um das Thema zu wechseln. Ich sah ihr an, dass sie genau das plante, was ich auf keinen Fall wollte.
»Ich wüsste nicht, dass ich euch besuchen wollte.«
»Ach, komm schon, Bella!«, sagte sie. »Du willst doch keine Spielverderberin sein, oder?«
»Ich dachte, an meinem Geburtstag machen wir, was ich will.«
»Ich hole sie gleich nach der Schule von zu Hause ab«, sagte Edward. Er ignorierte mich einfach.
»Ich muss arbeiten«, protestierte ich.
»Musst du nicht«, sagte Alice selbstzufrieden. »Ich habe schon mit Mrs Newton gesprochen. Sie tauscht mit dir den Freitag. Ich soll dir einen herzlichen Glückwunsch bestellen.«
»Ich … ich kann trotzdem nicht kommen«, stammelte ich und suchte nach einer Ausrede. »Ich, also ich muss mir für Englisch Romeo und Julia ansehen.«
Alice rümpfte die Nase. »Romeo und Julia kennst du doch auswendig.«
»Aber Mr Berty hat gesagt, man kann das Stück erst richtig einschätzen, wenn man es aufgeführt sieht – so war es von Shakespeare gedacht.«
Edward verdrehte die Augen.
»Du hast doch den Film gesehen«, sagte Alice vorwurfsvoll.
»Aber nicht die Fassung aus den Sechzigern. Mr Berty hat gesagt, das ist die beste.«
Schließlich legte Alice das selbstzufriedene Lächeln ab und schaute mich zornig an.
»Du kannst dir aussuchen, ob du es uns leicht- oder schwermachen willst, Bella, so oder so …«
Edward fiel ihr ins Wort. »Immer mit der Ruhe, Alice. Wenn Bella einen Film sehen will, kann sie das tun. Es ist ihr Geburtstag.«
»Eben«, sagte ich.
»Ich hole sie gegen sieben ab«, fuhr er fort. »So hast du auch mehr Zeit für die Vorbereitungen.«
Alice ließ wieder ihr glockenhelles Lachen ertönen. »Das hört sich gut an. Bis heute Abend, Bella! Es wird toll, du wirst schon sehen.« Sie lächelte so breit, dass man all ihre ebenmäßigen, strahlenden Zähne sah, dann gab sie mir einen Kuss auf die Wange, und ehe ich etwas erwidern konnte, war sie schon zu ihrer ersten Stunde getänzelt.
»Edward, bitte …«, begann ich, aber er legte mir einen kühlen Finger auf die Lippen.
»Lass uns später darüber reden. Wir kommen zu spät zum Unterricht.«
Keiner starrte uns an, als wir uns auf unsere Plätze in der letzten Reihe setzten. Edward und ich waren jetzt so lange zusammen, dass nicht mehr über uns getratscht wurde. Nicht mal Mike Newton bedachte mich mit dem niedergeschlagenen Blick, der mir sonst immer ein etwas schlechtes Gewissen machte. Stattdessen lächelte er, offenbar hatte er sich endlich damit abgefunden, dass wir nur Freunde sein konnten. Mike hatte sich in den Sommerferien verändert – sein Gesicht war nicht mehr so rund, die Wangenknochen traten stärker hervor und er hatte eine neue Frisur. Früher hatte er die aschblonden Haare immer in einem Bürstenschnitt getragen; jetzt waren sie länger, und er hatte sie mit Gel gekonnt wirr gestylt. Es war unverkennbar, von wem er sich dabei hatte inspirieren lassen – aber Edwards Aussehen konnte man nicht einfach so kopieren.
Im Laufe des Tages überlegte ich immer wieder, wie ich mich dem entziehen könnte, was am Abend im Haus der Cullens stattfinden sollte. Es war schon schlimm genug, dass ich feiern sollte, wenn ich eigentlich in Trauerstimmung war. Noch schlimmer war jedoch, dass ich dabei im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen und Geschenke bekommen würde.
Im Mittelpunkt zu stehen ist nie gut, da würde mir wohl jeder zustimmen, der so ein unfallgefährdeter Tollpatsch ist wie ich. Niemand möchte im Rampenlicht stehen, wenn er höchstwahrscheinlich auf die Nase fällt.
Und ich hatte ausdrücklich darum gebeten – eigentlich sogar befohlen –, mir dieses Jahr nichts zu schenken. Charlie und Renée waren offenbar nicht die Einzigen, die diesen Wunsch einfach ignorierten.
Ich hatte nie viel Geld gehabt, und das hatte mir auch nie viel ausgemacht. Renée hatte uns von ihrem Gehalt als Erzieherin durchgebracht, und Charlie wurde mit seinem Job auch nicht gerade reich – er war Polizeichef im winzigen Forks. Etwas eigenes Geld verdiente ich mir an drei Tagen in der Woche im einzigen Sportgeschäft hier. In einer so kleinen Stadt konnte ich von Glück sagen, dass ich einen Job hatte. Jeder Cent, den ich verdiente, floss in meinen mikroskopisch kleinen College-Fonds. (College war Plan B. Ich hoffte immer noch auf Plan A, aber Edward bestand ja hartnäckig darauf, dass ich ein Mensch bleiben sollte …)
Edward hatte sehr viel Geld – ich wollte noch nicht mal darüber nachdenken, wie viel. Geld bedeutete Edward und den anderen Cullens praktisch nichts. Es war einfach etwas, das sich akkumulierte, wenn man unbegrenzte Zeit zur Verfügung hatte und eine Schwester mit der unheimlichen Fähigkeit, die Entwicklungen am Börsenmarkt vorherzusagen. Edward schien nicht zu verstehen, weshalb ich nicht wollte, dass er Geld für mich ausgab – weshalb es mir unangenehm war, wenn er mich in ein teures Restaurant in Seattle ausführte, weshalb er mir kein Auto kaufen durfte, das schneller fuhr als neunzig Stundenkilometer, oder weshalb ich ihm nicht erlaubte, meine Studiengebühren zu bezahlen (er war auf absurde Weise begeistert von Plan B). Edward fand, dass ich die Dinge unnötig kompliziert machte.
Aber wie konnte ich mich von ihm beschenken lassen, wenn ich mich nie revanchieren konnte? Aus irgendeinem unerfindlichen Grund wollte er mit mir zusammen sein. Alles, was er mir darüber hinaus noch gab, verstärkte das Ungleichgewicht zwischen uns.
Weder Edward noch Alice erwähnten meinen Geburtstag weiter, und meine Anspannung legte sich ein wenig.
In der Mittagspause setzten wir uns an unseren üblichen Tisch.
An diesem Tisch herrschte ein merkwürdiger Waffenstillstand. Wir drei – Edward, Alice und ich – saßen am einen Tischende. Meine anderen Freunde, Mike und Jessica (die sich in der unangenehmen Phase nach der Trennung befanden), Angela und Ben (deren Beziehung die Sommerferien überlebt hatte), Eric, Conner, Tyler und Lauren (obwohl Letztere streng genommen nicht zu meinen Freunden zählte), saßen mit am selben Tisch, jenseits einer unsichtbaren Trennlinie. An sonnigen Tagen, wenn Edward und Alice nicht zur Schule kamen, löste sich die Trennlinie problemlos auf, und dann wurde ich wie selbstverständlich in die Unterhaltung einbezogen.
Edward und Alice empfanden diese milde Form der Ächtung nicht als so seltsam oder verletzend, wie ich es an ihrer Stelle empfunden hätte. Sie bemerkten es kaum. Die Leute fühlten sich in Gegenwart der Cullens immer eigenartig unwohl, sie fürchteten sich aus einem Grund, den sie sich selbst nicht erklären konnten. Ich war eine merkwürdige Ausnahme von dieser Regel. Manchmal machte Edward sich Sorgen, weil ich mich in seiner Nähe so wohl fühlte. Er selbst meinte, er sei eine Gefahr für mein Leben – was ich jedes Mal, wenn er davon anfing, vehement bestritt.
Der Nachmittag war schnell vorüber. Nach Schulschluss begleitete Edward mich wie üblich zu meinem Transporter. Aber diesmal hielt er mir die Beifahrertür auf. Offenbar war Alice mit seinem Wagen nach Hause gefahren, damit er verhindern konnte, dass ich mich davonstahl.
Ich verschränkte die Arme und machte keine Anstalten, einzusteigen. »Darf ich an meinem Geburtstag nicht selber fahren?«
»Ich tue so, als hättest du nicht Geburtstag, ganz wie du wolltest.«
»Wenn ich nicht Geburtstag habe, muss ich heute Abend ja auch nicht zu euch kommen …«
»Na gut.« Er schlug die Beifahrertür zu, ging an mir vorbei und hielt mir die Fahrertür auf. »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.«
»Scht«, machte ich halbherzig. Ich stieg auf der Fahrerseite ein. Es wäre mir lieber gewesen, er hätte sich anders entschieden.
Während ich fuhr, spielte Edward am Radio herum und schüttelte missbilligend den Kopf.
»Dein Radio hat einen miserablen Empfang.«
Ich runzelte die Stirn. Ich konnte es nicht leiden, wenn er an meinem Wagen herummäkelte. Der Transporter war super – er hatte Persönlichkeit.
»Wenn du eine tolle Musikanlage willst, fahr doch mit deinem eigenen Auto.« Zu meiner sowieso düsteren Stimmung kam noch hinzu, dass ich wegen der bevorstehenden Geburtstagsparty nervös war, und die Worte kamen schärfer heraus als beabsichtigt. Ich ließ meine schlechte Laune sonst nie an Edward aus, und er presste die Lippen zusammen, um nicht zu grinsen.
Als ich vor Charlies Haus parkte, beugte Edward sich zu mir herüber und nahm mein Gesicht in die Hände. Er berührte mich ganz sanft, legte mir nur leicht die Fingerspitzen an die Wangen und Schläfen. Als wäre ich ganz zerbrechlich. Und das war ich ja auch – jedenfalls im Vergleich zu ihm.
»Gerade heute solltest du besonders gute Laune haben«, flüsterte er. Ich spürte seinen süßen Atem auf dem Gesicht.
»Und wenn ich keine gute Laune haben will?«, fragte ich. Mein Atem ging unregelmäßig.
Seine goldenen Augen glühten. »Zu schade.«
Als er sich noch weiter über mich beugte und seine eiskalten Lippen auf meine presste, schwirrte mir schon der Kopf. Wie zweifellos von ihm beabsichtigt, vergaß ich alle Sorgen und konzentrierte mich darauf, das Ein- und Ausatmen nicht zu vergessen.
Kalt und weich und sanft lag sein Mund auf meinem, bis ich ihm die Arme um den Hals schlang und mich dem Kuss etwas zu leidenschaftlich hingab. Ich spürte, wie er die Lippen zu einem Lächeln verzog, als er mein Gesicht losließ und meinen Griff in seinem Nacken löste.
Edward hatte für die körperliche Seite unserer Beziehung sorgfältige Regeln aufgestellt, die mein Überleben gewährleisten sollten. Zwar sah ich ein, dass ein Sicherheitsabstand zwischen meiner Haut und seinen messerscharfen Giftzähnen gewahrt werden musste, doch wenn er mich küsste, vergaß ich solche Nebensächlichkeiten leicht.
»Ein bisschen Rücksicht bitte«, hauchte er an meiner Wange. Noch einmal legte er die Lippen behutsam auf meine, dann richtete er sich auf und gab meine Arme sanft frei.
Der Puls hämmerte mir in den Ohren. Ich legte mir eine Hand aufs Herz und spürte, wie es raste.
»Ob sich das irgendwann mal gibt?« Die Frage war mehr an mich selbst gerichtet. »Dass mir das Herz nicht mehr jedes Mal aus der Brust springen will, wenn du mich berührst?«
»Das will ich doch nicht hoffen«, sagte er ein wenig selbstgefällig.
Ich verdrehte die Augen. »Komm, wir gucken uns an, wie die Capulets und die Montagues sich zerfleischen, okay?«
»Dein Wunsch ist mir Befehl.«
Edward streckte sich auf dem Sofa aus, während ich den Videorecorder einschaltete und den Vorspann vorspulte. Als ich mich vor ihn aufs Sofa hockte, schlang er die Arme um meine Taille und zog mich an seine Brust. Sie war hart und kalt und vollkommen wie eine Eisskulptur – zwar nicht ganz so bequem wie ein Sofakissen, aber diesem doch eindeutig vorzuziehen. Er nahm die alte Decke von der Rückenlehne und legte sie mir um, damit ich so nah an seinem Körper nicht fror.
»Also, Romeo geht mir immer ganz schön auf die Nerven«, sagte er, als der Film begann.
»Was hast du denn gegen Romeo?«, fragte ich etwas beleidigt. Romeo war einer meiner Lieblingshelden in der Literatur. Ehe ich Edward kennenlernte, hatte ich ein bisschen für ihn geschwärmt.
»Na ja, zuerst war er in diese Rosalind verliebt – findest du nicht, dass ihn das ein wenig wankelmütig erscheinen lässt? Und dann ermordet er wenige Minuten nach der Hochzeit Julias Cousin. Das ist nicht besonders klug. Er macht einen Fehler nach dem anderen. Er hätte sein Glück wohl kaum noch gründlicher zerstören können, oder?«
Ich seufzte. »Soll ich den Film lieber alleine gucken?«
»Nein, ich werde ohnehin hauptsächlich dich anschauen.« Er zeichnete mit den Fingern Muster auf meinen Arm und ich bekam eine Gänsehaut. »Wirst du weinen?«
»Wahrscheinlich«, gestand ich. »Wenn ich aufpasse.«
»Dann will ich dich nicht ablenken.« Doch ich spürte seine Lippen auf meinem Haar, und das lenkte mich ziemlich ab.
Nach einer Weile fesselte mich der Film dann doch, zum großen Teil deshalb, weil Edward mir Romeos Text ins Ohr flüsterte – gegen seine unwiderstehliche Samtstimme wirkte die Stimme des Schauspielers schwach und grob. Und zu Edwards Belustigung weinte ich tatsächlich, als Julia erwachte und feststellen musste, dass ihr junger Gemahl tot war.
»Ich muss zugeben, dass ich ihn darum ein wenig beneide«, sagte Edward und trocknete meine Tränen mit einer Locke meiner Haare.
»Sie ist sehr hübsch.«
Er schnaubte verächtlich. »Ich beneide ihn nicht um das Mädchen – sondern um die Tatsache, dass er so mühelos Selbstmord begehen kann.« Sein Tonfall war neckend. »Ihr Menschen habt es so leicht! Ihr braucht nur ein kleines Röhrchen mit Pflanzenextrakten hinunterzukippen …«
»Was?«, sagte ich erschrocken.
»Einmal gab es eine Situation, in der ich das erwog, und nach Carlisles Erfahrung wusste ich, dass es nicht leicht sein würde. Ich weiß nicht genau, auf wie viele Arten Carlisle versucht hat, sich zu töten … ganz am Anfang, als ihm klarwurde, was aus ihm geworden war …« Sein Tonfall war ernst geworden, jetzt wurde er wieder leichter. »Und er erfreut sich immer noch bester Gesundheit.«
Ich drehte mich um und schaute ihm ins Gesicht. »Wovon redest du?«, fragte ich. »Was meinst du damit, ›es gab eine Situation, in der ich das erwog‹?«
»Im letzten Frühling, als du … fast ums Leben gekommen wärest …« Er verstummte und holte tief Luft. Er gab sich alle Mühe, zu dem neckenden Ton zurückzufinden. »Natürlich habe ich alles darangesetzt, dich lebend zu finden, doch ein Teil meines Hirns schmiedete Pläne für den Fall, dass ich es nicht schaffe. Wie gesagt, für mich ist es nicht so einfach wie für einen Menschen.«
Eine Sekunde lang rauschte mir die Erinnerung an meine letzte Reise nach Phoenix durch den Kopf und mir wurde schwindelig. Ich sah alles genau vor mir – die blendende Sonne, die Hitzewellen über dem Zement, als ich in rasender Hast den sadistischen Vampir aufzuspüren versuchte, der mich zu Tode quälen wollte. James, der mit meiner Mutter als Geisel in dem verspiegelten Raum wartete – das hatte ich jedenfalls geglaubt. Ich wusste nicht, dass es nur ein Trick war. Genau wie James nicht wusste, dass Edward zu meiner Rettung eilte. Edward war rechtzeitig gekommen, aber es war knapp gewesen. Gedankenverloren zeichnete ich die sichelförmige Narbe auf meiner Hand nach, die immer ein paar Grad kälter war als die übrige Haut.
Ich schüttelte den Kopf – als könnte ich damit die schlechten Erinnerungen abschütteln – und versuchte zu begreifen, was Edward meinte. Mein Magen sackte ein Stück tiefer. »Pläne für den Fall, dass du es nicht schaffst?«, wiederholte ich.
»Nun ja, ich hatte nicht vor, ohne dich weiterzuleben.« Er verdrehte die Augen, als läge das auf der Hand. »Aber ich wusste nicht, wie ich es anstellen sollte – ich wusste, dass Emmett und Jasper mir niemals dabei helfen würden … daher erwog ich, nach Italien zu reisen und die Volturi herauszufordern.«
Ich wollte nicht glauben, dass er es ernst meinte, aber der Blick seiner goldenen Augen war abwesend, schien auf etwas weit Entferntes gerichtet, während Edward darüber nachdachte, wie er sein Leben beenden könnte. Auf einmal wurde ich wütend.
»Was ist ein Volturi?«, wollte ich wissen.
»Die Volturi sind eine Familie«, erklärte er, noch immer mit abwesendem Blick. »Eine sehr alte, sehr mächtige Familie unserer Art. Wenn es in unserer Welt eine königliche Familie gäbe, dann wären sie es wohl. In seinen frühen Jahren in Italien lebte Carlisle eine Weile bei ihnen, ehe er sich in Amerika niederließ – erinnerst du dich an die Geschichte?«
»Natürlich erinnere ich mich daran.«
Ich würde nie das erste Mal vergessen, als ich bei Edward zu Hause gewesen war, das riesige weiße Herrenhaus, das tief im Wald am Fluss lag, und das Zimmer, in dem Carlisle – der in so vielerlei Hinsicht tatsächlich Edwards Vater war – eine Wand mit Gemälden hatte, die seine Lebensgeschichte erzählten. Das lebendigste, bunteste und größte Bild stammte aus Carlisles Zeit in Italien. Natürlich erinnerte ich mich an die ruhige Gruppe von vier Männern mit den feinen Gesichtern von Seraphim, die von dem höchsten Balkon aus auf das wilde Farbengewirr hinabschauten. Obwohl das Bild mehrere Jahrhunderte alt war, hatte Carlisle – der blonde Engel – sich nicht verändert. Und ich erinnerte mich an die drei anderen, Carlisles Freunde aus frühen Jahren. Edward hatte das schöne Trio, zwei schwarzhaarig, einer schlohweiß, noch nie die Volturi genannt. Er nannte sie Aro, Caius und Marcus, die nächtlichen Schutzheiligen der Künste …
»Jedenfalls sollte man die Volturi nicht verärgern«, fuhr Edward fort und unterbrach damit meinen Gedankengang. »Es sei denn, man will sterben – oder was auch immer unsereins dann tut.« Er sagte es so ruhig, dass man fast hätte meinen können, die Vorstellung langweile ihn.
Meine Wut ging in Entsetzen über. Ich nahm sein marmornes Gesicht fest in die Hände.
»So was darfst du nie wieder denken, niemals!«, sagte ich. »Ganz egal, was mir zustoßen sollte, du hast nicht das Recht, dir etwas anzutun!«
»Ich werde dich nie wieder in Gefahr bringen, das ist also ein müßiges Thema.«
»Mich in Gefahr bringen! Wir waren uns doch einig, dass ich an der ganzen Sache schuld war!?« Jetzt wurde ich richtig wütend. »Wie kannst du nur so etwas denken?« Die Vorstellung, Edward könnte aufhören zu existieren, selbst wenn ich tot wäre, war unerträglich.
»Was würdest du denn tun, wenn es umgekehrt wäre?«, fragte er.
»Das kann man nicht vergleichen.«
Er schien den Unterschied nicht zu verstehen. Er lachte in sich hinein.
»Und wenn dir wirklich etwas zustoßen würde?« Bei dem bloßen Gedanken wurde ich blass. »Würdest du dann wollen, dass ich auch sterbe?«
Der Schmerz spiegelte sich in seinem schönen Gesicht.
»Ich glaube, ich verstehe, was du meinst … ein wenig«, gab er zu. »Doch was sollte ich ohne dich tun?«
»Dasselbe, was du getan hast, bevor ich gekommen bin und dein Leben durcheinandergebracht habe.«
Er seufzte. »Als ob das so einfach wäre.«
»Das sollte es sein. So interessant bin ich nun wirklich nicht.«
Er wollte widersprechen, doch dann ließ er es auf sich beruhen. »Ein müßiges Thema«, sagte er wieder. Plötzlich setzte er sich ordentlich hin und schob mich zur Seite, so dass wir uns nicht mehr berührten.
»Charlie?«, fragte ich.
Edward lächelte. Kurz darauf hörte ich, wie der Streifenwagen in die Einfahrt fuhr. Ich nahm Edwards Hand und hielt sie ganz fest. So viel konnte man meinem Vater schon zumuten.
Charlie kam mit einer Pizzaschachtel herein.
»Hallo, ihr zwei.« Er grinste mich an. »Ich dachte mir, an deinem Geburtstag hättest du bestimmt gern mal eine Pause vom Kochen und Geschirrspülen. Hunger?«
»O ja. Danke, Dad.«
Wir folgten ihm in die Küche.
Charlie sagte nichts zu Edwards offensichtlichem Mangel an Appetit. Er war es gewohnt, dass Edward das Abendessen ausließ.
»Haben Sie etwas dagegen, wenn ich Bella heute Abend entführe?«, fragte Edward, als Charlie und ich aufgegessen hatten.
Ich schaute Charlie hoffnungsvoll an. Vielleicht stellte er sich vor, dass man den Geburtstag zu Hause mit der Familie verbrachte – das hier war mein erster Geburtstag bei ihm, der erste Geburtstag, seit meine Mutter Renée wieder geheiratet hatte und nach Florida gezogen war. Ich wusste also nicht, was für Vorstellungen er hatte.
»Kein Problem – die Mariners spielen heute Abend gegen die Sox«, sagte Charlie, und meine Hoffnung schwand. »Ich könnte dir also sowieso keine Gesellschaft leisten … Hier.« Er nahm die Kamera, die er mir auf Renées Empfehlung geschenkt hatte (weil ich ja Fotos brauchte, mit denen ich das Album füllen konnte), und warf sie mir zu.
Er hätte es besser wissen sollen – ich war noch nie berühmt für meine Geschicklichkeit. Die Kamera glitt mir aus den Händen und wollte schon zu Boden trudeln. Edward fing sie gerade noch rechtzeitig auf, bevor sie auf den Linoleumboden knallen konnte.
»Gut reagiert«, sagte Charlie. »Wenn die Cullens heute Abend etwas Besonderes organisieren, musst du Fotos machen, Bella. Du kennst ja deine Mutter – sie will die Bilder bestimmt schneller sehen, als du fotografieren kannst.«
»Gute Idee, Charlie«, sagte Edward und reichte mir die Kamera.
Ich richtete die Kamera auf Edward und schoss das erste Foto. »Sie funktioniert.«
»Super. Und grüß Alice von mir. Sie war lange nicht mehr hier.« Charlie verzog den Mund.
»Drei Tage, Dad«, sagte ich. Charlie hatte einen Narren an Alice gefressen. Seit dem letzten Frühjahr war das so, als sie mir in der anstrengenden Zeit nach dem Unfall geholfen hatte. Charlie würde ihr immer dankbar dafür sein, dass sie ihn davor bewahrt hatte, seiner fast erwachsenen Tochter beim Duschen helfen zu müssen. »Ich werd’s ihr ausrichten.«
»Na dann viel Spaß heute Abend .« Das war deutlich. Charlie machte sich schon auf den Weg ins Wohnzimmer, wo der Fernseher stand.
Edward lächelte triumphierend, nahm meine Hand und zog mich aus der Küche. Als wir bei meinem Wagen ankamen, hielt er mir wieder die Beifahrertür auf, und diesmal widersprach ich nicht. Im Dunkeln hatte ich immer noch Mühe, die versteckte Abzweigung zu seinem Haus zu finden.
Edward fuhr Richtung Norden durch Forks. Er ärgerte sich sichtlich darüber, dass die Geschwindigkeit meines prähistorischen Chevys begrenzt war. Als Edward ihn über achtzig trieb, röhrte der Motor noch lauter.
»Keine Hektik«, warnte ich ihn.
»Weißt du, was dir gefallen würde? Ein schönes kleines Audi Coupé. Sehr leise, starker Motor …«
»Mit meinem Transporter ist alles in Ordnung. Und apropos unnötige Ausgaben, ich hoffe sehr für dich, dass du kein Geld für Geburtstagsgeschenke ausgegeben hast.«
»Keinen Cent«, sagte er treuherzig.
»Dann ist es ja gut.«
»Kannst du mir einen Gefallen tun?«
»Kommt drauf an.«
Er seufzte, sein schönes Gesicht wurde ernst. »Bella, der letzte richtige Geburtstag, den bei uns jemand hatte, war der von Emmett 1935. Sei nachsichtig mit uns und nimm dich heute Abend ein bisschen zusammen. Sie sind alle furchtbar aufgeregt.«
Ich erschrak immer ein wenig, wenn er mit so was anfing. »Okay, ich werd mich beherrschen.«
»Es ist wohl besser, wenn ich dich warne …«
»O ja, ich bitte darum.«
»Wenn ich sage, sie sind alle aufgeregt … dann meine ich wirklich alle.«
»Alle?«, brachte ich mühsam heraus. »Ich dachte, Emmett und Rosalie sind in Afrika.« In Forks glaubte man, die ältesten Cullens seien in diesem Jahr nach Dartmouth aufs College gegangen, aber ich wusste es besser.
»Emmett wollte unbedingt kommen.«
»Aber … Rosalie?«
»Ich weiß, Bella. Mach dir keine Sorgen, sie wird sich benehmen.«
Ich gab keine Antwort. So einfach war es nicht, sich keine Sorgen zu machen. Im Gegensatz zu Alice konnte Edwards andere »Adoptivschwester«, die goldblonde, wunderschöne Rosalie, mich nicht besonders gut leiden. Genau genommen war das Gefühl noch etwas stärker als bloße Abneigung. Für Rosalie war ich ein unwillkommener Eindringling in das geheime Leben ihrer Familie.
Ich hatte schreckliche Schuldgefühle, denn ich schrieb es mir zu, dass Rosalie und Emmett so lange fort waren. Auf der anderen Seite war ich insgeheim froh, Rosalie nicht sehen zu müssen. Emmett dagegen, Edwards witzigen, bärenhaften Bruder, vermisste ich sehr wohl. Er war in vielerlei Hinsicht wie der große Bruder, den ich mir immer gewünscht hatte … nur sehr viel gefährlicher.
Edward beschloss, das Thema zu wechseln. »Also, wenn ich dir keinen Audi schenken darf, gibt es nicht vielleicht irgendwas anderes, das du dir zum Geburtstag wünschst?«
»Du weißt, was ich mir wünsche«, flüsterte ich.
Er runzelte die marmorne Stirn. Wahrscheinlich bereute er jetzt, dass er das Thema gewechselt hatte.
Ich hatte das Gefühl, dass wir darüber heute schon mehrfach gestritten hatten.
»Nicht heute Abend, Bella. Bitte.«
»Tja, vielleicht erfüllt Alice mir ja meinen Wunsch.«
Edward grollte – ein tiefer, drohender Laut. »Dies wird nicht dein letzter Geburtstag sein, Bella«, schwor er.
»Das ist gemein!«
Ich glaubte zu hören, wie er mit den Zähnen knirschte.
Jetzt fuhren wir auf das Haus zu. Helles Licht schien aus allen Fenstern in den unteren beiden Stockwerken. Unterm Dach der Veranda hing eine lange Reihe leuchtender japanischer Laternen und tauchte die riesigen Zedern, die das Haus umgaben, in einen warmen Glanz. Große Blumenschalen – rosa Rosen – standen zu beiden Seiten der Eingangstreppe.
Ich stöhnte.
Edward atmete ein paarmal tief ein und aus, um sich zu beruhigen. »Das ist eine Geburtstagsparty«, erinnerte er mich. »Versuch, kein Spielverderber zu sein.«
»Klar«, murmelte ich.
Er ging um den Wagen herum, öffnete mir die Tür und reichte mir die Hand.
»Darf ich dich mal was fragen?«
Er wartete misstrauisch.
»Wenn ich den Film entwickele«, sagte ich und spielte mit der Kamera in meinen Händen, »bist du dann auf den Fotos drauf?«
Edward prustete los. Er half mir aus dem Wagen und führte mich die Treppe hinauf. Als er die Tür öffnete, lachte er immer noch.
Sie erwarteten uns alle in dem riesigen weißen Wohnzimmer; als ich zur Tür hereinkam, riefen sie laut im Chor: »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Bella!« Ich wurde rot und schaute zu Boden. Irgendjemand, vermutlich Alice, hatte überall rosa Kerzen und unzählige Kristallschalen mit Hunderten von Rosen hingestellt. Neben Edwards Flügel stand ein Tisch mit weißem Tischtuch, darauf standen eine rosa Geburtstagstorte, noch mehr Rosen, ein Stapel Glasteller und ein kleiner Haufen silbern verpackter Geschenke.
Es war noch tausendmal schlimmer, als ich es mir vorgestellt hatte.
Edward, der meine Qual spürte, legte mir aufmunternd einen Arm um die Taille und gab mir einen Kuss aufs Haar.
Edwards Eltern, Carlisle und Esme – unglaublich jugendlich und reizend wie immer –, waren die Ersten hinter der Tür. Esme umarmte mich leicht, ihr weiches, karamellfarbenes Haar streifte meine Wange, als sie mich auf die Stirn küsste. Dann legte Carlisle mir einen Arm um die Schultern.
»Tut mir leid, Bella«, flüsterte er für alle hörbar. »Alice war nicht zu bremsen.«
Rosalie und Emmett standen hinter den beiden. Rosalie lächelte nicht, aber immerhin schaute sie mich nicht hasserfüllt an. Auf Emmetts Gesicht lag ein breites Grinsen. Wir hatten uns seit Monaten nicht gesehen; ich hatte vergessen, wie unbeschreiblich schön Rosalie war – es tat fast weh, sie anzusehen. Und war Emmett immer so … groß und breit gewesen?
»Du siehst noch genauso aus wie vorher«, sagte Emmett mit gespielter Enttäuschung. »Ich hatte mit irgendeiner Veränderung gerechnet, aber du bist rotgesichtig wie eh und je.«
»Vielen Dank, Emmett«, sagte ich und wurde noch röter.
Er lachte. »Ich muss mal kurz austreten« – er zwinkerte Alice verschwörerisch zu –, »stell bitte nichts an, solange ich weg bin.«
»Ich werd’s versuchen.«
Alice ließ Jaspers Hand los und stürmte auf mich zu, ihre Zähne funkelten im Licht. Auch der große, blonde Jasper, der an einer Säule unten an der Treppe lehnte, lächelte, doch er hielt Abstand. Ich dachte, er hätte in den Tagen, die wir zusammen eingesperrt in Phoenix verbringen mussten, seine Abneigung gegen mich überwunden. Doch als er mich nicht mehr beschützen musste, war er sofort wieder zu seinem früheren Verhalten zurückgekehrt: Er ging mir so weit wie möglich aus dem Weg. Ich wusste, dass das nicht persönlich gemeint war, es war nur eine Vorsichtsmaßnahme, und ich versuchte, mir sein Verhalten nicht zu Herzen zu nehmen. Jasper fiel es schwerer als den anderen, sich an die Ernährungsweise der Cullens zu halten; er konnte dem Geruch menschlichen Bluts kaum widerstehen – er hatte noch nicht so viel Übung.
»Jetzt geht’s ans Geschenkeauspacken«, verkündete Alice. Sie schob ihre kühle Hand unter meinen Ellbogen und zog mich zu dem Tisch mit der Torte und den glänzenden Geschenken.
Ich setzte eine übertriebene Leidensmiene auf. »Alice, ich hatte dir doch gesagt, dass ich nichts haben will …«
»Aber ich hab nicht auf dich gehört«, unterbrach sie mich fröhlich. »Mach schon auf.« Sie nahm mir die Kamera aus der Hand und reichte mir stattdessen ein großes würfelförmiges Päckchen.
Das Päckchen war so leicht, als wäre es leer. Auf einem Zettel obendrauf stand, dass es von Emmett, Rosalie und Jasper kam. Unsicher riss ich das Papier ab und starrte dann auf die Schachtel darin.
Es war irgendetwas Elektronisches, mit vielen Zahlen im Namen. Ich öffnete die Schachtel und hoffte, aus dem Inhalt schlauer zu werden. Aber die Schachtel war tatsächlich leer.
»Ähm … danke.«
Rosalie brachte tatsächlich ein Lächeln zu Stande. Jasper lachte. »Das ist eine Stereoanlage für deinen Transporter«, erklärte er. »Emmett baut sie gerade ein, damit du sie nicht umtauschen kannst.«
Alice war mir immer einen Schritt voraus.
»Danke, Jasper, danke, Rosalie«, sagte ich und grinste, als ich daran dachte, wie Edward heute Nachmittag über mein Radio gemeckert hatte – offenbar alles inszeniert. »Danke, Emmett!«, rief ich lauter.
Ich hörte sein dröhnendes Lachen von meinem Transporter her und jetzt musste ich selber lachen.
»Jetzt mach das von Edward und mir auf«, sagte Alice. Sie war so aufgeregt, dass ihre Stimme wie ein hohes Trällern klang. Sie hielt ein kleines, flaches Päckchen in der Hand.
Ich drehte mich zu Edward um und warf ihm einen bösen Blick zu. »Du hattest es versprochen.«
Ehe Edward etwas sagen konnte, kam Emmett hereingesprungen. »Gerade noch rechtzeitig!«, jubelte er. Er drängte sich hinter Jasper, der näher gekommen war als sonst, um besser sehen zu können.
»Ich hab keinen Cent ausgegeben«, versicherte Edward. Er strich mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Meine Haut brannte von seiner Berührung.
Ich holte tief Luft und wandte mich an Alice. »Dann gib schon her«, sagte ich seufzend.
Emmett kicherte.
Ich nahm das Päckchen, sah Edward an und verdrehte die Augen. Ich ging mit einem Finger unter den Rand des Papiers und fuhr mit einem Ruck unter dem Klebestreifen entlang.
»Verflucht«, murmelte ich, als ich mir den Finger am Papier schnitt; ich zog es weg, um mir die Wunde anzusehen. Ein kleiner Blutstropfen quoll aus dem winzigen Schnitt.
Dann ging alles ganz schnell.
»Nein!«, brüllte Edward.
Er warf sich auf mich und schleuderte mich über den Tisch. Der Tisch fiel um und ich mit ihm. Alles wurde über den Boden verstreut, die Torte und die Geschenke, die Blumen und Teller. Ich landete in einem Durcheinander von zerbrochenem Kristall.
Jasper stürzte sich auf Edward, und es klang wie ein Steinschlag.
Da war noch ein anderes Geräusch, ein fürchterliches Knurren, das tief aus Jaspers Brust zu kommen schien. Jasper versuchte sich an Edward vorbeizudrängen, nur knapp neben Edwards Gesicht schnappte er mit den Zähnen.
Im nächsten Moment umfasste Emmett Jasper von hinten und hielt ihn mit festem Stahlgriff umklammert, aber Jasper wehrte sich, den wilden, leeren Blick nur auf mich gerichtet.
Abgesehen von dem Schreck spürte ich auch Schmerzen. Ich war neben dem Flügel zu Boden gestürzt – die Arme instinktiv ausgestreckt, um mich abzufangen –, direkt in die spitzen Scherben hinein. Erst jetzt spürte ich den brennenden, stechenden Schmerz vom Handgelenk bis zur Armbeuge.
Benommen schaute ich von dem hellroten Blut auf, das aus meinem Arm strömte – und traf auf die fiebrigen Blicke von sechs ausgehungerten Vampiren.
Nadelstiche
Carlisle bewahrte als Einziger die Ruhe. Seine leise, gebieterische Stimme sprach von jahrhundertelanger Erfahrung in der Notaufnahme.
»Emmett, Rose, bringt Jasper hinaus.«
Emmett lächelte ausnahmsweise einmal nicht und nickte. »Komm, Jasper.«
Jasper wehrte sich gegen Emmetts unnachgiebigen Griff, er wand sich und versuchte nun, seinen Bruder zu erwischen. Er sah immer noch nicht zurechnungsfähig aus.
Edward war kalkweiß, als er herumfuhr und sich schützend über mich warf. Zwischen den Zähnen entfuhr ihm ein tiefes, warnendes Knurren. Ich war mir sicher, dass er nicht atmete.
Ein eigenartig selbstgefälliger Ausdruck lag auf Rosalies überirdisch schönem Gesicht. Sie stellte sich vor Jasper, wobei sie eine sichere Entfernung zu seinen Zähnen wahrte, und half Emmett, ihn durch die Glastür zu bugsieren, die Esme ihnen aufhielt, eine Hand vor Mund und Nase gepresst.
Scham spiegelte sich in Esmes herzförmigem Gesicht. »Es tut mir so leid, Bella«, rief sie, als sie den anderen in den Garten folgte.
»Lass mich durch, Edward«, murmelte Carlisle.
Eine Sekunde verging, dann nickte Edward langsam und nahm eine entspanntere Haltung ein.
Carlisle kniete neben mir nieder und beugte sich über meinen Arm, um ihn zu untersuchen. Ich merkte, dass mein Gesicht vor Schreck erstarrt war, und versuchte meine Züge zu entspannen.
»Hier, Carlisle«, sagte Alice und reichte ihm ein Handtuch.
Er schüttelte den Kopf. »Zu viele Splitter in der Wunde.« Er langte zum Tisch und riss einen langen schmalen Streifen von der Tischdecke ab. Damit umwickelte er meinen Arm über dem Ellbogen, um das Blut zu stoppen. Vom Geruch des Bluts wurde mir schwindelig und in meinen Ohren rauschte es.
»Bella«, sagte Carlisle sanft. »Soll ich dich ins Krankenhaus fahren oder dich hier behandeln?«
»Hier, bitte«, flüsterte ich. Wenn er mich ins Krankenhaus brachte, könnte ich das nicht vor Charlie geheim halten.
»Ich hole dir deine Tasche«, sagte Alice.
»Komm, wir bringen sie zum Küchentisch«, sagte Carlisle zu Edward.
Mühelos hob Edward mich hoch, während Carlisle weiter auf meinen Arm drückte.
»Wie geht es dir, Bella?«, fragte Carlisle.
»Ganz gut.« Meine Stimme war einigermaßen fest, und darüber war ich froh.
Edwards Gesicht war wie versteinert.
Alice war da. Carlisles schwarze Tasche stand schon auf dem Tisch, und eine kleine, aber lichtstarke Schreibtischlampe brannte. Edward drückte mich sanft auf einen Stuhl, und Carlisle zog sich einen weiteren heran. Er machte sich sofort an die Arbeit.
Edward stand schützend über mir, er atmete immer noch nicht.
»Geh doch, Edward«, sagte ich leise.
»Ich werde schon damit fertig«, sagte er. Doch sein Kiefer war angespannt, und seine Augen brannten, weil er gegen ein Verlangen ankämpfte, das bei ihm noch viel stärker war als bei den anderen.
»Du brauchst hier nicht den Helden zu spielen«, sagte ich. »Carlisle kann mich auch ohne deine Hilfe verarzten. Geh lieber an die frische Luft.«
Ich zuckte zusammen, als Carlisle irgendetwas mit meinem Arm machte und ich einen stechenden Schmerz verspürte.
»Ich bleibe«, sagte Edward entschlossen.
»Warum bist du so masochistisch?«, murmelte ich.
Jetzt mischte Carlisle sich ein. »Edward, du könntest dich ebenso gut auf die Suche nach Jasper machen, sonst ist er bald zu weit weg. Sicher ist er wütend auf sich selbst, und ich bezweifle, dass er im Augenblick auf jemand anders als dich hören wird.«
»Ja«, stimmte ich sofort ein. »Such Jasper.«
»Genau, mach dich mal nützlich«, fügte Alice hinzu.
Edwards Augen wurden schmal, als wir so auf ihn einstürmten, dann nickte er kurz und rannte schnell durch die Hintertür nach draußen. Ich war mir sicher, dass er seit meinem Missgeschick kein einziges Mal geatmet hatte.
Ein dumpfes, taubes Gefühl breitete sich in meinem Arm aus. Zwar löschte es den stechenden Schmerz aus, doch jetzt erinnerte ich mich wieder an die Schnittwunde, und ich konzentrierte mich voll auf Carlisles Gesicht, um mir nicht vorzustellen, was seine Hände machten. Sein Haar leuchtete golden im Lampenlicht, während er sich über meinen Arm beugte. Ich spürte ein leichtes Unwohlsein in der Magengrube, aber ich wollte mich auf keinen Fall so zimperlich anstellen wie sonst. Es tat nicht weh, ich merkte nur ein leichtes Ziehen, das ich zu ignorieren versuchte. Kein Grund für Übelkeit, schließlich war ich kein kleines Kind mehr.
Hätte Alice nicht direkt hinter Carlisle gestanden, hätte ich nicht bemerkt, dass sie aufgab und sich aus dem Zimmer stahl. Mit einem kleinen entschuldigenden Lächeln auf den Lippen verschwand sie durch die Küchentür.
»Na, das wären dann alle«, sagte ich seufzend. »Ein Zimmer leer fegen kann ich immerhin.«
»Es ist nicht deine Schuld«, versuchte Carlisle mich zu trösten. Er lachte in sich hinein. »Das hätte jedem passieren können.«
»Hätte«, sagte ich. »Aber normalerweise passiert so was nur mir.«
Er lachte wieder.
Seine Gelassenheit war verblüffend, zumal sie im völligen Gegensatz zu der Reaktion der anderen stand. Ich konnte keine Spur von Nervosität in seinem Gesicht ausmachen. Seine Bewegungen bei der Arbeit waren schnell und sicher. Das einzige Geräusch außer unserem ruhigen Atem war das leise Pling, Pling, als die winzigen Glassplitter einer nach dem anderen auf den Tisch fielen.
»Wie schaffst du das?«, wollte ich wissen. »Selbst Alice und Esme …« Ich ließ den Satz in der Luft hängen und schüttelte verwundert den Kopf. Obwohl die anderen der üblichen Ernährungsweise von Vampiren ebenso radikal abgeschworen hatten wie Carlisle, war er doch der Einzige, der den Geruch meines Bluts ertragen konnte, ohne unter der enormen Versuchung zu leiden. Garantiert war die Situation für ihn sehr viel schwieriger, als es den Anschein hatte.
»Jahrelange Übung«, sagte er. »Ich nehme den Geruch kaum noch wahr.«
»Glaubst du, es wäre schwerer, wenn du länger nicht im Krankenhaus wärst und nichts mit Blut zu tun hättest?«
»Vielleicht.« Er zuckte die Schultern, aber seine Hände blieben ruhig. »Ich hatte noch nie das Bedürfnis nach einem längeren Urlaub.« Er lächelte mich strahlend an. »Dafür macht mir meine Arbeit zu viel Spaß.«
Pling, pling, pling. Ich war erstaunt, wie viele Splitter in meinem Arm steckten. Ich hätte gern einmal kurz geguckt, wie das Häufchen anwuchs, aber ich wollte mich ja nicht übergeben, und da wäre das auf jeden Fall kontraproduktiv gewesen.
»Was macht dir daran denn Spaß?«, fragte ich. Mir kam das absurd vor – wie viele Jahre Kampf und Selbstverleugnung musste es ihn gekostet haben, bis er diese Arbeit so mühelos ertragen konnte! Außerdem wollte ich, dass er weiterredete; die Unterhaltung lenkte mich von dem mulmigen Gefühl im Magen ab.
Als er antwortete, war sein Blick ruhig und nachdenklich. »Hmm. Das Schönste ist für mich, wenn meine … besonderen Fähigkeiten es mir erlauben, jemanden zu retten, der sonst verloren wäre. Es tut gut zu wissen, dass ich dazu beitragen kann, das Leben mancher Menschen zu verbessern. Und mein Geruchssinn ist bisweilen sogar sehr hilfreich bei der Diagnose.« Er verzog einen Mundwinkel zu einem halben Lächeln.
Während er meinen Arm noch einmal ganz genau untersuchte, um sicherzugehen, dass er alle Splitter entfernt hatte, grübelte ich über seine Worte nach. Dann kramte er in seiner Tasche nach weiteren Instrumenten und ich versuchte nicht an Nadel und Faden zu denken.
»Du gibst dir große Mühe, etwas wiedergutzumachen, an dem du gar nicht schuld bist«, sagte ich, während ich ein neues schmerzhaftes Ziehen an der Haut spürte. »Ich meine, du wolltest doch gar nicht so sein.«
»Ich wüsste nicht, dass ich versuche etwas wiedergutzumachen«, widersprach er. »Ich musste mich einfach entscheiden, was ich mit dem, was mir gegeben war, anfangen wollte, so ist das im Leben.«
»Das klingt aber zu einfach.«
Er untersuchte meinen Arm noch einmal. »So«, sagte er und durchtrennte einen Faden. »Fertig.« Er strich mit einem überdimensionierten Wattestäbchen, das mit einer sirupfarbenen Flüssigkeit getränkt war, gründlich über die Wunde. Es roch merkwürdig und mir wurde schwindlig. Der Sirup brannte auf der Haut.
»Jedenfalls am Anfang«, bohrte ich nach, während er ein langes Stück Mull auf die Wunde drückte und festklebte. »Wie bist du überhaupt darauf gekommen, einen anderen Weg einzuschlagen als den naheliegendsten?«
Seine Lippen formten sich zu einem feinen Lächeln. »Hat Edward dir die Geschichte nicht erzählt?«
»Doch. Aber ich versuche zu verstehen, was du gedacht hast …«
Plötzlich war seine Miene wieder ernst, und ich fragte mich, ob er an dasselbe dachte wie ich. Daran, was ich wohl denken würde, wenn ich in derselben Situation wäre – ich weigerte mich, war zu denken.
»Du weißt, dass mein Vater ein Geistlicher war«, sagte er nachdenklich, während er den Tisch zweimal gründlich mit nassem Mull abwischte. Der Geruch von Alkohol brannte mir in der Nase. »Er hatte eine recht strenge Weltanschauung, die ich bereits vor meiner Verwandlung in Zweifel zu ziehen begann.« Carlisle sammelte den blutigen Mull und die Glassplitter in einer leeren Kristallschale. Selbst als er ein Streichholz anzündete, begriff ich noch nicht, was er vorhatte. Dann ließ er das Streichholz auf den alkoholgetränkten Stoff fallen. Eine kleine Stichflamme schoss empor, und ich zuckte zusammen.
»Entschuldigung«, sagte er. »Das sollte genügen … Mit dem Glauben, wie mein Vater ihn pflegte, hatte ich also nie übereingestimmt. Und doch hat mich in den nahezu vierhundert Jahren seit meiner Geburt nichts je daran zweifeln lassen, dass es Gott in der einen oder anderen Form gibt. Nicht einmal meine eigene Existenz.«
Ich tat so, als würde ich meinen Verband betrachten, um meine Überraschung über die Wendung des Gesprächs zu verbergen. Religion hätte ich in Anbetracht der Umstände am wenigsten erwartet. In meinem eigenen Leben spielte der Glaube eigentlich keine Rolle. Charlie betrachtete sich als Lutheraner, weil seine Eltern das auch gewesen waren, aber sonntags hielt er Gottesdienst am Fluss mit einer Angel in der Hand. Renée versuchte es hin und wieder mit der Kirche, aber ebenso wie ihre flüchtigen Affären mit Tennis, Töpfern, Yoga und Französisch war diese Laune auch schon wieder vorüber, ehe ich sie mitbekommen hatte.
»Das alles klingt aus dem Munde eines Vampirs gewiss etwas absurd.« Er grinste, weil er wusste, dass es mich immer noch schockierte, wenn sie das Wort so beiläufig benutzten. »Doch ich hoffe, dass dieses Leben noch einen Sinn hat, selbst für uns. Es ist sehr gewagt, das gebe ich zu«, fuhr er leichthin fort. »Wir sind vermutlich ohnehin verdammt. Doch auch, wenn es vielleicht töricht ist, so hoffe ich, dass man uns den Versuch bis zu einem gewissen Grad anrechnen wird.«
»Ich glaube nicht, dass das töricht ist«, murmelte ich. Ich konnte mir niemanden vorstellen, Gott eingeschlossen, der von Carlisle nicht beeindruckt wäre. Außerdem könnte ich nur einen Himmel akzeptieren, zu dem auch Edward Zutritt hätte. »Und das glaubt bestimmt auch sonst keiner.«
»Ehrlich gesagt bist du die Allererste, die meiner Meinung ist.«
»Sehen die anderen das nicht so?«, fragte ich überrascht und dachte dabei nur an einen Bestimmten.
Wieder erriet Carlisle, in welche Richtung meine Gedanken gingen. »Edward stimmt mir bis zu einem bestimmten Punkt zu. Es gibt einen Gott und einen Himmel … und eine Hölle. Aber er glaubt nicht, dass es für unseresgleichen ein Leben nach dem Tod gibt.« Carlisle sprach sehr leise, er starrte aus dem großen Fenster über dem Waschbecken in die Finsternis. »Verstehst du, er glaubt, wir hätten unsere Seele verloren.«
Sofort dachte ich an Edwards Worte von heute Nachmittag: Es sei denn, man will sterben – oder was auch immer unsereins dann tut. Die Glühbirne über meinem Kopf wurde eingeschaltet.
»Darum geht es ihm eigentlich, oder?«, sagte ich. »Deshalb macht er solche Probleme, was mich angeht.«
Carlisle sprach langsam. »Ich schaue ihn an, meinen … Sohn. Seine Kraft, seine Güte, was für einen Geist er versprüht … und das bestärkt mich umso mehr in meiner Hoffnung und meinem Glauben. Es ist undenkbar, dass für jemanden wie Edward danach nichts mehr kommen sollte.«
Ich nickte heftig.
»Aber wenn ich glauben würde, was er glaubt …« Sein Blick war unergründlich, als er mich ansah. »Wenn du das glauben würdest – könntest du ihm seine Seele rauben?«
Dass er die Frage so stellte, machte eine Antwort unmöglich. Hätte er gefragt, ob ich meine Seele für Edward aufs Spiel setzen würde, wäre die Antwort einfach gewesen. Aber würde ich Edwards Seele aufs Spiel setzen? Ich verzog unglücklich den Mund. Das war eine gemeine Frage.
»Du siehst, wo das Problem liegt.«
Ich schüttelte den Kopf und merkte, dass ich das Kinn eigensinnig vorgereckt hatte.
Carlisle seufzte.
»Es ist meine Entscheidung«, beharrte ich.
»Es ist auch die seine.« Er hob die Hand, als ich widersprechen wollte. »Er trägt die Verantwortung, wenn er dir das antut.«
»Er ist nicht der Einzige, der es machen kann.« Ich sah Carlisle forschend an.
Er lachte, und die ernste Stimmung war augenblicklich durchbrochen. »O nein! Das musst du schon mit ihm aushandeln.« Aber dann seufzte er. »Das ist die Frage, die ich mir nie eindeutig beantworten kann. Ich glaube, dass ich aus dem, was mir zur Verfügung stand, größtenteils das Beste gemacht habe. Aber war es richtig, die anderen zu diesem Leben zu verdammen? Das vermag ich nicht zu sagen.«
Ich gab keine Antwort. Ich stellte mir vor, wie mein Leben aussähe, wenn Carlisle der Versuchung widerstanden hätte, sein einsames Leben zu verändern … und schauderte.
»Mein Entschluss ist Edwards Mutter geschuldet.« Carlisles Stimme war jetzt kaum mehr als ein Flüstern. Er starrte zum Fenster hinaus ins Leere.
»Seiner Mutter?« Wenn ich Edward nach seinen Eltern fragte, sagte er immer nur, dass sie vor langer Zeit gestorben seien und dass er sich kaum noch an sie erinnern könnte. Jetzt begriff ich, dass Carlisle sich sehr wohl an sie erinnerte, obwohl er sie nur kurz gekannt hatte.
»Ja. Sie hieß Elizabeth. Elizabeth Masen. Sein Vater, Edward senior, kam im Krankenhaus nicht mehr zu sich. Er starb an der ersten Grippewelle. Doch Elizabeth war fast bis zum Ende bei vollem Bewusstsein. Edward ähnelt ihr sehr – ihre Haare hatten denselben eigenartigen Bronzeton, und ihre Augen waren genauso grün wie seine.«
»Er hatte grüne Augen?«, murmelte ich und versuchte es mir vorzustellen.
»Ja …« Carlisles Blick war jetzt hundert Jahre weit weg. »Elizabeth war wahnsinnig vor Sorge um ihren Sohn. Sie nahm ihre letzten Kräfte zusammen, um ihn vom Krankenbett aus zu pflegen. Ich hatte gedacht, er würde vor ihr sterben, er war so viel schlimmer dran. Doch dann ging es ganz schnell mit ihr zu Ende. Es war kurz nach Sonnenuntergang, und ich kam, um die Ärzte abzulösen, die den ganzen Tag gearbeitet hatten. In dieser Zeit fiel es mir besonders schwer, mich zu verstellen – es gab so viel zu tun, und ich hätte keine Ruhepausen gebraucht. Es war mir unerträglich, nach Hause zu gehen, mich im Dunkeln zu verstecken und so zu tun, als schliefe ich, während so viele starben.
Als Erstes sah ich nach Elizabeth und ihrem Sohn. Ich hatte sie ins Herz geschlossen – das ist immer gefährlich, wenn man bedenkt, wie zerbrechlich Menschen sind. Ich sah sofort, dass es schlecht um sie stand. Das Fieber tobte und ihr Körper war zu schwach, um noch länger zu kämpfen. Doch als sie von ihrem Bett zu mir aufschaute, sah sie gar nicht schwach aus.
›Retten Sie ihn!‹, befahl sie mit heiserer Stimme – mehr ließen ihre Kräfte nicht zu.
›Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht‹, versprach ich und nahm ihre Hand. Das Fieber war so hoch, dass sie vermutlich nicht mehr spürte, wie unnatürlich kalt die meine war. Für sie fühlte sich jetzt alles kalt an.
›Sie müssen‹, drängte sie und klammerte sich so fest an meine Hand, dass ich mich fragte, ob sie diese Krise nicht vielleicht doch überstehen konnte. Ihre Augen waren hart wie Stein, wie Smaragde. ›Sie müssen alles tun, was in Ihrer Macht steht. Was andere nicht tun können, das müssen Sie für meinen Edward tun.‹
Sie machte mir Angst. Sie durchbohrte mich mit ihrem Blick und einen Augenblick war ich mir sicher, dass sie mein Geheimnis durchschaut hatte. Dann übermannte das Fieber sie und sie kam nicht wieder zu Bewusstsein. Eine Stunde nach ihrer Bitte starb sie.