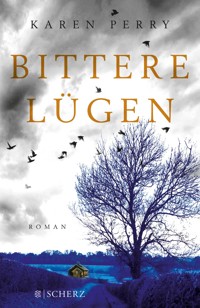
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Man hat ihnen das Liebste genommen. Aber was, wenn es die WAHRHEIT, die sie kannten, so nie gab? Psychospannung aus Irland – voll emotionaler Wucht, hintergründig, atemlos In Sekundenbruchteilen liegt ihr Leben in Schutt und Asche. Harry und Robin haben bei einem schrecklichen Erdbeben ihren dreijährigen Sohn Dillon verloren. Auch fünf Jahre später überschattet der unfassbare Verlust, das Gefühl der Ohnmacht und Schuld jede Minute ihres Zusammenlebens. Bis zu dem kalten Wintertag, als Harry denkt, Dillon in Dublin auf der Straße gesehen zu haben. Seither ist er von dem Gedanken besessen, dass sein Sohn noch leben könnte. Und er ist bereit, bis zum Äußersten zu gehen, um die ganze Wahrheit ans Licht zu bringen. Mit unvorstellbaren Folgen … »Dieses Buch werden Sie nie mehr vergessen – ›Bittere Lügen‹ ist fesselndes Psychodrama und beklemmende emotionale Reise in einem.« Tana French
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Ähnliche
Karen Perry
Das Ende der Wahrheit
Roman
Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
FISCHER E-Books
Inhalt
Prolog
Tanger 2005
Ein Gewitter zieht auf. Er spürt es an der seltsamen Stille, die in der Luft liegt. Nichts bewegt sich, keine Wäsche flattert, kein Windhauch streicht durch die schmalen Straßen von Tanger.
Über den Dächern, hinter den Wäscheleinen, die zwischen den Häusern gespannt sind, sieht er ein Stück Himmel. Es leuchtet sonderbar bläulich und ist durchzogen von Lichtschwaden, die fast aussehen wie Polarlichter.
Er rührt die warme Milch in der Tasse um, blinzelt und betrachtet weiter die sich wandelnden und unwirklichen Farben des Himmels.
Er legt den Löffel auf die Arbeitsplatte, wendet sich vom offenen Fenster ab und geht durch den Raum zu seinem Sohn, der mit hochkonzentriertem Gesicht ein Puzzle macht.
»Hier«, sagt sein Vater und hält ihm die Tasse hin.
Der Junge schaut nicht auf.
»Mach schon, Dillon. Trink.«
Der Junge sieht ihn an und verzieht das Gesicht.
»Nein, Daddy, ich mag nicht.«
Sein Vater hält ihm weiter die Tasse hin. Der Junge zögert, ehe er die Hand ausstreckt, und in diesem Moment spürt Harry ein ganz leises Pochen der Unentschlossenheit. Er ignoriert es und nickt dem Jungen aufmunternd zu. Der Junge nimmt die Tasse und trinkt mit langen, gemächlichen Schlucken. Ein kleines Milchrinnsal läuft ihm aus dem Mundwinkel, und sein Vater wischt es weg. Dillon schluckt ein letztes Mal und gibt die Tasse zurück. »Da, Daddy«, sagt er. »Fertig.«
Harry nimmt die Tasse und geht damit zur Spüle, um sie auszuwaschen. Am Boden der Tasse ist noch ein feiner Rest Pulver zu sehen. Er dreht den Hahn weiter auf und sieht zu, wie der Pulverrest nach oben steigt, aus der Tasse fließt und im Abfluss verschwindet. Dann füllt er einen Topf mit Wasser und stellt ihn auf den Herd. Das Gas lässt sich nur schwer entzünden, und er muss mehrmals den Reglerknopf und den Zündschalter drücken, bis die Flamme brennt.
Den Couscous hat er schon bereitgestellt. Als Nächstes gibt er eine Handvoll Rosinen in eine Schüssel. Eine halbvolle Flasche Brandy steht auf der Arbeitsplatte neben dem Olivenöl. Harry nimmt den Brandy und gießt ihn über die Rosinen. Ehe er den Verschluss wieder aufschraubt, hält er sich die Flaschenöffnung unter die Nase und inhaliert. Dann trinkt er einen schnellen, fast verstohlenen Schluck aus der Flasche, schraubt sie zu und stellt sie wieder neben das Olivenöl.
Er blickt erneut nach draußen auf die wechselnden Farben des Himmels. Er möchte sie seinem Sohn zeigen, tut es aber nicht. Dillon hat sein Puzzle fast fertig, wird schläfrig.
Harry wendet sich wieder seinen Essensvorbereitungen zu. Er gießt sich ein wenig Olivenöl in die rechte Hand und reibt damit das Wiegemesser ein. Er hackt Datteln, gibt sie in eine Schüssel und streicht mit dem Finger über die Messerklinge, ehe er die Aprikosen auf das Schneidebrett legt.
Die Straßen draußen vor dem Fenster sind ruhig. Normalerweise hört man um diese Tageszeit aus den Nachbarwohnungen die geschäftigen Geräusche von Menschen, die Abendessen kochen, doch heute sind da keine lauten Stimmen, ist da kein Geschirrklappern, kein Zischen von brutzelndem Fett, kein Geschrei von hungrigen Babys. Stille hat sich über diesen Teil der Welt gesenkt. Es ist, als hielten alle Bewohner von Tanger den Atem an.
Er dreht sich zu Dillon um. »Zeit fürs Bett.«
Sein Sohn widerspricht nicht, sondern nickt bloß vage. Harry hebt ihn hoch und trägt ihn in sein Zimmer. Er zieht den Jungen bis auf die Unterwäsche aus, legt ihn ins Bett und deckt ihn zu. Er streichelt ihm die Wange und drückt ihm einen Kuss auf die Stirn. »Schlaf schön, mein kleiner Prinz«, flüstert er, doch der Junge antwortet nicht. Er ist schon eingeschlafen.
Zurück in der Küche macht Harry sich einen Gin Tonic. Es war ein langer und anstrengender Tag. Die Hitze, die Bedürfnisse seines Sohnes und seine eigene Unfähigkeit, sich zu konzentrieren, das alles hat an ihm gezerrt, bis er sich in seiner eigenen Haut nicht mehr wohlfühlte.
Die Luft ist nach wie vor schwül, obwohl die Hitze sich gelegt hat. Jetzt, wo der Junge schläft, kommt er mit dem Kochen schneller voran. Es ist Robins Geburtstag, und er will sie mit einem besonderen Essen überraschen.
Er stellt den Backofen an, packt das Lammfleisch auf der Arbeitsplatte aus und würzt es mit grob gemahlenem Salz. Dann reibt er es mit Rosmarin und Oregano ein und schiebt den Braten in den Ofen. Während er das tut, wirft er einen Blick zum Himmel und fragt sich, wann der Wolkenbruch endlich losgeht.
Regen in Tanger kann biblische Ausmaße haben. Mitunter schüttet es tagelang wie aus Kübeln. Das ist eines der Dinge, die ihn und Robin am meisten überraschten, als sie vor fünf Jahren hierher zogen. Jetzt sehnt er sich nach so einem Regenguss, der die Luft reinigt und diese dumpfe, bedrückende Stimmung vertreibt.
Der Schmerz in seinem Kopf ist trotz des Gins nicht abgeklungen. Er wirft einen Blick auf die Uhr über dem Herd und füllt sein Glas nach.
Das Klingeln des Telefons lässt ihn zusammenzucken.
»Alles in Ordnung?«, fragt Robin.
»Ja. Dillon schläft, und ich bin beim Kochen.«
»Er schläft?«
Die Verwunderung in ihrer Stimme macht ihn nervös.
»Er war hundemüde.«
»Hör mal«, sagt sie dann, und ihr Tonfall verrät ihm, dass sie ihn um einen Gefallen bitten wird. »Simo ist krank geworden und früher nach Hause gegangen, deshalb habe ich Raul versprochen, etwas länger zu bleiben.«
»Aber du hast Geburtstag.«
»Ich komme höchstens zwei Stunden später, mehr nicht.«
Er schweigt.
»Ich werde noch Geburtstag haben, wenn ich nach Hause komme«, sagt sie.
Er leert sein Glas und gibt ihr recht, ja, sie wird noch Geburtstag haben, wenn sie nach Hause kommt.
Er verabschiedet sich, legt auf und macht sich noch einen Drink. Es wird sein letzter sein müssen, bis sie von der Arbeit kommt. Er will sich nicht betrinken und ihr den Abend verderben.
Seine Kopfschmerzen, das ungute Gefühl in der Luft, machen ihn heute schreckhaft wie eine Katze, und er sehnt sich nach Robins beruhigender Gegenwart. Aus irgendeinem Grund möchte er nicht allein sein. Also lenkt er sich ab, indem er Spielsachen wegpackt und Bücher aufsammelt und die Kissen wieder aufs Sofa legt.
Er räumt das Durcheinander auf dem Couchtisch weg und fegt den Fliesenboden. Die Wohnung wird wieder die alte, wieder ihr ordentliches Zuhause mit dem abgewetzten, aber bequemen Sofa, dem Perlenvorhang, der diesen Raum von der winzigen Küche trennt, der Ecke am Fenster, wo ein Stapel Leinwände an der Wand lehnt. Sogar der Holztisch, an dem sie essen, ist aufgeräumt. Harry ist sauer auf Robin, will aber trotzdem, dass ihr Geburtstag etwas Besonderes ist. Vielleicht hätte er Dillon nicht so früh zum Schlafen gebracht, wenn er gewusst hätte, dass sie später kommt.
Dennoch, er kämpft gegen seine Niedergeschlagenheit an und deckt den Tisch. Messer, Gabeln, Servietten, aber wo sind die Kerzen?
Er war heute auf dem Souk und hat vier weiße, unparfümierte Kerzen gekauft, einen safrangelben Leinenüberwurf für das Sofa und ein großes, kunstvoll mit filigranen Ornamenten verziertes Silbertablett. Das Tablett ist ein Geschenk für Robin, und er hat eine Stunde um den Preis gefeilscht, doch jetzt fällt ihm ein, dass er es zusammen mit den anderen Sachen bei Cosimo vergessen hat.
Er hatte gar nicht vorgehabt, zu Cosimo zu gehen. Es war ein spontaner Einfall gewesen. Fast augenblicklich hatte Harry bereut, dass er Dillon mitgenommen hatte. Cosimo war Kinder nicht gewohnt, schon gar nicht in seinem Haus. Dillon hatte sich gelangweilt und war quengelig geworden, während Harry und Cosimo sich unterhielten, und nach einer Weile hatte der Junge angefangen, Harry am Arm zu ziehen und laut zu jammern, so dass der Besuch abrupt damit endete, dass Harry Dillon kurzerhand auf den Arm nahm und wegtrug und seinen Freund in dankbarem Frieden zurückließ.
»Scheiße.« Harry überlegt, was er machen soll.
Am logischsten wäre es natürlich, Cosimo anzurufen. Aber Harry weiß, was das bedeuten würde: Cosimo würde es sich nicht nehmen lassen, die vergessenen Sachen vorbeizubringen, einen Drink für seine Mühe verlangen, und im Handumdrehen würden sie sich angeregt unterhalten – Cosimo würde es sich gemütlich machen, das Abendessen wäre vergessen und der Abend auf dem besten Wege, ein Reinfall zu werden.
Harry sieht Dillon, er schläft tief und fest, und Harry wird sich hüten, ihn zu wecken. Außerdem ist es nicht weit bis zu Cosimos Haus – ein kurzer Fußweg den Hügel hinunter. Er kann in zehn Minuten wieder zurück sein. Am besten, er macht sich sofort auf den Weg, ehe der Regen anfängt.
Nach einem letzten Blick auf das schlafende Kind läuft er die Treppe hinunter in den leeren Buchladen, der jetzt, wo das Abendlicht schwindet und der Himmel dunkel und düster wird, in Schatten getaucht ist. Er tritt nach draußen, schließt die Tür hinter sich ab und eilt entschlossen durch die schmale Straße hinunter.
Die anhaltende Stille um ihn zerrt an seinen Nerven. Er blickt hoch und sieht eine verschleierte Frau, die zu ihm herunterspäht. Hastig weicht sie vom Fenster zurück und verschwindet aus seinem Blickfeld.
Irgendwo in seiner Nähe, in dem engen Gewirr von Gassen, bellt ein Hund und verstärkt das Unbehagen, das Harry einfach nicht abschütteln kann. Der Gin hat ihn nicht entspannt, sondern dieses ungute Gefühl noch gesteigert.
Aber weshalb dieses Unbehagen?
Er hat den Jungen allein gelassen. Jähe Gewissensbisse lassen ihn schneller werden, so dass er fast im Laufschritt zur Straßenecke eilt.
Die Leuchtschrift über der Bar gibt ein lautes, flimmerndes Surren von sich, als er unter ihr hindurchläuft. Er ist sich bewusst, was für eine seltsame Figur er abgibt – ein Weißer, der durch diese überwiegend arabischen Straßen hastet. Erst als er das verzierte Tor erreicht, bleibt er stehen und drückt lange auf die Klingel.
Kurz darauf hört er das leise Schlurfen von weichen Lederslippern auf den Pflastersteinen hinter dem Tor. Eine kleine Gestalt in einer Dschellaba taucht auf, und als Cosimo näher kommt, weicht die Verwirrung aus seinen runzeligen Gesichtszügen, und er hebt eine Hand zum Gruß.
»Mein Freund«, sagt er und entriegelt das Tor.
Und genau in dem Moment, als der Riegel zurückgeschoben wird und mit einem klirrenden Schaben durch die Halterung gleitet, hört Harry es – ein Gegengeräusch, lauter, heftiger und beängstigender als das erste.
Kein Blitz, kein Donner. Die langerwartete Eruption geschieht nicht über seinem Kopf, wie er sich das vorgestellt hat. Nein, er spürt sie in den Fußsohlen.
Ein tiefes Grollen steigt aus dem Innersten der Erde auf. Der Boden beginnt zu zittern. Harry will sich an der Mauer festhalten, aber die Mauer schwankt, und das Tor klappert in den eisernen Angeln.
Der Boden unter seinen Füßen bewegt sich, als wäre er flüssig. Die Erde schaukelt schwindelerregend. Die Welt füllt sich mit dumpfem Getöse und dem Klang von splitterndem Glas, herabstürzenden Dachziegeln und dem Kreischen von reißendem Holz.
Der Boden unter Harry pulsiert, die Erde entgleitet seinen Füßen, das Herz schlingert ihm in der Brust.
Irgendwo auf der Straße hört er Gas aus geplatzten Rohren zischen, und als er sich an der Mauer umdreht, sieht er das Gebäude gegenüber gefährlich schwanken. Es pendelt bedrohlich auf seinem Fundament vor und zurück, Rauch steigt in der Ferne auf, die Luft füllt sich mit Gasgeruch, und gerade als er meint, dass das Haus einstürzt, hört alles auf.
Der Boden wird still. Das Getöse verstummt. Das Wüten unter der Erde verebbt.
Harry bleibt, wo er ist, gegen die Mauer gepresst, die gespreizten Hände rechts und links vom Körper. Das Haus, das er beobachtet hat, kommt zur Ruhe.
Sein ganzer Körper ist vor Angst vollkommen starr, und es dauert einige Augenblicke, bis er sich wieder beruhigt hat. Seine Muskeln lockern sich, seine Gelenke werden wieder beweglich.
»Das war ein ganz übles«, sagt Cosimo mit aschfahlem Gesicht, die Augen noch immer angstvoll aufgerissen.
Harry will etwas sagen, tut es aber nicht.
»Was?«, will Cosimo fragen, doch seine Kehle ist ausgedörrt, und Harry ist bereits verschwunden.
Er rennt an der Bar vorbei, wo die Leuchtschrift auf die Straße gefallen ist. Stromstöße lassen sie zischen und prasseln, ehe sie erstirbt. Auf der ganzen Straße gehen die Lichter aus. Jetzt herrscht totale Stille, die wie ein Schleier verstörender Ruhe über der Stadt liegt. Doch das ist nicht von Dauer.
Der brüchige Frieden endet, als zuerst wenige, dann immer mehr Menschen an Harry vorbeiströmen, den Hügel hinunter fliehen, weg von ihren Häusern, von Angst erfüllt, Angst vor den Nachbeben, die kommen werden, Angst vor dem drohenden Einsturz dieser wackeligen Behausungen.
Er scheint als Einziger den Hügel hochzurennen, mit keuchendem Atem, mit wie verrückt schlagendem Herzen.
Dann hört er das erste Kreischen, die ersten Schreie. Türen fliegen auf, und Menschen tauchen aus ihren Häusern auf, einige benommen und verstört, andere von Panik getrieben. Ein Mann hetzt an ihm vorbei, drei Kinder auf den Armen. Eine Frau kommt aus einer Tür getaumelt, weinend und blutverschmiert, eine leuchtendrote Wunde über dem Auge.
An der Ecke ruft ein Mann wieder und wieder: »Das hat Allah geschickt, Allah.«
Harry bleibt stehen und ringt nach Luft. Eine Frau wirft die Arme um seinen Hals. Er stößt sie weg und rennt weiter.
Rings um ihn herum schwanken Gebäude, und Flammen schießen in die Höhe. Überall Menschen, die schreien, beten und um Hilfe rufen. Auch die Tiere – Federvieh und Vierbeiner – brüllen panisch.
Er hastet verzweifelt vorwärts. Am Hotel Mediterranean stehen drei Männer auf dem Dach. Statt mit ansehen zu müssen, wie die Wahnsinnigen mit dem Dach einstürzen und bei lebendigem Leib in dem in Flammen stehenden Gebäude verbrennen, befiehlt ein Militäroffizier vor Ort seinen Männern, die drei zu erschießen. Was sie auch tun, rasch und treffsicher, vor den Augen einer entgeisterten Menge.
Es ist wie das Ende der Welt.
Überall ist Staub.
Er atmet ihn ein, hustet und spuckt, seine Augen tränen, der Mund ist ausgetrocknet. Er sieht brennende Häuser, Flammen, die an Fenstern und Türen züngeln.
In der Ferne Sirenengeheul. Auch andere Geräusche, plötzliches Krachen, wenn Gebäude einstürzen, das Gepolter von Ziegelsteinen, die auf der Straße landen, das Knacken von Holz, wenn Dachbalken sich biegen und bersten.
Aber er läuft weiter. Ein Haus sackt gegen seinen Nachbarn, als könnte es sich vor Müdigkeit und Altersschwäche einfach nicht mehr aufrecht halten.
Aus Rissen im Asphalt sprudelt Wasser hoch, Wasser und Sand. Ein stinkender Schlamm füllt die Straße und greift nach seinen Füßen.
Die Fassade der Bäckerei am Anfang seiner Straße ist weggebrochen, so dass er in die Zimmer schauen kann, in denen die Möbel noch stehen.
Er sieht ein Bett und ein Sofa, Vorhänge flattern im Freien.
Als er seine Straße hochläuft, wird der Staub in der Luft dichter. Eine gewaltige Wolke aus Staub schlägt ihm entgegen.
Er bleibt stehen.
Um seine Füße herum wirbelt und flattert es. Er blickt nach unten und sieht Hunderte Bücher auf der Straße verteilt.
In der Lücke ist der Himmel flach und dunkel. Die Häuser, die noch stehen, sind gelb und ärmlich.
Er lässt den Blick über die Zerstörung schweifen. Ein Bild von früher am Abend kehrt zurück: Er steht in dem engen Flur und hält seinen schlafenden Sohn in den Armen, kann fast wieder seine weiche Haut, seinen warmen Körper spüren.
Doch nun stellt sich ihm eine andere unbegreifliche Realität dar: Das Haus, in dem er gearbeitet, geschlafen, geliebt hat, in der er Vater wurde, seinen Sohn ins Bett brachte, das Haus, in dem er gelebt hat und das für ihn sein Zuhause war, ist schlicht und einfach und unwiederbringlich nicht mehr da; es ist in der Erde versunken, verschluckt, weg.
Kapitel Eins
Harry
Robin schlief noch, als ich aus dem Haus ging. Ich wollte sie wecken, ihr erzählen, dass es geschneit hatte. Aber als ich mich vom Fenster zu ihr umdrehte und sie da liegen sah, das übers Kissen ausgebreitete Haar, das sanfte Heben und Senken ihres Atems, die geschlossenen Augen und das friedvolle Gesicht, entschied ich mich dagegen. Sie war in letzter Zeit müde gewesen, zumindest war es mir so vorgekommen. Sie hatte über Kopfschmerzen geklagt, und dass sie nicht gut schlief. Also ließ ich sie ruhen, schloss leise die Schlafzimmertür hinter mir, ging nach unten, nahm die leeren Weinflaschen vom Küchentisch, stellte sie nach draußen und ging dann ohne Frühstück oder Kaffee. Es war nicht nötig, ihr eine Nachricht hinzulegen. Sie würde wissen, wo ich war.
Die kalte Luft war erfrischend. Ich bereute mal wieder, wie schon so oft, dass ich am Vorabend zu viel getrunken hatte, aber in der knackig kalten Luft fühlte ich mich plötzlich wie neu geboren. Ich war voller guter Vorsätze. Ich würde ein neues Kapitel aufschlagen, mein Leben bewusster, gesünder, aufrichtiger leben. Es lag nicht nur an der Morgenluft. Hatte ich das nicht schon letzte Nacht zu Robin gesagt?
»Du bist ein Mann mit guten Vorsätzen.«
»Den besten.«
Robin lächelte, als ich das sagte. Sie hatte ein großzügiges Lächeln, ein Lächeln, das die Schwäche in mir erkannte und sie trotzdem verzieh. Nach Dillon war ihre Sanftmut nicht verschwunden, obwohl das leicht hätte passieren können. Ich hätte es ihr nicht verübelt. Und sie wurde nicht verbittert. Sie blieb größtenteils sie selbst, trotz allem, was wir durchgemacht hatten.
Natürlich sagte oder tat sie hin und wieder etwas Überraschendes, das mich stutzig machte und mich veranlasste, meine Frau mit neuen Augen zu sehen.
»Das nennt man verheiratet sein«, sagte mein Freund Spencer einmal zu mir. Als Single oder Junggeselle, wie er sich selbst gern nannte, hatte er häufig Weisheiten über die Ehe parat. Als ich einmal darüber jammerte, dass mein Ehering zu eng sei, erwiderte er kurz und knapp: »Das soll er auch sein.«
Robin und ich redeten noch immer wie früher miteinander, öffneten uns einander, aber wie bei jedem Paar, das schon lange zusammen ist, kann es vorkommen, dass man im Voraus weiß, was der andere sagen will, und man hört nicht mehr zu und geht ins Bett. Und neulich Abend – gestern Abend –, na ja, da war genau das passiert. Ich erzählte munter drauflos, als Robin abrupt aufstand, sich vorbeugte und mich mit einem Kuss zum Schweigen brachte, bevor sie einfach Gute Nacht sagte. Ich hätte nicht gekränkt sein sollen. Ich hatte geplappert, höchstwahrscheinlich Unsinn geredet, und als sie so unvermittelt aus der Küche verschwand, öffnete ich noch eine Flasche Wein und stellte mich auf eine weitere lange Nacht ein.
Aber heute war alles anders. Heute würde ein Tag der Neuanfänge werden. Der Schnee war als Vorbote gekommen, um mich aufzurütteln und mich daran zu erinnern. Ich hatte vor, mein Atelier im Stadtzentrum zu räumen und dichtzumachen. »Das Ende einer Ära«, hatte Spencer gewitzelt. Von nun an würde ich zu Hause in der Garage arbeiten. Dadurch würden wir das Geld sparen, das wir dringend für die Renovierung des Hauses brauchten, in das wir vor kurzem eingezogen waren. Das Haus hatte mal Robins Großeltern gehört und jetzt gehörte es uns. Für Robin barg das Haus Erinnerungen. Und obwohl der Dubliner Vorort Monkstown so gar nichts mehr mit unserer Zeit in Tanger zu tun hatte oder auch nur mit der Zeit, die wir zusammen mitten in Dublin gewohnt hatten, war ich nicht undankbar. Das Haus war groß und alt. Und Robin hatte Pläne. Sie wollte die Ärmel hochkrempeln und im Dreck wühlen. Ihre Begeisterung war ansteckend. Was konnte ich anderes sagen als Ja, Ja, lass uns die Ärmel hochkrempeln und im Dreck wühlen.
Das Knirschen unter meinen Schuhen, als ich durch den Schnee ging, zauberte mir ein Lächeln ins Gesicht. Es lagen bestimmt acht Zentimeter, und anscheinend war ich der erste Mensch, der hier draußen seine Spuren hinterließ. Als ich zu dem alten VW-Bus kam, wollte die Tür nicht aufgehen. Ich zerrte daran, bis sie sich schließlich öffnen ließ, ging dann noch einmal ins Haus, um einen Kessel heißes Wasser zu holen, das ich über die Windschutzscheibe goss. Ich liebte den alten, orangegelben VW-Bus. Robin hatte mich bekniet, ihn nicht zu kaufen. Hatte er je den Geist aufgegeben? War er mal nicht angesprungen oder liegengeblieben? Nein. Er war stets zuverlässig und robust gewesen. Wir hatten sogar schon drin geschlafen. Ich will nicht behaupten, dass er bequem war, aber er hätte es sein können. Ich stieg ein, drehte den Schlüssel im Zündschloss, ließ den Motor einen Moment warmlaufen und setzte dann langsam und vorsichtig rückwärts aus der Einfahrt, spürte, wie der Schnee unter den Reifen zusammengepresst wurde.
An diesem kalten, herrlichen Morgen schaffte ich es problemlos in die Stadt. Die Straßen waren leer, und ich kam gut voran, parkte vor dem Atelier auf der Fenian Street und als ich in den Keller hinunterging, dachte ich mir, dass es wohl das letzte Mal sein würde.
Das Atelier war früher mal eine Souterrainwohnung gewesen, aber Spencer hatte sie entkernt. Die Wände waren kahl. Der Fußboden aus Beton. Der Spülkasten der Toilette gurgelte den ganzen Tag, und wenn ich dort übernachtete, auch die ganze Nacht. Ich hatte eine alte Matratze, ein Sofa, einen Wasserkessel und einen Campingkocher. Mir gefiel, dass das Atelier so kahl war, und zum Arbeiten breitete ich meine Leinwände auf dem Boden aus. Ich benutzte keine Staffelei. Ich benutzte keine Palette. Manchmal benutzte ich auch keine Pinsel. Ich schuf meine Bilder mit Hilfe von Stöcken und Messern oder Glasscherben. Die Kargheit des Raumes beflügelte meine Phantasie, und ich hatte hier zahllose Gemälde skizziert, entworfen und vollendet. Und jetzt war das alles vorbei.
Ich hatte kein richtiges System, aber ich verbrachte den Vormittag damit, den Bus mit Leinwänden, Rahmen, Farben in Töpfen und Tuben, Pinseln, Stöcken, Katalogen und fertigen und unfertigen Bildern vollzuladen. Ich halte mich nicht für sentimental, aber es tat doch ein bisschen weh. Das Atelier hatte mir gute Dienste geleistet, seit wir aus Tanger zurückgekommen waren. Ich hatte dort mein gesamtes neues Werk geschaffen und bisher zwei Einzelausstellungen und eine Reihe von Gruppenausstellungen gehabt. Spencer, der früher ein paar clevere Geschäftsentscheidungen getroffen hatte, gehörte das Haus, und er wohnte im obersten Stock. Er hatte mir das Atelier für einen Spottpreis vermietet. Er erinnerte mich auch gern daran, dass er mein Vermieter und ich sein Mieter war. Um elf Uhr, als ich seit über zwei Stunden zugange war, rief er an.
»Hier ist Ihr Vermieter. Der Räumungsbefehl wird vollstreckt.«
»Du bist ein Witzbold«, sagte ich.
»Das weiß ich selbst.«
Zehn Minuten später kam er, um mir zu helfen. Er trug einen schwarzseidenen Morgenmantel, hatte ein Paar alte Lederslipper an den Füßen und eine Zigarette zwischen die Lippen geklemmt. Ich sage, er kam, um mir zu helfen: Er brachte eine Trommel und einen Kasten Bier mit. »Ich bin der Junge, der die Trommel schlägt.«
»Hilf mir lieber schleppen.«
»Ich hätte ein reicher Mann werden können, wenn ich dir die Miete abgeknöpft hätte, die ich für diese Wohnung hätte haben können.«
»Du warst ein reicher Mann.«
»Ich hab das gestern Abend durchgerechnet. Ich hätte ganz schön was auf die hohe Kante legen können.«
»Ich fürchte, die Vermietung einer kleinen Wohnung an einen Freund hat dich nicht in den Ruin getrieben.«
»Und das sagst ausgerechnet du, der kleine Mieter.«
Mein Telefon klingelte.
Diane, die Leiterin der Galerie, in der ich ausstelle, war am Apparat. »Willst du es dir nicht doch noch mal überlegen?«
»Ich habe schon alles verladen.«
»Du weißt, ich halte das für einen Fehler.«
»Das hast du mir schon gesagt.«
»Und nicht nur, weil ich dann nicht mehr auf einen Sprung vorbeikommen kann, sondern auch in geschäftlicher Hinsicht.«
»Die Sache ist gegessen.«
Diane wollte noch alles Mögliche. Ich sagte, ich müsse Schluss machen.
»Wer war das?«, wollte Spencer wissen.
Ich hatte keine Lust auf die Tirade, die er garantiert über Diane vom Stapel lassen würde, wenn ich ihm sagte, dass sie das am Telefon gewesen war, deshalb log ich. »Bloß Robin«, sagte ich.
»Die Gute.«
Als Spencer seine letzte Kiste geschleppt und sich ein Bild ausgesucht hatte, das ihm gefiel – »Entweder ich verkauf das für dich oder ich nehm es als Weihnachtsgeschenk« –, legte ich eine Pause ein und kochte uns eine Kanne Kaffee.
»Der stärkste Kaffee diesseits der Liffey«, sagte Spencer. Er zog einen silbernen Flachmann aus der Tasche und goss ein.
»Was auch immer das heißt.«
»Das hier heißt das.« Er hielt mir den Flachmann hin, aber ich legte die Hand über meine Tasse.
»Muss noch fahren«, sagte ich.
»Wieso jemand an einem Tag wie heute fahren will, ist mir ein Rätsel.«
»Schon vergessen? Ich ziehe aus.«
»Jetzt hör mal gut zu. Ich habe eine Bitte an dich.«
»Schieß los«, sagte ich, während ich ein paar Pinsel in einen Lappen einwickelte.
»Du bestellst bitte Ihrer Ladyschaft, Königin der Verdammten, dass du den Schmelztiegel der Kreativität verlassen und meiner kolossalen Großzügigkeit abgeschworen hast.«
»Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein geschwätziger Saftsack bist?«
»Wage es nicht mich zu beleidigen.«
»Ist nicht meine Absicht. Redest du von Diane?«
»Wenn du sie so nennen willst. Ich bevorzuge –«
»Sie weiß, dass ich ausziehe«, sagte ich, griff nach Spencers Flachmann und goss einen Schuss in meine Tasse. Ich spürte in dem Moment das Verlangen nach irgendetwas, um das plötzliche und unerwartete Zittern meiner Nerven zu beruhigen.
»Aber weißt du, was ich befürchte? Dass sie spät abends herkommt und zu dir will. Stattdessen trifft sie mich an, und was dann? Sie wird versuchen, ihre Zähne auch in mich zu schlagen. Sie wird versuchen, mir das Blut auszusaugen.«
»In meinen Augen ist ihr da schon jemand zuvorgekommen. Hast du mal in den Spiegel geschaut?«
»Du grausamer Scheißkerl.«
»Ich sage die Wahrheit.«
Spencer schüttelte den Kopf. Ich sah zu, wie er sich die nächste Zigarette anzündete, dann aufstand und durch den leeren Raum schlenderte. Eine dumpfe Stimmung hatte sich breitgemacht, und ich fühlte mich einsam. Der Whiskey brannte ein Loch in die Kälte meines leeren Magens, und ich sah, wie Spencer stehen blieb und in eine von den wenigen Kisten schielte, die noch darauf warteten, in den Bus geladen zu werden. Er nahm die Zigarette aus dem Mund, griff in die Kiste und fing an, den Stoß Zeichnungen darin durchzusehen. Ich spürte, wie sich in mir schlagartig alles zusammenzog, vor Trauer oder auch Wut. Das waren meine Zeichnungen von Dillon. Spencer zog eine heraus und hielt sie hoch, studierte sie mit zusammengekniffenen Augen. Ehe er eine Bemerkung machen konnte, ehe er überhaupt etwas sagen konnte, war ich bei ihm und riss ihm die Zeichnung aus den Händen. »Die gehen dich nichts an«, sagte ich barsch und drehte mich weg, damit er meine hochroten Wangen und meine zitternden Hände nicht sah. Ich legte die Zeichnung zurück zu den anderen, ließ meine Finger kurz darauf ruhen.
Ich spürte sein Schweigen und mir war klar, dass er überlegte, ob er irgendetwas sagen sollte. Er kannte mich gut genug, um zu wissen, wann es besser war, den Mund zu halten. Dann hörte ich das langsame Schlurfen seiner Slipper, das Schaben einer Tasse auf dem Tisch, als er seinen Kaffee nahm und in einem Zug leerte. »Hat das hier einen Namen?«, fragte er, und als ich aufblickte, sah ich, dass er das Bild hochhielt, das er sich ausgesucht hatte.
Es war eines meiner Tanger-Bilder: verschwommene Gestalten, ein Marktplatz, schwaches Sonnenlicht im Hintergrund. In der Ferne das Meer.
»Das ist ohne Titel.«
»Ich werde ihm einen geben«, sagte Spencer. Er deutete auf seine Trommel. »Und die da hol ich später.«
»Von mir aus«, sagte ich, und weg war er.
Die Tür knallte zu, und ich wartete einige Augenblicke, ehe ich mich wieder Dillons Kiste zuwandte. Sie war groß und aus Holz, mit gehämmerten Aluminiumverstärkungen an den Ecken. Ich nahm eine Handvoll loser Blätter heraus und sah sie mir an. Einen kurzen Moment lang spielte ich mit dem Gedanken, sie wegzuwerfen, sie zu vernichten. Vor meinem geistigen Auge tauchte eine Tonne auf, in der ein Feuer brannte und all diese Bilder zu Asche wurden. Schließ endlich damit ab. Schau nach vorn. Solche Dinge haben Menschen zu mir gesagt. Vernünftige Menschen. Menschen, die mich mochten und denen mein Wohl am Herzen lag. Menschen, die Robin mochten, uns beide mochten.
Die ganze Zeit hatte ich meine Trauer verborgen gehalten, aber weiterhin diese Zeichnungen angefertigt. Irgendetwas, das ich nicht ganz verstand, hatte sie aus mir herausgeholt, meine Hand über das Blatt Papier gelenkt, wieder und wieder. Irgendwie konnte ich einfach nicht damit aufhören. Und ich weiß nicht, wie lange ich an dem Tag dasaß und sie mir ansah. Ich weinte nicht. Stattdessen war da ein ganz anderes Gefühl. Ich glaube nicht, dass ich es richtig beschreiben kann. Ein Gefühl von Wiedererkennen. Die Zeichnungen waren das Wahrhaftigste, was ich seit Jahren geschaffen hatte. Ich glaube nicht, dass es eine Seele gibt, aber wenn ich es täte, würde ich sagen, dass in diesen Bleistiftstrichen eine Seele steckte.
Meine Zeichnungen von Dillon waren chronologisch geordnet. Und ich saß da und ging die Jahre durch, ging die Bleistift- und Kohlezeichnungen von ihm durch, hunderte Zeichnungen, die zeigten, wie der Junge sich mit zunehmendem Alter verändert hätte. Der Junge. Ist das zu fassen? Sprich’s doch aus – mein Sohn.
Aus diesen Zeichnungen waren nie Gemälde geworden. Und ich hatte sie niemandem gezeigt, nicht mal Robin. Vor allem nicht Robin. Die Zeichnungen waren ein Geheimnis. Deshalb konnte ich es nicht ertragen, dass Spencer irgendetwas über sie sagte. Ich weiß nicht warum, aber in gewisser Weise hatten sie mich am Leben gehalten.
Daher packte ich sie nicht zusammen, um sie zu verbrennen. Ich legte sie sorgfältig nach den notierten Daten aus, verteilte sie auf dem Betonboden. Ich hatte versucht, meinen Sohn so darzustellen, wie er mit jedem Monat, den er älter wurde, ausgesehen hätte, mit jedem Jahr. Und als ich so dastand und den Blick über Zeichnung für Zeichnung gleiten ließ, war er wieder da und wuchs vor meinen Augen.
Es reicht, sagte ich mir, ging in die Hocke und sammelte die Zeichnungen ein, um sie langsam wieder zu dem Kalender der Verzweiflung zu ordnen, der sie waren. Der Deckel über der Kiste klappte zu, und ich trug sie nach draußen und schloss das Atelier hinter mir ab.
Ich entschied mich, den VW-Bus stehen zu lassen. Die Vorstellung, nach Hause zu fahren und den Wagen auszuräumen, machte mich nur müde. Stattdessen ließ ich mich treiben, folgte dem Brummen eines tieffliegenden Hubschraubers, der über der O’Connell Street kreiste. Ich hatte vor, irgendwo was zu essen, das gähnende Loch in meinem Bauch zu füllen, doch die schwirrenden Rotorblätter über mir faszinierten mich, und auf einmal war ich auf der O’Connell Street und geriet schnurstracks in die Protestdemonstration gegen die Regierung hinein. Ich war so sehr mit meinem persönlichen Drama beschäftigt gewesen, dass ich die angekündigte Demonstration glatt vergessen hatte. An einem anderen Tag hätte ich vielleicht selbst daran teilgenommen, um mit meiner Stimme den kollektiven Zorn, die Wut auf die Regierung zu unterstützen. Ich war genauso aufgebracht wie alle anderen auch. Menschen im ganzen Land waren in ihrem hilflosen Zorn auf den Rettungsschirm vereint. Dessen Bedingungen waren knüppelhart, daher war ich in gewisser Weise froh, die O’Connell Street hinunterzugehen und per Zufall zum Mitdemonstranten zu werden.
Es gab keine Autos, keinen Verkehr, sondern Tausende von Menschen, die marschierten und skandierten und sich ihren Unmut aus dem Leib schrien. Nachrichtenteams aus aller Welt hatten ihre Kameras entlang der Demonstrationsstrecke aufgebaut. Touristen blieben stehen, um Fotos und Videos zu machen. Woher sie auch immer kamen, die Demo konnte für sie keine Überraschung sein. Irlands Finanzprobleme hatten schließlich international Schlagzeilen gemacht.
Auch die Garda war stark vertreten. Die Polizisten, die gelbe Leuchtjacken über ihren Uniformen trugen, standen in Abständen entlang der Strecke zu zweit oder dritt zusammen, plauderten und stampften mit den Füßen auf der Stelle, um warm zu bleiben. Ehrlich gesagt, sie hatten nicht viel zu tun. Die Demo verlief gewaltlos und sittsam. Trotz der ganzen Wut herrschte eine würdevolle Zurückhaltung. Der Protest war eher manierlich als aufrührerisch. Ein Demonstrant hielt ein selbstgemachtes Plakat hoch, auf dem in schwarzem Filzstift stand: »Republican IRA: Europe Out, Brits Out.« Auf einem Handzettel, der unter die Haustür geschoben worden war, hätte das bedrohlich wirken können. Doch am Ende eines Stocks mitten in einer friedlichen Demo wirkte es einfach nur jämmerlich und fehl am Platz.
Ich reihte mich in den Demonstrationszug ein und überlegte, ob ich auch mitsingen und skandieren sollte. Der Menschenstrom folgte der breiten Straße und sammelte sich vor dem Hauptpostamt, wo eine Bühne aufgebaut worden war und hinter den ausgestreckten Armen der Jim-Larkin-Statue ein großer Bildschirm mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Demos aus der Vergangenheit flackerte. Gespenstische Bilder. Die wieder zum Leben erweckte Vergangenheit wurde in einem seltsamen und unheimlichen Licht erneut abgespielt. Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter.
Dann trat oben auf der Bühne, die jetzt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand, ein Mann ans Mikrophon. Er sprach unter Jubel und Buhrufen ein paar kämpferische Worte und kündigte dann eine Frau an, die einen langen und schwülstigen Protestsong sang. Die Gitarre zitterte in ihren Händen. Ein Hubschrauber flog über die Kundgebung hinweg, und seine lärmenden Rotorblätter übertönten den Gesang für einen Moment.
Ich stand eingezwängt in einem dichten Pulk von Menschen, die sich mal hierhin, mal dorthin bewegten. Ich glaube, ich ließ mich von der Stimmung mitreißen. Ich applaudierte und skandierte mit, unterstützte den Chor anderer mit meiner Stimme. Als die Frau ihren langen Klagegesang beendete, erntete sie Jubel und Pfiffe. »Wir sind verraten und verkauft worden!«, schrie der Mann am Mikro. »Es wird Zeit, dass wir für uns selbst eintreten!« Er stellte eine andere Frau vor, die ihre Geschichte erzählte, eine Geschichte von Krankenhauseinsparungen und Wartelisten. Und dann ging ein Mann ans Mikrophon und sprach von kleinen Kommunen und schließenden Postämtern. Und ein weiterer Mann erzählte seine Geschichte und überließ das Mikro dem Nächsten in einer langen Reihe von Leuten, die alle etwas zu erzählen hatten, und das löste bei den Zuhörern jedes Mal dröhnenden Beifall aus, Jubel, Kopfnicken und solidarisch zum Himmel gereckte Arme.
Die Zeit verging; wie viel Zeit weiß ich nicht. Aber nach einer Weile wurde ich matt und heiser. Irgendwer schlug irgendwo eine Trommel. Ich spürte die Vibrationen im Kopf und überlegte zu gehen. Es war ein seltsamer Morgen, der überraschende Schnee, das Ausräumen meines Ateliers, Whiskey auf leeren Magen, Spencers Hände an den Zeichnungen, und jetzt das Gedränge und Gebrüll der Menschenmenge. Bum-bum-bum machte die Trommel. Es war zu viel. Ich war hungrig und müde. Ich musste nach Hause oder in die Wärme vom Slattery’s. Ich musste Robin sehen.
Als ich mich zum Gehen wandte, blieb mein Blick an einem auffälligen Farbtupfer hängen. Ein Tuch um den Hals einer Frau, mit losen Enden, die in der Brise wehten. Ein durchscheinender Stoff, Seide vielleicht, in Blau, wie Rauch in der Luft. Die Frau, groß und attraktiv, hielt einen Jungen an der Hand, und beide gingen zielstrebig die O’Connell Street hoch. Auf einmal drehte der Junge sich um und sah mich an, und schlagartig verlangsamte sich alles. Das Trommeln hörte auf. Das Gebrüll wurde leiser. Die Menschenmenge verschwand. In diesem Moment gab es nichts anderes, nur mich und den Jungen, und unsere Blicke hielten einander fest.
Dillon.
Mein Herz zuckte erschrocken. Ich schnappte nach Luft, und das Blut rauschte mir wild in den Ohren.
Mein Sohn. Mein verschwundener Sohn.
Jemand ging an mir vorbei, ich verlor meinen Sohn eine Sekunde lang aus den Augen, und in das plötzliche Vakuum kam alles zurückgeströmt: das laute Geschrei und Gejubel der Menge, das donnernde Pulsen der Trommel, das Geschiebe von Körpern und der beklemmend niedrig schwebende Hubschrauber über uns.
Ich hielt verzweifelt Ausschau nach ihm. Der Schweiß brach mir aus, als ich anfing, mich durch die Menge zu zwängen. Das blaue Halstuch hob sich wie eine Rauchwolke, und eine Art Panik überkam mich. Ich stieß Leute aus dem Weg, drängelte und schubste, um vorbeizukommen, getrieben von einem neuen und unbekannten Drang. Ich wurde angeraunzt: »Hey, pass doch auf, verdammt!«, »Immer mit der Ruhe!«, »Wohin so eilig, Mann?« Aber das war mir egal. Ich drängte und schob, wich aus und hastete durch die Menschenmasse. Ich kam nur schwer voran. Aber ich ließ mich nicht aufhalten. Ich hatte das Gefühl, dass nichts mich aufhalten konnte.
Nach all den Jahren, in denen ich voller Hoffnung und Fragen gewesen war, gesucht und gezweifelt hatte, nach all den Jahren, in denen ich den kleinsten Hinweisen gefolgt, durch die düsteren Straßen von Tanger gestreift war, an gottlosen Orten ganze Nächte durchwacht hatte und immer wieder von einer erkalteten Spur enttäuscht worden war, zeigte er sich mir. Er ging an mir vorbei. Ausgerechnet jetzt, wo ich am wenigsten damit rechnete, war er da, vor meinen Augen, in Dublin, einer Stadt, in der er nie gewesen war.
Die Menge schien sich um mich herum zu verdichten und zusammenzuballen. Die Atmosphäre veränderte sich. Sie wurde feindselig und abweisend. Ich tat, was ich konnte, um die beiden im Auge zu behalten – an ihnen dranzubleiben, während ich mich durch das Gewühl zwängte. Sie waren schneller geworden. Gingen in forschem Tempo; der Abstand zwischen ihnen und mir wurde größer.
»Dillon!«, schrie ich. »Dillon!«
Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob er mich hörte oder nicht, doch für einen kurzen Moment war mir, als ob er auf mein Rufen hin den Kopf wandte und unsere Blicke sich erneut trafen. Da, inmitten der wogenden Massen, hatten seine blauen Augen irgendwie meine gefunden, jedenfalls für den Bruchteil einer Sekunde. War da ein Zögern, ein Moment des Widerstands, ein kurzes Erkennen? Ich weiß es nicht, obwohl ich mir die Frage seitdem unzählige Male gestellt habe. Und genauso schnell, wie er den Kopf gewendet hatte, um mich anzusehen, war er verschwunden, wurde er mir erneut genommen. Mein Sohn, mein verschwundener Sohn, ließ mich eingeschlossen in dem Menschenmeer zurück, gefangen wie ein Stück Fleisch im Körper einer Schlange, fassungslos und verzweifelt kämpfend, um den Weg nach draußen zu finden.
Kapitel Zwei
Robin
Als ich aufwachte, saß Harry auf der Bettkante, zog sich die Schuhe an und griff nach seiner Jacke. Ich stellte mich schlafend. Ich beobachtete ihn heimlich aus meinem Nest aus Decken, erfreute mich an dem Anblick, wie er seine Zigaretten in die Hemdtasche schob, das Portemonnaie in die Gesäßtasche seiner Jeans – sein übliches Morgenritual –, ehe er sich hochstemmte und aufrichtete, um sein Gesicht im Spiegel zu betrachten. Aufgrund seiner Größe musste er sich leicht vorbeugen, um sein Aussehen zu überprüfen, während er sich mit einer Hand grob durchs Haar fuhr. Seine Hände waren breit und stark, Farbe und Pigmente hatten sich für immer rings um die Fingernägel festgesetzt, und im kalten Morgenlicht wirkte sein Körper muskulös und kantig. Ich sah zu, wie er mit den Fingern über das unrasierte Kinn strich, dunkel von drei Tage alten Stoppeln, und spürte dieselbe Faszination, die mich an ihn gefesselt hatte, als wir uns vor sechzehn Jahren kennenlernten.
Er öffnete die Vorhänge und stieß einen erstaunten Laut aus. Hinter ihm konnte ich sehen, dass der Baum vor dem Fenster mit Schnee bedeckt war. An der Scheibe war eine Eisblume, und Harry fuhr mit der Hand darüber und schaute hinaus.
Es war der letzte Samstag im November, und es hatte das erste Mal geschneit. Ich betrachtete ihn, wie er dort am Fenster stand, und das helle Sonnenlicht, das von der weißen Gartenfläche reflektierte, schien sein Gesicht zu beleuchten, befreite es kurz von allen Spuren der Bürde, die er schon so lange mit sich herumschleppte. Er war sechsunddreißig Jahre alt und sah älter aus, aber an diesem Morgen war seine Freude über den unerwarteten Schnee – die Überraschung über die dicke und unberührte weiße Pracht, die alles sauber und neu machte –, so arglos und jungenhaft, dass ich lächeln musste. Ich wollte schon aufhören, mich zu verstellen, und seinen Namen sagen, vielleicht zu ihm ans Fenster treten, meine Arme um ihn schlingen, ihm »Geh nicht, Liebling« ins Ohr flüstern, ihn dann zurück in die wohlige Wärme unseres Bettes ziehen, als ich daran denken musste, wie Dillon immer zwischen uns geschlafen hatte.
Eine unangenehme Kälte kroch in mich hinein, und ich wusste sofort, dass ich nicht zu ihm gehen würde. So sehr ich es wollte, ich konnte es nicht. Stattdessen musste ich ganz still liegen bleiben, die Augen geschlossen halten, und mich fest darauf konzentrieren, das Bild auszublenden, das mir in den Sinn gekommen war. Die Weichheit und Wärme des kleinen Körpers unseres Sohnes, der zwischen uns lag. Das Geräusch seines Atems. Sein Geruch.
Mein Verstand packte das Bild wie eine stählerne Falle.
Ich blieb, wo ich war. Ich hielt die Augen geschlossen.
Der Moment verging, und ich lag da und lauschte darauf, wie Harry die Treppe hinunterschlich, spürte einen Anflug von Reue, dass ich ihn hatte gehen lassen. Aber immerhin, ich hatte mich wieder gefangen. Das allein zählte. Ich würde es später bei Harry wiedergutmachen. Außerdem hatte ich erst noch was zu erledigen. Von unten hörte ich das Klirren von Flaschen und das Geräusch, wie sich die Tür hinter ihm schloss. Kurze Zeit später sprang der VW-Bus hustend und stotternd an, und dann war Harry weg.
Bei Dillon wusste ich es sofort. Ich wachte eines Morgens auf, und es war, als hätten sich alle Moleküle meines Körpers über Nacht leicht verschoben – eine kleine, fast unmerkliche Neuordnung –, so dass ich mich anders fühlte, aber auf eine Art, die ich nicht genau benennen konnte. Ich fühlte mich verändert. Wenige Tage später setzte die Übelkeit ein – in Wellen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und gleichzeitig überkam mich eine überwältigende Müdigkeit, die zur Folge hatte, dass ich, die ich doch immer Probleme mit dem Einschlafen gehabt hatte, plötzlich überall einnicken konnte, an Bushaltestellen, in Kneipen, beim Essen mit Freunden. Ich fühlte es – ich fühlte ihn –, noch bevor ich merkte, dass meine Periode überfällig war. Bei Dillon hatte ich das Gefühl, als hätte sich die Schwangerschaft förmlich auf meinen Körper gestürzt. Diesmal war es anders. Ich war über eine Woche überfällig, und es gab keine Symptome – keine Übelkeit, keine plötzlichen Müdigkeitsattacken. Es war anders als beim ersten Mal, und dafür war ich dankbar. Weil ich nicht wollte, dass diese Schwangerschaft, dieses Baby, mich an Dillon erinnerte. Ich hatte das alles hinter mir gelassen.
Zehn Minuten nachdem ich gehört hatte, wie Harrys alter VW-Bus ächzend und quietschend aus der Einfahrt setzte, saß ich schlotternd im Bad und starrte auf den dünnen rosa Strich, der meinen Verdacht bestätigte.
»Ganz ruhig!«, ermahnte ich mich und spürte mein Herz in der Brust taumeln. »Nicht aufregen, Robin.«
Ich legte das Teststäbchen weg, wusch mir die Hände und betrachtete mich in dem kleinen gesprungenen Rasierspiegel. Ich habe einen blassen Teint, aber an diesem Morgen war das Gesicht, das mich aus dem Spiegel ansah, gerötet, Blut strömte vom Hals hoch und durchflutete meine Wangen mit Farbe. Ich legte die Finger ans Gesicht und lächelte. Ein glückliches Murmeln begann in meinem Innern. Ich musste lachen. In diesem kalten, klammen Badezimmer, wo mein Atem in der Luft Wölkchen bildete, schlang ich die Arme um mich. Ein ganz neues Leben. Ein Neuanfang. Ich empfand es wie die saubere weiße Schneedecke draußen, die alles neu machte.
In unserem Haus gibt es ein Zimmer, das völlig frei ist von irgendwelchen Heimwerkerspuren. Es ist ein Refugium, wo man nicht über Kabelstränge von Elektrowerkzeugen stolpert, die wie Schlangennester auf den nackten Dielen liegen, wo die Wände nicht von halbherzigen Tapetenabreißaktionen zeugen, die angefangen und wieder aufgegeben wurden; und wo keine abgeschlagenen Fliesen Klümpchen von altem Fliesenkleber hinterlassen haben und der Putz abgeblättert ist. Diesen einen Raum benutzen wir als Büro, und in diesen Raum ging ich jetzt, noch immer im Bademantel, lange Strümpfe hoch bis über die Knie gezogen. Ich setzte mich bibbernd vor mein MacBook, suchte im Internet nach einem Eisprungkalender, einer Zyklustabelle, irgendeiner Möglichkeit, um auszurechnen, wann dieses Kind wohl gezeugt worden war. Dann rief ich den Kalender in meinem Handy auf und blätterte die letzten Wochen durch. Ich tat das alles so, als würde mir jemand dabei zusehen, stellte meine Berechnungen demonstrativ sorgfältig an, obwohl ich es in Wahrheit schon wusste. Ich legte das Handy hin und klappte das MacBook zu. Am Fenster sah ich, wie das Baumskelett immer mehr zuschneite. Ich hatte es die ganze Zeit gewusst.
Es war unser Jahrestag. Unser jährlicher Festtag, den wir zum sechsten Mal begingen. Wir hatten das eines Abends beschlossen, nicht lange nachdem er von uns gegangen war. Wir beide saßen in einem Café, mit nichts Stärkerem als Kaffee zwischen uns, und Harry schlug mit der Faust auf den Tisch, Tränen in den Augen. Er zischte wütend, er wolle unser Leben nicht durch die Tragödie bestimmen lassen, die wir erlitten hatten. Er weigere sich, ein von Schmerz beherrschtes Leben zu leben. Er könne einfach nicht einer von diesen Leuten werden, die sich von der Vergangenheit lähmen lassen, eingeschlossen im Bernstein der Trauer. Er sagte das, und ich sah, dass er vor Schmerz und Kummer zitterte, fast haltlos, und ich streckte die Hand aus, um ihn zu beruhigen. Ich hielt seinen Arm fest, und während er schluchzte, flüsterte ich ihm zu, wir bräuchten keine jährliche Gedenkmesse oder wöchentlichen Besuche an einem Grab, um das zu überstehen. Kein Wiederbeleben all der liebevollen Erinnerungen – das würde uns Dillon nicht zurückbringen. Stattdessen schlug ich vor, dass wir uns einen Tag im Jahr nehmen würden – Dillons Geburtstag –, und dass wir an diesem Tag feiern würden, nur wir zwei. Er horchte auf und sah mich an, während ich die Idee erläuterte: Jedes Jahr an diesem Tag, bis ans Ende unseres Lebens, ganz gleich, was in Zukunft zwischen uns passierte, an diesem einen Tag würden wir irgendwo hinfahren, essen gehen, übernachten, trinken und lange Spaziergänge machen; wir würden über ihn sprechen, darüber, wie sehr wir ihn geliebt hatten, wie glücklich er uns gemacht hatte; wir würden uns betrinken, wir würden uns lieben, wir würden weinen, wir würden alles tun, was nötig war, um diesen Tag zu überstehen. Es war eine Chance, alles zu destillieren und aufzufangen, was uns nach ihm an Liebe und Sehnsucht geblieben war.
Dillon war drei Jahre alt, als er starb. Und seither begingen wir Jahr für Jahr diesen einen besonderen Tag. Seltsam, denn unsere eigenen Geburtstage feierten wir nicht mehr, nahmen sie nicht mal zur Kenntnis. Nach dem, was in Tanger passiert war, konnte ich das einfach nicht.
Vor einem Monat. Wir waren auf der Fahrt nach Kilkenny, wo wir eine Übernachtung in einem ehemaligen Herrensitz gebucht hatten – Kaminfeuer, Teppiche mit Schottenmuster und Hirschköpfe über den Billardtischen, das volle Programm –, und unterhielten uns darüber, dass manche Leute uns für morbide hielten, weil wir noch immer den Geburtstag unseres Sohnes feierten, obwohl er schon fünf Jahre tot war.
»Dein Bruder zum Beispiel«, sagte Harry.
»Mark? Du hast mit Mark darüber gesprochen?«
»Nein, aber er hat mich einmal auf seine unbeholfene Art tatsächlich gefragt, ob er ›also, ähm, Geburtstagskarten für Dillon schicken soll und so‹.«
Harry hatte angefangen, Mark nachzuahmen, mit seiner stockenden Sprechweise und der nervösen Art, auf der Unterlippe zu kauen, wenn es um irgendetwas Ernstes ging. Ich tat schockiert und empört, prustete dann aber doch los und sagte, er solle aufhören, sich über meinen Bruder lustig zu machen.
»Nein, ehrlich, Robin. Und dann erst deine Mutter – großer Gott! Als ich ihr erzählt habe, wir hätten ein Zimmer im Kilronan House gebucht, geriet sie richtig ins Schwärmen und meinte, sie hätte in Image Interiors einen Artikel darüber gelesen und irgendeine Freundin im Bridge-Club hätte sich ganz begeistert über das Haus geäußert, und als ich sagte, dass wir Dillons Geburtstag da feiern wollten, sind ihr vor Entsetzen die Gesichtszüge eingefroren. Ehrlich! Ich denk mir den Mist nicht aus. Ihr Gesicht sah aus wie eine Totenmaske. Wie die Wachskopie von Robespierres Kopf nach der Guillotine. Daran hat sie mich erinnert.«
»Hör auf. Im Grunde liebst du sie. Gib’s zu.«
Er grinste, und ich richtete meine Aufmerksamkeit auf die Landschaft jenseits der Windschutzscheibe.
Irgendetwas nagte an den Rändern meines Glücks. Seit wir in Dublin losgefahren waren, wurde ich das Gefühl nicht los, dass ich etwas vergessen hatte, und als wir schon halb in Kilkenny waren, fiel es mir ein: meine Antibabypille. Ich sagte Harry nichts davon, sondern saß bloß da, kaute auf der Unterlippe, wippte mit übereinandergeschlagenen Beinen, und während ich Felder und Heckenreihen vorbeifliegen sah, versuchte ich auszurechnen, wie groß das Risiko war, wenn ich die Pille erst morgen Mittag nahm, wenn wir wieder zu Hause wären, statt heute Abend um neun Uhr, wann ich sie eigentlich nehmen sollte. Waren fünfzehn Stunden ein großes Risiko? Bestimmt nicht. Doch nicht nach neun vorsichtigen Jahren?
Ich beruhigte mich mit dem Vorsatz, sobald wir am nächsten Tag nach Hause kämen, nach oben zu gehen und die Pille einzuwerfen.
Ich tat es bloß nicht.
Wir kamen nach Hause nach einer Nacht, in der wir zu viel Wein getrunken hatten, um dann beschwipst, wild und rührselig miteinander zu schlafen. Wir waren beide müde und ein wenig traurig, wie immer nach diesem Tag, fühlten uns aber auch durch ihn erneuert, irgendwie gestärkt. Ich ging nach oben und stand dann im Badezimmer, starrte auf die Folienpackung mit Pillen, sieben leere Blisterkammern, vierzehn volle. Ich sah die kleinen Buchstaben – Sa –, die auf die Folie gedruckt waren, und auf einmal dachte ich: Nein.
Ich schätze, man könnte sagen, dass ich in diesem Moment die Entscheidung traf. Damals hatte ich das Gefühl, das Richtige zu tun. Ich besprach es nicht mit Harry – ich wusste schon, wie seine Antwort lauten würde. Ich hatte das Thema schon öfter angeschnitten und war jedes Mal auf Ablehnung gestoßen.
»Ich würde mir selbst nicht trauen.«
Das sagte er immer. Aber der Blick, mit dem er mich ansah, sagte etwas anderes: dass er in Wahrheit Angst vor dem Gedanken hatte, dass ich ihm nicht noch mal ein Kind anvertrauen würde. Nicht nach Dillon.
Aber ich hatte Vertrauen zu ihm. Ich verstand, dass es Schuldgefühle waren, die ihn davon abhielten, wieder ein Kind zu wollen, als müsse er sich selbst bestrafen, weil er Dillon an jenem Abend allein gelassen hatte. Und nachdem ich fünf lange Jahre zugesehen hatte, wie er sich ausweglos mit der Last seiner Selbstverachtung quälte, fand ich, dass etwas geschehen musste, um ihn davon zu befreien.
Ich spülte die Pillen im Klo runter. Was soll’s, sagte ich mir, während ich zusah, wie das wirbelnde Wasser die kleinen blauen Tabletten verschluckte. Warten wir einfach ab, was passiert. Das war einen Monat her, und in der ganzen Zeit hatte ich die Sache Harry gegenüber mit keinem Wort erwähnt. Ich wartete immer auf den richtigen Moment, um davon anzufangen, aber es ergab sich keiner. Jetzt war es zu spät für ein Gespräch. Und als ich an diesem verschneiten Morgen in unserem kleinen kalten Büro darüber nachdachte, spürte ich die ersten leisen Zweifel in mir aufsteigen.
»Hallo?«
»Hallo, Schätzchen. Schön, dass ich dich erwische.«
»Mum. Wie geht es dir?«
»Ich bin durchgefroren. Dein Vater dreht ständig die Heizung ab. Das dauernde Gerede über Sparmaßnahmen hat ihn zum Fanatiker werden lassen.«
Ich saß auf der untersten Treppenstufe mit dem Telefon am Ohr. Im Hintergrund konnte ich das Klappern von Besteck gegen Geschirr hören und stellte mir meine Mutter am Küchentisch vor, das blonde Haar ordentlich frisiert wie eine Perücke, das Gesicht perfekt geschminkt und ein Kaschmirtuch um die Schultern geschlungen, während sie sich an einer dampfenden Tasse Kaffee aufwärmte.
»Der einzige Raum im ganzen Haus mit etwas Wärme ist die Küche. Jim fürchtet, wenn wir den Aga-Herd abstellen, kriegen wir ihn nicht mehr an.«
»Und ich vermute, du unterstützt ihn gern in dem Glauben.«
»Selbstverständlich. Kein Wort zu ihm, hörst du?«
»Dein Geheimnis ist bei mir sicher.«
»Und wie geht’s dir, Schätzchen? Wie kommst du mit dem kalten Wetter klar?«
»Na ja, ich sitze hier in der Diele, und über der Haustür ist ein Riss, und die Hintertür schließt nicht richtig, deshalb fühl ich mich ein bisschen wie in einem Windkanal.«
»Kann ich mir vorstellen. Dieses gruselige alte Haus. Ich frier schon, wenn ich bloß dran denke. Wieso ihr euch kein hübsches modernes mit Wärmedämmung und Zentralheizung gekauft habt, wird mir immer ein Rätsel bleiben. Ich hab dich damals gewarnt, aber du wolltest Mark ja unbedingt seinen Anteil am Haus abkaufen und drin wohnen. Du hast nicht mit dir reden lassen. Und ich weiß, ich weiß«, sagte sie, ehe ich dazu kam, mich zu verteidigen. »Es war Grannys Haus, und du wolltest keine fremden Leute darin wohnen lassen.«
»Wir lieben dieses Haus, Mum.«
»Liebe ist ja schön und gut. Ich hoffe bloß, du bist warm angezogen.«
»Ich trage eine Strumpfhose unter der Jeans und ein Thermounterhemd unter einem Flanellhemd und darüber eine Fleecejacke.«
»Du hörst dich an wie ein Müllmann. Was habt ihr beide denn heute so vor?«
Ich starrte auf den Spachtel in meiner Hand.
»Ich reiß Tapeten ab, und Harry ist in die Stadt gefahren.«
»Oh.« Eine kurze Pause entstand, und dann sagte sie: »Er ist doch wohl nicht auf die Demonstration gegangen, oder?«
Die Demonstration. Die irische Bevölkerung protestierte gegen die Regierung und die Banken und den IWF und die EU und all die anderen Buhmänner, die behaupteten, uns retten zu wollen. Ich hatte meine Mutter deutlich vor Augen, wie sie ihre Perlenkette wie einen Rosenkranz befingerte und sich auf ihrem Gesicht Abscheu ausbreitete bei der beschämenden Vorstellung, ihr Schwiegersohn könnte von einer Fernsehkamera dabei gefilmt werden, wie er hinter einem Gewerkschaftstransparent marschierte oder einen Molotowcocktail warf oder mit einer Glasflasche auf einen Polizisten losging.
»Nein, Mum. Er ist ins Atelier gefahren. Er räumt doch heute seine restlichen Sachen aus.«
»Ach ja. Hatte ich vergessen.« Dann fügte sie nach einer Pause hinzu: »Er wird sein Atelier vermissen.«
»Ich weiß. Es ist schwer für ihn.«
»Trotzdem«, fuhr sie nun resoluter fort, »die Miete für einen großen kalten Keller in der Stadt wäre schließlich reine Geldverschwendung, wo ihr doch zu Hause so viel ungenutzten Platz habt.«
»Ja, Mum«, erwiderte ich, doch noch während sie das sagte, und ich es auch einleuchtend fand, meldete sich ein leiser Zweifel in mir, und ich dachte daran, wie still Harry in letzter Zeit jedes Mal geworden war, wenn wir darüber sprachen, dass er sein Atelier in die Garage neben unserem Haus verlegen könnte. Er liebte sein Atelier. Er liebte die Einsamkeit und Ungestörtheit dort. Das wusste ich. Aber finanziell gesehen war es unsinnig. Und dann musste ich daran denken, wie wir gestern Abend nebeneinander an der Spüle gestanden und den Abwasch gemacht hatten, und an mein Angebot, ihm beim Umzug zu helfen. »Nein, Robin«, hatte er gesagt, mit dumpfer, ausdrucksloser Stimme, die Augen auf den Teller in seiner Hand gerichtet, und ich hatte die Enttäuschung gespürt, die er fast greifbar ausstrahlte, und ganz plötzlich auch einen Anflug von Reue, eine Ahnung, dass es vielleicht ein Fehler war. Er war manchmal so verletzbar.
»Überhaupt«, sagte meine Mutter jetzt, »wenn jemand auf die Straße gehen sollte, dann du.«
»Ich?«
»Ja! Architekten hat die Krise doch schlimm getroffen, oder?«
»Das schon, aber –«
»Wie viele Tage die Woche arbeitest du jetzt? Vier? Drei?«
»Dreieinhalb.«
»Dreieinhalb. Und das, wo ihr die Hypothek auf ein Haus abbezahlen müsst, das jeden Tag über euch zusammenbrechen kann.«




























