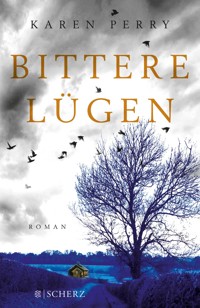9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Sie behauptet, deine Tochter zu sein, und du lässt sie in dein Leben. Vertraust ihr, bedingungslos. Bis es zu spät ist … Der große Sunday-Times-Bestseller – »Karen Perrys bester Roman.« Tana French Eines Nachmittags steht Zoë Barry in Professor David Connollys Büro an der Dubliner Uni und behauptet, seine Tochter zu sein. David ist wie vor den Kopf geschlagen und traut seinen Ohren nicht. Nach dem ersten Schock stellt er Zoë seiner Frau Caroline und seinen Kindern vor. Bald ist die junge Frau Teil der Familie, zieht sogar bei den Connollys ein. Doch während sie in Davids Gegenwart schüchtern und verletzlich wirkt, zeigt sie Caroline gegenüber ein anderes Gesicht – kühl, berechnend, beinahe verschlagen. Ist Zoë die, die sie vorgibt zu sein? Wen haben die Connollys in ihr Haus und in ihr Leben gelassen? Eine Tochter? Eine Schwester? Oder eine völlig Fremde, die geduldig darauf wartet, ihrer aller Leben zu zerstören? Der neue Roman des Erfolgsduos Karen Perry – unter die Haut gehende Psychospannung made in Irland
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Ähnliche
Karen Perry
Girl Unknown - Schwester? Tochter? Freundin? Feindin?
Roman
Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
FISCHER E-Books
Inhalt
Prolog
Das Wasser ist kalt, doch der anbrechende Tag bringt bereits die Verheißung von Hitze mit sich. Bald wird das Sonnenlicht den Garten erreichen. Insekten schwirren und summen im Gebüsch, Lavendelduft entströmt den Töpfen auf der Terrasse. Tropfen rollen vom Rand des Sprungbretts, fallen mit trägem Platschen auf die schwankende Wasseroberfläche des Pools.
Eine Seemöwe landet auf der Mauer und späht mit ihren Knopfaugen auf der Suche nach Futter oder bloß aus Neugier nach unten ins Wasser. Das Tropfen vom Sprungbrett wird langsamer.
Der Vogel mustert den Garten – das gedrungene, stille Haus im Hintergrund, die Schatten auf der Terrasse. Er hebt einen Flügel und stößt seinen gelben Schnabel ins Gefieder, ordnet es. Er hebt den Kopf, legt den Flügel wieder an und schaut erneut nach unten.
Im Wasser dreht sich etwas – oder eher, jemand. Die wachsame Möwe blinzelt. Das Wasser wird dunkler. Ein zur Seite gewandtes Gesicht, eine untergetauchte Gestalt. Der Mund ist offen, doch es gibt keine glänzende Spur aus Luftblasen, keinen silbrigen Atem.
Das einzige Geräusch ist das langsame Tropfen von Blut, das auf die glatte Fläche des Pools trifft, ehe es durch blaugrünes Wasser schwebt, sich vermischt und schließlich verschwindet.
Teil Eins
1David
Ich denke, ich fange am besten ganz am Anfang an, mit unserer ersten Begegnung. Genauer gesagt, mit unserer ersten Unterhaltung, denn gesehen hatte ich sie vorher schon – unter den Erstsemestergesichtern, die mich im Hörsaal anschauten. Ihr Haar machte es fast unmöglich, sie nicht zu bemerken. Diese hellblonden, schimmernden, lang herabfallenden Locken, wie ein sanftes Ausatmen. Im Halbdunkel von Hörsaal L fing es das Licht auf und reflektierte es, golden und schillernd. Ich bemerkte das Haar und das strahlende runde Gesicht darunter und dachte: Unverbraucht. Dann kehrten meine Gedanken zurück zu meinen Folien, und ich redete weiter.
In den ersten Wochen eines neuen Semesters herrscht auf dem Campus eine unvergleichliche Energie. Die Luft ist aufgeladen mit faszinierenden Möglichkeiten. Ein optimistischer Elan greift um sich, verleiht den ausgetretenen Gängen, den abgenutzten Räumen neues Leben und neuen Glanz. Selbst die routiniertesten Veteranen im Lehrkörper bewegen sich während des ersten Monats mit federnden Schritten, und ein Gefühl von Zuversicht steckt alle an. Sobald die Hektik der Einführungswoche abgeklungen ist, und die Vorlesungen und Seminare ihren Rhythmus gefunden haben, wird der Campus von Arbeitseifer erfasst, wie wirbelndes Herbstlaub. Er schwirrt durch die Korridore und Treppenhäuser, fegt über die Rasenflächen, wo die Studierenden zusammensitzen und Kaffee trinken. Auch ich spürte das – dieses Pulsieren von Möglichkeiten, den Drang, das neue Semester schwungvoll anzugehen. Nach siebzehn Jahren an der Universität war ich noch immer nicht immun gegen die tatkräftige Hochstimmung der Erstsemester.
Das Semester war erst ein paar Wochen alt, als sie mich das erste Mal ansprach. Ich hatte gerade meine Donnerstagmorgen-Vorlesung über neuere irische Geschichte beendet, und die Studierenden verließen den Saal, unterhielten sich mit zunehmender Lautstärke, während sie die Stufen zum Ausgang hochgingen. Ich klappte meinen Laptop zu und packte meine Notizen ein, war mit der Frage beschäftigt, ob ich noch genug Zeit für einen schnellen Kaffee im Dozentenzimmer hatte, als ich jemanden ganz in meiner Nähe spürte und aufschaute. Sie stand mir gegenüber, ihre Mappe an die Brust gedrückt, das Gesicht halb versteckt hinter dem langen, goldblonden Haar.
»Dr. Connolly«, sagte sie, und ich registrierte sofort den Anflug eines Belfaster Akzents.
»Ja?«
»Hätten Sie vielleicht kurz Zeit für mich?«
Ich schob den Laptop in meine Tasche, hängte mir den Trageriemen über die Schulter und bemerkte eine gewisse Anspannung im Blick ihrer großen runden Augen. Sie hatte einen hellen Teint und wirkte wie frisch gebadet. Viele Studentinnen in meinen Veranstaltungen sind dick geschminkt, eingehüllt in ein Miasma aus chemischen Gerüchen. Diese junge Frau war anders: Sie hob sich durch eine Frische und Schlichtheit ab, die sie schrecklich jung erscheinen ließ.
»Natürlich«, sagte ich munter. »Ich habe in ein paar Minuten eine Besprechung, aber wenn Sie wollen, können Sie mich ein Stück begleiten.«
»Oh. Nein, ist schon okay.«
Enttäuschung, ein unsicherer Gesichtsausdruck, der mein Interesse weckte.
»Vielleicht ein andermal«, sagte sie.
»Meine Sprechstunde ist freitagnachmittags von drei bis fünf. Da können Sie gern kommen. Falls Sie da keine Zeit haben, können Sie auch einen Termin per E-Mail vereinbaren.«
»Danke«, sagte sie höflich. »Das mach ich.«
Wir gingen zusammen die Stufen zum Ausgang hoch, wortlos, betretenes Schweigen zwischen uns.
»Also, dann auf Wiedersehen«, sagte ich mit einem Blick auf die Uhr und tauchte in den Strom von Studierenden auf dem Weg zur Treppe ein.
Als ich zu meiner Besprechung kam, hatte ich sie schon vergessen. Seltsam, wenn ich jetzt daran zurückdenke. Schließlich war unsere erste Begegnung so folgenschwer. Heute betrachte ich diesen Moment als den Punkt, an dem mein Leben sich teilte – wie eine Buchseite, die man falzt und damit alles in davor und danach unterteilt.
Mein Büro liegt im zweiten Stock des geisteswissenschaftlichen Gebäudes. Seine Wände sind bedeckt mit Regalen voller Bücher und gerahmten Drucken: die Osterproklamation von 1916, zwei William-Orpen-Skizzen aus den Schützengräben des Ersten Weltkriegs, eine verblichene Fotografie, die meinen Großvater zusammen mit anderen aus dem Kavallerieregiment Royal Dragoon Guards zeigt, und schließlich eine Karikatur aus dem New Yorker von zwei streitenden Akademikern, Letztere ein Geschenk meiner Frau. Dann hängt da noch ein Familienfoto von uns vier, ein Selfie, das ich im letzten Sommer auf einer Wanderung zum Hell Fire Club in den Dubliner Bergen mit meinem Handy gemacht hatte: Hollys Haare sind windzerzaust, Robbie grinst, und Caroline tränen die Augen – wir sehen glücklich aus, einzeln und als Familie. Ich habe die Arme irgendwie um uns alle geschlungen, und die Stadt mit ihren Vororten, der Campus und dieses Gebäude sind als verschwommener Hintergrund in der Ferne zu sehen.
Mein Guckloch in die Außenwelt, und das Hübscheste an diesem Büro, ist das große Südfenster, das auf den Innenhof geht. Dort wachsen ein paar Birken, und ich kann das ganze Jahr über verfolgen, wie sich die Farben des Laubs verändern, und die Jahreszeiten vergehen.
Ich habe mein ganzes Erwachsenenleben – bis auf drei Jahre Promotion an der Queen’s University – auf diesem Campus verbracht. Ich habe jede Minute davon genossen und schätze mich glücklich, hier zu sein und allmählich die Karriereleiter bis zum Lehrstuhlinhaber hochzuklettern, und ich liebe die Interaktion mit Studierenden in den Vorlesungen und Seminaren. Ich liebe die wissbegierigen jungen Leute, mit denen ich es zu tun habe – die aufbrausende und mitunter respektlose Arroganz, mit der ein Student die Vergangenheit in Frage stellt. Ich gebe zu, ich war ehrgeizig, und ich habe hart arbeiten müssen. Mir ist nichts in den Schoß gefallen – nicht wie bei anderen, die anscheinend eine natürliche Begabung für die Deutung der Vergangenheit besitzen. Meine Arbeit war mühsam, aber sie hat mir Freude gemacht.
Dennoch, die junge Frau tauchte zu einem Zeitpunkt auf, als sich mir die Chance auf einen besonderen Karrieresprung bot. Mein ehemaliger Lehrer und der Leiter unserer Fakultät, Professor Alan Longley, würde in zwei Jahren in den Ruhestand gehen. Er hatte mehr als einmal unmissverständlich angedeutet, dass ich sozusagen alle Trümpfe in der Hand hielt, um sein Nachfolger zu werden. Natürlich würde die Fakultätsleitung mehr Arbeit mit sich bringen, aber ich war bereit, die zusätzliche Aufgabe zu übernehmen und mich der Herausforderung zu stellen. Das machte mein Leben aus: der befriedigende Arbeitsrahmen, den ich mir aufgebaut hatte – das heißt, bis zum letzten Herbst.
Damals, in jenen Septemberwochen, als das Licht sich veränderte und die Luft erstmals kühl wurde, wusste ich so gut wie nichts über sie. Ich kannte nicht mal ihren Namen. Ich hatte, glaube ich, nicht mehr an sie gedacht, bis ich am Freitagnachmittag meine Sprechstunde abhielt. Die ersten Studierenden trudelten kurz nach drei ein – ein Zweitsemester, der Fragen zu seiner Hausarbeit hatte, eine Examenskandidatin mit Prüfungsangst, eine weitere, die überlegte, an den Bachelor noch den Master anzuhängen. Sie kamen einer nach dem anderen herein, und ich merkte, dass ich anfing, nach ihr Ausschau zu halten, jedes Mal damit rechnete, ihr helles Gesicht in der Tür zu sehen.
Ich hatte irgendwann zwei kleine Sessel und einen niedrigen Couchtisch von zu Hause in mein Büro gebracht, um die Unterredungen mit den Studierenden in einem entspannteren Rahmen führen zu können. Mir gefällt das Machtungleichgewicht nicht, wenn ich hinter dem Schreibtisch sitze und sie davor. Ich ließ die Tür während der Besprechungen offen, bei Studenten ebenso wie bei Studentinnen. Wissen Sie, vor Jahren, als ich noch wissenschaftlicher Mitarbeiter war, sah ein Kollege sich dem schlimmen Vorwurf einer Studentin ausgesetzt, er habe sie in seinem Büro sexuell belästigt. Ich weiß noch, wie schockiert ich damals war: Er war ein schmächtiger Typ mit der unschönen Angewohnheit, ständig zu schniefen, wenn er sich auf eine Sache konzentrierte.
So seltsam es klingen mag, ich konnte mir nicht vorstellen, dass er überhaupt irgendwelche sexuellen Gelüste hatte. Die meisten Akademiker sind ganz normale Leute, deren Leben sich keineswegs von dem anderer Leute gleich welcher Profession unterscheidet. Manche jedoch sind realitätsfremd, kaum geeignet, außerhalb der schützenden Mauern der Universität zurechtzukommen. Der Unglückliche hieß Bill – ein fleißiger Historiker, aber leider sehr naiv. Ein freundlicher und sanftmütiger Mann, den die Beschuldigung wie ein Hammerschlag traf. Über Nacht mutierte er zu einem grimmigen Sonderling, der keine Gelegenheit ausließ, seine Unschuld zu beteuern, häufig zu den unpassendsten Zeitpunkten – auf Fakultätssitzungen, im Dozentenzimmer beim Kaffee, einmal sogar am Tag der offenen Tür. Ein Disziplinarausschuss untersuchte die Behauptungen und kam zu dem Ergebnis, dass sie jeder Grundlage entbehrten. Bill wurde entlastet. Die Studentin machte ihren Abschluss und verließ die Uni. Bill arbeitete weiter, doch er hatte sich verändert. Er ging nicht mehr mit uns anderen Kaffee trinken und vermied jeden sozialen Umgang mit Studierenden. Es war keine Überraschung, als er ein Jahr später erklärte, dass er eine Stelle an einer Uni im Ausland angenommen hatte. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt ist, obwohl ich ab und zu an ihn denke, wenn es auf dem Campus mal wieder zu einem Skandal kommt, oder wenn ich den Blick einer Studentin als eine Spur zu intensiv empfinde.
Irgendetwas an der Art, wie sie mich an dem Tag angesehen hatte, wie ihre Stimme gestockt hatte, ließ mich an Bill denken. Ich war neugierig, aber auch auf der Hut. Die mit den Rehaugen, die jung und unschuldig wirken, bei denen muss man vorsichtig sein. Nicht bei den Lässigen mit den Ugg-Stiefeln und der Solariumbräune – die sind durchsetzungsstark, und ein Mann wie ich passt nicht in ihr Beuteschema. Ich bin vierundvierzig, Vater von zwei Kindern. Ich ernähre mich gut und mache regelmäßig Sport. An den meisten Tagen fahre ich mit dem Rad zur Uni; dreimal die Woche gehe ich schwimmen. Ich versuche, auf mich zu achten, könnte man sagen. Schön, ich bin nicht der attraktivste Mann der Welt, aber so schlecht sehe ich auch wieder nicht aus. Ich bin knapp einen Meter achtzig groß, habe dunkles Haar, braune Augen und einen blassen Teint. Mein Dad meinte, wir hätten spanisches Blut in den Adern: »Von den Seeleuten der Armada, die damals an der Westküste Irlands gestrandet sind.« Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber nach dem, was Bill passiert ist, halte ich es nicht für gänzlich unmöglich, dass eine Studentin sich in mich verknallen könnte. Doch zu jenem Zeitpunkt war ich seit siebzehn Jahren verheiratet, und mir war durchaus bewusst, wie teuer mich ein dummer Fehler zu stehen kommen könnte. Außerdem hatte ich zu viel zu verlieren.
Ich schätze, solche Gedanken schossen mir durch den Kopf, als wir das erste Mal miteinander sprachen. Ihr Widerstreben, mit mir zu reden, während sie neben mir herging – als erforderte die Schwere dessen, was sie mir zu sagen hatte, Ungestörtheit, Ruhe und meine volle Aufmerksamkeit.
An jenem Freitag rechnete ich fest damit, dass sie in mein Büro kommen würde. Aber sie kam nicht. Ich muss gestehen, ich war enttäuscht. Sie blieb ohne Erklärung weg, was nicht heißen soll, dass ich eine solche gebraucht oder erwartet hätte. Sie bat auch nicht per E-Mail um einen Termin. In der darauffolgenden Woche sah ich sie wieder in meiner Vorlesung, die Augen starr auf den Notizblock vor ihr gerichtet, aber als die Stunde vorbei war, verließ sie zusammen mit den anderen Studierenden den Saal.
Die Angelegenheit beschäftigte mich nicht weiter, und ich hätte sie garantiert mit der Zeit völlig vergessen. Ich hatte genug damit zu tun, meine Lehrveranstaltungen und Forschungsprojekte und diversen anderen Verpflichtungen an der Uni unter einen Hut zu bringen, ganz zu schweigen von den vielen Verwaltungsaufgaben, die ich zu erledigen hatte. Außerdem sollte ich in den kommenden Monaten von einigen Radio- und Fernsehsendern zur Hundertjahrfeier des Osteraufstandes von 1916 interviewt werden. Caroline war wieder berufstätig. Wir wechselten uns damit ab, die Kinder zur Schule und zu irgendwelchen Freizeitaktivitäten zu kutschieren. Das Leben war ausgefüllt. Ich war überaus beschäftigt. Ich war glücklich. Das weiß ich jetzt.
Eines Nachmittags dann, im Oktober, kam ich von einer Fakultätsbesprechung zurück in mein Büro und sah sie auf dem Fußboden neben meiner Tür sitzen. Knie angezogen, Hände um die Knöchel. Sobald sie mich sah, stand sie auf und zupfte ihre Kleidung zurecht.
»Kann ich was für Sie tun?«, fragte ich, während ich in der Hosentasche nach dem Büroschlüssel kramte.
»Sorry. Ich hätte einen Termin machen sollen.«
»Tja, jetzt sind Sie schon mal da.« Ich öffnete die Tür. »Kommen Sie rein.«
Ich trat an den Schreibtisch, legte meine Tasche darauf. Es war kalt im Zimmer. Ich ging zum Heizkörper und strich mit den Fingern darüber. Die junge Frau wollte die Tür hinter sich schließen.
»Nein, lassen Sie die bitte auf«, sagte ich.
Sie warf mir einen leicht erschrockenen Blick zu, als wünschte sie, sie wäre nicht gekommen.
»Setzen wir uns, und dann erzählen Sie mir, was Sie auf dem Herzen haben.«
Ich nahm in einem der Sessel Platz, doch sie blieb stehen, fingerte an dem Reißverschluss ihres Pullovers herum. Sie war klein und dünn, knochige Handgelenke lugten aus den Ärmeln, deren Säume vom vielen Herumzupfen ganz ausgefranst waren. Ihre nervösen Finger waren ständig in Bewegung.
»Wie heißen Sie?«
»Zoë«, sagte sie leise. »Zoë Barry.«
»Nun, Zoë. Was kann ich für Sie tun?«, fragte ich, während ich einen Stapel Fachzeitschriften auf dem Couchtisch ordnete.
Ihre Hände wurden still, und mit einer Stimme, die glockenrein klang, sagte sie: »Ich glaube, Sie könnten mein Vater sein.«
2David
Jeden Wochentag kommen Studierende in mein Büro. Manche haben normale Fragen, die sich auf meine Veranstaltungen beziehen. Andere haben Probleme. Sie wollen Hilfe von mir. Sie wissen vielleicht nicht mal, wo genau das Problem liegt. Wieder andere sind das Problem. Im Laufe der Jahre habe ich schon mit allerhand Problemfällen zu tun gehabt. Von harmlos bis kompliziert. Aber keiner war wie dieser. Keiner verhieß so klar und unmissverständlich nichts Gutes oder sprach das Problem mit so offener, wenn auch schüchterner Deutlichkeit aus.
»Ich verstehe nicht«, sagte ich.
»Darf ich die Tür schließen?«
»Nein, lieber nicht.« Ich forderte sie mit einer Geste auf, in dem Sessel mir gegenüber Platz zu nehmen.
»Ich weiß, das ist wahrscheinlich ein Schock für Sie«, sagte sie, als sie sich setzte und ihre Tasche abstellte.
»Ein Schock?«, sagte ich. Wohl eher ein Übergriff oder eine absurde Behauptung. Ich warf einen Blick in meinen Terminkalender für den Tag. Er war voll: Ein Meeting jagte das andere. Die Lehrplanbesprechung würde besonders schwierig werden. Außerdem musste ich noch zur Bibliothek, um mit Laurence über die Zeitzeugendokumente zu sprechen, die er für mich aus der British Library besorgte.
»Na ja … ich tauche hier aus heiterem Himmel auf und eröffne Ihnen, dass ich Ihre Tochter bin.«
»Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Wieso glauben Sie, ich könnte Ihr Vater sein?«, sagte ich.
Ihre Miene veränderte sich nicht. Schüchtern, geradezu scheu, als wäre sie gegen ihren Willen gekommen. »Ich hab darüber nachgedacht, wie ich es am besten formuliere, damit es nicht so unverblümt rüberkommt«, sagte sie und beugte sich ein wenig vor. »Aber egal, wie ich es ausdrücke, Sie sind mein Vater.« Sie hustete verlegen in einen Ärmel. »Ich dachte, es wäre besser, direkt mit der Sprache rauszurücken, als um den heißen Brei herumzureden, wenn das irgendwie Sinn ergibt?«
Sie verzog keine Miene, ihr Gesicht wirkte offen und ehrlich. Sie hatte grüne Augen, groß und strahlend. Hin und wieder fielen ihr die Haare ins Gesicht, und sie musste sie zurückstreichen – eine Angewohnheit, vermutete ich.
»Ich bin jetzt echt erleichtert«, sagte sie mit einem müden Lächeln. »Ich hab ewig hin und her überlegt, wenn ich in Ihrer Vorlesung saß und die ganze Zeit wusste, dass Sie mein Vater sind, und dass Sie keine Ahnung hatten. Irgendwann hab ich’s nicht mehr ausgehalten. Ich fand, ich musste es Ihnen sagen.«
Ihre Stimme, so zaghaft und sanft sie auch war, hatte den erdigen, kehligen Beiklang des Nordens. Ich musste unwillkürlich an die amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg denken, über die ich in letzter Zeit so viel gelesen und geforscht hatte, an die G.I.s, die in verschiedenen Städten von Nordirland stationiert gewesen waren – Coleraine, Ballycastle, Portstewart –, und an ihr ungeschriebenes Vermächtnis: Viele von ihnen hatten nämlich Söhne und Töchter gezeugt, von deren Existenz sie vermutlich nie erfuhren, während andere von ihrem Nachwuchs ausfindig gemacht worden waren. Ich hatte das immer für ein erfreuliches, wenn auch kompliziertes Vermächtnis gehalten – einen Zufluss in den Strom der Vergangenheit –, ein bereicherndes Erbe.
Dennoch, ich begann mich über die Kapriolen meines eigenen Verstandes zu ärgern und über die Störung, die die junge Studentin meinem Tag beschert hatte: den Unsinn, den sie mir auftischte, die Äußerungen einer Unzurechnungsfähigen, was auch immer.
Ich nahm mein Notizbuch, hievte mich aus dem Sessel und ging zu meinem Schreibtisch. Ich spürte, wie die kurze Zündschnur meines Zorns zischte. »Noch mal, wie kommen Sie auf die Idee, dass ich Ihr Vater bin?«
Das Lächeln verschwand aus ihrem Gesicht. Sie beugte sich vor und holte ein Taschentuch aus ihrer Tasche. Ich sah ihr an, dass sie nur mit Mühe die Fassung bewahrte. Vielleicht war ich zu barsch gewesen. Ich hatte ihr gegenüber als Studentin schließlich eine Fürsorgepflicht. Sie war jung, durcheinander. Es musste ihr sehr schwergefallen sein, den – wenn auch fehlgeleiteten – Mut aufzubringen, herzukommen und mit mir zu reden.
»Hören Sie«, sagte ich, »Sie sind offensichtlich aufgewühlt. Und glauben Sie mir, Sie sind nicht die erste Studierende, die hier in Tränen ausbricht. Das Uni-Leben kann sehr belastend sein. Viele tun sich schwer damit. Aber wer Hilfe sucht, findet welche. Ich gebe Ihnen die Nummer von jemandem beim Psychologischen Beratungsdienst, den Sie anrufen können.« Ich ging hinter meinen Schreibtisch und notierte die Nummer auf einem Post-it-Zettel. Claire O’Rourke, eine Psychologin auf dem Campus, war eine alte Bekannte von mir. Während ich schrieb, fragte ich mich kurz, was sie von der Behauptung der jungen Frau halten würde.
Ich riss den Zettel vom Block, ging zu ihr und hielt ihn ihr hin, doch sie nahm ihn nicht. Sie schaute ihn nicht mal an.
Ich kehrte hinter meinen Schreibtisch zurück. »Ihre Entscheidung, wenn Sie die Nummer nicht wollen«, sagte ich. Die Situation fing an, mir lästig zu werden. Ich musste arbeiten. »Ich biete Ihnen gern Hilfe an, aber ich kann Sie nicht zwingen, sie anzunehmen.«
Ich erweckte meinen Computer zum Leben, indem ich auf die Leertaste tippte. Der Monitor wurde hell, und das Bild von Robbie und Holly löste sich auf.
»Meine Mutter hieß Linda«, sagte sie, und meine Hand ließ die Maus los. »Linda Barry.«
Linda Barry … Als ich ihren Namen hörte, fühlte es sich an, als würde eine unverheilte Wunde aufbrechen. Ich hatte ihn so lange nicht gehört, dass es mir vorkam, als würde ich träumen, oder als würde die Zeit mir einen Streich spielen. Mein Mund wurde trocken.
»Linda Barry?«, sagte ich, und wurde jäh in eine andere Zeit, an einen anderen Ort katapultiert, als wäre ihr Name ein geheimes Passwort zur Vergangenheit – zu meiner Vergangenheit, zu einem jüngeren, verantwortungsloseren und leidenschaftlicheren Mann und der damit verbundenen Zeit. Ein Passwort, das auch Kummer barg. Mir stockte der Atem, und ich wurde plötzlich sehr wachsam.
Ich suchte nach irgendeiner Ähnlichkeit in ihrem Gesicht, doch da tauchte die Gestalt eines Studenten in der offenen Tür auf.
»Dr. Connolly?«
»Jetzt nicht«, sagte ich gereizt. »Ich bin in einer Besprechung.« Ich schaltete den Monitor aus. »Kommen Sie später wieder.«
»Vor etwas über einem Jahr hat sie mir von Ihnen erzählt«, flüsterte sie kaum hörbar.
»Sie hat Ihnen von mir erzählt?«
»Sie fand, ich sollte es wissen«, sagte Zoë Barry und zupfte an den Fäden ihres Ärmels.
Ich sah ihr an, dass sie auf eine Reaktion von mir wartete, während ich anfing zu überlegen, ob an ihrer Behauptung etwas dran sein könnte.
»Sie hat mir erzählt, dass Sie ihr Tutor waren, als sie an der Queen’s studiert hat«, sagte sie. »Sie hat mir erzählt, wie Sie beide Freunde wurden und dann eine Zeitlang ein Liebespaar waren.«
Es fühlte sich falsch an – von einer Studentin zu hören, wie sie über mich und Linda sprach, uns als Liebespaar bezeichnete. Konnte das stimmen? Hatte Linda ein Kind bekommen?
Ich dachte an das Wochenende, das wir in Donegal verbracht hatten, bevor wir uns trennten. Drei Tage auf dem Lande. Ich hatte mich gefühlt, als würde ich mein vorheriges Leben, die Jahre des Studiums abstreifen, meine Hingabe an die akademische Welt vergessen, aus einem langen Traum erwachen. Unter der Oberfläche war das Wissen um unsere bevorstehende Trennung spürbar gewesen. Bald würde ich nach Dublin zurückkehren, um eine Stelle an der Uni anzunehmen, an der ich drei Jahre zuvor Examen gemacht hatte. Das Leben, das ich in Belfast geführt hatte, an der Queen’s, würde zu Ende gehen. Und diese Beziehung, diese Liebesgeschichte – ich ahnte nicht, wie viel sie mir bedeutete –, auch sie würde enden. Wir wussten es beide, obwohl keiner von uns es ausgesprochen hatte.
Zoë Barry hob eine Hand an den Mund, und plötzlich bemerkte ich in der gerundeten Form ihres Gesichts eine Ähnlichkeit. Eine Schlichtheit, die reizlos hätte sein können, wären da nicht ihre lebendigen Augen gewesen – Lindas Augen, oder vielleicht doch nicht? Ich war mir nicht ganz sicher.
»Aber wie …«, stammelte ich. »Ich versteh nicht …«
»Sie hat gesagt, die Affäre mit Ihnen wäre kurz gewesen. Anschließend ist sie ins Ausland gegangen, um ihren Master zu machen. Da hat sie erst gemerkt, dass sie schwanger war.«
Ich war inzwischen promoviert und zurück in Dublin. Ich hatte Caroline wiedergetroffen, und wir hatten unsere Beziehung – die während meiner drei Jahre in Belfast auf Eis gelegen hatte – wieder aufgenommen. Nach Linda, nach der Achterbahnfahrt der Gefühle, wollte ich etwas Solides, Stabiles und Verlässliches. »Aber sie hat nichts gesagt. Sie hat mir nie erzählt …«
Ich weiß noch, was für eine Erleichterung es war zu heiraten, die sichere, feste Struktur der Ehe um mich herum zu spüren. Aber durch dieses Mädchen in meinem Büro war ich plötzlich wieder auf hoher See, und das Tosen der Wellen in meinen Ohren übertönte vieles von dem, was sie mir erzählte. Ich musste immerzu an Linda mit einem Baby denken – einem Baby von mir. Wieso hatte sie mir nichts gesagt? Wieso hatte sie das alles allein durchgestanden?
»Das muss schwer für Sie sein«, sagte sie mit neugewonnener Fassung. »Das ist bestimmt nicht leicht zu verkraften.«
Mit der schmächtigen Statur – knochige Handgelenke und Knie, dünne Beine in einer hautengen Jeans, schwere, ochsenblutrote Stiefel – hatte sie etwas Verletzliches an sich, auch wenn sie gerade ihre Granate geworfen und mich ins Taumeln gebracht hatte. »Nicht leicht zu verkraften? Ja, das können Sie laut sagen.«
»Ich weiß«, sagte sie mit einem gequälten Lächeln. »Aber damit Sie’s wissen, ich will nichts von Ihnen.«
»Nein?«
»Nichts!«, sagte sie und lachte nervös. »Ich dachte bloß, Sie sollten es wissen.«
»Und das ist alles? Mehr wollen Sie nicht?«, fragte ich.
Sie zuckte mit den Schultern und begann wieder, an ihren ausgefransten Ärmelbündchen zu zupfen. »Bloß reden.«
»Reden?«
Sie schien sich innerlich zu winden, ihr Gesicht verdunkelte sich. Der Haarvorhang war ihr wieder vors Gesicht gefallen, und sie machte keinerlei Anstalten, ihn zurückzuschieben. Leise sagte sie dahinter versteckt: »Ich wollte Sie bloß ein bisschen kennenlernen.«
Der Wunsch war eigentlich durchaus nachvollziehbar, aber ich blieb skeptisch. »Hat Linda Sie darauf gebracht?«, fragte ich. »Weiß sie, dass Sie mich aufsuchen? Hat sie Ihnen gesagt, Sie sollen herkommen?«
Im Rückblick ist mir klar, wie töricht ich war – wie albern es sich angehört haben muss – zu denken, eine Exfreundin hätte die letzten achtzehn Jahre einen Plan ausgeheckt, wie sie mein Leben ruinieren könnte.
»Meine Mutter ist tot.«
Tot? So nüchtern und so bestimmt ausgesprochen, dass kein Raum für Zweifel blieb. Dennoch hatte ich zunächst den irrationalen Impuls, ihr zu widersprechen, obwohl ich in all der Zeit keinerlei Kontakt zu Linda gehabt hatte. Linda, meine alte Flamme, tot. Ich konnte es nicht fassen. Gegen meinen Willen musste ich an unseren ersten Kuss denken: Sie hatte mich förmlich herausgefordert, sie zu küssen. »Na los«, hatte sie an dem Abend gesagt, als ich sie nach einer Gastvorlesung nach Hause brachte. »Du weißt, dass du es willst.«
Ich stellte mich dumm, trat aber die ganze Zeit näher auf sie zu und sie auf mich, bis ihre Hände meine Jackentaschen packten und meine Hände ihre Taille umfassten. Es war kein langer Kuss gewesen. Sie war rasch zurückgewichen, und ich war ihr in dem Gefühl gefolgt, kurz davor zu sein, einen schrecklichen Fehler zu begehen, aber ohne zu wissen, ob der Fehler darin bestand, ihr zu folgen oder sie mir entgleiten zu lassen.
Und jetzt war sie tot? Die Vorstellung schockierte mich, machte mich sprachlos. Es ist seltsam und unwirklich zu erfahren, dass ein Mensch, den man mal geliebt hat, gestorben ist. Der Gedanke, dass die Zeit zu zweit keine gemeinsame Erinnerung mehr ist, keine von Übereinstimmung und Auseinandersetzung geprägte Erfahrung, kein Raum für umstrittene, aber kostbare, längst vergangene Augenblicke – wie der aufsteigende Rauch eines Lagerfeuers, an dem wir an einem Halloween-Abend in Belfast zusammen standen. Längst vergangen – wie das schwindende Herbstlicht bei Sonnenaufgang. Es ist ein plötzliches Ziehen im Herzen, ein kurzes Erwachen und die Erkenntnis, dass Lindas Leben die ganze Zeit, die wir getrennt waren, weitergegangen ist, die ganze Zeit, die sie vergessen war. Sie existierte weiter, schuf ihre eigene Geschichte. Eine jähe Explosion von Erinnerungen, das Aufflackern alter und zärtlicher Gefühle, dann ist es wieder vorbei.
»Das tut mir sehr leid«, sagte ich zu ihr. »Was ist passiert?«
»Eierstockkrebs. Vor knapp einem Jahr.«
Jetzt ergab das alles mehr Sinn für mich: Eine junge Frau, deren Mutter unlängst gestorben ist, sucht eine Art Ersatz, um ihren Verlust auszugleichen. Es war möglich. Psychologen würden vermutlich von Übertragung sprechen, und auf diesem Campus waren weiß Gott schon seltsamere Dinge passiert. Aber ich war neugierig. »Und wann hat Linda Ihnen von mir erzählt?«, fragte ich.
Sie strich sich das Haar wieder nach hinten. »Als es mit ihr langsam zu Ende ging.«
»Haben Sie sich deshalb an dieser Universität eingeschrieben?«
Sie wurde rot, rutschte in ihrem Sessel hin und her. »Keine Ahnung. Kann sein. Geschichte hat mich schon immer interessiert, und nach Mams Tod wollte ich einfach weg, verstehen Sie. Irgendwo neu anfangen.«
Ob sie mir die Wahrheit erzählte oder nicht, ich konnte nicht anders, als sie ein wenig zu bewundern, ihr neugierig gerecktes Kinn, ihren tapferen Optimismus.
Sie fuhr zusammen, als es plötzlich an der offenen Tür klopfte. Sie stand rasch auf. Ein weiterer Student erschien. »Dr. Connolly?«
»Einen Moment bitte«, sagte ich.
Sie schlang sich bereits den Riemen ihrer Umhängetasche über eine Schulter. »Ich geh besser«, sagte sie.
Unter dem Blick des Studenten an der Tür verabschiedeten wir uns förmlich voneinander. Ich wandte mich ab und ging zum Fenster und wartete, bis der junge Mann Platz genommen hatte. Unten im Hof saßen Kollegen und Studierende an Tischen zwischen den Birken; ihre Gespräche drangen als kaum hörbares Raunen herauf. Schatten bewegten sich am Himmel, der Tag wurde dunkel. Der Student hinter mir räusperte sich.
»Warten Sie bitte kurz?«, sagte ich und ging zur Tür. »Ich bin gleich wieder da.«
Sie war schon fast an der Treppe, als ich sie einholte. Das Haar fiel ihr über die Schulter, während sie den Korridor hinunterschlenderte. Ich rief ihren Namen, und sie drehte sich um. Eine Tür ging auf, und eine Schar Studierende strömte heraus, drängte lärmend an uns vorbei.
»Ich wollte Sie fragen«, sagte ich, »ob Sie es schon jemandem erzählt haben. Irgendwelchen Freunden? Jemandem in der Vorlesung?«
»Nein«, sagte sie.
»Darf ich Sie bitten, es vorerst dabei zu belassen? Bitte. Damit ich etwas Zeit habe, das zu verarbeiten.«
»Keine Sorge«, sagte sie, der Tonfall ausdrucklos und schwer zu deuten. In ihren Augen schien so etwas wie Mitleid auf. Auch in mir regte sich etwas: Scham vielleicht. Es mochte naiv sein, aber ich glaubte noch immer, ich könnte das, was da losgetreten worden war, aufhalten.
»Ich werde nichts verraten«, sagte sie und mischte sich dann unter den Strom von Studierenden. Ich blieb stehen, mit verschwitzten Händen, hielt mich am Treppengeländer fest und wusste auf einmal, dass ich von etwas mitgerissen werden würde, das mächtiger war, als ich ermessen konnte, von etwas Gefährlichem, das sich meiner Kontrolle entzog.
3Caroline
Ich weiß noch, wann es anfing.
Eines Nachmittags im Frühherbst erhielt ich einen Anruf im Büro. Es hatte einen Zwischenfall mit Davids Mutter Ellen gegeben, und ich sollte unverzüglich kommen.
Ich hatte ihr gerade ein Tablett mit Tee und einer Kleinigkeit zu essen ins Wohnzimmer gebracht und den Fernseher für sie eingeschaltet, als mein Handy klingelte, und Davids Nummer auf dem Display erschien.
»Caroline?«
»Ich wollte dich gerade anrufen.«
»Wieso?«, fragte er. »Ist was passiert?«
Ein Unterton in seiner Stimme: eine leichte Gereiztheit oder eine Spur Besorgnis.
»Wer ist dran?«, fragte Ellen, deren Stimme noch immer vor Aufregung bebte.
»David.« Ich stellte den Fernseher lauter, schloss dann leise die Tür hinter mir. In der Diele setzte ich mich auf die Treppe und spürte den Teppichboden, aus dem ein muffiger Geruch aufstieg, rau hinten an den Beinen. »Deine Mum«, sagte ich zu ihm. »Sie hat wieder die Orientierung verloren.«
»O Gott.«
»Es geht ihr gut –«
»Was ist passiert?«
Ich erzählte ihm von dem Anruf, den ich bekommen hatte – Ellens Nachbarin Marion, die atemlos und gehetzt klang: Ich sollte Sie doch anrufen, wenn irgendwas ist. Dann erzählte sie mir, dass sie Ellen bei Tesco in der Tiefkühlabteilung entdeckt hatte, weinend, weil sie nicht wusste, wo sie war oder wie sie nach Hause kommen sollte. Das war nicht der erste Vorfall dieser Art. »Ich hab sie vor den Fernseher gesetzt«, sagte ich, »und ihr Tee und Toast mit Baked Beans gemacht.«
»Soll ich rüberkommen?«
Ellen hatte gerade begonnen, sich zu beruhigen. Wenn ihr Sohn jetzt käme, würde sie das Ganze für ihn noch einmal durchleben. »Warte bis zum Wochenende, David. Lass ihr Zeit, sich zu erholen.«
»Okay«, sagte er, und dann: »Caroline?«
»Ja?«
Er zögerte. »Nichts. Das kann warten.«
Aber da war irgendwas in seiner Stimme – ein Tonfall, den ich nicht deuten konnte.
Ich wusste sofort: Irgendwas war passiert.
Sie kam in unser Leben, in unser Haus, zu einer für mich schwierigen Zeit, einer Zeit, die aus heutiger Sicht von Nervosität und Selbstzweifeln bestimmt war. Ich hatte nach einer fünfzehnjährigen Unterbrechung wieder in der Werbeagentur angefangen, wo ich aufgehört hatte, als Robbie geboren wurde. Alles kam mir anders vor, wie ein fremdes Territorium, das ich einmal betreten hatte, an das ich mich aber nicht mehr erinnern konnte. Nichts war vertraut.
Die Entscheidung, meine Karriere an den Nagel zu hängen, um für die Kinder da zu sein, bedauerte ich keineswegs, obwohl die Langeweile, die Einsamkeit mitunter belastend gewesen waren. Ich hatte das tiefe Bedürfnis, für meine Kinder ein warmes und liebevolles Umfeld zu schaffen, wo immer jemand war, der darauf achtete, dass sie ihre Hausaufgaben machten, der das Essen auf den Tisch brachte, nach ihnen sah, wenn sie schliefen. Ich tat das gern. Mein einziger bleibender Kontakt zur Agentur beschränkte sich auf den Kalender, den ich jedes Jahr zu Weihnachten geschickt bekam und der für jeden Monat ein Hochglanzbild von einem Auto oder einem alkoholischen Getränk oder irgendeinem anderen Produkt zeigte, dessen Vermarktung angekurbelt werden sollte. Ich gebe zu, wenn der Kalender kam und ich all die Namen der Mitarbeiter las, die auf der dazugehörigen Grußkarte unterschrieben hatten, gab mir das einen Stich, der in Richtung Neid ging. Flüchtig, aber ich spürte ihn trotzdem – einen Anflug von Unsicherheit oder Bedauern, der aufkam, wenn ich daran erinnert wurde, was ich aufgegeben hatte. Als ich Peter zufällig über den Weg lief und er erwähnte, dass eine Mitarbeiterin demnächst für zehn Monate in Mutterschaftsurlaub ging, setzte sich die Idee in meinem Kopf fest. Meine Kinder waren alt genug. Ich hatte Zeit zur Verfügung. Ich war zwar schon sehr lange aus dem Geschäft, aber ich spürte das Verlangen danach, den Sog einer fernen Sehnsucht. Ich hatte nicht mit Zoë gerechnet. Ich hatte nicht mal von ihrer Existenz gewusst.
Als ich an dem Abend von Ellen durch dichten Verkehr nach Hause fuhr, hatte ich noch immer lebhaft das Bild vor Augen, wie meine alte Schwiegermutter im Supermarkt bitterlich weinend vor Kühlschränken mit Fischstäbchen und Tiefkühlerbsen stand. Ich öffnete die Haustür und hörte Geräusche aus dem Wohnzimmer, Bewegung oben. Ich zog in der Diele meine Schuhe aus und verharrte kurz, um das Wohlgefühl zu genießen. Nachdem ich meine Jacke an die Garderobe gehängt hatte, ging ich ins Wohnzimmer.
Robbie saß im Schneidersitz auf der Couch. Im Fernsehen schluchzte eine Frau vor einem Studiopublikum, einen beschämt dreinblickenden Mann neben sich.
»Hallo, Schätzchen«, sagte ich. »Entschuldige, dass ich so spät komme.«
»Hey, Mum«, antwortete er.
»Ich war bei Oma«, sagte ich, obwohl er gar nicht um eine Erklärung gebeten hatte. »Wo ist dein Dad?«
»Oben.«
Er trug noch immer seine Schuluniform, und nachdem er ein rasches Lächeln in meine Richtung geworfen hatte, starrte er wieder gebannt auf den Bildschirm, dessen flackernde Bilder die einzige Lichtquelle im ansonsten dunklen Raum waren. Das Studiopublikum pfiff und buhte, während der Moderator durch die Sitzreihen ging. Robbie rutschte unter meinem Blick unruhig hin und her, und dann bemerkte ich eine leere Chipspackung, die er neben sich in die Couchritze gestopft hatte.
»Du hast doch wohl nicht die ganze Tüte aufgegessen, oder?«
Er lächelte wieder und verzog das Gesicht. »Sorry, ich hatte Hunger.«
»Robbie …«
»Sorry!«, sagte er wieder, noch immer lächelnd. Mit seinen fünfzehn Jahren war er in einer schwierigen Übergangsphase, gefangen im hormonellen Niemandsland zwischen Kind und Erwachsenem. In Augenblicken wie diesem, wenn er mich schelmisch angrinste, war er wieder mein kleiner Junge. Ich ließ es dabei bewenden.
Auf dem Weg nach oben hörte ich Musik aus Hollys Zimmer kommen – irgendein blecherner Popsong –, und die süße, stockende Stimme meiner Tochter, die mitsang. Ich ging an ihrer Tür vorbei, öffnete leise die zu unserem Schlafzimmer und sah David ausgestreckt auf dem Bett, die Augen geschlossen, ein Glas Wein in einer Hand auf der Brust. Ich betrachtete ihn einen Moment, sein attraktives Gesicht, das ernst war, selbst wenn er ruhte, die Lach- und Konzentrationsfalten, die sich allmählich dauerhaft eingruben. Er bewegte sich leicht.
»Achtung, dein Wein.«
Seine Augen öffneten sich jäh, und er setzte sich rasch auf. Ich streckte die Hand aus und rettete das Glas, hob es an die Lippen und trank einen Schluck.
»Ich hab dich gar nicht reinkommen hören«, sagte er blinzelnd und fuhr sich mit einer Hand übers Gesicht.
Der Wein wärmte mir die Kehle. Ich stellte das Glas auf den Nachttisch und setzte mich neben ihn aufs Bett. Er legte sich wieder hin, verschränkte die Hände im Nacken, und ich spürte zu meiner Überraschung, wie sich kurzes Begehren in mir regte. Ich könnte mich neben ihn aufs Bett legen, und während das Abendessen im Backofen verbrutzelte, könnten wir uns ausziehen und die Sorgen des Tages für eine Weile vergessen. Es war eine gewagte Vorstellung, Sex um diese Zeit am Abend, mit den Kindern im Haus, während unten der Fernseher lief. Ich legte eine Hand vorn auf sein Hemd, fuhr mit einem Finger bis hinunter zu seinem Gürtel. Eine solche Spontaneität kam mir noch immer unnatürlich vor nach dem, was zwischen uns passiert war. Er schloss die Augen und bewegte sich unter meiner Berührung, stimmte meinem unausgesprochenen Vorschlag stillschweigend zu.
Hollys Zimmertür ging auf, dann waren ihre Schritte draußen auf dem Flur zu hören. Meine Hand verharrte, und David öffnete die Augen.
»Was denkst du?«, fragte ich.
Er setzte sich auf und schwang die Füße auf den Boden. Der Moment war vorüber. Er nahm sein Weinglas vom Nachttisch und sagte: »Komm. Gehen wir nach unten und essen.«
In der Küche schaltete er das Radio ein, und ich nahm den Salat aus dem Kühlschrank. Irgendeine Moderatorin, deren forsche Stimme den Raum zwischen uns füllte, stellte einem Politiker kritische Fragen zu seinem gescheiterten Versuch, Abtreibung bei fetalen Missbildungen zu legalisieren. Vor gut einem Jahr hatten wir unser Haus umfangreich renovieren lassen. Wir hatten den Dachboden ausgebaut und durch einen Anbau die Küche vergrößert, wodurch wir zusätzlich Platz für ein Sofa und einen Ofen sowie einen großen Esstisch und eine Kücheninsel hatten. Die Umbauarbeiten waren kostspielig gewesen, und ohne die kleine Erbschaft von meinen Eltern, die einige Jahre zuvor verstorben waren, hätten wir sie uns nicht leisten können. Ein Darlehen von der Genossenschaftsbank hatte die noch fehlende Summe abgedeckt.
Meistens, wenn David abends müde von der Arbeit kam, warf er sich aufs Sofa und plauderte mit mir, während ich das Abendessen zubereitete. An diesem Abend jedoch lehnte er sich gegen die Arbeitsplatte und erkundigte sich nach Ellen, während ich den Salat in der Spüle wusch. Ich war müde, beantwortete aber seine Fragen, und er hörte mit verschränkten Armen zu. Es war klar, dass wegen des sich verschlechternden Geisteszustands seiner Mutter irgendetwas geschehen musste, und wir diskutierten verschiedene Ideen, obwohl wir beide das Thema lieber gemieden hätten.
Es gab noch etwas anderes, das ich ihm erzählen musste. Ich überlegte, ob ich es jetzt zur Sprache bringen oder lieber warten sollte, bis die Kinder im Bett waren. David wirkte abgelenkt, und ich hatte leichte Kopfschmerzen. Ich bat ihn, mir ein Glas Wein einzuschenken, während ich den Salat schleuderte. Als er Robbie und Holly zum Essen rief, beschloss ich, die Sache rasch zur Sprache zu bringen, ehe die Kinder hereinkamen.
»Die Schule hat eine E-Mail geschickt«, sagte ich, nahm die Teller aus dem Schrank und stellte sie nebeneinander auf die Arbeitsplatte. »Der Elternsprechtag für Robbie ist nächsten Dienstag. Hast du da Zeit?«
Er stellte die leere Weinflasche in die Kiste neben der Tür. »Nächsten Dienstag?«
»Ja, am Nachmittag.«
Ich nahm die Lasagne aus dem Backofen, stellte sie auf den Untersetzer und teilte sie in Portionen auf. David stand neben mir und wartete darauf, die Teller zum Tisch zu bringen. »Kannst du nicht hingehen?«, fragte er.
»Das dauert nicht lange. Höchstens eine Stunde. Die da kannst du schon hinstellen.« Ich deutete auf die ersten zwei Teller, und er nahm sie, rührte sich aber nicht von der Stelle. Er wartete darauf, dass ich noch etwas sagte, das spürte ich. Ich gab Lasagne auf die anderen Teller, öffnete dann den Backofen und stellte die Form wieder hinein, um den Rest warm zu halten.
»Caroline –«
»Bitte, David. Es ist nur ein Nachmittag.«
»Darum geht’s nicht. Das weißt du.«
Ich spürte, wie meine Wangen rot wurden. Ich nahm die anderen Teller und wartete darauf, dass er mich vorbeiließ.
»Es ist ein Jahr her«, sagte er, mit sanfter, aber nachdrücklicher Stimme. »So kann das nicht weitergehen. Du kannst dich nicht ewig von der Schule fernhalten.«
Im Radio gab die Moderatorin einen übertrieben lauten Seufzer von sich, wie immer, wenn sie das Ende eines Interviews signalisierte. Die Küchentür öffnete sich.
»Bitte, verlang das nicht von mir«, sagte ich, als ich an ihm vorbeiging. Ich stellte die Teller mit einem Knall auf den Tisch.
Beim Essen erzählte Holly von einem für Ende Oktober geplanten Schulausflug in den Burren-Nationalpark. Begeistert sprach sie von Tropfsteinhöhlen und Kalksteinablagerungen, Sumpfgebieten und deren abwechslungsreicher Pflanzenwelt. Robbie lümmelte auf seinem Stuhl, einen Ellbogen auf dem Tisch, und stocherte in seinem Essen herum. David war still. Die Kinder führten das bestimmt auf seine Arbeit zurück. Wir machten immer Witze darüber, die Kinder und ich. »Dad ist wieder auf der dunklen Seite«, sagten wir zum Beispiel, wenn er zerstreut und abwesend wirkte. An dem Abend schien er noch schweigsamer als sonst, was ich auf den Elternsprechtag zurückführte. Ich wusste, dass er daran dachte, was ein Jahr zuvor passiert war, dass die ganze peinliche Geschichte an der Schule wieder ihre hässliche Fratze zeigen würde. Um ihn auf andere Gedanken zu bringen, erzählte ich von dem Drama meines Nachmittags, dem Anruf in der Arbeit, dem verwirrten Zustand, in dem ich Ellen angetroffen hatte.
»Morgen früh ruf ich als Allererstes Dr. Burke an«, sagte ich.
»Die arme Oma«, sagte Holly und trank einen Schluck von ihrem Wasser, die Augen hinter ihrer Brille entgeistert.
»Sie wird schon wieder«, sagte David zu ihr, in der Stimme eine Bestimmtheit, die wie eine Warnung klang.
Er war verärgert wegen der Schulsache, was ich ihm nicht verübeln konnte, aber trotzdem. Ich hatte mich den ganzen Nachmittag um seine Mutter gekümmert und bislang noch kein Wort des Dankes von ihm gehört. »Isst du das nun oder nicht?«, fragte ich Robbie.
Müde drückte er mit der Gabel auf das Stück Lasagne, das auf seinem Teller kalt wurde. »Ich hab keinen Hunger.«
David ließ sein Besteck klappernd auf den Teller fallen, und wir schauten alle erschrocken auf. »Wenn du nicht eine ganze verdammte Tüte Doritos in dich reingestopft hättest, dann hättest du vielleicht noch Platz im Magen«, fauchte er.
Robbie öffnete den Mund, als wollte er etwas sagen, brachte aber kein Wort heraus.
»David, bitte«, sagte ich scharf.
Er starrte mich über den Tisch hinweg an.
Mein Mann geht nicht in die Luft, er zieht sich zurück. Er macht mich mürbe mit seinem hartnäckigen Schweigen. Wir stritten aus Prinzip niemals vor den Kindern – nicht mal, als unsere Ehe in der Krise war. In dieser Phase hatten wir die Streitereien auf die Zeiten beschränkt, wenn wir allein waren, und im Beisein der Kinder eine angestrengte Höflichkeit bewahrt. Diesmal war sein Unbehagen anders, und ich begriff, dass es gar nichts mit der Schule zu tun hatte.
»Lasst uns einfach essen«, sagte er.
Er widmete sich wieder seinem Teller und spießte ein Stück Pasta mit der Gabel auf. Wir hatten den Salat ganz vergessen, der noch neben der Spüle stand, aber keiner von uns machte Anstalten, ihn zu holen. Die Abspannmusik der Radiosendung schallte fröhlich aus den Lautsprechern, und wir saßen schweigend am Tisch, bis wir mit dem Essen fertig waren.
Immer, wenn ich versuche, mich daran zu erinnern, wie alles anfing, denke ich nicht an den Morgen, an dem ich es erfuhr, oder an das erste Mal, als ich die blonde Haarmähne, den katzenartigen Blick sah. Ich denke an David an dem Abend, die extreme Anspannung in ihm, seine unstete Gereiztheit. Ich wusste nicht, dass sie der Grund war – Zoë. Ich wusste nicht mal, dass sie existierte. Aber da spürte ich zum ersten Mal ihren Schatten über mich fallen. Spürte zum ersten Mal die Schwingungen einer neuen Präsenz in meinem Zuhause, wie ein Farbstoff, der sich in Wasser ausbreitete, seine Chemie bereits veränderte.
4David
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war mein erster Gedanke: Sie ist tot. Linda ist tot.
Ich spürte keine richtige Trauer. Wie auch? Sie war schon lange aus meinem Leben verschwunden. Aber trotzdem war ich traurig, und durch den Schock war ich irgendwie neben der Spur, innerlich aufgewühlt. Ich stand auf, klatschte mir Wasser ins Gesicht, rasierte mich, duschte und riss mich zusammen, so gut ich konnte. Beim Frühstück stabilisierte sich meine Welt wieder um mich herum. Robbie und Holly waren ganz auf ihre Cornflakes konzentriert, während Caroline für sie die Lunchpakete fertig machte. Ich frühstückte rasch zu Ende, beugte mich zu Caroline, um ihr einen Abschiedskuss zu geben, und spürte ihre warmen Lippen auf meinen. Ich sagte mir: Alles wird gut.
Ich stieg aufs Rad und fuhr los, meine Lunge füllte sich mit Luft, und als ich an dem zähfließenden Verkehr vorbeistrampelte, versuchte ich, mir einzureden, dass sich Zoë Barry, selbst wenn Linda gestorben war, bloß einen Scherz mit mir erlaubte, einen ausgeklügelten Streich. Studierende machen oft verrückte Sachen, lassen sich irgendwelche Gags und Dreistigkeiten einfallen. Und deshalb gab es keinen Grund, meiner Frau zu erzählen, was sie gesagt hatte. Vielleicht hatte jemand sie dazu angestiftet. Vielleicht war ich gar nicht ihr Vater.
Auf dem Campus verbrachte ich die erste Stunde damit, meine E-Mails durchzusehen. Mir fiel zunächst auf, wie viel Arbeit ich mir aufgehalst hatte, die nichts mit der Uni zu tun hatte: Medienverpflichtungen, Interviews, Zeitungsartikel, Buchrezensionen, Verwaltungsrats- und Ausschusstätigkeiten. Ich beantwortete so viele E-Mails, wie ich konnte, ehe ich zu einem Tutorenkurs für Drittsemester hetzte, anschließend Kaffee, dann Seminare bis um eins. Meine Vorlesung für Erstsemester war gleich nach der Mittagspause, und als sich der Zeitpunkt näherte, wurde ich kribbelig. Meine Handflächen wurden feucht, und mir war flau im Magen. Ich ermahnte mich, mit der Paranoia aufzuhören, und betrat den Hörsaal, ging die Stufen hinunter, legte meine Tasche schwungvoll auf den Tisch und schloss meinen Laptop an den Projektor an. Als ich dann ins Auditorium blickte, schlug mir das Herz bis zum Hals. Stille breitete sich im Saal aus. Während ich redete, suchte ich die Sitzreihen nach ihr ab, vergeblich. Zweimal kamen Nachzügler herein. Doch ein Blick hinauf zur Schwingtür verriet mir, dass sie es nicht war. In den letzten paar Minuten der Vorlesung stellte ich mich eventuellen Fragen, was mir wieder Gelegenheit bot, das Meer von Gesichtern abzusuchen. Als die Zeit um war, hatte ich keinen Zweifel mehr: Sie war nicht da.
An jenem Tag und auch am nächsten dachte ich trotz aller gegenteiligen Bemühungen fast ständig an sie. Carolines neue Stelle und unsere Diskussion, wie es mit meiner Mum weitergehen sollte – Betreuung zu Hause oder Heimunterbringung –, brachten mich vorübergehend auf andere Gedanken. Aber Zoë Barry war da, in meinem Kopf, die ganze Zeit.
Ich unternahm nichts weiter in Bezug auf die ganze Angelegenheit. Dann kam der Freitag. Ich saß mit meiner vielversprechendsten Doktorandin, Niki Angsten, und ihrer Zweitbetreuerin, Dr. Anne Burke, zusammen, um über Nikis Dissertation zu reden. Ihr Thema war die Rolle von Frauen während des Ersten Weltkriegs, und sie erzählte uns, worauf sie bei ihren jüngsten Recherchen gestoßen war. »Ich war im Gerichtsarchiv«, sagte sie. »Und in einer Prozessakte aus dem Jahr 1918 habe ich Folgendes entdeckt.«
Anne und ich hörten zu, während sie eine Zeugenaussage vorlas, in der ausführlich beschrieben wurde, wie eine Frau ein Kind zur Welt brachte und es anschließend tötete. »Es ist seltsam«, sagte Niki, »aber seit ich das gelesen habe, muss ich immerzu an sie denken. Sie hat versucht, ihr eigenes Baby mit einem Strumpf zu erdrosseln. Als das nicht klappte, hat sie ein Schiebefenster auf das Neugeborene fallen lassen. Wieso hat sie gedacht, ihr Baby am Leben zu lassen wäre so viel schlimmer, als seinen Tod auf dem Gewissen zu haben?«
Anne gab irgendeine Antwort, aber ich bekam sie gar nicht richtig mit, weil meine Gedanken plötzlich zu sehr mit meiner eigenen Geschichte beschäftigt waren. Auf einmal hatte ich ein Bild vor Augen: Linda in einem Badezimmer zusammengekauert, die Wangen vor Hitze gerötet, den Test in der Hand, ein Strich auf dem Stäbchen. Meine Phantasie ging mit mir durch. Ich dachte an die Panik, die sie empfunden haben mochte, die Einsamkeit. Wieder fragte ich mich, warum sie mir nichts gesagt hatte. Vorausgesetzt natürlich, die Behauptung des Mädchens stimmte, was ich noch immer nicht wusste. Und falls sie stimmte, was das für meine Beziehung zu Caroline bedeuten würde, für die Probleme, mit denen unsere Ehe ohnehin schon zu kämpfen hatte, ganz abgesehen von den Folgen für unsere Kinder. Zu viele Was-wenns jagten mir durch den Kopf, und zu viele unbeantwortbare Fragen machten es mir unmöglich, mich zu konzentrieren.
»David?« Anne wartete auf eine Antwort.
Was würde sie denken, wenn ich ihr von Linda erzählte, von Zoë?
»Entschuldigung, was?«
»Nächsten Donnerstag – einverstanden?«
»Ja«, sagte ich. »Ja, natürlich.«
Sie gingen. Ich stand auf und dachte darüber nach, dass ich die Behauptung der Studentin abgetan hatte, sie in einen Witz umgemünzt hatte, auf einen Studentenschabernack oder die Auswüchse eines kranken Geistes reduziert hatte. Ich erkannte, dass es etwas Verzweifeltes hatte, wie ich versuchte, diese Worte auszulöschen. Zoë Barry auszulöschen.
Ich setzte mich an den Schreibtisch, erweckte den Computer zum Leben und ging ins Internet. Ich wurde auf Anhieb fündig. Dennoch war ich überrascht. DNA-Tests kamen mir so exotisch vor, eher das Produkt einer Gesellschaft, die prozessfreudiger war als die irische, aber da stand es schwarz auf weiß: Eine Firma in Dublin führte Vaterschaftstests durch, 99-prozentige Genauigkeit und Diskretion garantiert.
Was benötigte ich? Eine Speichelprobe von der Wangeninnenseite war am besten, aber es gab noch andere Möglichkeiten: ein Haar (möglichst mit Haarwurzel), eine Zahnbürste. Ich dachte bestimmt zwanzig Minuten darüber nach, auf welche Weise ich mir ihre DNA verschaffen könnte, ohne dass sie es merkte.
Während ich die DNA-Seiten durchstöberte, überlegte ich die ganze Zeit, ob ich mit Zoë über den Vaterschaftstest sprechen sollte oder nicht. Ich erwog, sie um Erlaubnis zu fragen, ihr zu sagen, dass es mir wichtig war, den Test machen zu lassen, aber jedes Mal, wenn ich mir das Gespräch mit ihr vorstellte, malte ich mir aus, wie chaotisch und kompliziert es ablaufen könnte. Die Minuten verstrichen. Meine Gedanken gerieten noch mehr durcheinander: Die plötzliche Einsicht, wie verrückt die ganze Situation war, veranlasste mich, die DNA-Seite, auf der ich gerade war, zu schließen. Reiß dich zusammen, beschwor ich mich. Als Alan den Kopf zur Tür hereinsteckte und fragte, ob ich mit ihm einen Kaffee im Dozentenzimmer trinken würde, war ich mehr als erleichtert.
Alan, eine kluge Seele mit rauer Schale, ist mein Freund und Mentor seit meinem Studium. Nach meiner Promotion an der Queen’s hatte er mir meine erste Stelle angeboten. Ich verdanke ihm viel und empfinde trotz all unserer Differenzen eine tiefe Zuneigung für ihn. Er ist ein Historiker alter Schule, und mein historischer Ansatz ist ihm mitunter ein Rätsel. Meine Präsenz in den Medien ärgert ihn besonders. Als wir an dem Nachmittag zum Dozentenzimmer spazierten, nahm er meinen neuesten Artikel aufs Korn.
»Die Sportbeilage!«, sagte er. »Wie kommst du dazu, über Sport zu schreiben?«
Ich lachte. »Findest du etwa, Sport hat keine historische Relevanz? Was ist mit den Olympischen Spielen 1936?«
»Ach, hör mir auf. Er ist ja wohl kein Jesse Owens, oder?«
»Fällt dir eine umstrittenere Gestalt im irischen Sport ein?«
»Ich verstehe einfach nicht, wieso du deine Zeit damit vertust, dich mit Polemikern anzulegen und Artikel über so –«
»Na los, sag’s schon. Über so einen Quatsch zu schreiben, wolltest du sagen.«
»Journalistisches Thema, wollte ich sagen.«
»Wolltest du nicht.«
Er lachte.
»Sport, Kunst, Popkultur, das alles prägt unser nationales Bewusstsein«, sagte ich. »Es macht uns als Nation aus. Es ist gelebte Geschichte.«
Wir nahmen unseren Kaffee und setzten uns. Alan schmunzelte über meine Äußerungen. Ich sah ihm an, dass er heute nicht in Stimmung für fachliche Diskussionen war. »Ich soll nächsten Monat zu dem Kongress in East Anglia«, sagte er, beugte sich vor und starrte seine Tasse an. »Soll da einen Vortrag halten … Ich hab mir gedacht, dass du an meiner Stelle hinfahren könntest.«
»Im Ernst?«
»Es wäre gut für dich«, erwiderte er. »Und für deinen Lebenslauf.«
Wie oft war mir gesagt worden, dass es meiner Karriere irgendwann zugutekäme, wenn ich jemandem einen Gefallen täte? Ich hatte nichts dagegen, für Alan einzuspringen, aber es sah ihm nicht ähnlich, sich vor einer Verpflichtung zu drücken.
»Klar, Alan. Ist alles in Ordnung?«
»Ich hab in letzter Zeit viel nachgedacht«, sagte er ernst. »Ich bin gesundheitlich nicht auf der Höhe – Herzprobleme. Mein Arzt hat mir zu einer OP geraten, aber ich weiß nicht, ob ich das will. In meinem Alter …«
»Du bist erst zweiundsechzig.«
»Ja, genau. Darauf will ich hinaus. Ich will noch was vom Leben haben, solange es geht. Deshalb habe ich beschlossen, in den Vorruhestand zu gehen.«
»In den Vorruhestand?«
»Was denn? Hast du gedacht, ich bleibe ewig hier, David?«
»Ja«, sagte ich. Eine gewisse Traurigkeit erfasste mich. Ich konnte noch nie gut mit Abschieden umgehen.
»Diesmal meine ich es wirklich ernst«, sagte er.
Er musste es nicht aussprechen. Es war mir auch so klar. Mit Alans Fortgang würde eine neue Professorenstelle frei werden. Das war meine Chance. Eine leichte Erregung durchströmte mich. Die Art, wie er mich ins Spiel brachte, kam mir fast wie Vetternwirtschaft vor. Seine Freundlichkeit, so schien es, war schon immer über rein professionelle Fürsorgepflicht hinausgegangen.
Die Aussicht auf einen Lehrstuhl beschäftigte mich auf dem ganzen Weg zurück ins Büro. Mein Kopf sprudelte über vor Ideen, meine Gedanken eilten ein paar Monate weiter, zur Berufungskommission und den Vorträgen der Kandidaten. Ich fing an, im Geiste eine Liste der Arbeiten zu machen, die ich in dem Jahr hoffentlich veröffentlichen würde, einschließlich des Buches, das ich bald fertig haben würde, und ich fragte mich, ob mein Forschungsoutput dem Vergleich mit dem anderer Kandidaten standhalten würde. Der Gedanke nahm mich so in Beschlag, dass ich fast den Zettel auf dem Fußboden übersehen hätte, als ich mein Büro betrat. Als ich die Tür hinter mir schloss, flatterte der Zettel im Luftzug. Ich bückte mich, hob ihn auf und las ihn rasch.
Schlagartig war meine Aufregung wie weggeblasen. Mein Herz fühlte sich wieder schwer wie Blei an.
Es war eine kurze Notiz in einer eleganten Handschrift, schwungvoll unterschrieben, ihr Name schräg auf dem Papier.
Treffen heute Abend? Im Madigan’s, nach der Arbeit. Sagen wir um 18.30 Uhr.
Zoë
Ich steckte den Zettel sorgfältig in mein Portemonnaie.
Freitagabend, und es lag eine erwartungsvolle Atmosphäre in der Luft. Die kollektive Erleichterung darüber, dass das Wochenende erreicht war, offenbarte sich in einer hektischen Betriebsamkeit auf Straßen und Gehwegen. Der Wind hatte aufgefrischt, und ich radelte gemächlich nach Donnybrook. Der Verkehr war stark, die Menschen hatten es eilig, die Arbeitswoche, ihre Schreibtische, Chefs und Verpflichtungen hinter sich zu lassen.
Als ich ankam, war der Pub rappelvoll: Büroangestellte, Studierende, Mechaniker vom nahe gelegenen Busdepot, deren lautstarke Unterhaltungen zu einem dichten Stimmengewirr verschmolzen. Ich entdeckte sie im hinteren Teil, wo sie allein mit einer Flasche Bier vor sich saß. Einen Ellbogen auf dem Tisch, den Kopf in die hohle Hand gestützt, das Gesicht ausdruckslos, während sie an ihrem Handy herumspielte. Für einen kurzen Moment, ehe sie mich sah, wirkte sie so jung, so harmlos, dass sie mir einfach leidtat.
»Da sind Sie ja.« Sie lächelte und stand auf.
»Zoë«, sagte ich.
»Ich hab Ihnen einen Platz freigehalten.« Sie deutete auf einen Hocker. »Ich bin so froh, dass Sie da sind. Ich war mir nicht sicher, ob Sie kommen würden. Ich hol Ihnen was zu trinken.«
»Nein«, sagte ich.
»Bitte. Das ist das Mindeste, was ich tun kann.«
»Ich zahl lieber selbst«, sagte ich und fing den Blick des Barmanns auf. Ich bestellte ein Glas Bier für mich und noch eine Flasche für Zoë.
Sie legte die Arme auf den Tisch, eine Hand um ihr Bier, das Gesicht offen und erwartungsvoll. Rings um uns herum wurden die Stimmen lauter. Gelächter erschallte, und Blechinstrumente spielten übermütigen Ragtime aus versteckten Lautsprechern. Wir mussten fast schreien, um uns gegenseitig verstehen zu können.
»Ich hatte keine Ahnung, dass es hier so voll sein würde«, sagte sie. »Sonst hätte ich ein ruhigeres Lokal vorgeschlagen.«
In Wahrheit fühlte ich mich durch den Krach und den Stimmenlärm geschützt. Irgendwie wollte ich nicht mit einer Studentin, einer Fremden, in einer abgeschiedenen stillen Ecke sitzen. Und von Gott weiß wem gesehen werden.
»Ich fand diesen Pub bloß günstig, weil er so nah an der Uni ist.«
Unsere Getränke kamen, und ehe das Glas meinen Mund erreicht hatte, hob sie ihre Flasche. »Cheers.«
»Sláinte«, sagte ich und dachte kurz, dass ich mit Robbie irgendwann in so einen dunklen Pub hätte gehen können, um ihm sein erstes Bier zu spendieren und unsere Vater-Sohn-Bindung zu vertiefen. Stattdessen saß ich hier mit einer jungen Frau, die ich kaum kannte.
»Ich wollte mich entschuldigen«, begann sie, »für neulich. Dass ich Sie so überrumpelt hab. Das war unfair. Es tut mir echt leid«, sagte sie, und kleine Fältchen erschienen in ihren Augenwinkeln.
Sie trug einen schlichten roten Pullover, und ich fragte mich kurz, ob sie wohl die roten Armeestiefel noch an den Füßen hatte. »Sie machen sich doch nicht über mich lustig, Zoë, oder?«
»Gott, nein!« Ihre Augen wurden rund, aber das ängstliche Lächeln umspielte weiter ihren Mund. »Ich fand bloß, wir hatten einen schlechten Start.«
»Was Sie da von mir behaupten … dass ich Ihr Vater sein soll, das ist eine sehr ernste Angelegenheit.«
»Ich weiß, ich weiß.« Sie blickte nach unten auf den Tisch, schüttelte den Kopf.
Ich trank einen kräftigen Schluck und wartete. Ich hatte mir zurechtgelegt, was ich sagen wollte, aber ich wollte es gut hinkriegen. Sie kam mir jedoch zuvor, und was sie sagte, überraschte mich: »Ich möchte Ihnen versichern, dass Sie keine Angst zu haben brauchen …«
»Angst?«, sagte ich.
»Vor mir«, sagte sie kleinlaut. »Ich will Ihnen nicht schaden. Ich will Sie nicht in Schwierigkeiten bringen.«
»In was für Schwierigkeiten könnten Sie mich denn bringen? Ich habe nichts Falsches getan.«
»Nein, ich weiß. Ich hab gemeint, ich will nicht, dass Sie meinetwegen irgendwelche Probleme an der Uni kriegen oder mit Ihrer Frau.«
»Meiner Frau?«
»Ja«, sagte sie. »Haben Sie ihr von mir erzählt?«
Es war fast eine Woche vergangen. Keine lange Zeit insgesamt gesehen, aber es war eine anstrengende Woche voller Heimlichtuerei und Vorsicht gewesen. Die ganze Zeit hatte ich es Caroline verschwiegen, mir eingeredet, ich wollte sie schützen, doch in Wirklichkeit wollte ich mich selbst schützen. Ich hasste Geheimniskrämerei. Tatsächlich hatte ich geglaubt, dass wir als Paar über so etwas hinweg wären. Die Vergangenheit hatte mich bereits eines gelehrt: Geheimnisse kommen irgendwann ans Licht, und Geheimnistuerei hat immer ein Nachspiel, doch ich hatte meine eigene bittere Lektion missachtet. In diesem Moment wusste ich, dass es ein großer Fehler gewesen war, Caroline nicht einzuweihen.
»Ich habe ihr nichts von Ihnen erzählt, nein«, gab ich zu. »Noch nicht. Ich wollte erst sicher sein …«
»Sicher sein?«, fragte sie nach. »Dass ich mir die ganze Sache nicht ausgedacht habe?«