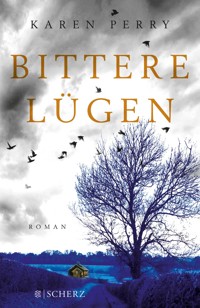Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Argon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Psycho-Spannung made in Irland - der neue Roman von Bestseller-Autorin Karen Perry Irgendwann kannst du nicht mehr davonlaufen. Irgendwann musst du dich stellen. Deiner Vergangenheit. Deiner Schuld. Dem Tag, der dein Leben verändert hat. Damals, als du gerade acht Jahre alt warst. Masai Mara, Kenia 1982. In der sengenden Mittagssonne spielen drei Kinder am Fluss. Ihr Spiel hat keinen Namen, sie haben es sich selbst ausgedacht. Sie lachen und wetteifern, doch dann herrscht plötzlich Stille. Bis der erste Schrei ertönt. Dublin 2013. Katie Walsh arbeitet als Journalistin bei einer Tageszeitung und soll ausgerechnet über Luke Yates, einen erfolgreichen Unternehmer, ein Porträt schreiben. Katie und Luke kennen sich seit Kindertagen, sie haben gemeinsam mit Lukes jüngerem Bruder Nick einen Sommer in Kenia verbracht. Doch seit jener Zeit ist der Kontakt zwischen ihnen abgebrochen. Zu schrecklich ist die Erinnerung an jenen heißen Nachmittag am Fluss, das Gefühl der Schuld, dass sie seither nur eines wollen: vergessen. Katie trifft Luke schließlich bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung wieder und erfährt am nächsten Morgen, dass er noch in derselben Nacht verschwunden ist. Niemand weiß, wo er sein könnte, sein Büro ist ein Ort der Verwüstung, alle Bilder wurden von den Wänden gerissen und es finden sich Blutspuren. Auf dem Schreibtisch liegt ein Foto: Luke gemeinsam mit Katie und Nick 1982 in Kenia. Katie ist sofort klar, dass das kein Zufall sein kann. Es muss einen Zusammenhang zwischen Lukes Verschwinden und den Ereignissen von damals geben. Aber wer weiß etwas darüber? Als Katie kurz darauf mit der Post einen toten Vogel erhält, begreift sie, dass sie nicht länger davonlaufen kann. Denn die Vergangenheit hat bereits unerbittlich begonnen sie einzuholen, und jemand sinnt auf späte Rache … »›Was wir getan haben‹ wirft die packende Frage auf, wer wir tief im Herzen sind, wie sehr uns Schuld beeinflusst und ob und vor allem wie wir Vergebung finden können.« Tana French
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 9 min
Ähnliche
Karen Perry
Was wir getan haben
Roman
Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
FISCHER E-Books
Inhalt
PROLOG
KENIA, 1982
Eine Frau liegt auf einer Wiese und sonnt sich. In dem hohen Gras um sie herum wispern und summen unsichtbare Insekten. Nicht weit von ihr sitzen die Kinder, zappelig und gelangweilt, aber sie lassen sie zum Glück in Ruhe. Über ihr flimmert die Luft vor Hitze. Es ist fast Mittag.
Sie hat sich die Plane im Gras ausgebreitet, die ihnen als Zeltboden gedient hat und von der ein schaler Geruch nach Schweiß oder Schimmel aufsteigt. Doch das stört die Frau jetzt nicht, wie sie so daliegt, ausgestreckt, die Beine an den Knöcheln gekreuzt, ein aufgeschlagenes Taschenbuch ungelesen auf dem Bauch, die Augen mit einer Sonnenbrille vor dem gleißenden Sonnenlicht geschützt. Sie will einfach nur eine Weile entspannen und die Hitze in sich aufsaugen.
Sie atmet die drückende Luft ein, spürt die sengende Erde unter sich und lässt die Stille der weiten Graslandschaften ringsherum auf sich wirken. Die anderen sind vor einer halben Stunde aufgebrochen, folgen der ausgefahrenen Piste zum Massai-Dorf, und sie, Sally, ist geblieben, um auf die Kinder aufzupassen. Aber die sind in einem Alter, das sich elterlicher Aufsicht widersetzt. Den ganzen Sommer über haben sie sie schon auf Abstand gehalten, sind voll und ganz in ihrem neu entdeckten Bündnis aufgegangen, ihren eigenen geheimen Spielen, ihrem eigenen heimlichen Code. Sie fühlt sich ausgeschlossen durch dieses neue Bedürfnis der Kinder nach ungestörter Privatheit. Auch jetzt, wo sie unruhig werden, offenbar mit einmütiger Entschlossenheit vom Boden aufstehen. Sie setzt sich auf und schaut ihnen nach, wie sie zielstrebig über die Wiese gehen.
»Jungs!«, ruft sie ihnen hinterher, und als sie ein zweites Mal ruft, bleiben sie stehen. Luke dreht sich zu ihr um, Nicky flüstert Katie irgendetwas zu.
»Was ist?«
Sie muss die Augen mit einer Hand abschirmen, um das Gesicht ihres älteren Sohnes zu sehen, und obwohl es im Schatten liegt, kann sie seine mürrische Miene erkennen, den argwöhnischen Blick, mit dem er sie in letzter Zeit immer ansieht. Neuerdings hat sie das Gefühl, dass der Junge sie irgendwie verachtet.
»Wo wollt ihr hin?«
»Zum Fluss.«
»Nein, Luke, das ist gefährlich –«
»Dad lässt uns immer hin.«
»Trotzdem, mir ist nicht wohl dabei –«
»Ach, verdammt nochmal.«
»Luke!«, ruft sie empört.
Er öffnet den Mund, um etwas zu sagen, verkneift es sich aber und steht einfach da, nagt an der Unterlippe und wartet. Sally ist gereizt und fühlt sich unbehaglich, spürt die gewaltige Hitze, die um sie herum aufsteigt. Als sie an die Bäume denkt, die den Fluss säumen, den wohltuenden Schatten dort, bringt sie es nicht über sich, mit ihm zu streiten.
»Also schön«, sagt sie, bemüht, entschlossen und konsequent zu klingen. Sie wünschte, sie würde nicht sitzen. Ihre Autorität wirkt angeknackst, sie unten auf der Plane, während ihr Sohn überheblich auf sie hinabschaut. Ein Zehnjähriger mit dem Hochmut eines Aristokraten. »Aber seid gefälligst vorsichtig, verstanden? Alle drei.«
Sie hebt die Stimme, damit auch die anderen beiden sie hören. Katie schaut zu ihr rüber, aber Nicky hält die Augen stur auf die staubige Erde gerichtet.
»Luke«, sagt sie schneidend, als er sich zum Gehen wendet. »Du passt auf die anderen auf, ich verlass mich auf dich. Ist das klar?«
Er wirft ihr einen Blick zu, verschlossen und unergründlich, und da ist es wieder, dieses Gefühl, das sie in letzter Zeit hat, dass er sich beherrschen muss, um nicht mit irgendetwas rauszuplatzen und sie zur Rede zu stellen.
»Ist das klar?«, wiederholt sie.
Er zuckt die Achseln und wendet sich ab. Sie sieht, wie er zu den anderen läuft, sie überholt, die Schultern mit grimmiger Entschlossenheit gestrafft, und dann scheinbar unaufhaltsam weiter zum schattigen Flussufer strebt, während die anderen hinter ihm hertraben. Wie unterschiedlich sie sind, ihre beiden Söhne. Der eine ist unerschrocken und von geradezu animalischer Energie beseelt, der andere zurückhaltend, verträumt und schüchtern. Sally fällt es manchmal schwer, zwei so verschiedenen Kindern gerecht zu werden. Wenn sie ehrlich zu sich ist, weiß sie, dass sie eine größere Schwäche für ihren jüngeren Sohn hat, weil sie spürt, dass sie ihn intuitiv versteht, dass sie sich mit seiner Verträumtheit, mit seinem reichen Innenleben identifizieren kann. Ihr älterer Sohn ist ihr ein ewiges Rätsel, obwohl er sein Leben so geradlinig lebt, fast aggressiv, mit einer Tatkraft, die sie manchmal verblüfft. Ein warmes Gefühl erfasst sie, während sie ihnen nachschaut, bis sie die Bäume erreichen und im Schatten verschwinden – ihre beiden Söhne, ihre wunderbaren Jungs.
Die Sonne ist zu grell, und die drückende Hitze macht es unmöglich, noch länger mitten auf der Wiese zu bleiben. Sie spürt förmlich, wie ihr Körper austrocknet, genau wie die hart gebrannte Erde um sie herum. Außerdem hat sie einiges zu erledigen, ehe die anderen zurückkommen. Sie steht auf und geht zurück zum Lager, lässt ihr Buch und die Plane liegen – sie wird sie später holen, wenn Ken und Helen mit einem anderen Fahrer zurückgekehrt sind.
Die Zelte sind schon abgebaut, müssen aber noch zusammengefaltet und eingepackt werden, eine Arbeit, die sie unterbrochen haben, als Mackenzie wieder aufkreuzte und sie merkten, dass er betrunken war. Gott, was für eine Szene. Sally möchte gar nicht mehr daran denken. Sie bleibt an dem weißen Minibus stehen, um nach Mackenzie zu sehen, bevor sie die Zelte in Angriff nimmt. Sie späht durchs Beifahrerfenster und sieht ihn ausgestreckt auf der Vorderbank, ein Arm über dem Kopf, der andere in den Fußraum hängend, beobachtet kurz das stetige Heben und Senken seiner Brust, während er seinen Rausch ausschläft. Sein Gesicht kann sie nicht sehen, weil es zur Rückenlehne gedreht ist.
»Ich mag ihn nicht«, hatte sie gleich am ersten Tag zu Jim gesagt.
Sie waren im Büro in Kianda, zu zweit. Mackenzie war gerade gegangen.
»Wieso nicht?«, hatte Jim überrascht gefragt.
»Ich trau ihm nicht«, war ihre Begründung, und Jim hatte kopfschüttelnd gelacht, um den Blick dann wieder auf seine Unterlagen zu richten, während er mit dem Stift in der Hand einen Rhythmus klopfte.
»Du traust doch niemandem«, hatte er gesagt, doch in seiner Stimme lag Zuneigung, ein heiterer Unterton, der seinen Worten die Schärfe nahm.
Aber es stimmte – sie traute dem Mann nicht, obwohl es keinen Grund dafür gab, nur ihr eigenes Bauchgefühl. Er hatte kaum das Büro betreten, als sich bei ihr auch schon Skepsis meldete. Er war klein, hatte dünne, angespannte Schultern, ein eckiges Gesicht und eine platte Nase, mit Nasenflügeln, die ständig geweitet schienen. Sie hatte ihn beobachtet, wie er sich eine Zigarette ansteckte und dann die ganze Zeit paffte, während sie die Einzelheiten besprachen. Seine kleinen Augen huschten durch den Raum, verweilten aber so gut wie nie auf ihr. Er sprach ausschließlich mit Father Jim, als wäre Sally gar nicht da. Das Weiß seiner Augen war gelblich, wie vom Nikotin verfärbt, und er sah ihr nicht ein einziges Mal direkt ins Gesicht.
»Er wirkt durchtrieben«, hatte sie gesagt.
»Hör mal«, sagte Jim, bemüht vernünftig, »er kennt sich in der Gegend gut aus, und er kennt die Safarirouten wie seine Westentasche. Such von mir aus jemand anderen, aber du wirst niemanden finden, der so einen Riecher für Großwild hat wie Mack, glaub mir.«
Sie hatte eingewilligt. Deshalb war es in gewisser Weise ihre Schuld, dass ihr Fahrer am letzten Tag der dreitägigen Safari nach dem Aufwachen verschwunden war.
Am späten Vormittag dann näherte sich der weiße Minibus in Schlangenlinien und kam in einer Staubwolke schlingernd zum Stehen. Sobald Mackenzie ausstieg, hatte sie gewusst, dass er betrunken war. Seine schiefe Mütze, sein torkeliger Gang, als er auf sie zukam, die Art, wie er würgend einatmete, als müsste er die aufsteigende Galle unterdrücken.
»Ach du Schande«, hatte Ken gesagt. »Er ist besoffen.«
Und das war er. Sogar stockbesoffen. Er war auf sie zugewankt, hatte versucht, ein paar Worte aneinanderzureihen, aber nur eine zusammenhanglose gelallte Entschuldigung herausgebracht. Helen war förmlich explodiert. Ken war der Geduldsfaden gerissen, und Sally war dermaßen wütend geworden, dass sie jemanden hätte umbringen können. Ein furchtbarer Streit entbrannte. Als hätte der Alkoholrausch des Fahrers ein Streichholz an eine hochentzündliche Atmosphäre gehalten, die seit Tagen geschwelt hatte und nun endlich in Flammen aufging.
Als Sally sich in der sengenden Hitze der Mittagssonne bückt, um die Zelte zusammenzufalten, spürt sie, wie Scham sie durchflutet. Sie hätte es nie so weit kommen lassen dürfen. Die Worte, die sie ausgesprochen, die Dinge, die sie gesagt hatte – vor ihren Kindern, vor Helens Tochter –, waren unverzeihlich.
Sie würde sich mit Helen aussöhnen müssen, obwohl es schwierig sein würde, dafür eine gute Gelegenheit zu finden. Heute Abend würden sie zurück nach Nairobi fahren – falls sie einen Fahrer fanden –, und am nächsten Tag würden Helen und Katie nach Hause fliegen. Und was dann?
Sie packt die Zelte ein, verstaut die ordentlichen Bündel beim übrigen Gepäck und schaut sich um, ob noch irgendwelche Habseligkeiten herumliegen. Von den anderen ist noch immer nichts zu sehen.
Rufe schallen von den Bäumen am Fluss herüber – Freudenschreie und Lachen, kecke Herausforderungen. Helens Worte fallen ihr wieder ein – Du passt doch auf Katie auf, ja? Sie spürt einen kleinen Stich schlechten Gewissens. Die Rufe locken sie zum Fluss, ebenso wie ihr Wunsch, aus der prallen Sonne herauszukommen.
Selbst hier, im Schatten der Akazien, ist es noch höllisch heiß. Schweiß perlt ihr auf der Stirn, und sie wischt ihn mit dem Unterarm ab, und als sie hinunter ins Halbdunkel blickt, müssen ihre Augen sich erst an das jähe Verschwinden des Sonnenlichts gewöhnen. Ein freudiges Juchzen, das kreischend aus dem Schatten ertönt, lässt sie zusammenzucken; unwillkürlich weicht sie einen Schritt zurück, dann hört sie ein lautes Platschen. Sie blickt nach unten aufs Wasser, sieht, wie es sich kräuselt und kleine Wellen schlägt, ehe Lukes blonder Kopf auftaucht, dann sein nackter Oberkörper. Seine Haut glänzt, und als sie ihn ruft, sieht sie für einen ganz kurzen Moment pure Freude auf seinem Gesicht, doch sogleich ist die Maske wieder da und löscht das Strahlen.
»Was?«, fragt er mürrisch.
»Ich hab doch gesagt, ihr sollt nicht ins Wasser gehen.«
»Nein, hast du nicht.«
»Doch, Luke, das hab ich. Es ist zu gefährlich.«
»Du hast gesagt, wir sollen vorsichtig sein, und das sind wir. Aber du hast nicht gesagt, dass wir nicht reindürfen.«
Sie zögert – ein schwerwiegender Fehler. Er lässt sich wieder ins Wasser sinken, sieht ihr dabei herausfordernd in die Augen.
»Wo ist Nicky?«, fragt sie.
»Da drüben.« Sie folgt seinem ausgestreckten Arm, sieht das dunkle Haar ihres jüngeren Sohnes ein Stück weiter weg. Er hockt im seichten Wasser, und es sind zwei Mädchen bei ihm, aber keins der beiden ist Katie.
»Hallo«, sagt sie zögernd und sucht sich vorsichtig einen Weg hinunter zum Wasser. »Wie ich sehe, hast du neue Freunde gefunden, Nicky.«
Der Junge schaut nicht auf, bleibt einfach, wo er ist, die Knie an die Brust gedrückt, und starrt ins Wasser, mit einem seltsamen kleinen Lächeln im Gesicht.
»Hallo, Lady!«, ruft das Mädchen neben ihm.
Sally lacht über die Begrüßung und sieht das Mädchen an – weißblondes Haar rechts und links zusammengebunden, zwei große neue Schneidezähne leuchten Sally entgegen, daneben auf beiden Seiten Lücken, wo die zweiten Zähne sich gerade erst zeigen. Ein kaninchenartiges Gesicht voller Sommersprossen, Pausbacken. Das Lächeln der Kleinen ist offen und warm, doch sie hat etwas an sich, das Sally nicht genau benennen kann. »Beschränkt« scheint ihr schließlich das passende Wort dafür zu sein. Der Blick des Mädchens wirkt irgendwie stumpf und tranig. »Nicht sehr helle«, hätte Sallys Vater gesagt.
»Wie heißt du?«, fragt sie freundlich.
»Cora.«
»Hallo, Cora.«
»Und das ist Amy.«
Ein Daumen deutet ruckartig auf ein kleines Mädchen, das hinter ihr steht. Es trägt ein zerschlissenes, in den Schlüpfer gestopftes Kleidchen, hat das gleiche weißblonde Haar wie ihre Schwester, aber die Augen sind scharfsichtiger, der Blick aufgeweckter. Sally schätzt das Mädchen auf vier oder fünf.
»Dürft ihr denn hier am Fluss spielen?«, fragt sie, verwundert darüber, dass das kleinere Kind in der Obhut des älteren Mädchens gelassen wird.
»Ja klar. Pops hat nichts dagegen.«
Sally blickt über die Schulter des Mädchens, vorbei an der Baumreihe am anderen Flussufer. Da ist eine Lichtung mit den undeutlichen Umrissen eines Hauses. In den vergangenen Nächten haben sie durch die Bäume den Schein eines Lagerfeuers gesehen, Rauch, der in die Nacht aufstieg. Als sie Mackenzie fragten, wer da wohnen würde, hatte er abfällig geschnaubt. »Zigeuner.«
Sally betrachtet diese Mädchen mit ihren verwaschenen Kleidern, dreckigen Gesichtern und Füßen, und ist plötzlich verunsichert.
»Wo ist Katie?«, fragt sie.
»Hier bin ich.«
Die Stimme, direkt hinter ihr, lässt Sally zusammenfahren. Sie dreht sich um, sieht Katie noch im Schatten sitzen, die Füße in Sandalen nebeneinander, die Hände um die Knie gelegt und große runde Augen, die durch das Halbdunkel ernst zu ihr hochschauen.
»Was machst du da?«, fragt Sally, unangemessen scharf, aber sie hat den Schreck noch nicht ganz verwunden.
»Nichts«, sagt Katie, die Augen unverwandt auf Sally gerichtet.
»Kommt jetzt, es wird Zeit, wir müssen zum Lager zurück«, sagt Sally entschieden.
»Ist Dad schon wieder da?«, fragt Luke.
»Nein. Aber es kann nicht mehr lange dauern.«
»Noch zehn Minuten.«
»Nein, sofort.«
»Och, bitte, Mum«, sagt er, ein wehleidiges Jammern in der Stimme. Es geht Sally unter die Haut, dass er zum ersten Mal seit Tagen wieder »Mum« zu ihr gesagt hat. Irgendetwas in ihr wird schwach.
»Also schön.«
Und warum auch nicht? Besser, sie lässt sie weiter hier spielen, wo sie ihren Spaß haben, als sie zurück zum Lager zu schleppen, wo sie nörgeln und stöhnen und sie laufend fragen würden, wann die anderen wiederkommen.
Sie klettert die Uferböschung hoch, bleibt stehen, um einen letzten Blick auf die Kinder zu werfen – Luke, der durchs Wasser gleitet, Nicky, der sich dem Mädchen mit den Hasenzähnen zugewandt hat, Katie, die still und teilnahmslos dasitzt und die beiden beobachtet. Sally betrachtet sie noch einen kurzen Moment, ehe sie sich abwendet. Und als sie wieder hinaus in die gleißende Hitze tritt und spürt, wie das trockene Gras ihre Knöchel streift, ahnt sie nicht, dass sie die Kinder gerade zum letzten Mal in ihrer Unschuld gesehen hat, zum letzten Mal eine so bedingungslose Liebe empfindet. Sie weiß es noch nicht, aber in weniger als einer Stunde wird sich ihr ganzes Leben verändert haben.
Alles ist jetzt gepackt und abfahrtbereit, doch die anderen sind noch immer nicht zurück. Sally legt sich wieder bäuchlings auf die Plane und versucht, ihr Buch zu lesen. Doch die Wörter verschwimmen auf der Seite, Schweiß rinnt ihr in die Augen. Bald gibt sie es auf, dreht sich auf den Rücken und schließt die Augen.
Sie spürt, wie ihr Körper in der Hitze glüht, stellt sich vor, sie wäre ein winziges Insekt, das unter dem sengenden Blick der afrikanischen Sonne gefangen ist. Drei Jahre sind sie mittlerweile hier, und jetzt, wo Kens Vertrag ausläuft, steht eine Entscheidung an. Kehren sie nach Irland zurück, oder wird er mit allen Mitteln versuchen, seinen Vertrag um ein Jahr zu verlängern? Die Jungs werden langsam groß und brauchen eine schulische Perspektive. Außerdem ist da Sallys eigene Arbeit in Kianda, die ihr immer wichtiger wird. Sie denkt an das Haus in Irland, in den Wicklow Mountains, an die Zimmer voll mit geerbten Antiquitäten, und versucht, sich vorzustellen, dorthin zurückzukehren, da weiterzumachen, wo sie aufgehört hat. Afrika hat sie verändert. Sie ist nicht mehr dieselbe Frau, die in diesen Räumen mal den Haushalt geführt hat. Eine Tür in ihr ist geöffnet worden, und sie fürchtet, die Rückkehr nach Irland würde bedeuten, sie für immer zuzuschlagen.
Müdigkeit kriecht in ihre Glieder, zerrt sie Richtung Schlaf. Sie sollte die Kinder holen. Nur noch fünf Minuten, dann wird sie aufstehen und zum Fluss gehen.
Es muss eine Entscheidung getroffen werden – Ken wird sie bald dazu drängen. Tatsächlich hatte sie gehofft, sie wüsste es inzwischen, hatte gedacht, ihr würde irgendwie klarwerden, was sie tun sollte. Doch ihre Gedanken sind trübe, völlig undurchsichtig. Und da ist noch eine andere Entscheidung, die ihr keine Ruhe lässt – ein Ultimatum, das ihr kurz vor ihrer Abfahrt in die Masai Mara gestellt wurde, ein Ultimatum von jemand ganz anderem.
»Ich muss es wissen«, hatte der Mann gesagt. »Ich kann nicht ewig hierbleiben und auf dich warten.«
Sie hatte die drei Tage auf Safari eigentlich zum Nachdenken nutzen wollen. Aber wenn sie mal einen Moment Zeit für sich hat, will sie darüber am allerwenigsten nachdenken.
Dann kommt er, der Schlaf, schwingt sich herab und packt sie. Unter der brennenden Sonne lässt sie alles los – den Streit heute Morgen, ihre bröckelnde Freundschaft, das Ultimatum, die Unentschlossenheit und die Furcht, die ihr in letzter Zeit im Nacken sitzt – das alles verschwindet, als sich die Dunkelheit des Schlafes über sie breitet.
Ein Schrei.
Schrill, von Panik durchsetzt.
Sie hört ihn im Traum. Sofort reißt sie die Augen auf, blinzelt im grellen Sonnenlicht, spürt, dass sich sonnenverbrannte Haut an Stirn und Wangen spannt.
Wieder ein Schrei. Sie stemmt sich hoch, den Kopf schwer und benommen vom Schlaf. Sie schaut sich um, desorientiert, hinter den Augen das erste Pochen eines nahenden Kopfschmerzes.
Stille umfängt sie. Nur das sanfte Säuseln einer Brise im Gras, das Ticken und Summen von Insekten. Vögel in den Bäumen. Und doch lässt das Fehlen jedes anderen Lauts eine Alarmglocke in ihr losschrillen. Sie kann die Kinder jetzt nicht hören, aber sie erinnert sich an den Schrei, und ihr Herz versetzt ihr einen jähen angstvollen Stich. Sie weiß, sie hat ihn nicht bloß im Traum gehört.
Sie rappelt sich hoch, lässt den Blick über die leere Wiese schweifen und wendet sich dann zum Fluss. Sie geht mit schnellen Schritten, die Erde hart und unnachgiebig unter den Fußsohlen, wird angetrieben von der Furcht, die in ihr erwacht ist.
Die Stille scheint sich zu vertiefen, dichter zu werden, als die dunkle Baumreihe vor ihr auftaucht.
Eine Stimme flüstert in ihrem Kopf.
Die Jungs.
Und dann setzt sie ein, die Flut beängstigender Möglichkeiten – ein Sturz, ein gebrochener Arm, ein aufgeschlagener Kopf, ein Schlangenbiss –, das alles wirbelt durch sie hindurch, während sie sich einen Pfad durchs Buschwerk bricht. Die Stille scheint jetzt rings um sie herum zu tosen, und die warnende Stimme in ihrem Kopf ermahnt sie, ruhig zu bleiben, sich zu wappnen für das, was sie erwartet.
Ein weiterer Schrei – diesmal vom anderen Ufer – lässt sie wie angewurzelt stehen bleiben.
Und dann begreift Sally mit verblüffender Klarheit, hat eine Erkenntnis, die so deutlich ist, dass sie einfach wahr sein muss.
Der Fluss.
Ein Kind unter Wasser.
Für einen Moment weicht die Furcht zurück, als der Schock sie erschüttert und Kälte ihren Körper durchströmt. Der Moment dauert nur eine Sekunde. Dann rennt sie los.
TEIL EINS
DUBLIN 2013
1.KATIE
Es fängt mit den Fotos an.
An einem Donnerstagmorgen, einem Morgen wie jeder andere im Büro, stehen wir drei um Reillys Schreibtisch und plaudern, während wir auf die Ankunft des stellvertretenden Redaktionsleiters warten. Die anderen lästern über mein Aussehen – mein verschmiertes Make-up von letzter Nacht, das Haar noch teilweise hochgestylt, weil ich das Wachs nicht richtig ausgebürstet habe. Mir ist, als wäre ich nur halb da. Die andere Hälfte von mir kann es kaum erwarten, zu meinem Schreibtisch zurückzukommen, meinen Artikel fertig zu schreiben, dann nach Hause abzuhauen, um zu duschen und mich auszuschlafen.
Colm von der Rechtsabteilung sagt: »Mensch, Katie, du hast eine Fahne, die glatt ein Pferd umhauen könnte.«
Peter neben ihm kichert, und ich lächele zuckersüß. »Ich mach bloß meine Arbeit, Jungs. Opfere meinen soliden Lebenswandel für die ganz große Story, ihr kennt das ja.«
Und Colm sagt, nein, kennt er nicht, aber es ist alles in Ordnung, wirklich, bis auf die heftigen Schmerzen in meinen Schläfen und die Müdigkeit, die mir die Beine hochsteigt wie Quecksilber in einem Thermometer. Alles nichts Neues für mich. Und dann kommt Reilly, sichtlich aufgewühlt, als ob er uns etwas Wichtiges mitzuteilen hat. Er schmeißt sich in seinen Sessel, wirft die Fotos auf den Schreibtisch und sagt: »Seht euch die mal an.«
Alle vier beugen wir uns vor, um auf die Fotos zu schauen, und sofort spüre ich, wie es anfängt.
Fotos von einem toten Mädchen, das in einem Swimmingpool treibt.
»Die sind eben reingekommen«, sagt Reilly. Eine Tote auf einer Party in den frühen Morgenstunden. Alkohol. Drogen, ein Haufen Studenten, ein Spiel, das aus dem Ruder gelaufen ist.
Peter breitet die Fotos aus, so dass sie die Hälfte des Schreibtischs bedecken. Das Wasser ist so klar. Das Mädchen, noch ein Teenager, das Haar, das sich im Wasser auffächert.
»Irgendein Perverser auf der Party hat die mit seinem Handy gemacht«, erklärt Reilly.
»Die können wir nicht drucken«, sagt Colm energisch. »Auf gar keinen Fall.«
»Echt makaber«, flüstert Peter mit faszinierter Miene. Seine Augen saugen die Fotos geradezu auf.
»Ihre Eltern haben sie wahrscheinlich noch nicht mal identifiziert, und wir ziehen uns hier schon die Bilder rein«, sagt Colm angewidert.
»Wir können sie nicht drucken, aber wir haben trotzdem eine Story«, sagt Reilly, »über die moralisch fragwürdige Verwendung von Kamerahandys.«
Sein Kommentar richtet sich an uns alle. Ich höre ihm zu, kann aber die Augen nicht von den Fotos losreißen. Die cremeweiße Haut des Mädchens, die rötliche Haarwolke, die sich im Wasser ausbreitet. Die Kleidung, die an ihren Gliedmaßen klebt. Der Körper halb gedreht, wie zu einem langsamen Abschied. Die Augen offen und blicklos, der Mund zu einem überraschten O erstarrt. Ich stelle mir vor, wie das Wasser in sie eindringt, sie ausfüllt, die Lunge bis zum Bersten aufbläht.
Jemand sagt meinen Namen.
Doch ich starre die Bilder an, wie gebannt. Nicht eine einzige Luftblase. Bloß die Reglosigkeit des Mädchens unter einem Wasserfilm. Ich schaue sie an und spüre die Veränderung, die mich überkommt, die zarte Stelle in meinem Innersten, an der plötzlich herumgestochert wird. Meine harte Schale löst sich in Luft auf.
»Katie?«, sagt Reilly wieder, doch ich sehe ihn nicht an, sehe keinen von ihnen an.
Ich bücke mich und greife nach meiner Tasche. Wie unter einem inneren Zwang taumele ich weg von dem Tod, der da auf dem Schreibtisch ausgelegt ist. Ohne ein Wort zu sagen, laufe ich vor den Fotos davon, bleibe erst am Aufzug stehen.
Ich trete hinaus in die regengraue Tristesse der Talbot Street, überquere die Straße, ohne nach links oder rechts zu schauen, und gehe schnurstracks in den Pub.
»Whiskey«, sage ich zu dem Barmann und krame nach Kleingeld in meiner Handtasche.
»Powers oder Jameson?«, fragt er. Seine Miene verrät weder Überraschung noch Missbilligung. Es ist nicht mal Mittag.
»Jameson.«
Es ist die Sorte Pub, wo die Wände mit gerahmten Spiegeln und verstaubtem Nippes dekoriert sind, Pferderennen im Fernseher laufen und ein Geruch nach klammer Kleidung in der Luft hängt. Es kann noch so früh am Tag sein, irgendein einsamer Trinker steht immer an der Bar, übellaunig über sein Bier gebeugt. Ich gehe mit meinem Glas in eine ruhige Ecke und warte, dass meine Nerven sich beruhigen. Mir ist flau im Magen, und das hat nichts mit meinem Kater zu tun. Das junge Mädchen im Wasser. Ein kaltes Frösteln findet zielstrebig die zarte Stelle in mir. Ich schließe die Augen und warte, dass es vergeht, rede mir zu, mich am Riemen zu reißen.
Ich kann spüren, wie es einsetzt. Das Engegefühl, als würde ein Gürtel um meinen Hals zugezogen. Jedes Mal, wenn so etwas passiert, spüre ich, dass der Gürtel ein Loch enger gezurrt wird. Wie vor einigen Jahren, als ich hörte, dass Ken Yates bei einem Autounfall ums Leben gekommen war – ein Loch. Und Sallys Beerdigung letztes Jahr – wieder ein Loch. Jedes Mal, wenn eine Nachricht aus der Vergangenheit durchsickert – ein weiteres Loch.
Die meiste Zeit spüre ich ihn nicht – diesen Würgegriff um meinen Hals. Aber dann passiert irgendetwas, aus heiterem Himmel, wie die Fotos vorhin, von einem Mädchen und einer Tragödie, die absolut nichts mit mir zu tun hat. Und sofort merke ich, wie die Tentakel der Vergangenheit sich nach mir ausstrecken und mich packen, bis ich nicht mehr atmen kann, als wäre ich selbst unter Wasser. Erst vor ein paar Wochen hatte ich es wieder gespürt, hier in diesem Pub.
Ich habe den Abend noch lebhaft in Erinnerung. Ich war mit ein paar Kollegen auf ein Feierabendbier hergekommen, woraus mehrere wurden; im Hintergrund lief der Fernseher. Irgendwer sagte: »He, mach mal lauter, ja?« Ich drehte mich zum Bildschirm um, und da war Luke Yates auf dem Sofa einer Talkshow und richtete einen leidenschaftlichen Appell an die Öffentlichkeit. In einer Runde von Unternehmern, Wirtschaftsexperten und anderen Fernsehköpfen, die über die Konjunkturkrise diskutierten und forderten, dass wir als Nation das Wachstum ankurbeln müssten, statt einen Sparkurs zu fahren, hielt Luke sich anscheinend nicht an die ihm vorgegebene Rolle und forderte von den Zuschauern, sich nicht länger auf das eigene Elend zu konzentrieren, sondern endlich mal über den Tellerrand zu schauen, damit sie begriffen, was echtes Leiden bedeutete.
»Dieses kleine Land hat schon immer in einer höheren Liga gespielt«, sagte er. »Was internationales Ansehen und internationale Hilfe betrifft, haben wir denjenigen, deren Not größer ist als unsere, niemals die kalte Schulter gezeigt. Generationen von Iren haben gespendet, um den Armen in anderen Ländern zu helfen – und das schon lange bevor es die katholische Hilfsorganisation Trócaire und die Live-Aid-Benefizkonzerte gab. An der Bereitschaft, in die eigene Tasche zu greifen, um unseren Mitmenschen zu helfen, hat es in diesem Land noch nie gemangelt. Aber jetzt sind Sturmwolken aufgezogen, und die Buhmänner sind da, der IWF, die Troika, und wir reden bloß noch über Sparmaßnahmen, Etatkürzungen, Hypothekenrückstände, Arbeitslosigkeit. Die Angst hat Irland fest im Griff. Überall um mich herum sehe ich Menschen, die sich nur noch um sich selbst kümmern. Und das Schlimmste an der Angst ist ihre Auswirkung auf uns als Nation. Sie isoliert uns. Wir sind nicht mehr weltoffen, wollen uns selbst schützen, uns abschotten und das festhalten, was wir haben. Nach uns die Sintflut. Die Angst tötet unsere Großzügigkeit, sie unterdrückt unser kollektives Gewissen, sie macht uns hart, kleinlich und habgierig, und so sind wir meiner Ansicht nach nicht. So sind die Iren nicht.«
In dem Stil ging es weiter und weiter. Der Moderator und einige der anderen Talkgäste unterbrachen ihn mit Bemerkungen zur Arbeitslosigkeit und der schleichenden Verarmung, doch Luke ließ sich nicht zum Schweigen bringen.
»Meine Fresse, der regt sich aber ganz schön auf«, sagte jemand.
Und das stimmte. Ich konnte sehen, wie sein Gesicht rot anlief, als er sich mühsam beherrscht auf seinem Stuhl vorbeugte. Wo war das hergekommen, sein leidenschaftliches Engagement, sein soziales Gewissen? Wie die anderen um mich herum hatte ich bis dahin keine Ahnung gehabt, dass er so feste Prinzipien oder Überzeugungen besaß. Während ich zuschaute, fiel mir noch etwas anderes auf: Es war still geworden im Pub. Alle Gäste starrten auf den Bildschirm. Biergläser blieben unangetastet, jeder war nur noch auf den Fernseher konzentriert, auf den Mann mit dem schicken Anzug und den telegenen Gesichtszügen, der mit der Faust auf den Tisch schlug und uns unsere Versäumnisse vorwarf, uns bekniete, nicht zuzulassen, dass diese Wirtschaftskrise unsere Grundwerte veränderte, dass unser menschlicher Anstand unter dem Druck zerbrach. Auch das Studiopublikum war verstummt, und mir kam plötzlich eine Erinnerung: Luke als Junge, bis zur Taille im Fluss, Schlingpflanzen, die von den Bäumen über ihm herabhingen. In dem Moment spürte ich es, während ich ihn da oben auf dem Bildschirm sah – das Engegefühl um den Hals –, was seltsam war, weil wir einander kaum noch kannten, zumindest nicht richtig.
Er kam zum Ende, und es entstand eine Pause. In der kurzen Stille hob ein Mann an der Bar sein Bierglas Richtung Fernseher. »Bravo.« Dann applaudierte das Studiopublikum, und die Leute um mich herum hoben ihre Gläser, nickten und sprachen den Rest des Abends über nichts anderes mehr.
Am nächsten Tag war Luke mit seinem Auftritt in der Late Late Show Thema in allen Radiosendern. Auch die Zeitungen berichteten ausführlich. Im Gegensatz zu manchen Geschichten, die schnell wieder aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwinden, blieb diese haften. Deshalb war es keine Überraschung, als von unserem Chefredakteur die Anweisung kam, jemand solle ein Feature über Luke für die Zeitung schreiben. Ich hatte bloß nicht damit gerechnet, dass mir diese Aufgabe zufallen würde.
Ich trinke mein Glas aus, nehme meine Tasche und gehe hinaus in die Nachmittagssonne. Ich spiele mit dem Gedanken, einen Spaziergang am Kanal zu machen, weil ich weiß, dass ich durch die Bewegung an der frischen Luft wieder einen klaren Kopf bekommen werde. Doch stattdessen setze ich mich an einen der Holztische draußen vor dem Barge und schicke der Redaktion eine E-Mail, dass ich nach Hause gegangen wäre, weil mir schlecht sei. Dann schalte ich das Handy aus und verbringe den Rest des Nachmittags damit, Coronas zu trinken und dem Gespräch am Nebentisch zu lauschen, bis die Schatten länger werden und es frostig wird. Reggae dringt aus einem offenen Fenster in der Nähe, untermalt vom Verkehrslärm der dahinterliegenden Straßen.
Gestern um diese Zeit war ich dabei, mich zu schminken und das Haar hochzustecken, ein rotes Kleid auf dem Bett ausgelegt, daneben die kleine Handtasche mit meiner Einladung. Eine Charity-Veranstaltung im Morrison. Nichts, worauf ich besonders scharf war, aber Luke würde da sein, mit einigen anderen, über die ich Recherchen anstellen sollte. Es war für mich eher ein Pflichttermin als Vergnügen.
Als ich dort ankam, war die Party schon in vollem Gange. Gut gekleidete und gepflegte Körper schmiegten sich aneinander, schlürften Champagner; Kellnerinnen in gestärkten weißen Blusen und Schürzen jonglierten Tabletts mit Kanapees durch das Gedränge. Wir alle zusammengepfercht in der obersten Etage eines Hotels in einem Raum mit Aussicht auf die Dächer, Türme und Baukräne, die die Skyline der City durchsetzen. Luke und Julia Yates, das Glamourpaar, standen mitten im Gewühl, und ich beobachtete sie von weitem: ihr geübtes Lächeln, die Art, wie sie gemeinsam mit den Leuten plauderten, ihr sorgsam choreographiertes Auftreten, den Glanz ihres Selbstbewusstseins und ihrer Privilegien. Ein Neidgefühl beschlich mich. Nein, Neid war es nicht. Es war eher, als würde ich mit einem Spiegelbild von mir selbst konfrontiert: eine Frau in den Dreißigern mit nichts Beständigem in ihrem Leben. Keinem Mann, keinen Kindern, keinem eigenen Haus. Stattdessen lebte sie in einer Mietwohnung – nur eine weitere von vielen, in denen sie vergeblich versucht hatte, sich zu Hause zu fühlen. Allein ihr Job, die einzige Konstante in ihrem Leben, sorgt dafür, dass sie nicht die Bodenhaftung verliert. In letzter Zeit hat sie öfter das Gefühl, dass diese Heimatlosigkeit auch auf ihre Arbeit übergreift. Selbst im Büro, wo sie sich sicher fühlt, läuft sie trotzdem Gefahr, den Halt zu verlieren.
Ich setzte mein Strahlelächeln auf und bahnte mir einen Weg durch das Getümmel, floh auf die Terrasse, um Luft zu schnappen, um wieder Sauerstoff in meinen Körper zu saugen und meine zitternden Hände zu beruhigen. Ich trank meinen Champagner und spürte, wie sich Wut in mir regte, Wut auf mich selbst. Warum war ich zu dieser Party gegangen? Wie um alles in der Welt war ich auf die Idee gekommen, dass ich hierherpassen könnte? Mittlerweile hätte ich eigentlich wissen müssen, wann ich etwas besser lassen sollte.
»Ich würde zu gern wissen, was du gerade denkst.«
Ich drehte mich um. Er stand draußen vor der Glastür. Er schloss sie hinter sich, um den Lärm der Party zu dämpfen, und ich sah ihn an, während er grinsend auf mich zukam. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Elegant und lässig in seinem schwarzen Smoking, das Haar glatt aus dem attraktiven Gesicht nach hinten gekämmt, hielt er mir eines der beiden Gläser Champagner in seinen Händen hin. »Wie ich sehe, sitzt du auf dem Trockenen.«
Die frische Luft hatte meine Unsicherheit nicht vertreiben können. Luke lächelte, doch ich konnte nicht sagen, ob es ein echtes Lächeln war oder ob er sein Unbehagen einfach besser kaschieren konnte als ich.
»Ich hab gedacht, du kommst hallo sagen«, fügte er hinzu.
»Du hättest ja auch kommen können«, sagte ich trotzig.
»Stimmt.« Er trat neben mich und blickte über die Stadt.
»Ich hatte das Gefühl, wir würden uns gezielt aus dem Weg gehen, Katie.«
»Ich weiß nicht, was du meinst.«
Und doch spürte ich die Anziehung zwischen uns und wusste, dass auch er sie spürte, genauso wie ich wusste, dass er sich gleichermaßen der Vergangenheit bewusst war, die jeden Kontakt zwischen uns gefährdete. Selbst die zwangloseste Begegnung war belastet mit Angst, Reue oder irgendeiner anderen schwer fassbaren Emotion.
»Ich habe gar nicht mit dir gerechnet«, sagte er. »Nach unserem letzten Gespräch dachte ich, du würdest Abstand halten.«
Sein zuvor amüsierter Tonfall war weicher geworden. Wir standen zusammen, während die untergehende Sonne die Dächer von Dublin in sanftes Licht tauchte. Ich sah das Gold an seinem Finger glänzen, ehe seine Hand sich auf meine legte.
Er ließ sie dort ruhen, und ich machte keinerlei Anstalten, meine Hand wegzuziehen. Ein Stück entfernt auf der Terrasse scherzte eine Gruppe von Rauchern miteinander. Ihr Lachen drang zu uns herüber, während die Schatten unten in den Straßen dunkler wurden.
»Ich hab mir gedacht, so eine Party könnte lustig werden.«
»Du siehst nicht so aus, als würdest du dich amüsieren, Katie.«
»Aber was ist mit dir?«, sagte ich und zog meine Hand unter seiner weg. »Der Sonnyboy. Der Mann der Stunde.«
Enttäuschung huschte über sein Gesicht. Dann lachte er und winkte ab, als wollte er meine Worte verscheuchen. Es war auch schwer zu begreifen. Eben noch war er ein Geschäftsmann gewesen, der ein paarmal Glück gehabt hatte. Im nächsten Moment war er aufs hohe Podest katapultiert worden – Mann des Volkes, Held der Massen, mit dem Finger am Puls der Öffentlichkeit. Und das alles nur wegen eines aufsehenerregenden Fernsehauftritts. Die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt.
»Und wohin geht die Reise?«, fragte ich, während ich ihn über den Rand meines Champagnerglases hinweg beobachtete. »Sitz im Parlament? Ministeramt? Oder vielleicht sogar Präsident? Ich könnte mir gut vorstellen, wie du mit Julia in die Residenz im Phoenix Park einziehst.«
Das war natürlich ein Witz: In Lukes Vergangenheit gab es zu viel, das einer erfolgreichen Politikerkarriere im Weg stand.
»Mensch, Katie, jetzt lass mal gut sein!« Er lachte. »Politik ist nicht mein Ding, das weißt du.«
Doch irgendetwas an der Art, wie er das sagte, ließ mich aufmerken, und ich musterte ihn genauer. Leichte Schatten unter den Augen, angespannte Körperhaltung. Ich fragte mich, ob er sich übernommen hatte. Aber ehe ich ihn das fragen konnte, sagte er: »Nick hat sich gemeldet.«
Sein Bruder.
»Ach ja?«
»Er hat vor ein paar Tagen angerufen, aus heiterem Himmel.«
Mein Magen zog sich nervös zusammen.
»Ist er noch in Nairobi?«
»Ja.« Er nickte, sagte dann: »Wusstest du, dass er heiratet?«
Mein Mund wurde trocken.
»Eine Amerikanerin, die er offenbar dort kennengelernt hat. Scheint noch so eine Hippie-Aussteigerin zu sein. Sie kennen sich gerade mal fünf Minuten.« Er trank einen Schluck Champagner. »Die Hochzeit ist morgen.«
Bevor ich etwas erwidern konnte, öffnete sich hinter uns die Glastür, und jemand kam heraus. Luke trat sofort ein Stück von mir weg.
»Gott, ist das heiß da drin«, sagte der Mann, kam zu uns und gab Luke einen freundlichen Klaps auf die Schulter. Ich erkannte ihn auf Anhieb – Damien Rourke, ein Selfmade-Multimillionär, der noch immer aussah wie ein zerknitterter Lebensmittelhändler. Er hatte ein weißes Taschentuch aus der Tasche gezogen und wischte sich damit über die Stirn, ehe er seine Aufmerksamkeit auf mich richtete. »Sie sind das, nicht?«, fragte er unfreundlich.
Ich hatte mal einen nicht unbedingt schmeichelhaften Artikel über ihn geschrieben. »Leibhaftig.«
»Sie schreiben noch immer für das Schmierblatt, was?«, fragte er mit einem Grinsen.
»Von irgendwas muss ich ja leben.«
Er schnaubte und wechselte das Thema. Wir unterhielten uns eine Weile über Politik und die europäische Wirtschaftskrise. Ein graues Wolkenband schob sich über den Horizont, während die Sonne versank. Ich schaute Luke möglichst nicht zu oft an, war mir aber ständig seiner ruhigen Selbstsicherheit und der Konturen seines markanten Gesichts bewusst. Nick heiratet. Nick: dunkles Haar, das ihm in die Stirn fiel, der versonnene Blick und das schüchterne Lächeln, als wäre ihm gerade etwas Komisches oder Anrührendes eingefallen, das er niemandem erzählen wollte.
Ich lächelte und nickte während des Gesprächs, trank aus meinem Glas und fühlte mich die ganze Zeit wie benommen. Ich sagte mir, dass es keinen Grund dafür gab, warum die Nachricht von Nicks Heirat mir dermaßen unter die Haut gehen sollte.
Jetzt, da ich vor dem Pub ein weiteres Corona trinke und die Schwäne auf dem Kanal vorbeigleiten sehe, denke ich an Nick und versuche mir vorzustellen, wie er vor dem Altar steht und auf eine namenlose, gesichtslose Frau wartet. Es hatte mal einen Bund zwischen uns gegeben, Nick und mir – die Narbe, die ich habe, beweist es. Aber jetzt sind wir Fremde. Ich spüre den Drang, ihm eine SMS zu schicken, ihm zu sagen, dass ich mich für ihn freue, obwohl das nicht annähernd beschreibt, wie ich mich fühle.
Reiß dich zusammen, sage ich mir streng. Gib dich nicht diesem rührseligen Schwachsinn hin. Ich stehe von der Bank auf und lasse meine halbleere Bierflasche stehen. Im flotten Tempo gehe ich Richtung City, ziehe meine Jacke enger um mich, verschränke die Arme, als würde ein kalter Wind wehen, dabei ist es noch warm, und vom Kanal kommt höchstens der Hauch einer Brise, obwohl schon Abend ist.
Ich gehe ins Bett und sinke in einen Schlaf, der an Bewusstlosigkeit grenzt.
Als ich vom Klopfen an meiner Wohnungstür wachwerde, kommt es mir vor wie mitten in der Nacht. Ich stehe auf und tapse schlaftrunken zur Tür. Reillys vertrauter massiger Körper steht im Licht der nackten Glühbirne über seinem Kopf.
»Reilly? Was ist los? Was machst du hier?«
»Ich hab versucht, dich anzurufen, aber dein Handy ist ausgeschaltet.«
»Scheiße, es ist mitten in der Nacht!«
»Es ist acht Uhr morgens, Katie«, sagt er, mit einem Anflug von Sorge in der Stimme. »Geht’s dir gut? Du siehst jedenfalls nicht danach aus.«
»Alles bestens«, erwidere ich plötzlich verlegen und ziehe meinen Bademantel fester um mich.
»Du bist gestern nicht zurück in die Redaktion gekommen.«
»Mir war schlecht.«
Ich drehe mich um und lasse ihn mir in die Wohnung folgen, höre, wie er die Tür schließt, ehe er zu mir in die Küche kommt. Ich schalte die Kaffeemaschine ein, lege den Kopf auf die Küchentheke, spüre den Schmerz, der mir von den Schläfen bis ins Kreuz zieht.
Ich fühle, dass Reilly mich beobachtet, also richte ich mich auf und fange an, Kaffee zu machen, weil es, so sehr ich Reilly auch mag, ein seltsames Gefühl ist, ihn in meiner Küche zu haben. Er ist anders als die meisten Männer, die mir dabei zugesehen haben, wie ich morgens im Bademantel Kaffee koche. Dichtes helles Haar, einen rötlichen Stich im Bart, der die tiefen Falten rechts und links vom Mund ebenso wenig kaschiert wie die Belustigung, die jetzt sein Gesicht belebt. Schwarze Lederjacke, graues Hemd, verwaschene Bluejeans – die Journalistenuniform, aber an ihm wirkt sie irgendwie deplatziert. Ich stelle mir gern vor, dass Reilly, wenn er von der Arbeit kommt, einen Hausrock und Samtpantoffeln anzieht.
Er nimmt eine Tasse Kaffee von mir entgegen, lässt dann den Blick durch meine Wohnung gleiten. Sie ist ziemlich armselig – zwei in Pastelltönen gestrichene Zimmer, eine Küchenzeile und ein Bad kaum größer als ein Schrank, wackelige Bücherstapel an einer Wand und Grünpflanzen in unterschiedlichen Stadien des Absterbens. Diese Wohnung im Herzen von Dublin, in einer dreistöckigen edwardianischen Backsteinvilla mit einer traurigen, lieblosen Fassade, ist seit vier Monaten mein Zuhause.
»Seit wann machst du Hausbesuche, Reilly?«
»Du bist meine erste Patientin.«
»Ich Glückliche.«
»Ich hab mir Sorgen gemacht, Katie. So, wie du gestern aus dem Büro abgehauen bist –«
»Mir war schlecht …«
Er fixiert mich mit einem Blick, der mich jäh und schmerzhaft an meinen Vater erinnert.
»Hör mal, Katie«, sagt er mit gesenkter Stimme. »Was gestern passiert ist … Wir waren alle entsetzt, angewidert von der Vorstellung, dass irgendein Perverso versucht, uns Geld für Fotos von einer Leiche abzuknöpfen. Aber du … du warst weiß wie die Wand. Und während wir anderen darüber diskutierten, bist du so schnell weggelaufen, dass du fast deine Tasche vergessen hättest. Eddie an der Pforte hat gesagt, er hätte noch niemanden mit solchem Tempo aus dem Gebäude rennen und gegenüber im Mother Kelly’s verschwinden sehen.« Er stockt. »Aber es waren bloß Fotos, Katie. Und du hast schon schlimmere gesehen. Du bist hart im Nehmen. Warum haben die dich so aus der Fassung gebracht?«
Ich kann es ihm nicht sagen. Sonst würde ich sämtliche Schutzschichten entfernen und den einen dunklen Ort freilegen, an den ich niemals Licht lassen wollte. »Hör mal, Reilly«, sage ich. »Ich weiß deine Sorge zu schätzen, ganz ehrlich. Aber mir geht’s gut. Ich schwöre.«
Er sieht mich auf seine prüfende Art an. »Da ist noch was«, sagt er. »Luke Yates.«
Die Art, wie er das sagt, lässt die Worte in mir versiegen. Ich sehe das Zögern in seinem Gesicht, und ich bin schlagartig alarmiert.
»Was ist mit ihm?«, frage ich.
»Du hast es noch nicht gehört.« Eine Feststellung, keine Frage.
»Sag schon.« Mein Herz rast.
»Es tut mir leid, dass du es von mir erfahren musst, Katie«, sagt er leise, »aber Luke Yates ist tot.«
2.NICK
Die Manschettenknöpfe sind leicht angelaufen und liegen auf einem Bett aus schwarzem Samt in einer ebenfalls schwarzen Schatulle. Sie sind alt, aber die Schatulle ist neu, und ich muss an Julia denken. Ich nehme an, dass sie diejenige war, die sie für die Reise so sorgsam eingepackt hat, obwohl das Geschenk angeblich von Luke ist. Wäre es nach ihm gegangen, hätte mein Bruder sie wahrscheinlich in einen Briefumschlag gesteckt, ihn zugeklebt und adressiert und dann auf das Beste gehofft. Als ich sie ins Licht halte, zittert meine Hand leicht. Ich sehe die Initialen meines Vaters, die in eleganter Schrift auf die flachen Goldscheiben graviert sind, und muss an einen Abend auf der Veranda unseres Hauses in Lavington denken: Dad – gerade von der Arbeit zurück – sitzt mit Mum zusammen, lockert seine Krawatte und nimmt die Manschettenknöpfe ab, das klimpernde Geräusch, das sie auf der Tischplatte machen, als die Fliegentür aufgeht und Jamil die Getränke bringt.
Die Erinnerung entgleitet, übertönt von den Straßengeräuschen. Die Stadt draußen ist laut. Autohupen gellen. Ich höre das Heulen eines Motorrollers, dann den Knall, als irgendetwas Schweres auf die Erde fällt. Nairobi läuft auf Hochtouren, vibriert vor Leben und Dynamik. Aber in diesem Raum scheint die Welt für einen Moment den Atem anzuhalten.
Das Päckchen ist gestern gekommen, ein wattierter Umschlag mit der Schatulle und einem Zettel:
Trag sie an Deinem großen Tag, Nico. Und werde glücklich. Dein Bruder, Luke.
Heute ist mein Hochzeitstag.
Die Tür geht auf. Murphy kommt herein, er sprüht vor Energie.
»Na denn«, sagt er, schlägt klatschend seine großen Hände zusammen und reibt sie energisch aneinander. »Wie fühlen wir uns?«
»Gut«, sage ich und versuche, ruhig zu bleiben.
»Komm, lass mich das machen.« Ehe ich protestieren kann, nimmt er mir die Schatulle aus den Händen. »Her mit den Manschetten.«
Er befestigt die Manschettenknöpfe mit kräftigen, aber trotz ihrer Größe sanften Fingern, Konzentrationsfalten auf der Stirn. Mir kommt unwillkürlich der Gedanke, dass eigentlich mein Vater hier sein müsste, um mir Halt zu geben. Aber Dad ist schon lange tot.
»Du bist doch nicht nervös, oder?« Murphy mustert mich mit seinen kleinen, durchdringenden Augen.
»Nein«, sage ich, obwohl ich mich beklommen fühle, seit ich Lukes Zettel gelesen habe.
»Gut. Es gibt auch keinen Grund, nervös zu sein. Du hast das ganze Leben vor dir.«
Er fasst mich an der Schulter, lässt seine Hand einen Moment dort liegen. Ich kann seine rastlose Energie spüren. Er nimmt mein Jackett von der Rückenlehne des Stuhls und hilft mir hinein.
»Wir haben noch reichlich Zeit, also keine Panik«, sagt er.
Hinter den Fenstern ist Nairobis Skyline in mildes Sonnenlicht getaucht. Ich nicke.
»Das Wetter ist schön«, sagt Murphy. Er meint es gut. Und obwohl ich bereit bin für diesen Tag, ist da irgendetwas, das an mir nagt.
Murphy kennt mich lange genug, um zu wissen, wann etwas im Busch ist, doch bevor er etwas sagen kann, hören wir einen Pfiff auf dem Flur. Es ist Karl. Er stößt schwungvoll die Tür auf. »Hallo! Hallo!« Er hat das Kästchen mit den Ringen in der Hand.
»Du hast dran gedacht«, sage ich trocken.
Er grinst und schüttelt das Kästchen neben seinem Ohr. »Wie könnte ich die vergessen? Also wirklich.« Er schließt die Tür hinter sich. Karl ist ein kleiner Mann, schmächtig und blond, mit kurz geschorenem Haar. Seine Spritzigkeit hat die Energie im Raum schlagartig verändert. Heute Morgen trägt er einen blauen Anzug, der wie angegossen sitzt, eine dünne schwarze Krawatte und Vans an den Füßen. Sein flacher Hut sitzt weit hinten auf dem Kopf. Er hat sich sichtlich Mühe gegeben – anscheinend hat er sich sogar rasiert. Kaum hat er die Tür geschlossen, holt er auch schon seine Zigaretten aus der Tasche. Als er sich eine zwischen die Lippen steckt, tritt Murphy vor und protestiert.
»Untersteh dich«, sagt er streng. »Oder willst du, dass der Bräutigam nach Rauch stinkt?«
Karl gibt sich gekränkt, tut aber wie geheißen, stellt die Autorität des Priesters weder in Frage, noch lässt er sich von ihr einschüchtern.
»Hey, Father Murphy«, sagt er mit Blick auf Murphys Haaransatz. »Wie ich sehe, waren Sie bei meinem Friseur.«
Murphy lacht. Bis vor kurzem hatte er einen grauen, aber nach wie vor dichten widerspenstigen Haarschopf, den er einfach nicht bändigen konnte. Es war ein Schock, ihn mit Bürstenhaarschnitt zu sehen. Die Frisur brachte seine Wangenknochen besser zur Geltung und ließ ihn irgendwie puritanisch wirken.
»Also, Nick«, sagt Murphy. »Deine Eltern wären heute sehr stolz auf dich, weil du diese Bindung eingehst. Ich weiß, es ist schwer für dich, dass sie nicht dabei sind.«
Mein Handy klingelt. Murphy, der nach seiner emotionalen Anwandlung leicht verlegen wirkt, greift nach dem Telefon auf dem Tisch, doch statt es mir zu geben, geht er selbst ran.
»Murphy hier«, sagt er fröhlich. »Ach, hallo.«
Ich blicke ihn fragend an, erwarte, dass er mir das Handy reicht. »Ja, er ist da …«
Er wirft einen Blick in meine Richtung und dreht sich dann weg, die Schultern hochgezogen. Irgendetwas an seiner Haltung verrät mir, dass er gerade etwas Unerfreuliches hört. Er stöhnt auf. Ich warte, dass er sich umdreht, doch stattdessen hebt er einen Finger und verlässt den Raum.
»Was war das denn?«, sage ich zu Karl.
Er zuckt die Achseln. »Hochzeitsarrangements, schätze ich. Er will nicht, dass du dir irgendwelche Gedanken machst. Du kennst Murphy ja, am liebsten würde er alles selbst machen.«
»Zeig mir die Ringe«, sage ich, um das ungute Gefühl abzuschütteln, das Murphys Reaktion bei mir ausgelöst hat.
Ich nehme sie aus dem Kästchen und wiege sie in der Hand. »Schwerer, als ich sie in Erinnerung hatte.«
»Die werden dich nach unten ziehen«, witzelt Karl. »Komm, wir rauchen eine, solange Murphy nicht da ist.« Er öffnet das Fenster, zündet eine Zigarette an und gibt sie mir. »Wir besprühen dich hinterher mit Raumspray oder so.«
Seite an Seite lehnen wir uns gegen die Fensterbank, teilen die Zigarette wie zwei Schuljungen, die blaumachen.
»Fass dich bei deiner Rede kurz, Nick, ja? Ich meine, als dein Trauzeuge will ich meinen Teil sagen können, und wie ich dich kenne, nimmst du die ganze Sendezeit für dich in Anspruch. Die Leute mögen kein langatmiges Geschwafel.«
Ich ziehe an der Zigarette und lächele. In Wahrheit rede ich nie viel. Schon als Kind war ich zurückhaltend, habe das Reden lieber anderen überlassen. Ich hatte ja Luke, der immer jede Menge zu sagen hatte – genug für uns beide zusammen. Als ich acht war, sprach ich ein ganzes Jahr kein Wort. Es war, als würde etwas in mir festsitzen. Posttraumatische Belastungsstörung würde man so was heute wohl nennen. Damals gab’s keinen Namen dafür. Meine Eltern zogen es aus persönlichen Gründen vor, die Sache nicht genauer untersuchen zu lassen. Sie warteten lieber ab, bis ich mich von allein wieder fing. Ich malte viel und hörte viel Musik. Ich saß stundenlang am Klavier. Luke war derjenige, der es schaffte, mich in die Welt der Sprechenden zurückzuholen. »Ich hab heute Geburtstag«, sagte er eines Morgens, als er an der Tür meines Zimmers auftauchte.
»Herzlichen Glückwunsch«, sagte ich unwillkürlich, die Worte ein heiser krächzender Laut in meiner Kehle. Luke rannte sofort zu Mum und Dad, um ihnen die Neuigkeit zu erzählen, und das war das Ende meines selbstgewählten Schweigens.
Jetzt lasse ich lieber die Musik für mich sprechen. Und obwohl ich kein Freund von Worten bin, findet zwischen mir am Klavier und Karl mit seinem Saxophon die innigste Unterhaltung statt, die ich mir vorstellen kann.
Als Murphy zurückkommt, sagt er nichts über den Anruf, wirkt aber beunruhigt. Er gibt mir das Handy.
»Wer war das?«
»Niemand. Nichts, worüber du dir jetzt Gedanken machen musst«, sagt Murphy aufgesetzt heiter. Er wedelt mit der Hand durch die Luft. »Jungs, Jungs, Jungs. Also wirklich! Müsst ihr unbedingt rauchen?«
»Nichts, worüber ich mir Gedanken machen muss?«, frage ich.
»Ich erzähl’s dir später«, sagt er und sieht auf seine Uhr. »So, mach die Zigarette aus, Karl. Wir müssen los.«
Karl murmelt irgendwas vom Verurteilten auf dem Weg zum Schafott, gibt mir einen freundschaftlichen Klaps auf den Rücken und trottet hinter Murphy her aus dem Raum.
Ehe ich den beiden folge, schaue ich in meinem Handy nach, wer angerufen hat, doch unter »eingegangene Anrufe« ist nichts aufgeführt.
Vor einigen Tagen habe ich abends meinen Bruder angerufen. Als er sich meldete, konnte ich hören, dass im Hintergrund eine Party im Gange war. Am liebsten hätte ich gleich wieder aufgelegt.
»Ich wollte dir nur was sagen«, begann ich und hörte, wie er sich von dem Lärm entfernte. »Luke, ich heirate.«
Eine Pause entstand. Luke hustete. »Das ist eine tolle Neuigkeit, Nick. Glückwunsch!« Er tat zwar mir zuliebe, als würde er sich für mich freuen, konnte aber seine Überraschung nicht verhehlen. »Wann ist der große Tag?«
»Nächste Woche …«
»Nächste Woche? Donnerwetter«, sagte er. Ich hatte ihn überrumpelt. »Und wer ist die Glückliche?«
»Sie heißt Lauren.«
Ich erzählte ihm ein bisschen mehr über Lauren, obwohl das schwierig war, weil sie neben mir lag und mithörte. Ich dachte, wenn ich ihm von ihr erzählte, könnte das den Zauber brechen. Irgendwie fürchtete ich, dass Luke eine Bemerkung machen würde, die das Einzige, das mir lieb und teuer war, vergiften könnte. Dass er Zweifel anmelden würde, weil ich Lauren schon nach so kurzer Zeit heiraten wollte – dass er mir vielleicht sogar davon abraten würde. Wenn Lauren und ich zusammen sind, fühlt sich die Liebe zwischen uns uralt und verlässlich an, doch während ich mit Luke sprach, erschien sie mir fragil und nackt.
»Ich würde sie gern mal kennenlernen«, sagte Luke. Er klang aufgewühlt. »Und die Hochzeit – die ist in Nairobi, nehme ich an?«
»Ja«, sagte ich.
»Du weißt, das werd ich nicht schaffen. Nicht so kurzfristig.« Der Stimmenlärm und die Musik im Hintergrund wurden lauter. Er hatte sich wohl wieder dem Raum genähert, wo die Party stattfand, behielt die Lage im Auge.
»Hört sich an, als würdest du selbst gerade feiern«, sagte ich.
»Bloß eine kleine Party. Kein Vergleich zu einer Hochzeit.«
Mein Bruder konnte eine richtige Stimmungskanone sein, und ich hatte schon oft gehört, wie seine Schulfreunde über seine Witze lachten, wenn sie nach der Schule zu uns nach Hause kamen. Ihre ausgelassenen Scherze schlossen mich allerdings nicht mit ein – ich war bloß der kleine Bruder, der nur aus der Ferne zusehen oder lauschen konnte, was Luke mit einem engen Freundeskreis teilte, dem ich nicht mehr angehörte, seit wir Nairobi verlassen hatten.
»Tut mir leid«, sagte ich. »Wir haben erst vor ein paar Tagen beschlossen zu heiraten. Ganz spontan.«
Was immer ich mir auch für einen Text zurechtgelegt hatte, es lief nicht rund. Ich geriet ins Stocken.
»Spontan«, wiederholte Luke. Ich stellte mir vor, wie er den Kopf schüttelte.
»Keine Einladungen oder so«, sagte ich. Es sollte keine große Feier werden. Bloß Lauren und ich und eine Handvoll Freunde, im kleinen Rahmen. Von Laurens Familie würde auch niemand kommen. Sie hatte sie angerufen und genau die verdutzte Reaktion geerntet, die sie erwartet hatte. Aber wir hatten gehalten, was wir einander versprochen hatten: so wenig Tamtam wie möglich. Unsere Hochzeit sollte klein und intim sein, kein gesellschaftliches Event wie die Heirat von Luke und Julia, über die in den Sonntagsbeilagen der Zeitungen und in Hochglanzmagazinen berichtet worden war, doch dann hatte Karl von unseren Plänen Wind bekommen und anderen davon erzählt. Ehe wir wussten, wie uns geschah, war eine Party geplant worden, mit einem Lokal zum Feiern, einer Band und einer Gästeliste. Ich sagte mir, dass Luke ohnehin nicht gekommen wäre, doch in der kurzen Pause während unseres Telefonats stellte ich mir vor, was er hinterher dazu gesagt hätte, wäre er doch dabei gewesen.
»Es geht ums Prinzip«, hörte ich ihn zu Julia sagen.
Warum hatte ich ihm keine Einladung geschickt? Weil seine Anwesenheit so viel aufgewühlt hätte? Oder weil er sich vielleicht verpflichtet gefühlt hätte zu kommen, obwohl er lieber nicht nach Nairobi zurückgekehrt wäre?
Die Wahrheit ist, ich wollte ihn nicht in meine Welt hineinlassen, in eine Wirklichkeit, die ich mir selbst geschaffen hatte, in etwas, das mit ihm nichts zu tun hatte.
»Ich hätte nie gedacht, dass du mal heiratest, Nick, aber ich hoffe wirklich, du und deine Braut habt einen wunderbaren Tag«, sagte er, und seine Stimme klang ehrlich, was alles nur noch schlimmer machte. Ich fragte mich, warum er nie gedacht hatte, dass ich mal heirate.
»Ich werde an dich denken. Es ist …« Er stockte.
»Was?«
»Nichts. Ich will nur das Beste für dich, Nick. Das hab ich schon immer.«
Ich spürte einen Kloß im Hals. Ich wollte »danke« sagen, wollte »es tut mir leid« sagen, doch stattdessen sagte ich: »Murphy hält die Trauung ab.«
»Murphy? Deine Hochzeit, Mums Beerdigung … Was würden wir bloß ohne ihn machen?«
Der Sarkasmus war unüberhörbar, doch ich ging lieber nicht darauf ein. Luke sprach die nächsten Worte undeutlich aus: »Du warst so schnell weg nach der Beerdigung …«
»Du kennst mich, Luke. Abschiede liegen mir nicht.«
»Scheint so«, sagte er.
Die Party wurde lauter, als er noch näher ranging und sich, so kam es mir vor, weiter von mir entfernte. Ich konnte kaum verstehen, was er als Nächstes sagte: »Es gibt wohl nie einen richtigen Zeitpunkt, um sich zu verabschieden.«
Er dankte mir für den Anruf, gratulierte noch einmal und sagte, dass wir uns in nicht allzu ferner Zukunft mal sehen müssten, doch es klang alles unklar, Worte, die ineinander übergingen, während sich in mir allmählich eine alte Panik meldete. Ich murmelte eine Verabschiedung, legte das Telefon auf den Nachttisch und drehte mich zu Lauren um. Sie zog mich an sich, sagte aber nichts.