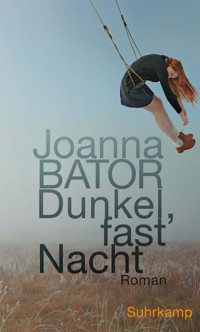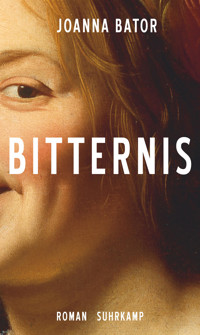
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kalina Serce, jüngster Spross einer Frauendynastie, Erforscherin einer düsteren Familiengeschichte, betritt eine Villa, die lange Zeit unbewohnt war. Sie tastet nach dem Ebonit-Schalter aus der Vorkriegszeit, um Licht zu machen – eine Ankunft im Unvertrauten.
Mit diesem Haus, der früheren Pension Glück im schlesischen Langwaltersdorf, hat es seine eigene Bewandtnis. Hier traf sich Kalinas Urgroßmutter Berta mit ihrem Geliebten. Berta träumt von einer Flucht mit ihm nach Prag, die der Vater verhindert. Der Hass auf ihn wird so groß, dass sie zu einer ungeheuren Tat schreitet.
Joanna Bators neuer Roman erzählt von weiblichen Lebensentwürfen. Und wie sie scheitern. Im drängenden, sarkastischen, an Elfriede Jelinek erinnernden Ton entfaltet sich das Drama der zornigen Frauen, die ihr Geheimnis durch die Generationen weitergegeben haben. Krieg, Gewalt und privates Unglück haben die Angst und Bitternis hervorgebracht, aus deren Bannkreis erst die Jüngste, Kalina, heraustritt, indem sie davon erzählt. Mit Macht fordert sie das Glück ein, das den Frauen ihrer Familie versagt war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1150
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Joanna Bator
Bitternis
Roman
Aus dem Polnischen von Lisa Palmes
Suhrkamp Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Gorzko, gorzko bei Znak in Krakau.Abweichungen der vorliegenden Übersetzung von der Originalausgabe wurden mit der Autorin abgestimmt.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2023.
© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG,Berlin, 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagabbildung: Gerrit van Honthorst, Lächelndes Mädchen, eine Kurtisane, die ein obszönes Bild hält (Ausschnitt), 1625, Öl auf Leinwand, © Saint Louis Art Museum/Friends Fund/Bridgeman Images
eISBN 978-3-518-77734-3
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Ich
Berta
Barbara
Violetta
Kalina
Berta
Barbara
Violetta
Kalina
Berta
Barbara
Violetta
Kalina
Berta
Barbara
Violetta
Kalina
Berta
Barbara
Violetta
Kalina
Berta
Barbara
Violetta
Kalina
Berta
Barbara
Violetta
Kalina
Berta
Barbara
Violetta
Kalina
Berta
Barbara
Violetta
Kalina
Berta
Barbara
Violetta
Kalina
Berta
Barbara
Violetta
Kalina
Berta
Ich
Häckerle nach Berta Koch
Fußnoten
Informationen zum Buch
Ich
Letzten Herbst habe ich mir in einem niederschlesischen Dorf ein hundert Jahre altes Haus gekauft. Zu dem Haus gehört auch ein Hund; sein Kopf sieht nach Wolf aus, sein Körper wie ein angestaubter Eisbär. Ein Ohr schwarz, das andere weiß, beide spitz und wachsam. Außer dem Hund haben die Vorbesitzer mir ein paar Sachen hinterlassen, eine Küchenkredenz, ein Himmelbett mit Säulen und einen Eichentisch; in die Platte sind unzählige Schnitte eingegraben – Schriftzeichen, die ich jeden Tag aufs Neue zu entziffern versuche.
Zu deutschen Zeiten hieß der Ort Görbersdorf und rühmte sich des weltweit ersten Sanatoriums für Tuberkulosekranke, die ein Doktor Hermann Brehmer und seine Nachfolger mit Hilfe des zuträglichen Klimas und einer entsprechenden Kost kurierten. Heute trägt der Ort den Namen Sokołowsko, zu Ehren eines polnischen Pulmologen, der einige Jahre Doktor Brehmers liebster, aber auch äußerst kritischer Assistent war; er beharrte darauf, dass kalte Güsse und weite Spaziergänge bei fortgeschrittener Schwindsucht nicht das Mittel der Wahl sind. Diesen Ort, an dem ich bleiben möchte, kann man leicht übersehen, so klein ist er; von oben erinnert er an eine schmale, mit Wald überwuchernde Narbe. Das alte Sanatorium ist nur noch eine Ruine, die meisten kleineren Erholungszentren und Pensionen sind seit Jahren geschlossen, und die Altbauten aus der Vorkriegszeit stehen leer, sie verfallen. Es ist der kleinste Ort, in dem ich je gewohnt habe. Zum Ausgleich ist dieser riesige Hund in mein Leben getreten; sein Zottelfell ist so dicht, dass ich es nur mit einem Pferdestriegel entwirren kann. Unter dem Fell ist seine Haut rosa, von Narben gezeichnet, zart wie bei einem Kind. Die ausgekämmte Unterwolle verströmt einen warmen Duft, der mich an Ahornsirup und Torf erinnert, und sie ist so weich, dass man Garn daraus spinnen könnte. Der Hund war an meinem dritten Tag hier aufgetaucht und hatte sich in der kühlen Stunde kurz vor Morgengrauen einfach neben der Hundehütte niedergelassen, würdevoll, erhaben und unwirklich. Sein Atem dampfte, und als ich die Haustür öffnete, blickte er mich unverwandt an.
Im Dorfladen sagte man mir, er sei der Gefährte Bazyl Ochęduszkos gewesen, eines Hellsehers und Heilers, der das Haus einem Wrocławer Geschäftsmann verkauft hatte, aus Unglück und Verzweiflung; danach verlor sich seine Spur in dem dichten Nebel, der über dem Talkessel hing. Angeblich lebt er nicht mehr, er soll ertrunken sein, doch seine Leiche wurde nie gefunden. Der neue Hausbesitzer hatte den Hund irgendwo ausgesetzt, weit weg, sogar zweimal, doch das Tier war zurückgekommen und hatte knurrend das Haus umrundet. Schließlich hatte der Städter ihm gestattet zu bleiben, wohl eher aus Angst als aus Sympathie. Er hielt ihn an einer Kette bei der Hundehütte, die er vom Dorfschreiner zusammenzimmern ließ. Der Mann, jener Städter, von dem ich das Haus gekauft habe, wurde abfällig »der Dingens« genannt, weil allen gleich klar war, dass er trotz der gezimmerten Hütte und der guten Miene zum bösen Hund mehr nicht verdiente. Orte wie Sokołowsko sind gnadenlos und unberechenbar – von einer unergründlichen Logik geleitet, nehmen sie Neuankömmlinge entweder königlich auf oder spucken sie aus wie Obstkerne. Jedenfalls war der Hund einige Monate später spurlos verschwunden, und der Dingens ging suchend durchs Dorf und fragte herum, wer ihn von der Kette gelassen haben könnte, denn diese war, wie er behauptete, durchtrennt worden. Er beklagte sich über wiederkehrende Strom- und Wasserausfälle, die umso ärgerlicher waren, als Strom und Wasser jeweils kurz vor Erscheinen des Kundendienstes wieder zu fließen begannen, um direkt nach der Visite erneut zu versiegen. Schließlich bot er das Haus zum Verkauf an. Der Hund blieb mehrere Monate verschwunden und kehrte erst zurück, nachdem der Dingens ausgezogen war.
Vielleicht hatte der Hund mich schon von ferne beobachtet und überlegt, ob man mir vertrauen könne, ja, vielleicht hatte er sogar gesehen, wie ich zum ersten Mal Licht in der Küche machte und die Tischplatte berührte. An diesem Tisch hatte Bazyl Ochęduszko mit Wasser aus seiner Quelle geheilt, Geister herbeigerufen, meiner Großmutter Barbara und Tausenden anderen die Zukunft geweissagt und auch die Vergangenheit, was eine mindestens so hohe Kunst ist. Für jeden fand er die richtige Sprache und dadurch den Zugang zu ihren Herzen. Für die Rationalisten gab es Quantenenergie, für Marienverehrerinnen die Tränen der Muttergottes, für aufgeklärte Katholiken den Hauch des Heiligen Geistes und für die Anhänger leichtverdaulicher Esoterik New Age und Paulo Coelho. Bazyl Ochęduszkos Therapien halfen bedauerlicherweise nur bei wenigen Auserwählten – ein Heiler, dem die Heilung nur bei jedem zehnten Krebspatienten gelingt, und ein Hellseher, der nur jede fünfte lebendige oder tote Person auffindet, ist wenig vertrauenerweckend. Geister aber erschienen immer in seinen spiritistischen Séancen, zumindest darin waren sich alle einig.
Die Dorfbewohner erinnerten sich an Bazyl Ochęduszko, doch keiner kannte den Namen des Hundes, als hätte das Tier vor meiner Ankunft sämtliche ihm vom Menschen verliehenen Benennungen abgestreift. Beim Einzug in eine neue Welt, wie sie das Dorf für mich war, lässt es sich kaum überleben, ohne die Umgebung wenigstens vorläufig zu benennen und sie damit zu einer Vertrauten zu machen. Ich ordnete die Namen ihren mutmaßlichen Designaten zu, so wie man einem fremden Tier eine Schüssel Futter vorsetzt – frisst es, ist alles gut, frisst es nicht, wartet man ab und versucht es mit etwas anderem. Bruno war der erste Name, der mir in den Sinn kam, als der Hund und ich uns im grauen Morgendämmer ansahen. Ringsum roch es nach Wald, nach Erde und nach verbrannter Kohle, deren Partikel mir im Hals kratzten, und mich ergriff eine Traurigkeit, gegen die es kein Mittel gibt. In einer plötzlichen Aufwallung dachte ich, das Tier sei vielleicht ein Geschenk, das Bazyl Ochęduszko mir zum Trost geschickt hatte. Ich weiß nicht, was der Hund dachte – ich zumindest fühlte mich beschenkt. Ein seltenes und schönes Gefühl, das ich ihm gern ebenfalls bereitet hätte.
Komm, Bruno, wir gehen auf ein Bier. Gewiss erwartet man uns schon, pflegte meine Mutter Violetta mit V und Doppel-t einen Dichter zu rezitieren, den heute kaum noch jemand liest. Als sie jung war, sang man seine traurigen Texte, die sich auflehnten gegen die Schlechtigkeit der Welt und zugleich enthusiastisch von verschlungenen Pfaden und weiten Heiden sprachen, auf denen man wandeln konnte, um all das andere zu vergessen. Meine Mutter Violetta las und summte Edward Stachuras Texte vor sich hin, und ich glaube, sie liebte ihn auf ihre Art, bevor sie mit der Fähigkeit zu lieben auch den Glauben verlor, dass sie ihren eigenen verschlungenen Pfad finden würde. Wir sterben nicht so bald, wie der Tod es wünschen mag! Wir finden uns noch im Menschendschungel, zitierte sie, von aufkeimender Hoffnung beflügelt. Es ist zu spät, nein, noch ist es nicht zu spät! Sie zögerte, um schließlich doch zu handeln und eine neue Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen, die sich dann als ebensolcher Reinfall entpuppen sollte wie ich, ihre Tochter. Mein Gott, du bohrst in mich all deine Messer!, rief sie nach jedem Misserfolg, um dann nach einer Trauerphase ein neues Drehbuch zu entwerfen, das sie auf demselben Weg in die nächste Niederlage führen sollte. Mein Gott, du bohrst in mich all deine Messer! – das war ihr Lieblingszitat, als sie nach sechs Jahren Abwesenheit wieder in mein Leben trat; sie erinnerte fast an den heiligen Sebastian oder an die Mater dolorosa, so viele Klingen steckten in ihr.
Sobald ein Spiegel in der Nähe war, ein Augenpaar, eine Pfütze, überprüfte sie den Sitz der Messerspitzen, rückte hier eine Klinge ins rechte Licht, schob dort ein Messer tiefer in die Wunde. Violetta mit V und Doppel-t hatte für jede Gelegenheit ein passendes Zitat – nur für mich, sagte sie, fehlten ihr die Worte. Ich bin eine Tochter, zu der sich nur schwer etwas Passendes finden lässt, sowohl in der polnischen als auch in der internationalen Literatur, allerdings las Violetta Serce am liebsten Schundromane und schwelgte gern in Träumen, sie selbst könnte eines Tages die Heldin eines solchen Romans sein. Wir teilten die Faszination für Ufos – Violetta war tief beeindruckt von einem Artikel über eine Frau aus Ohio, die in einer fliegenden Untertasse gefangen gehalten und vergewaltigt wurde und nach ihrer Befreiung zehn Kilo schlanker und überdies berühmt geworden war; mir gefiel ein Artikel über kleine grüne Männchen, die Kinder entführten und sie auf einen Planeten voller freundlicher grüner Tiere mitnahmen. Violetta mit V und Doppel-t hatte Vorzeigebücher und private Lektüren, sie hatte Bühnenkostüme und bequeme Kleidung, die sie trug, wenn sie allein war, sie hatte ein Ausgehgesicht und eines, das man kaum je zu sehen bekam, am ehesten noch morgens, wenn Zbyszek Papugas Husten sie geweckt hatte.
Komm, Bruno, sagte ich also, als wir einander gegenüberstanden, ich in der Tür meines neuen Hauses, der Hund auf der noch leeren Straße. Wir gehen auf ein Bier, gewiss erwartet man uns schon – es klang wie eine Beschwörung. Der Hund erhob sich und kam auf mich zu, zögernd, als ginge er über ein Minenfeld. Sein Fell verströmte einen Geruch nach schmelzendem Schnee, keimenden Pflanzen und etwas Süßem. Ich hielt ihm meine Hand hin, damit er daran schnuppern konnte, und seine lange Hundeschnauze passte genau hinein.
Seitdem weicht Bruno mir nicht von der Seite, nur nachts will er um keinen Preis ins Haus kommen, und wenn ich nicht schlafen kann, sehe ich ihn draußen seine Runden ziehen; im Mondlicht gleicht er noch mehr einem schmuddeligen Eisbären, der sich aus seiner tauenden Heimat hierher verirrt hat. Er muss ein bisschen abnehmen und scheint einverstanden, nur ein Mal am Tag Futter zu bekommen; allmählich zeichnet sich ein sehniger Raubtierkörper unter seiner teddyhaften Rundlichkeit ab. Ein Wolf im Bärenfell. Ich weiß genau, dass er sich nachts mehr zu fressen holt, kommt er doch morgens satt zurück, zufrieden, mich überlistet zu haben. Dass manche Angst vor ihm haben könnten, ist mir bewusst, obwohl er nie jemandem etwas getan hat – dennoch, ein hinterhältiger Nachbar, ich vermute, einer der neu zugezogenen, hatte dem Tierarzt gemeldet, ich hielte mir einen Wolf.
Dem großen bärtigen Mann, der herkam, um den Hund zu inspizieren – er war so breitschultrig, dass er kaum durch die Tür passte –, log ich ungeschickt vor, ich hätte Brunos Eltern gekannt. Einen nicht ganz reinrassigen deutschen Schäferhund und eine große graue kaukasische Schäferhündin. Beschwörend redete ich auf ihn ein, während der Hund ihn gespielt träge anblinzelte, als wüsste er genau, worum es ging. Der Arzt streichelte das Tier mit den verschiedenfarbigen Ohren, und ich, die ich damals noch keine Ahnung hatte, wie gut dieser Mann meinen Hund kannte, starb tausend Tode, als Bruno ihm die Vorderpfoten auf die Schultern legte und mit seiner Wolfsschnauze näher kam, um sein Gesicht zu lecken.
Ungewöhnlich zahm für einen Wolf, scherzte der Mann und entblößte lachend seine schiefen Zähne. Diese Zähne gefielen mir sofort, und am zweitbesten gefiel mir, dass er mich an niemanden erinnerte. Beim nächsten Mal brachte er mir Morcheln mit, wunderschöne Herbstpilze mit dunklen faltigen Köpfen. Es genügt, sie kurz in erhitzte Butter zu geben und dann mit zarten Eiernudeln, etwas geriebenem reifen Käse und kaltgepresstem Olivenöl zu servieren. Wenn Bunia das sehen könnte! Sie hatte allen Pilzen misstraut, hielt sie für Teufelswerk und fürchtete ihre halb pflanzliche, halb tierische Natur. Meine Großmutter, Babcia Barbara, genannt Bunia, die Honig und papierdünne Pfannkuchen liebte und herrlich flaumiges Hefegebäck backen konnte, würde nie wieder mit mir am Tisch sitzen – es sei denn, Bazyl Ochęduszko käme zurück und riefe sie aus dem Jenseits herbei.
Das Haus, das ich mit meinem geschenkten Hund bezogen habe, steht am Ende der einzigen Straße, die sich von Ost nach West durchs Dorf zieht, ein Stück weiter wird die Chaussee zu einem Sandweg, um kurz darauf zu einem Pfad zu schrumpfen und schließlich zwischen Gräsern und Frühlingsblumen zu versickern. Hinter der Wiese schließen Berge den Horizont. Die Wände meines Hauses sind rau, das graue Holz erinnert an die Haut des Zirkuselefanten aus einer unserer Erinnerungen – im Moment kann ich nicht genau sagen, welcher. Meiner eigenen? Der meiner Mutter Violetta mit V und Doppel-t? Meiner Babcia Barbara? Oder stammt sie aus noch früheren Zeiten – etwa von Berta? Der schönen Berta, die ihr Vater mit in den Zirkus nach Waldenburg nahm, wo sie die warme Haut des Elefanten berührte und mir die Erinnerung daran in meinen Träumen vererbte? Dazu kommen wir noch, wenn ich auch gleich vorwegnehmen möchte, dass ich meine Zweifel nicht unter der verführerischen Maske einer allwissenden Erzählerin verbergen werde. Da ich fast nichts über meine Genealogie wusste, weder meine Großväter kannte noch meinen Vater, erschien mir die allwissende Erzählerin ein erstrebenswerter und herrlicher Zustand zu sein. Inzwischen weiß ich, dass man nicht alles wissen kann, weder über real existierende Personen wie mich, Violetta, Barbara oder Berta noch über die erfundenen. Fiktive Wesen sind so unergründlich wie Menschen aus Fleisch und Blut. Derjenige, der erzählt, ist niemals allwissend; manche Erzähler aber verstehen es, diesen Eindruck zu erwecken, und genießen es, vor dem Leser zu prunken wie der Pfau, der sein Rad schlägt. Ich versuche einfach, aufmerksam und genau zu sein. Außerdem habe ich einen Privatdetektiv engagiert, Adrian Smętowicz, dem es zu verdanken ist, dass ich nun unter anderem weiß, wo meine Mutter sich aufhält – wenn auch ihre Abwesenheit mir nicht mehr so wichtig erscheint wie früher einmal. Hauptsache, ich erinnere mich an diese Berührung, an mein eigenes oder ein ererbtes Gefühl, das sich einstellt, wenn ich meine Hand an die Wände mit ihrer waffelartigen Struktur lege. Und das tue ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit, um mich zu vergewissern, dass das Haus auch tatsächlich existiert.
Vielleicht wird manche die nichtlineare Struktur dieser Geschichte irritieren, und sie werden fragen, weshalb ich von der Vergangenheit in die Zukunft springe und zurück, ob ich nicht der Reihe nach hätte erzählen können. Je weiter ich mich aber in die Geschichte über uns vier hineinbegebe, desto stärker wird mein Eindruck, dass wir mit und zugleich gegen den Strom der Zeit leben, mitgerissen von der Zukunft wie von der Vergangenheit, unverwurzelt im schwindenden Jetzt. Paradoxerweise fiel es mir umso leichter, die Vergangenheit meiner Familie zu rekonstruieren, je weiter sie zurücklag, deshalb macht auch die Geschichte meiner Urgroßmutter Berta einen so geordneten Eindruck. Je näher ich aber mir selbst komme, desto mehr erinnert die Geschichte an das Leben, das sich immer in drei Zeiten zugleich abspielt und der Sehnsucht nach linearer Ordnung spottet. Ich selbst trete in dieser Geschichte selten auf, ich husche nur ab und zu im Hintergrund vorüber, mal in der dritten, mal in der ersten Person, die sich häufig überschneiden oder ineinanderfließen. Diejenige, die erzählt, und die jüngste meiner Hauptfiguren, Kalina Serce, sind ein und dieselbe Gestalt. Nur so gelingt es mir, die wenig gehaltvolle Existenz zu fassen, die ich bin, und sie mit Kalina zu verbinden, diesem mir kaum bekannten kleinen Mädchen, das auf einen Jungen namens Konrad wartet und sich nach Babcia Bunia sehnt. Und später in die Welt hinausgeht, mit einem Blatt Papier, darauf elf Buchstaben, niedergeschrieben von einer Hand aus dem Jenseits, die bei einer spiritistischen Séance in Bazyl Ochęduszkos Haus Barbara die Hand führte.
Damit wir uns nicht falsch verstehen – die Vergangenheit als Projektion meiner Gegenwart interessiert mich nicht. Ich vertraue den Fakten. Jetzt bin ich dreißig Jahre alt, und ich weiß, dass viele meiner Altersgenossinnen und -genossen sich auch noch in diesem Alter wie Kinder fühlen. Ich selbst war immer eher ein altes Kind. Eine alte Kleine – so nannte mich meine Mutter, und sie hatte recht, spüre ich doch, seit ich denken kann, ein seltsames Gewicht in meinem Geist, als läge dort ein Ei verborgen, in dem ein mir unbekanntes Geschöpf heranreift. Ich habe nichts anderes vor, als meine Familiengeschichte aufzuschreiben – der Gedanke, die Vorsehung habe mich zu diesem Haus geführt, gefällt mir, schließlich wusste ich an jenem eiskalten Tag, an dem ich mich zu bleiben entschloss, noch nicht einmal die Hälfte dessen, was ich heute weiß. Ich wusste nur, dass ich schon einmal hier gewesen war: In einem grünen Kleid und in Schnürstiefeln, die an den Knöcheln scheuerten, hatte ich neben Bunia am Tisch gesessen. Wir tranken Wasser mit Tränen der Gottesmutter.
Jahre später fuhr ich wieder nach Sokołowsko – die Spur Bertas, meiner Urgroßmutter, führte mich hierher, ich musste sie überprüfen und herausfinden, ob eine verrückte gelbhaarige alte Frau aus Unisław Śląski die Wahrheit sagte. Von ihr erfuhr ich, dass Berta und »der Junge« in Görbersdorf ein Kind gemacht hatten, machnęli dziecko, in genau diesen Worten drückte sie es aus, und sie benutzte auch den alten deutschen Namen des Ortes, in dem sich das erste Sanatorium für Tuberkulosekranke befunden hatte – weltberühmt. Das Kind, das sie nach den Worten der alten Frau mit dem stählernen Händedruck dort »gemacht« hatten, war meine Großmutter, Barbara Serce.
An jenem Tag, der mein Leben verändern sollte, parkte ich mein Auto neben dem verfallenen Sanatorium und begab mich auf den Weg durch den ausgestorbenen Ort. Erst nach einer Weile bemerkte ich winzige Lebenszeichen – in einem Fenster bewegte sich die Gardine, eine Katze mit rotem Halsband saß auf einem hölzernen Balkon, der so zart und zierlich wirkte, als müsste er jeden Moment von der baufälligen Fassade brechen, zwei Männer standen in einem Hauseingang. Mein Spiegelbild huschte am Schaufenster eines Altwarenladens vorüber – kurz geschnittenes Haar, magerer Körper. Alles, was ich in diesem Moment empfand, erschien mir ungewöhnlich, geradezu atemberaubend klar und wichtig. Ich gelangte ans Ende des Dorfes, wie es mir die uralte Frau gesagt hatte; an dem Haus, von dem sie gesprochen hatte, hing ein hässliches grellgelbes Banner: Zu verkaufen. Dann ging die Tür auf, und der Dingens stand auf der Schwelle.
Ich verwachse mit meiner neuen Umgebung und sie mit mir. Nun kann ich mich bereits im Dunkeln in ihr bewegen, wenn die Angst um meine Waden streicht und mich doch nicht zu Fall bringt. Mit sicherer Hand mache ich in der Dunkelheit Licht; Steckdosen und Schalter im ganzen Haus sind von vor dem Krieg, aus Ebonit, und erinnern mich an meine Kindheit in Barbara Serces Wohnung. Szajse, szajse, dieser alte deutsche szajs, zischte Bunia verärgert, doch als sie dann eines verregneten Herbstes kamen und das Ebonit gegen Plastik austauschten – sie, die von der Verwaltung, von der ad-mi-ni-stra-cja, wie Bunia flüsterte, weil sie das Wort mit der Regierung, den Ämtern, der Obrigkeit assoziierte, mit dem Übel und der Bedrohung per se –, murrte sie ebenfalls. Das Neue war immer schlechter als das Alte, Wandel schlechter als Beständigkeit, Überraschung schlechter als beruhigende Routine. Die von der Hausverwaltung waren gekommen, weil es wenige Tage zuvor aus einer Steckdose zu rauchen begonnen hatte, die unter den von Barbara »für alle Fälle« gehorteten Dingen verborgen war – und hätte nicht die Alte Papugowa auf dem Dachboden und vor unserer Tür herumgeschnüffelt, dann wären wir wohl bei lebendigem Leibe verbrannt. Gegen Ende ihres Lebens bezeichnete Bunia sogar sich selbst als szajs und ließ auch keinen Zweifel daran, dass nach ihrer Einschätzung unser ganzes Land nichts anderes war als szajs. Dieses Polen ist ein einziger alter deutscher und neuer chinesischer szajs, schimpfte sie, orientierungslos in dieser Welt mit ihrer Schwemme an minderwertigen Waren, deren grelle Farben die Augen schmerzten. Nur die Plastiktüten gefielen ihr, man durfte sie umsonst mitnehmen, konnte eine in die andere stopfen und dann halbdurchsichtige, weiche Kugeln aus ihnen formen. Früher blieben die Leute, wo sie waren, und dann starben sie und fertiś, aber heute muss es Tunesien-Hochnäsien sein und die Kanaren-Kackaren, reimte sie in einem zornigen Rap. Sie selbst war nie weiter gefahren als bis zu dem Dorf, in dem ich nun, viele Jahre später, diese Zeilen schreibe. Auf den Besuch bei Bazyl Ochęduszko bereitete sie sich lange vor und ließ sich für diese Gelegenheit zwei neue Zähne machen, die, wenn sie redete, klappernd aufeinandertrafen.
Aber nicht mit Bunia fängt diese Geschichte an. Vor ihr war noch eine andere Frau, ihre Mutter, meine Urgroßmutter Berta. Und wäre jene gelbhaarige Alte aus Unisław Śląski nicht gewesen, so besäße ich nichts als ein paar Zeitungsartikel, in denen die Einzelheiten nach Belieben zurechtgebogen und die Namen verdreht waren – oder in denen es, schlimmer noch, hieß, die ganze Geschichte sei erstunken und erlogen!
Jetzt weiß ich, dass Berta dieses Haus kannte – mein Haus mit den Wänden aus Holz, die Wind und Wetter getrotzt haben und rau sind wie die Haut des Zirkuselefanten –, obwohl sie im Nachbardorf wohnte, dort, wo immer noch jene alte Frau lebt, die behauptet, als Kind mit ihr befreundet gewesen zu sein. Sie hat mir alles erzählt, was sie wusste, und sogar – wie sie sagte – ein kleines bisschen mehr, um dann schweigsam und schwach zu werden, als sei die Quelle ihrer ungeheuren Energie und Lebenskraft mit diesem Bericht versiegt. Wenn ich sie nun in Unisław Śląski besuche, in ihrem kleinen Haus beim Friedhof, sitzt sie einfach da und lächelt, wobei ihr Lächeln nicht mir gilt, sondern längst vergangenen Geschehnissen und Menschen, unter denen auch der Geist meiner Urgroßmutter mit ihrem Fleischermesser weilt.
Zu dem Haus, das nun mir gehört und vor dem Krieg die Pension Glück beherbergte, hatte Berta die Liebe geführt. Allerdings war sie auch vorher schon öfters nach Görbersdorf gekommen, einen Korb voller Wurstwaren für die Ärzte und Schwindsüchtigen am Arm, die großen Geschmack an den Fleischereierzeugnissen ihres Vaters fanden. Berta aber war es, die, bereits als Kind angelernt, Räucherwürsten, Gulasch und Häckerle, einem frisch zubereiteten Heringssalat, ihre raffinierte Würze verlieh und sich darin als wahre Meisterin erwies. Manchmal ging sie zu Fuß in das Dorf, in dem ein außergewöhnliches, kühles und frisches Mikroklima herrscht, manchmal nahm jemand sie mit – wie an jenem denkwürdigen Tag, als sie den Wagen des Wanderbulgaren Krum, auch Türke Nasrallah genannt, auf dem Weg erblickte. In jenem Jahr vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war der Händler zum ersten Mal mit seinem Gehilfen unterwegs, einem jungen Mann, bildschön wie die Kavaliere aus den Liebesromanen, die Berta so gerne las.
Aber manche glauben jetzt sicher, ich denke mir diese Geschichten nur aus, und fragen sich: Woher weiß sie das alles? Außerdem passieren solche Dinge niemals in Wirklichkeit, denn schließlich ist eine jede ihres Glückes Schmiedin und wiederholt in der Regel die eigenen Fehler, nicht aber die der Mutter oder der längst verstorbenen Großmutter oder Urgroßmutter, die sie gar nicht gekannt hat. Und wer mir doch glaubt, schüttelt den Kopf, so wie meine Mutter Violetta, leidenschaftliche Leserin von Klatschspalten, den Kopf schüttelte über Artikel im Boulevardmagazin Skandale, die ihr alternatives Leben schilderten: Nicht zu fassen! Was für eine Geschichte! Und tatsächlich ist es zu viel für eine einzelne, unbedeutende Familie, in der es nicht einmal anständige männliche Helden gibt. Eine Geschichte ohne Frauen ist für kaum jemanden ein Grund zur Beunruhigung; die Frauen werden schon irgendwo im Hintergrund wirken, in Küche und Hof, mit langweiligem Weiberkram beschäftigt. Bei einem Mangel an männlichen Akteuren hingegen muss es sich um einen besorgniserregenden Irrtum handeln. Als sei ein fehlender Mann ein Defizit. Genau das aber hat Tradition in unserer Familie, in der die Väter irgendwann einfach verschwunden sind, was sich auf die unterschiedlichste Weise und bisweilen auch unter Mitwirkung der Frauen abspielte. Bei Unfällen – die sich schließlich so unerwartet einstellen wie die Liebe und der Tod – kam immer der Mann ums Leben, während die beteiligte Frau das Ganze, wenn auch schwer gebeutelt, überstand, ihre Tochter bei sich tragend, im Bauch oder an der Brust. Die Männer kamen abhanden – ob sie nun starben oder verschwanden –, die guten und die schlechten Männer, die liebenden, die destruktiven oder die mangels glaubwürdiger Quellen und mündlicher Überlieferung schwer zu definierenden Männer. Die Geschichte meiner Familie ist durchsetzt mit männerförmigen Löchern.
In der grauen Stunde vor Morgendämmerung, der Stunde zwischen Hund und Wolf, wenn es so still ist, dass ich nur den Herzschlag des Hauses und den Atem des schlafenden Mannes höre, versetze ich mich in die Zeit der Ersten von uns, der Tochter von Winifred und Hans Koch in Langwaltersdorf. Ich sehe sie deutlich, denn sie ist so groß wie ich und hat die gleichen rötlich blonden Haare mit dem widerspenstigen Wirbel über der Stirn. Das dafür zuständige Gen hat zwei Generationen übersprungen, um bei mir wieder aufzutauchen, sehr zur Verwirrung derer, die gern eindeutig wüssten, ob eine Frau nun rothaarig ist oder blond. Berta Kochs schöne Haare sind zu einem Zopf geflochten, und ihre starken Hände schneiden Schweineohren für die Sülzwurst, den Lieblingsschmaus der Schwindsüchtigen in Doktor Brehmers Heilanstalt.
Berta
Berta Koch war eine ausnehmend reinliche junge Frau. So jedenfalls schrieben es die Zeitungen über die Tochter des Fleisch- und Wurstwarenproduzenten Hans Koch, als alles vorbei war; die Kunde von ihrer ausnehmenden Reinlichkeit drang bis nach Amerika – ein Artikel über Berta erschien am 10. April 1939 in der New York Times. Auf dem abgedruckten Foto sieht man ein junges Mädchen mit ernstem Gesicht und schönen hohen Wangenknochen. Ihre Augen stehen leicht schräg und weit auseinander. Die Haare sind fest zusammengebunden und wirken wie eine glatte Haube, doch eine Strähne hat sich gelöst und ringelt sich wie eine Spirale über der Stirn. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto sieht man weder ihre grüne Augenfarbe noch das außergewöhnliche rotblonde Haar – aber man kann sich denken, dass sie zu all dem fähig war, dessen man sie bezichtigte, und auch noch zu ganz anderen Dingen, die auszuprobieren sie unter dem gestrengen Auge des Vaters keine Gelegenheit hatte.
Während der achtzehn Jahre im kleinen Langwaltersdorf nahe dem deutschen Waldenburg, das wenige Jahre nach ihrem Weggang zum polnischen Wałbrzych werden sollte, deutete nichts darauf hin, dass Berta einmal die Hauptrolle in einer weltweit bekannten Geschichte spielen würde. Die Tochter der toten Winifred und des übermäßig lebendigen Hans Koch galt eher als Eigenbrötlerin denn als Dorfschönheit, sie wirkte viel zu melancholisch, um den jungen Männern zu gefallen und die Sympathie der anderen Mädchen zu wecken. Es kam vor, dass sie auf eine einfache Frage eine vollkommen abwegige Antwort gab und dabei entrückt dreinsah, und nicht wenige dachten, sie habe schlicht einen an der Waffel. Andere hielten ihre Extravaganzen eher für Jungmädchenflausen, die ihr schon noch vergehen würden, wenn sie erst einmal unter der Haube wäre. Über Menschen wie Berta sagt man, sie lebten in ihrer eigenen Welt, und Hans Kochs Tochter hätte dieser Definition wahrscheinlich sogar zugestimmt, erschien ihr doch die Menschenwelt um sie herum wahrhaft uninteressant und sinnentleert im Gegensatz zu der Welt ihrer Romanfiguren. Sie identifizierte sich stets mit der von Leidenschaften gebeutelten, tief verstrickten Heldin, die nur die Liebe aus den Fesseln befreien konnte, eine Liebe, die sich immer im rechten Moment einstellte. Nach einem solchen Leben sehnte sich Berta, und darüber schrieb sie in ihrem geheimen Tagebuch, einem Geschenk ihrer jungen Lehrerin, die ebenso wie sie ihren Träumen nachhing.
Fräulein Schindlermeyer, die die Irrungen des Herzens für wenige Jahre nach Langwaltersdorf verschlugen, ahnte, dass sich die rotblonde Halbwaise nach jemand Verlorenem sehnte und dass wahrscheinlich auch ihr einmal das Herz gebrochen werden würde. Sie war Absolventin der Leipziger Hochschule für Frauen und hatte anschließend, bevor man sie zwang, jegliche höheren Ambitionen aufzugeben, ein Jahr lang heimlich Vorlesungen besucht, wo sie einen flüchtigen Einblick in die Ideen Sigmund Freuds bekam. Daraus war ihr das in Erinnerung geblieben, was ihr eigenes Schicksal schmerzlich betraf – dass jemand, der in der Kindheit seelische Verletzungen erlitten hat, mit dem Fluch der lebenslangen Suche nach dem vertrauten Schmerz geschlagen ist. Wenn niemand Berta von der Schule abholen konnte, begleitete Fräulein Schindlermeyer das Mädchen nach Hause, und zusammen gingen sie durch das Dorf, was Berta mit Stolz und Verlegenheit erfüllte. Auf dem Wegstück von der Schule bis zur Brücke, an der Fräulein Schindlermeyer immer sagte: Ab hier kannst du alleine gehen, ich schaue dir nach, fühlte sich Berta, als hätte sie eine Mutter – nicht das schreckliche und unvorstellbare Ding, das da auf dem Friedhof unter einem Stein ruhte, sondern eine lebendige, warme, menschliche Mutter, die mit ihren hellblauen Augen ihrer Tochter Berta nachsah, wie sie die Brücke überquerte. Manchmal blieben sie dort noch einen Moment stehen, wenn der Zug nach Meziměstí vorüberfuhr. Von Meziměstí kommt man nach Prag, seufzte Fräulein Schindlermeyer. Ins schöne Goldene Prag.
Golden?, fragte Berta verträumt, und der ölige Leib des Zuges ratterte an ihnen vorbei und stieß einen warnenden Pfiff aus, als sei er sich der Sehnsüchte bewusst, die er weckte. Golden, bestätigte die Lehrerin und zählte eins, zwei, drei, und Berta zählte mit ihr, bis fünfundzwanzig oder gar sechsundvierzig. Merk dir, wenn die Zahl der Waggons gerade ist, dann geht dein Traum in Erfüllung. Und wenn sie ungerade ist, dann nicht, fügte Fräulein Schindlermeyer hinzu, und die kleine Berta hatte das Gefühl, das Geheimnis der Welt sei ihr anvertraut.
Zum zehnten Geburtstag schenkte ihr die Lehrerin ein dickes elegantes Büchlein und sagte, sie solle darin ihre verborgensten Gedanken und Sehnsüchte notieren und das Tagebuch zu ihrem Freund und Vertrauten machen. Außerdem nahm sie allen Mut zusammen und sprach mit Hans Koch, um ihn zu überzeugen, dass seine Tochter begabt sei und eine höhere Schule besuchen könne, doch der lachte sie nur aus – seine Tochter könne seit Kindesbeinen Graupenwurst machen und brauche kein Puddingabitur, wie man damals den Schulabschluss der wenigen Mädchen nannte, die ein Gymnasium besuchten, um dort doch nur Hauswirtschaft zu lernen. Kurz darauf verließ die junge Lehrerin Langwaltersdorf, nachdem ihr zum zweiten Mal – diesmal von einem verheirateten Gymnastiklehrer, den sie auf einer Arbeiterkundgebung in Waldenburg kennengelernt hatte – das Herz gebrochen worden war.
Bertas verborgenste Gedanken und Sehnsüchte drehten sich um die Liebe. Sie sollte die schmerzliche Leere vertreiben, die sie von jeher begleitete und ein zehrendes Gefühl tief im Innern ihres Seins auslöste. Wenn sie eine solche Liebe erleben dürfte, so malte Berta sich aus, dann wäre ihr ganzes Ich gewissermaßen fassbarer, schärfer konturiert, und würde sich zugleich auf wundersam süße Weise auflösen wie Honig in Milch. Aus solcherart köstlichen Gedanken gerissen, antwortete sie etwa der Nachbarin Liselotte Wagenknecht auf deren Frage, wie es ihr heute gehe, es gehe ihr kühl und flüssig. Und statt einfach zu sagen, sie sei hungrig, verkündete sie, sie habe einen Wolf – in einer so unheimlichen Stimmlage, dass alle Anwesenden erschauerten; die Wölfe in den Wäldern rings um das Dorf waren von jeher ein Quell der Angst.
Nachts schlug Berta Koch ihr Tagebuch auf und schrieb unvollständige Sätze hinein, zwischen denen dramatische Fragen nach dem Sinn des Lebens und kindlich-verzweifelte Aufschreie wie abgebrochene Zweige im Strom der Alltagsödnis trieben. Bertas häufigstes Wort war »Vater«, schuf doch Hans Koch seine Tochter Tag für Tag nach seinem Ebenbild. Er lehrte sie die hohe Kunst, Schweine auszunehmen, und von ihm hatte sie den Ausdruck »Wolf« für Hunger. Hab ich einen Wolf!, scherzte er, setzte sich zu ihr an den Tisch und deklamierte knurrend: Um elfe kommen die Wölfe, um zwölfe bricht das Gewölbe! Berta wusste nicht, wieso die Wölfe ausgerechnet um elf kommen und eine Stunde später die Grabkammern einstürzen sollten, aber die Wörter fand sie lustig und gruselig, und ihre Melodie grub sich in ihr Gedächtnis ein. Sie stellte sich vor, wie erst die Wölfe kamen und sich dann die Grabplatte hob, unter der ihre unbekannte, ersehnte, schrecklich anzusehende Mutter hervorkroch.
Um elfe kommen die Wölfe, um zwölfe bricht das Gewölbe!, sprach sie Magda Tabach vor, der Tochter der Dienstmagd Trudi, ihrer Milchschwester, und als Magda die Zeilen auswendig konnte, sagten sie sie gemeinsam auf, als Beschwörung und zur Bestätigung ihrer Freundschaft. Um elfe kommen die Wölfe, begann Berta. Um zwölfe bricht das Gewölbe, endete Magda.
Trudi Tabach war am Tag von Winifreds Tod nach Langwaltersdorf gekommen, ein kleines Bündel auf dem Rücken und einen wenige Tage alten Säugling an der Brust; sie erwies sich als unerwartete Rettung für den Witwer und für Berta, die sie von nun an gemeinsam mit ihrer eigenen Tochter stillte. Damals war es schwierig, gute und billige Mädchen für alles zu finden; die jungen Frauen zog es immer häufiger in die Städte, zudem war es bereits verpönt, Jüdinnen einzustellen. Den Verdacht, sie könnte Jüdin sein, zerstreute Trudi mit Hilfe eines Wortschwalls in perlendem Deutsch, mit dem sie ihre Dienste gegen kaum mehr als einen Hungerlohn anpries; ihre überzeugendsten Argumente aber waren ihre großen, milchschweren Brüste sowie ihre starken Hände, mit denen sie zupacken konnte wie sonst nur Hermenegilde Mock, die im Dorf die Zähne zog. Trudis Tochter Magda war zäh wie eine Quecke und wurde für Hans und Berta bald zum Familienmitglied; die beiden kleinen Mädchen waren unzertrennlich und sehnten sich nach einander, sobald sie einmal nicht zusammen waren. Trudi wie auch ihr Töchterchen bewiesen eine außerordentliche Sprachbegabung und konnten sich ihrem Gegenüber in Ausdrucksweise und Sprachmelodie perfekt angleichen – besonders, wenn sie etwas Bestimmtes erschmeicheln wollten, was so gut wie immer der Fall war. Während Berta heranwuchs, stellten sich hier und da andere Dienstmägde vor; sie waren stets zugereist, blieben eigentümlich konturlos und regten weder zu Gerüchten noch zu Sympathie an – müde, abgearbeitete Frauen ohne besondere Eigenschaften, abgenutzt wie Dinge, die zu lange zum falschen Zweck gebraucht wurden. Schließlich beschäftigte Hans Koch nur noch Trudi Tabach und nahm achselzuckend in Kauf, dass Magda sich beständig etwas in den Mund stopfte und herunterschlang, bevor man recht wusste, wie einem geschah – einen kurz abgelegten Brotkanten oder, schlimmer noch, eine kaum angebissene Wurst. So weit, dass sie bei ihm einzogen, wollte er jedoch nicht gehen; stattdessen brachte er den Betreiber der Pension Storchberg dazu, Trudi Tabach trotz ihres ledigen Kindes gegen Kost und Logis in Dienst zu nehmen. Was Alfred Mittmann überzeugte, war der Gedanke, dass er an Magda, wenn sie erst heranwachsen würde, ein zusätzliches billiges Paar Hände zur Arbeit hätte.
Im Hause Koch wohnten somit nur Berta und der Vater mit seinem mächtigen Leib, seiner sonoren Stimme und den zarten rosa Ohren, die er ihr zu knüllen und zu kneten erlaubte, als sie noch klein war. Fasziniert sah sie zu, wie die zartrosa Ohrmuscheln sich dunkler färbten, wenn die Blutgefäße sich füllten. Die weichen Knorpel boten ihr einen Ersatz für die mütterliche Wärme. Zieh nur, mein Ferkelchen, ermunterte Hans Koch seine Tochter, zieh nur kräftig, dann sind sie ab, und du hast einen ohrenlosen Vater! Er lachte dröhnend, bis Berta lustig auf seinem bebenden Nacken hüpfte. In solchen Momenten, besonders, wenn sie zuvor ihren Hunger mit einem Stück Graupenwurst oder Brühwurst mit Knoblauch und Majoran gestillt hatte, fehlte es ihr an nichts.
Erst als sie groß genug war, um nach ihrer Mutter zu fragen, trübte sich Bertas kindliche Sorglosigkeit, als hätte sich Ruß aus der Waldenburger Kokerei auf den Grund ihres Herzens gesenkt. War ihre Mutter vielleicht gar nicht tot, sondern nach Waldenburg gezogen? Wohnte sie jetzt in der schönen großen Stadt? Sollte ihr Vater es doch endlich sagen, sollte er doch zugeben, dass er sie, Berta, angelogen hatte! Schaffte er es nicht rechtzeitig, sie mit einem Versprechen oder einem Geschenk abzulenken, endete es damit, dass Berta sich heulend zu Boden warf, und wenn er sie aufheben wollte, war ihr Körper steif und durchgebogen wie im Krampf. Ich will nach Waldenburg!, schrie sie und heulte. Ich will zu Mama!
Nach Waldenburg gingen die jungen Männer aus Langwaltersdorf, um Arbeit im Kohlebergwerk zu finden, und wenn sie dann zu Besuch in ihr Heimatdorf kamen, hatten sie schwarz umrandete Augen, was manche von ihnen auf eigentümliche Weise schöner und männlicher wirken ließ. Der ist ja jetzt so’n richtiger Städter, pflegte man bissig über solche jungen Männer zu sagen. Manchmal, doch lange nicht so häufig, gingen auch junge Frauen nach Waldenburg, als Dienstmädchen, um zu heiraten oder – sehr selten –, um eine höhere Schule zu besuchen. Sie kehrten gewöhnlich nicht mehr zurück. In windigen Winternächten wehte der Geruch der Stadt herüber, ein warmer Kohlehauch, der die kleinen Jungen von Abenteuern unter Tage träumen ließ und die kleinen Mädchen von Abenteuern über Tage, wie man sie hier im ruhigen und beschaulichen Langwaltersdorf nicht erleben konnte. Einmal im Jahr kam ein Zirkus nach Waldenburg. Wenn es Hans gelang, das Interesse seiner Tochter in diese Richtung zu lenken, atmete er auf, waren doch Fragen nach Bertas Mutter das, was er am meisten fürchtete.
Als sie sieben war, nahm er sie zum ersten Mal mit in den Zirkus. Und seither träumte sie davon, die Akrobaten und Tiere, besonders den Elefanten, noch einmal zu sehen und Vanilleeis am Stiel zu essen, die letzte Süße aus dem Holzstäbchen zu saugen, das in ihrem Mund weich geworden war. Diesen Moment der Süße und der Wärme des Elefantenleibes, an den sie ihre Wange schmiegte, behielt sie als fast vollkommenes Glück in Erinnerung – es fühlte sich so an, als hätte sie eine Mutter. Unbedacht, im Scherz sagte Hans Koch, er könne ihr beim Wanderbulgaren Krum, auch Türke Nasrallah genannt, vielleicht einen eigenen Elefanten bestellen – damit brachte er sich in Teufels Küche, denn Berta nahm seine Worte für bare Münze.
Der Zirkus, der fahrende Händler mit seinem Zigeunerwagen voller exotischer Waren, der Kurort Görbersdorf hinter dem Wald, wo Lungenkranke aus aller Welt Heilung suchten und viele aus dem Dorf Arbeit fanden – all das waren Themen, die Berta von ihrer toten Mutter ablenken sollten. Der Weiße Tod, wie die Schwindsucht genannt wurde, war für die Langwaltersdorfer eine Einkommensquelle, und sie fütterten bereitwillig sein gieriges Maul, warfen ihm hier und da sogar Kinder zum Fraß vor. Die blut- und schleimhustenden halbtoten Kurgäste schätzten, wie jeder wusste, gutes Essen und Amüsement und entwickelten, den Weißen Tod im Nacken, die wildesten Gelüste. Einen Berliner Philosophen verlangte es nach weißen Trüffeln aus dem Piemont, einen anderen nach griechischen Bergteeblättern von den Hängen des Olymp, wieder ein anderer wollte, dass man ihm – selbstredend unter strenger Geheimhaltung vor den Ärzten – einen vierzehnjährigen Knaben zuführte, unbedingt mit rotem Haar, und eine Dame aus Moskau konnte keinen Tag länger ohne indische Patschuli-Räucherstäbchen sowie eine spezielle, birnenförmige Pumpe für Intimspülungen leben, wie sie nur ein bestimmter Pharmazeut in Bern herstellte. Die unternehmerischen Langwaltersdorfer waren den Halbtoten behilflich, ihre Wünsche zu erfüllen. So verdienten sie für ihr Leben oder handelten sich den Tod ein – aber wer nicht wagt, der kriegt ka Graupawurscht, wie Hans Koch zu sagen pflegte. Jene wenig schmackhafte, aber umso gehaltvollere Speise aus Getreide und Schweineblut in einem Stück Schweinedarm war sein Lieblingsessen; in der Zubereitung hatte er es zur Meisterschaft gebracht. Unter den Schwindsüchtigen ging das Gerücht – der gewiefte Hans wusste es zu befeuern –, Graupenwurst und Schweinsohrsülze seien Speisen mit magischen Heilkräften für ihre von Krankheit zerfressenen Lungen.
Die Schwindsüchtigen und ihre Familien waren die größten Abnehmer der Fleischerzeugnisse von Hans Koch, die Berta ihm seit frühester Kindheit zuzubereiten half. Fleisch zu zerteilen, kleinzuhacken, zu würzen – das war Bertas ganze Welt, und deswegen wollte sie wissen, ob es dem Schwein wohl wehtat, wenn es starb? Und tat es den Schwindsüchtigen weh? Genauso weh wie den Schweinen? Oder anders? Würde auch sie, Berta, des Weißen Todes sterben, und wie sah dieser Weiße Tod aus, vor dem die infizierten Reichen aus ganz Europa nach Görbersdorf flohen? Denn wenn er schon käme, dieser Weiße Tod, dann wolle sie, dass er schön sei. War er schön? Auf diese Frage fiel Hans Koch, der sich selbst für einen Ausbund an Gesundheit hielt, immun gegen Tuberkelbakterien und poetische Aufwallungen jeglicher Art, unter Aufbietung seiner gesamten Phantasie nur die Antwort ein, dass der Weiße Tod aussah wie ein abgemagertes Mastschwein mit roten Augen. Schön – ach wo! So gut wie keinen Speck auf den Rippen! – Und weiter? Und weiter? Berta zappelte vor Neugier. – Wenn ein Mensch dieses Schwein sieht, dann muss er sich die Augen zuhalten und ganz schnell dreimal sagen: Fort von mir, du Magerschwein, Futter sollst den Wölfen sein, erklärte der Vater, froh über diese Eingebung, während seine Gedanken schon wieder in andere Richtungen schweiften, zu einer gewissen reizenden Blondine aus Friedland und einem elektrischen Fleischwolf, die er beide gleichermaßen heftig begehrte.
Die Fragen seiner Tochter, woher denn die Wölfe in den Wäldern um Langwaltersdorf kamen und ob es wahr sei, dass sie Menschen fraßen, hörte Hans schon nicht mehr. Die rasante Zunahme der Wolfspopulation war ein vieldiskutiertes Thema, seit die Raubtiere wenige Jahre nach dem Großen Krieg den Veteranen Werner Wagenknecht und kurz darauf noch drei weitere Personen gerissen hatten. Um diesem Schicksal zu entgehen, investierte man beim Wanderbulgaren Krum, auch Türke Nasrallah genannt, der jeden Sommer mit seinem schwer beladenen Wagen ins Dorf kam, in Anti-Wolf-Amulette. Am wirksamsten war die Meerzwiebel, drimia maritima, die auch als Rattengift diente. Wirkt so ein Amulett auch gegen böse Menschen? Woran sieht man, dass ein Mensch böse ist?, wollte Berta wissen, während sie an der Meerzwiebel roch, und obwohl Hans Koch ihrer vielen Fragen ein wenig überdrüssig war, fühlte er sich wichtig und mächtig, schließlich war er es, der dieses Wesen in die Welt gesetzt hatte. Sein rosa Ferkelchen, seine Liebe und sein Eigentum.
Als junger Mann hatte er in einer Leinenweberei in Friedland gearbeitet, wie alle Männer aus seiner Familie und viele aus dem Dorf, doch war er nach der Berufsschule rasch zum Meister aufgestiegen und zählte nicht mehr zu den einfachen Malochern, die er verachtete. Die Zubereitung von Wurstwaren, die ihn seine Mutter gelehrt hatte, brachte ihm einen nicht geringen Zusatzverdienst ein und stärkte sein Überlegenheitsgefühl – er hielt die Fleischverarbeitung für einen wahren Männerberuf. Irgendwann wagte er den Sprung ins kalte Wasser und kündigte in der Weberei, obgleich seine ganze Familie sich dagegen aussprach. Hans Kochs Traum waren eine steile Karriere in der Fleischbranche und das Monopol für die Belieferung des Görbersdorfer Sanatoriums. Vor seinem inneren Auge sah er schon den Pferdewagen oder sogar ein Automobil mit dem Schriftzug Hans Koch. Gardemangerie=Erzeugnisse erster Güte. Den Ausdruck »Gardemangerie« hatte er bei einem der Ärzte aufgeschnappt, einem Polen, der ein erlesenes Deutsch sprach, und hielt ihn für den Gipfel der Eleganz. Nach dem Tod seiner Frau, mit dem er als alleinerziehender Vater zurückblieb, waren Hansens Träume in sich zusammengefallen; doch nun, da Berta zu seiner Kaltmamsell heranwuchs, begannen sie wieder Gestalt anzunehmen. Sie war flink, stark, begriff schnell und besaß zwei zupackende Hände, fast wie ein Junge. Schon im Alter von sechs Jahren hackte sie Zwiebeln wie eine kleine Maschine, und überdies hatte sie keine Scheu vor Blut. Großgewachsen für ihr Alter, blond und helläugig erinnerte sie Hans an die Schönheiten, die immer häufiger als Musterbeispiele für die echte deutsche Frau in der Presse gezeigt wurden, obwohl mindestens die Hälfte der Frauen ringsumher gänzlich anders aussah. Es gibt eben Frauen – und es gibt niederrassige Weiber, pflegte Berta Kochs Vater zu sagen, überzeugt, dass nur die blonden und hellhäutigen weiblichen Wesen die Bezeichnung »Frau« verdienten. Er hoffte, dass Bertas Haar den rötlichen Schimmer mit der Zeit verlieren und dass ihre Augen ruhiger werden und sich konzentriert auf die Dinge richten würden, auf die der Blick einer normalen Tochter und Frau gerichtet sein sollte.
War Hans Koch guter Laune, kitzelte er seine Tochter durch und benannte die einzelnen Körperteile seines Ferkelchens, damit Berta sich schon als Kind einprägte, wo der Schweinenacken saß und wo der Schweinerücken – Kenntnisse, die unerlässlich waren, wenn sie mit ihm zusammenarbeiten sollte. Berta mochte seine Liebkosungen, die Berührung seiner großen warmen Hände, und nur manchmal, wenn sie vor Lachen fast erstickte, rief sie: Hör auf!, oder sie rief: Nicht pusten!, wenn er sie mit seinem Bier- und Fleischatem anhauchte. Am Anfang genügte ihr das; sie hatte einen Vater, sie hatte Trudi und ihre Milchschwester Magda, doch Letztere, ein schwarzhaariges, starkes kleines Wesen, säte Zweifel in ihr – Magda bekam keine der gängigen Kinderkrankheiten, als ahnten die Mikroben, dass ihnen im Organismus der unehelichen Tochter einer Dienstmagd nicht die entsprechende Aufmerksamkeit zuteilwerden würde. Wenn Trudi Tabach putzte, wuselte ihre Tochter Hans Koch um die Beine, steckte sich herumliegende Bissen in den Mund und nervte ihn wie eine Schweineborste in der Sülze. Er duldete die Freundschaft der beiden Mädchen, wiewohl er Magda Tabach nicht für einen geeigneten Umgang für seine Tochter hielt, selbst wenn Trudi darauf bestand, dass sie in Wirklichkeit »Taback« hießen – die Papiere enthielten einen Fehler. Ungebildete, dreiste Göre, die zu allem Übel ständig irgendwelche dreckigen Köter oder Katzenviecher anschleppte, die er dann mühsam wieder loswerden musste, was er still und heimlich tat, um nicht noch einmal hysterische Anfälle bei den Mädchen zu provozieren wie an jenem Tag, als er einen ganzen Wurf ertränkte und den Eimer mit den sechs kleinen Katzenleichen in der Diele stehenließ. Berta starrte nur stumm mit erschrocken aufgerissenen Augen, aber Magda kreischte los wie besessen und hörte erst auf, als er ihr einen solchen Schlag versetzte, dass sie gegen die Wand taumelte und nach Luft schnappte. Und eines Tages zeigte Magda Berta ein Hundepärchen, das vor dem Haus kopulierte. Alfred Mittmanns schwarze Hündin, Magdas Liebling, ein Tier mit einem schwarzen und einem weißen Ohr, bog sich unter dem Gewicht eines gefleckten Streuners, den sie vergeblich mit ihrer schnappenden Wolfsschnauze zu verscheuchen versucht hatte. Der untere ist die Mama. Und der obendrauf der Papa. – Was machen die da?, fragte Berta. – Das weißt du nicht? Er hat ihn ihr reingesteckt, und jetzt gibt’s bald kleine Hündchen! Magda hätte Berta gern noch mehr erklärt, aber ihre Mutter gab ihr erschrocken eine Ohrfeige. Sie wusste, dass Hans Koch eine regelrechte Marotte hatte, was seine Tochter betraf, und wollte keinesfalls beschuldigt werden, dass Magda Berta verdorben hätte.
Doch es war bereits geschehen. Je weniger Hans Koch und seine Wurstwaren das vorher so hilfsbereite und tatkräftige Kind interessierten, desto mehr richtete es seine Gedanken auf Dinge, die ihm der Vater nicht geben konnte. Auf die Frage, wo Mama denn jetzt sei, hatte Hans Koch immer dieselbe unbefriedigende Antwort parat – jene, die er selbst als Kind zu hören bekommen hatte, wenn er fragte, was denn mit seinem Bruder passiert sei, der nach einem missglückten Salto ins Hochwasser des Steineflusses in einen Sarg gebettet und begraben worden war. Im Himmel, antwortete er und hob den Kopf, um ihn dann mit einem Seufzer wieder sinken zu lassen, was Berta nachzuahmen lernte, so wie er selbst es früher von seiner Mutter übernommen hatte. Doch diese Antwort genügte Berta schon bald nicht mehr. Wie war Mama denn?, wollte sie wissen. Darauf zu antworten, fiel dem Vater noch schwerer; außer den basalen Informationen wusste er nichts zu sagen. Winifred, eine zarte und reinliche junge Frau, war Krankenschwester in Doktor Brehmers Heilanstalt gewesen, bevor Hans Kochs Auge auf sie fiel. Er freute sich nicht lange an seiner Eroberung – die arme Winifred starb wenige Monate, nachdem sie ihren hartnäckigen Verehrer in der protestantischen Kirche geehelicht hatte, im zarten Alter von achtzehn Jahren im Kindbett und ruht seither auf einem verlassenen Friedhof unter einem Grabstein mit verwitterter Inschrift, von der nur noch die Buchstaben Wini och lesbar sind. Sie war eine Waise, und zur Hochzeit erschienen einzig ihre Schwesternkolleginnen aus dem Sanatorium in Görbersdorf und ein trauriger junger Arzt. Selbst die erfahrene Hebamme hatte die Blutung nicht zu stoppen vermocht – ein gewöhnliches Frauenschicksal, ein gewöhnlicher Frauentod. Alles, was blieb, waren ein Säugling weiblichen Geschlechts und die feuchten Spuren von Winifreds Qualen auf dem Bettlaken. Was gibt’s da groß zu sagen, Hans Koch zuckte die Achseln, und wenn die Kleine wissen wollte, ob sie ihrer Mutter ähnlich sehe, antwortete er wahrheitsgemäß, er wisse es nicht – was er aber bemerkte, wenn er seine Tochter betrachtete, war, dass sie ihn sehr an ihre Mutter erinnerte; sie erinnerte ihn an Winifreds Leben und an Winifreds Tod in Scheiße und Blut.
Hans Koch wusste nicht, ob man gleichzeitig dem Leben und dem Tod ähneln konnte, und er wollte auch nicht darüber nachdenken, aber wenn er es schon musste, dann redete er sich lieber ein, dass Berta seiner Zwillingsschwester glich, Ingeborg, die er seit Jahren nicht gesehen hatte, weil sie mit einem verheirateten Kurgast aus Görbersdorf, einem wohlhabenden Ladenbesitzer, durchgebrannt war, worauf ihre Spur sich in Breslau verloren hatte. Er war böse auf Ingeborg, zugleich aber weckte ihr Akt des Ungehorsams Neid und Bewunderung in seinem Herzen, denn im Grunde wäre es auch für ihn nicht schlecht gewesen, mit einer wohlhabenden Ladenbesitzerin durchzubrennen, und diese komplexe Gefühlslage wiederum vergrößerte noch seinen Ärger.
Hans Koch achtete Menschen mit starker Hand und starkem Charakter, und unter Menschen verstand er im Allgemeinen nur Männer oder aber, als absolute Ausnahme, alte Frauen mit fest umrissenem Beruf, so wie die aufs Zähneziehen spezialisierte Hermenegilde Mock. Was hat dieser Weiberich doch einen Griff!, seufzte er bewundernd noch lange, nachdem sie ihm erfolgreich einen oberen Backenzahn herausgerissen hatte. Wenn er mit Bekannten einen heben ging, riefen sie manchmal Trudi Tabach und Hermenegilde Mock zum Armdrücken herbei, und die Gewinnerin bekam danach ein Bier; die Chancen standen ungefähr gleich. Aber dass seine eigene Schwester es gewagt hatte, den ihr vorbestimmten Platz zu verlassen, und nicht einmal in Scham und Schande wieder angekrochen gekommen war? Das schmerzte ihn, vor allem weil Ingeborgs Flucht zu einer Art Heldinnengeschichte geworden war und man sich im Dorf Wunderdinge darüber erzählte, wie gut sie in der weiten Welt zurechtkam – und dass sie im Reichtum fast erstickte. Hans dachte oft an seine hübsche Schwester mit dem großen Mundwerk und den breiten Hüften; wenn Ingeborg in der Nähe geblieben oder sogar bei ihnen eingezogen wäre, dann käme er jetzt vielleicht besser mit seiner Tochter zurecht. Er erinnerte sich, wie Ingeborg und er früher unter der Aufsicht ihrer Mutter Wurst gemacht hatten und wie sie ihn im mütterlichen Tonfall schalt, dass er dies oder jenes falsch mache und dass er dumm sei, und wie er sie dann zur Rache in ihre drallen Arme kniff. Mit sechzehn fand Ingeborg Arbeit in der Küche der Görbersdorfer Heilanstalt, sie stieg rasch zur Bedienung auf, schwenkte in Schürze und keckem Häubchen an der Essensausgabe die Hüften – und weg war sie. Nur einmal bekam Hans von seiner durchgebrannten Schwester eine Postkarte, auf der Ingeborg ihn in Kenntnis setzte, dass bei ihr alles in Ordnung sei, eben habe sie ihr eigenes Gastgewerbe eröffnet. Die Karte mit dem Rathaus von Breslau trug eine schwungvolle Unterschrift, ganz als sei Ingeborg Arzt und nicht bloß ein dummes Ding mit wenigen Jahren Dorfschulbildung. Eigenes Gewerbe, dass ich nicht lache, schnaubte er. Wahrscheinlich ein Hurenhaus auf Rädern! Hans Koch war neidisch auf seine Schwester, trotzdem würde er ganz gewiss nicht zulassen, dass Berta in die Fußstapfen ihrer anmaßenden Tante Ingeborg trat.
Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter verdarb langsam, aber sicher, wie eine in der Sonne vergessene Wurst, und eines Tages stellte Berta, die zu dem Zeitpunkt vierzehn Jahre alt und besonders aufsässig war, eine Frage, die Hans Koch mitten ins Herz traf. Hast etwa du Mama getötet?, schoss sie zurück, als er sie heftig schalt, weil sie die Hühnerlebern für den Jüdischen Kaviar noch immer nicht kleingehackt hatte, und dabei war die Speise doch für ein Festbankett in Görbersdorf bestellt, wo eine Gruppe berühmter Ärzte aus der Hauptstadt des Dritten Reiches zu Gast war. In seiner Raserei schleuderte Hans Koch eine Schüssel mit Geflügelklein auf den steinernen Küchenboden, und sie mussten auf Knien die Scherben aufsammeln.
Hans Koch hätte nie erwartet, dass es so schwer sein würde, ein Kind weiblichen Geschlechts großzuziehen – dennoch konnte man nicht sagen, er hätte sich keine Mühe gegeben oder es sich zu leicht gemacht; ihm half seine Überzeugung, dass er selbst auf die richtige Weise erzogen worden sei. Hier aber kam eine praktische Schwierigkeit ins Spiel: in seinem Elternhaus war es der Vater gewesen, der Hans und seinen Bruder schlug und sich nach dem Tod des einen Sohnes gewissenhaft und leidenschaftlich dem noch lebenden anderen widmete, während Tochter Ingeborg ihre Schläge von der Mutter bezog, die sie der Bequemlichkeit halber über die Bettkante hängte und ihr den kleinen weißen Hintern mit der Schöpfkelle versohlte. Tüchtig schlagen sollte man nur Jungen, denn einen männlichen Körper machten Schläge hart, während sie einen Mädchenkörper verdarben, dieser Meinung war Hans Kochs Vater gewesen. Und so bekamen die Söhne ihre Prügel auf männliche Weise, mit einer Lederpeitsche, die in der Diele hing und ihnen gelegentlich unter die Nase gehalten wurde, damit sie den Geruch der väterlichen Übermacht niemals vergaßen. Doch dass der Vater seine Tochter schlug, nein, das hatte es bei Kochs nie gegeben, so etwas galt als bäurischer Brauch und ihres Hauses nicht würdig – und daher rührte des Witwers Dilemma. Hans Koch glaubte an eiserne Disziplin und harte körperliche Züchtigung, nur dank dieser Tugenden waren seine Schwester und er zu rechtschaffenen Menschen herangewachsen, wenn man von der Tatsache absah, dass Ingeborg das Weite gesucht hatte – aber solange sie noch lebte, bestand schließlich die Hoffnung, dass die weite Welt sie zu Fall bringen und reuig in den Schoß der Familie zurücktreiben würde. Jene erzieherische Ordnung, die Hans so sinnvoll erschien, dass irgendeine höhere Macht sie ersonnen haben musste, wurde durch Winifreds Ableben auf den Kopf gestellt. Hans hatte dazu nur bedingt beigetragen, indem er sie schwängerte; zur Gänze verantwortlich aber war er für seine Weigerung, sich wiederzuverheiraten – dabei wäre in Langwaltersdorf nichts selbstverständlicher erschienen als ein tüchtiger Witwer mit Kind, der sich erneut zur Heirat entschloss.
Hans Koch, so ging das Gerücht, war ein Frauenschwarm, es würde gewiss nicht lange dauern, bis eine Neue ihn sich angelte, stattliches Mannsbild, das er war, und außerdem besaß er ja, fast wichtiger noch, ein ebenso stattliches Haus und zwei zupackende Hände, die keine Arbeit scheuten – doch aus irgendeinem Grund gelang es keiner der Bewerberinnen, ihn zu bezirzen. Wie der hochgewachsene Mann mit dem mächtigen Wohlstandsbauch so mit dem kleinen Mädchen durch die Straßen schritt, weckte sein Anblick in vielen alleinstehenden Frauen das Verlangen, sich diese nahezu fertige Familie anzueignen und um neue Kinder zu erweitern. Selbst die Nachbarin der Kochs, Liselotte Wagenknecht, Mutter von neun Söhnen, die mit ihren achtunddreißig Jahren ein wenig zu alt für derlei Dinge schien, übermannte der Wunsch, es mit einem zehnten Kind zu versuchen. Am eifrigsten bei den Bemühungen um eine Stiefmutter für die kleine Halbwaise und Mitbesitzerin von Hans Kochs Immobilie war Alfred Mittmann, Eigentümer der Pension Storchberg, der nach Kräften versuchte, ihm seine noch immer ledige Schwester unterzujubeln, die bei ihm auslag wie ein langsam eintrocknendes Buffethäppchen. Das Fräulein Mittmann selbst, das sich einige Male mit Hans getroffen hatte, hätte mehr zu dem Thema sagen können, doch wehrte es alle Fragen mit hartnäckigem Schweigen ab und rührte nicht nur nie wieder eine Wurst des verhinderten Ehegatten an, sondern Fleisch im Allgemeinen, wodurch Fräulein Mittmann zu Langwaltersdorfs erster Vegetarierin wurde. Hans Koch blieb Witwer, und nur die wechselnden Dienstmägde betraten sein großes Haus am Ende des Dorfes. Es stand auf dem schmalen Streifen Erde zwischen Weg und Schienen, die aufeinander zu und wieder auseinanderliefen, sodass sie die Form eines Auges bildeten.
Hinter dem Hause Koch ging Langwaltersdorf in eine hügelige Landschaft über, in der die Züge, die Pferdewagen und die seltenen Automobile, die Berta an große Mistkäfer erinnerten, spurlos verschwanden. Aus den Küchenfenstern sah man den Weg nach Friedland, den hochmütig aufragenden Kegel des Stortzbergs, und darüber spannte sich der Himmel. Wenn sie Zwiebeln für Häckerle schnitt, schaute Berta hinaus auf die immer gleichen Bilder, die vorhersehbar waren wie die Jahreszeiten, und wusste nicht recht, ob sie irgendwohin fahren wollte außer nach Waldenburg – etwa nach Prag, ins Goldene Prag, von dem Fräulein Schindlermeyer ihr erzählt hatte. Die Welt, die weiter entfernt war als Waldenburg, kam ihr so irreal vor, als befände sie sich hinter dem Mond. Wenn sie also den Zug nach Meziměstí vorüberrattern sah, genoss sie einfach die verschwommene Aussicht, dass die Sehnsucht, die sie von jeher verspürte, irgendwann in unbestimmter Zukunft gestillt werden würde, und hob die Augen, um die Waggons zu zählen. Gerade Zahl – ihr Traum würde wahr, ungerade Zahl – nein, würde er nicht.
Jene Sehnsucht, in die sich manchmal ein brennender Schmerz mischte, jenes schwarze Loch irgendwo zwischen Sonnengeflecht und Vagina, das frei und unberechenbar in ihrem Oberkörper herumwanderte, schien Berta trotz allem der fassbarste Teil ihrer Persönlichkeit zu sein. Eines Tages war ihr klargeworden, dass ihre Mutter Winifred, die ihre Geburt mit dem Leben bezahlt hatte, ein Teil von ihr war, dass sie ein Stück dieses Dunkels, das da unter dem Stein ruhte, in sich trug. Seither legte sie sich manchmal nachdenklich eine Hand auf den Bauch und spürte der Leere nach, dem Nichtsein, das sich dort ausbreitete. Diese Leere war da, ganz eindeutig, bei allem anderen war sie sich nicht sicher. Deswegen schaute Berta außer dem fahrenden Zug gern fließendem Wasser zu. Die Strudel auf dem schwellenden Steinefluss glichen Einschusslöchern; vom Ufer sah Berta zu, wie sie Unrat umherwirbelten und einsaugten, und dachte bei sich, dass es in ihrem Innern genau so aussah. Das bin ich, dachte sie, eine strudelnde Leere. Ich entscheide nichts, ich bin willenlos, nur ab und zu fällt etwas in mich hinein. Ich bin nichts. Hier werde ich mein Leben verbringen, zwischen Weg und Bahngleisen, und die Waggons zählen, während ich selbst zum Bleiben verurteilt bin.
Manchmal begleitete Magda sie zum Fluss, in ihren wenigen freien Momenten, und dann sprachen sie über den Tod. Wenn ich zum Beispiel schwanger würde, und er würde mich sitzenlassen, dann würde ich springen, sagte Magda. Und du? – Ich würde auch einfach so springen, ohne Grund, erwiderte Berta, und in ihren Augen spiegelten sich die Wasserstrudel. – Ach, du bist ja dumm!, quittierte ihre Freundin, die sich um einiges besser mit ungewollten Bäuchen auskannte, war sie doch selbst einmal der Inhalt eines solchen gewesen. Ihre Mutter war zwar den eigenen Bauch damals nicht losgeworden, wusste aber dennoch sehr gut, wie sie anderen Frauen aus dieser Klemme half.