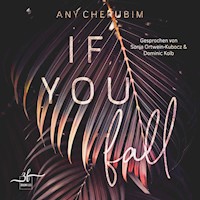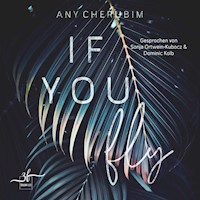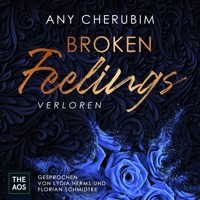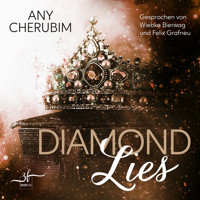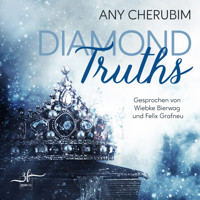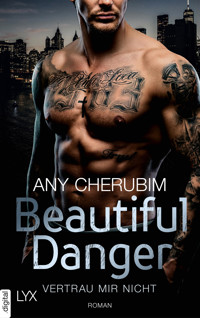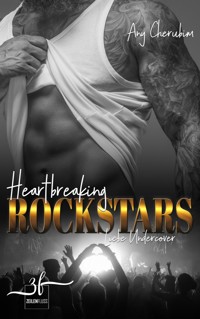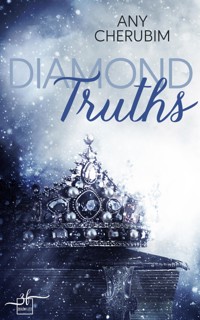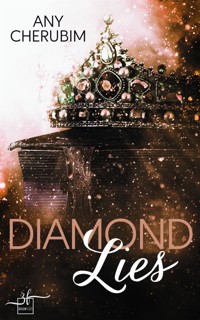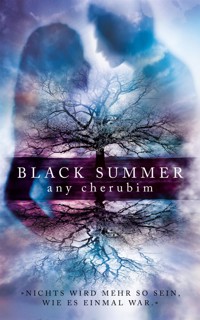
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Black Summer
- Sprache: Deutsch
Offene Boots, Lederjacke, zerrissene Jeans, ein sexy Lächeln – so hatte sich Joy einen FBI–Agenten in ihren kühnsten Träumen nicht ausgemalt. Und diesem Typen soll sie ihr Leben und das ihrer Schwester anvertrauen? Wahrscheinlich wären sie in einem tosenden Hurrikan sicherer als bei diesem unverschämt charmanten Kerl.
Seit dem Tod ihrer Mutter hat es sich die neunzehnjährige Joy zur Aufgabe gemacht, sich um ihre kranke Schwester Holly zu kümmern. Die Familie hat eine enge Bindung, bis das schier Unvorstellbare geschieht:
Kurz vor den Sommerferien konfrontiert der Vater sie mit der Wahrheit, die alles zerstört. Durch sein dunkles Geheimnis bröckelt seine mühsam aufgebaute Fassade. Joy und ihre Schwester werden aus ihrem gewohnten Leben gerissen und drohen in einen Abgrund zu stürzen.
Der Black Summer beginnt ...
Lesermeinungen:
"Ein Buch, das es in sich hat."
"Wow! Mehr fällt mir zu diesem Roman im ersten Moment nicht ein, direkt nachdem ich das Buch zur Seite gelegt habe."
"Da ist der Autorin aber ein richtiger WOW-Effekt gelungen.
Dieser Roman ist sowas von heiß, spannend und auch zum Haareraufen."
Der zweite und letzte Band ist ab sofort erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Black Summer – Teil 1
Liebesroman
Für meine Geschwister Sandra und Bubi BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenBlack Summer
Offene Boots, Lederjacke, zerrissene Jeans, ein sexy Lächeln – so hatte sich Joy einen FBI–Agenten in ihren kühnsten Träumen nicht ausgemalt. Und diesem Typen soll sie ihr Leben und das ihrer Schwester anvertrauen? Wahrscheinlich wären sie in einem tosenden Hurrikan sicherer als bei diesem unverschämt charmanten Kerl.
Nichts wird mehr so sein, wie es einmal war.
Seit dem Tod ihrer Mutter hat es sich die neunzehnjährige Joy zur Aufgabe gemacht, sich um ihre kranke Schwester Holly zu kümmern. Die Familie hat eine enge Bindung, bis das schier Unvorstellbare geschieht: Kurz vor den Sommerferien konfrontiert der Vater sie mit der Wahrheit, die alles zerstört. Durch sein dunkles Geheimnis bröckelt seine mühsam aufgebaute Fassade. Joy und ihre Schwester werden aus ihrem gewohnten Leben gerissen und drohen in einen Abgrund zu stürzen. Der Black Summer beginnt ...
Schlaflied
Schlaf', Kindlein, schlaf'! Der Vater hüt' das Schaf, die Mutter pflanzt ein Bäumelein, darunter liegt ein Träumelein.
Schlaf', Kindlein, schlaf'! So schenk ich dir das Schaf mit einem gold‘nen Glöckchen fein, das soll dein Spielgeselle sein.
Schlaf', Kindlein, schlaf',
das Kind hüt' das Schaf
Bis sie sind in Sicherheit
und von jeder Angst befreit
Kapitel 1
»Komm schon, lass dich fallen. Niemand wird etwas mitbekommen.« Er grunzte nasse Küsse auf meinen Hals; seine Hände wanderten hinauf zu meinen Brüsten und kneteten sie grob. Mir stand nicht der Sinn nach einem Quickie. Mein Kopf war voll mit Problemen und eigentlich hätte ich einen richtigen Freund gebraucht, der mir zuhörte und half, mein Chaos zu ordnen.
»Ich habe es noch nie in der Besenkammer unserer Senior Highschool getrieben und heute ist die letzte Gelegenheit.« Er presste seinen Schritt fester gegen meinen Bauch, sodass ich die harte Beule in seiner Hose deutlich spüren konnte. Das Regal mit den Putzmitteln drückte unangenehm in meinen Rücken und unsere Bewegungen ließen die Flasche mit dem Bodenreiniger gefährlich über unseren Köpfen wanken. Trotz allem versuchte ich mich auf ihn einzulassen.
Ich bemühte mich, mein Hirn für ein paar Minuten freizubekommen und die schrecklichen Ereignisse der letzten Tage zu vergessen … vergeblich. Sein heißer Atem fühlte sich schmierig an und ich war nicht bei der Sache. Da war diese Blockade, die mein Hirn benebelte. Die jüngsten Geschehnisse hatten mich einfach fertiggemacht und mein sorgloses Leben durcheinandergewirbelt. Ich war müde, ausgelaugt und realisierte immer noch nicht ganz, was eigentlich geschehen war. Vorsichtig schob ich ihn von mir. »Ich kann nicht, Ben.«
Endlich unterbrach er sein Geschlecke und Gestöhne, blickte mich fassungslos an. »Wieso nicht?« Die Verwirrung stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Wir haben uns die ganze Woche nicht gesehen. Ich habe dich vermisst«, versuchte er mich einzulullen. Ohne auf mein Einverständnis zu warten, machte er sich wieder an meinem Hals zu schaffen, drückte mich an sich und knetete meinen Hintern.
Ich bezweifelte, dass ich Ben wirklich gefehlt hatte. Es stimmte, in den letzten Tagen war ich nicht in der Schule gewesen. Außer zwei Nachrichten, die ich ihm geschickt hatte, hatten wir keinen Kontakt gehabt, aber jetzt war mir seine Nähe unangenehm, seine Bemühung, mich anzuheizen, zuwider. Ich fühlte mich bedrängt.
»Ben, hör auf. Ich kann nicht.« Diesmal stieß ich ihn etwas grober von mir. »Es geht einfach nicht, tut mir leid.«
»Hey! Was ist los?« Endlich ließ er von mir ab und fuhr sich durch sein honigblondes Haar. »Sonst hat es dir doch auch immer gefallen.«
Ich verdrehte die Augen. Wieso kamen die meisten Typen mit einem Nein nicht klar? »Tut mir leid, ich weiß auch nicht … Ich kann mich nicht entspannen und ...« Ehrlich gesagt, war ich genervt, wollte, dass er von dieser fixen Idee einer schnellen Nummer in der Putzkammer der Schule abließ und sich endlich wie mein Freund benahm. Was ich brauchte, war eine Schulter, an der ich mich ausheulen konnte. Jemanden, der mich hielt, mir Trost spendete, ganz egal, was mein Vater angeblich verbrochen hatte. Nur einen kurzen Augenblick, in dem ich alles vergessen konnte, nicht stark sein musste. War das etwa zu viel verlangt?
Die letzten Tage waren alles andere als gut gewesen. Es war der erste Schultag für mich, nachdem sich mein Vater der Polizei gestellt hatte. Vor genau fünf Tagen war ich noch eine ganz normale Highschoolschülerin auf einer normalen Privatschule mit normalen Freunden und einem halbwegs normalen Leben gewesen. Jetzt war ich der Feind Nr. 1, dabei wusste ich noch nicht einmal, was man mir vorwarf. Das Getuschel und die Blicke ließ ich äußerlich an mir abperlen, aber innerlich machte mich die deutliche Ablehnung meiner besten Freundinnen, der Mitschüler und sogar der Lehrer echt fertig. Ben schien der Einzige zu sein, der sich mit mir abgeben wollte. Jetzt war mir natürlich auch klar, warum.
»Wenn es wegen deines Vaters ist, mach dir keine Gedanken. Es turnt mich an, dass du die Tochter eines Verbrechers bist.«
Schlagartig sah ich wieder klar. »Mein Vater ist kein Krimineller, Ben! Du glaubst den Mist doch nicht wirklich«, zischte ich ihn an.
»Sorry, leider sieht die Beweislage anders aus. Aber mach dir nichts draus, in ein paar Wochen haben das alle vergessen. Also ...?« Er trat mit einem anzüglichen Grinsen wieder näher und rieb sich an mir.
Ich konnte nicht fassen, wie kalt und egoistisch er war. »Du bist echt ein Arsch, weißt du das?« Wütend stieß ich ihn von mir.
»Hey Süße, jetzt sei nicht sauer!« Er trat wieder näher und versuchte mich erneut zu besänftigen. Er kapierte einfach nichts, wusste nicht einmal, worum es mir ging. Was hatte ich auch von dem begehrtesten Sunnyboy der Schule erwartet? Er war bekannt dafür, alles flachzulegen, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Wieso hatte ich mir eingebildet, dass ich etwas Besonderes für ihn sein könnte? Endlich verstand ich, dass ich nur eine weitere Trophäe in seiner Sammlung darstellte und die Sache schon längst hätte beenden sollen. Jetzt war die beste Gelegenheit dazu. Eilig riss ich mich von ihm los und funkelte ihn wütend an. Sein Haar war zerzaust und sein verdutzter Gesichtsausdruck sah zum Schreien aus.
»Was soll das, Mia? Jetzt stell dich nicht so an.«
»Weißt du was, Ben? Du kotzt mich echt an. Fick dich selbst!« Ich drängte mich an ihm vorbei und stolzierte aus der Besenkammer.
Wow! Wie gut es sich anfühlte, ihn so abzuservieren! Innerlich klopfte ich mir auf die Schulter und feierte mich selbst.
***
Mein Magen flatterte heftig, als ich am Nachmittag in die fast volle Turnhalle trat. Für einen kurzen Augenblick verstummten die Gespräche und alle Blicke ruhten auf mir. Ich spürte, wie das Blut in meine Wangen schoss und der Kloß in meinem Hals anschwoll. Leises Getuschel setzte ein, das wie das unterschwellige Summen aus einem Wespennest klang. Am Vormittag hatte ich das alles noch mit Würde ertragen, doch meine Fassade begann langsam zu bröckeln – ich schwächelte. Ich durfte mich nicht unterkriegen lassen, egal, was geschehen war. Ich schluckte, straffte die Schultern und schritt hocherhobenen Hauptes weiter.
Der Raum war für den heutigen Abschlussball mit bunten Girlanden und Luftballons geschmückt worden. Mr. Finelly, unser Geschichtslehrer, der für die Technik während der Veranstaltung verantwortlich war, brabbelte etwas Unverständliches ins Mikro. Aus dem Augenwinkel entdeckte ich die zwei Zivilbeamten, die mich ständig bewachten. Warum auch immer die Polizei glaubte, ich bräuchte Schutz in meiner eigenen Schule, erschloss sich mir nicht. Unauffällig lungerten sie ein paar Meter hinter mir und ließen mich nicht aus den Augen.
Alle waren da, mit ihren Eltern und Familien. Hin und wieder blitzte irgendwo ein Fotoapparat auf und lautes Gekicher dröhnte durch den Saal. Neben der vordersten Stuhlreihe standen meine besten Freundinnen – Oder sollte ich eher Ex-Freundinnen sagen? – Jenny, Vio und Marcy mit ihren Eltern. Es tat weh, nicht mehr zu ihnen zu gehören, und ehrlich gesagt konnte ich nicht begreifen, warum ich plötzlich der Feind war. Seit Tagen behandelten sie mich wie eine Aussätzige und mieden jedes Gespräch. All meine Handynachrichten und Telefonanrufe wurden von ihnen ignoriert.
Gekleidet in blauer Robe und mit alberner Quastenkappe in der Hand, setzte ich mich in die letzte Reihe und wartete darauf, dass der Spuk vorbei sein würde. Bis auf ein paar heimliche Blicke beachtete mich niemand und so ertrug ich auch diese Bürde. Die Plätze füllten sich und endlich begann die Abschlussfeier. Eine Stunde musste ich die Schmach noch ertragen, bis ich mich für den Rest meines Lebens vergraben konnte. Direktor Mills betrat das Rednerpult und verharrte geduldig, bis sich alle auf ihren Plätzen eingefunden und ihre Gespräche eingestellt hatten. Neben mir blieb alles frei. Wer wollte schon neben der Tochter eines Kriminellen sitzen? Der Direktor fing mit seiner langweiligen Abschlussrede an.
Ben befand sich auf der anderen Seite der Halle. Meine Worte von heute Vormittag schienen ihm nicht viel auszumachen. Er flirtete ungeniert mit Angelina, die ihr Glück, endlich seine Aufmerksamkeit zu haben, kaum fassen konnte. Schmunzelnd schüttelte ich den Kopf. Er ließ wirklich nichts anbrennen. Zum Glück war ich ihn jetzt los. Es verletzte mich nicht, aber ich war enttäuscht. Bis dato hatte ich geglaubt, Freunde zu haben.
Applaus donnerte durch die Halle. Julie Baker strahlte ins Publikum und winkte, als wäre sie bei einer Misswahl. Ich verdrehte die Augen. Warum zog sie immer so eine Show ab? Ich hatte sie noch nie leiden können. Sie hatte mich von Anfang an als Konkurrentin gesehen, weil Ben an mir mehr interessiert gewesen war als an ihr. Jetzt hatte sie freie Bahn.
Weitere Namen wurden aufgerufen. Nervös nestelte ich mit den Händen an meiner Robe und musste an meinen Vater denken. Seit Dad fort war, stand mein Leben Kopf. Meine fünfjährige Schwester Cathrin brauchte mich – ich war nun ihr einziger Halt. Unsere Mutter war bei ihrer Geburt gestorben und seither hatte sie nur noch Dad und mich. Sie war ein tapferes und mutiges Kind, trotz ihrer Herzprobleme und der vielen Operationen, die sie schon seit ihrer Geburt begleiteten. Sie imponierte mir und manchmal fragte ich mich, woher sie ihre Stärke nahm, das alles durchzustehen. Sie war mein kleiner Keks und ich liebte sie über alles. Weinend hatte sie sich an mich geklammert, als die Polizei unser Haus durchsucht und alles konfisziert hatte. Seitdem schlief sie bei mir im Bett. Sie brauchte meine körperliche Nähe und konnte, ohne dass ich ihr geliebtes Schlaflied sang, nicht einschlafen.
Gekicher drang in mein Bewusstsein, irritiert sah ich auf. Alle Köpfe hatten sich zu mir gewandt. »Mrs. Morgan? Wollen Sie Ihr Diplom nicht bei mir abholen?« Ausdruckslos blickte Mr. Mills mir entgegen.
Shit! Ich hatte nicht mitbekommen, dass ich aufgerufen worden war. Gott, wie peinlich! Mein Mund war staubtrocken und ich zitterte leicht, als ich durch die kleine Gasse zwischen den Stühlen lief.
»Dass die sich nicht schämt!«
»Na, hoffentlich kommt sie heute Abend nicht zum Abschlussball.«
»Mir tut sie leid.«
»Halt die Klappe, Cynthia. Du hast keine Ahnung.«
Ich tat, als würde ich die Lästerattacken, die mich auf dem Weg zur Bühne begleiteten, nicht hören. Es verletzte mich mehr, als ich mir eingestehen wollte. Auf der Bühne angekommen, schüttelte mir der Direktor mit kaltem Blick die Hand und überreichte mir das Stück Papier. Mäßiger Applaus erklang, obwohl ich die Abschlussprüfungen mit besonderer Auszeichnung bestanden hatte. Bei mir hatte Mr. Mills das doch glatt zu erwähnen vergessen. Egal. Deshalb hätten die Lästereien auch nicht aufgehört. Mit klopfendem Herzen stellte ich mich zu den anderen Schülern in die Reihe. Bisher hatte ich meine Tränen zurückhalten können, war stark geblieben, doch jetzt, als ich auf die stolzen Gesichter der Eltern hinunterblickte, verschwamm meine Sicht. Mist! Dort unten hätten eigentlich mein Dad und Cathrin sitzen müssen. Mit aller Kraft zwang ich mich, den Kummer runterzuschlucken, und fixierte einen Punkt auf dem Bühnenboden.
Nach dem offiziellen Teil stand das große Kappenwerfen auf dem Programm. Eigens dafür war ein kleiner Leiterkran gemietet worden, damit der Fotograf die hochfliegenden Hüte und unsere fröhlichen Gesichter perfekt einfangen konnte. Das war mein Stichwort, die Veranstaltung schnellstens zu verlassen. Es dauerte eine ganze Weile, bis sich die Menschen durch die Flügeltür hinausgedrängt hatten. Niemand – außer den beiden Typen in Zivil – achtete auf mich. Ich nutzte das allgemeine Gedränge und flüchtete in eine Nische, zog dabei eilig den Talar aus und ließ ihn achtlos liegen. Zum Glück hatten meine Bewacher mich aus den Augen verloren. So langsam nahmen sie mir die Luft zum Atmen, und ich brauchte eine Auszeit. Ich mischte mich unter den hinauslaufenden Strom und schaffte es, sie tatsächlich abzuhängen. Schnell rannte ich über die Schulwiese zum Parkplatz und versteckte mich hinter Bens Mustang. Grinsend beobachtete ich, wie sich die beiden Polizisten hektisch nach mir umschauten. Meine Mitschüler winkten wild und lachten laut, während sie ihre Kappen in die Luft warfen. Der Fotograf versuchte, der feiernden Meute Anweisungen zu geben, was gar nicht so einfach war – meine Chance zu verschwinden. Ich sah mich um. Mein Sportwagen, den mir Dad letztes Jahr zum achtzehnten Geburtstag geschenkt hatte, war von der Polizei beschlagnahmt worden, wie auch der Rest meines Lebens. Also musste ich zu Fuß entkommen. Flink, damit mich die Beamten nicht entdeckten, rannte ich zum nächsten Häuserblock und stellte mich auf einen langen Fußmarsch ein. Es tat gut, sich die Beine zu vertreten. Mein Weg führte mich durch die Straßen von Pasadena. Hier war ich aufgewachsen.
Der Sommer versprach unerträglich heiß zu werden und die Sonne brannte erbarmungslos an diesem Juninachmittag. Was hätte ich dafür gegeben, jetzt in unseren Pool zu springen! Versteckt im Schatten eines Baumes, spähte ich hinüber zu unserem Haus. Presse und Schaulustige belagerten die Wiese und interviewten Nachbarn. Es schien, als würden wir die Schlagzeilen beherrschen. Ich erkannte sogar Mrs. Nashville, die alte Hexe, die bereitwillig einem Reporter den neusten Klatsch und Tratsch über uns erzählte. Was konnte sie schon wissen, außer dass mein Vater oft auf Geschäftsreise gewesen war und sie sich über jede Art von Ruhestörung, ärgerte? War ja klar, dass die alte Schachtel sich aufspielte, als wüsste sie genauestens Bescheid. Was für eine Heuchlerin!
Ich sah zu meinem Zimmerfenster hinauf. Alles war verschlossen, die Rollläden heruntergelassen. Mein Laptop, Tablet und Handy waren vom FBI konfisziert worden, sogar meine Kreditkarten hatte ich nicht behalten dürfen. Unser ganzes Haus wurde auf den Kopf gestellt. Kartonweise hatten die Schnüffler alle Akten, Unterlagen und Computer aus Dads Büro mitgenommen. Ich fragte mich, ob sie auch das Geheimversteck in meinem Zimmer entdeckt hatten. Was würde ich dafür geben, jetzt an das Geld zu kommen, das ich angespart hatte! Ich seufzte.
Ein Polizeibeamter und ein dickes Absperrband verhinderten, dass die Presse ins Innere unseres Hauses drang. Jetzt war ich froh, dass die Beamten Cathrin und mich bei einer Pflegefamilie untergebracht hatten, bis das Missverständnis endlich geklärt war.
Mr. und Mrs. Doyle ließen mich weitestgehend in Ruhe, bombardierten mich nicht mit Fragen. Somit hatte ich dort wenigstens etwas Luft zum Atmen. Es ging uns gut bei ihnen, aber ich sehnte mich nach vertrauten Gesichtern, nach Freunden und vor allem nach meinem alten Leben.
Mit brennendem Herzen wandte ich mich ab, schluckte meinen Kummer runter und machte mich auf den Weg zurück in mein neues Zuhause. Dort erwarteten mich sicherlich die beiden Beamten, denen ich in der Schule entkommen war. Ein Vortrag über Kooperation und Schutzmaßnahmen würde mir wahrscheinlich nicht erspart bleiben …
***
Eine Stunde später bog ich halb verdurstet in die Straße ein, in der ich zurzeit wohnte. Von Weitem erkannte ich mehrere Fahrzeuge, die direkt vor dem Haus der Doyles parkten. Das FBI? Es waren genau die gleichen Autos, die an dem Abend vor ein paar Tagen unsere Sachen als angebliches Beweismaterial aus unserem Haus geschafft hatten. Vielleicht hatte sich das Missverständnis aufgeklärt und wir durften endlich nach Hause? Vorfreude kribbelte in meinem Magen. Kaum hatte ich einen Fuß auf den Gehweg gesetzt, bemerkte ich hinter mir das Rauschen eines Funkgerätes. Zwei Männer mit Sonnenbrillen und dunkler Kleidung folgten mir. Als mir dann auch noch zwei weitere Typen entgegenliefen, fand ich das Ganze schon etwas übertrieben.
»Mensch, Mädchen! Wieso tust du uns das bei dieser Affenhitze an, hm?«, murrte ein Beamter, dem der Schweiß an Stirn und Nacken hinunterlief. Ich seufzte und rollte mit den Augen. Schnell hatten sie mich rechts und links am Arm ergriffen und führten mich zum Haus. »Wir haben sie«, brummte einer der beiden in sein Funkgerät.
»Hey, Finger weg! Ich kann allein gehen, okay?«, zischte ich sie an und riss mich mit einem Ruck von ihnen los.
Sobald das Quietschen der Verandatür zu hören war, verstummten die Stimmen aus der Wohnküche. Die Küche, die direkt ans Wohnzimmer der Doyles angrenzte, war voll mit fremden Männern in dunklen Anzügen und ausdruckslosen Gesichtern. Was war denn hier los? Überrascht blickte ich in die Runde und entdeckte Mrs. Tillinger von der Fürsorge, die sich in den letzten Tagen um uns gekümmert hatte.
»Da bist du ja! Wir wollten schon eine Fahndung rausgeben«, witzelte sie und kam auf mich zu. Sie hatte mich und meine Schwester zu den Doyles gebracht, als mein Dad sich der Polizei gestellt hatte. Genau wie beim letzten Mal trug sie einen blauen Hosenanzug und hatte ihr Haar straff zu einem Dutt geknotet. Trotz ihres konservativen Erscheinungsbildes war ihr Gesicht freundlich und warme braune Augen blickten mir mit einem Lächeln entgegen. »Es war nicht klug, dich ohne unsere Leute von der Schule zu entfernen«, kritisierte sie mich. »Wo warst du nur? Ich habe mir Sorgen gemacht.«
Gleichgültig zuckte ich mit den Schultern. »Ich brauchte einfach eine Pause.«
Ihr tadelnder Ausdruck verschwand und verständnisvoll legte sie ihren Arm um mich. »Die Männer sind für deinen Schutz verantwortlich. Du machst es uns wirklich nicht leicht.«
Glaubten sie etwa, für mich wäre diese Sache leicht? In der Schule wurde ich geächtet wie eine Verbrecherin, wir lebten bei einer fremden Familie und mein Vater soll fürchterliche Dinge getan haben. Diese ganze Situation war einfach nur paradox. Widerwillig nickte ich, auch wenn ich davon überzeugt war, den ›Schutz‹ nicht zu brauchen. Spätestens in ein paar Tagen würde sich der Irrtum sowieso aufgeklärt haben. »Was ist denn eigentlich los?«, wollte ich wissen.
Mrs. Tillinger lächelte unsicher und deutete auf den Mann, der neben dem Esstisch stand. »Darf ich dir Director Bennet vorstellen? Er ist ab jetzt für dich zuständig.« Er nickte grüßend. Missmutig sah ich ihn an. Ich schätzte ihn auf Mitte vierzig. Er war groß, sehr gepflegt und eigentlich recht schlank, wenn man von dem kleinen Bauchansatz, der mich an Dad erinnerte, absah. »Es freut mich, dich kennenzulernen, Joy«, sagte er und kam auf mich zu.
»Joy? Mein Name ist Mia ...«
Abwehrend hob er die Hände. »Ich weiß, wie dein richtiger Name ist, aber ab jetzt heißt du Joy. Joy Brown.«
Was? Was war denn jetzt los? Unsicher blickte ich zu Mrs. Tillinger. Sie hatte genau den gleichen entschlossenen Ausdruck wie der Director.
»Meine Männer und ich werden alles tun, um dich und deine Schwester zu schützen.«
Weitere Schutzmaßnahmen? Ich sah mich im Wohnzimmer um und entdeckte Cathrins roten Koffer mit dem Hasenmuster, den Dad ihr zum Geburtstag geschenkt hatte, neben dem Sofa.
»Wo ist ...?«, wollte ich Mrs. Tillinger fragen, doch wieder unterbrach mich der Director. »Keine Sorge, sie ist mit einer meiner Mitarbeiterinnen oben und packt noch ein paar ihrer Sachen zusammen.«
Verwirrt schüttelte ich den Kopf. Insgeheim hoffte ich, eine versteckte Kamera zu entdecken, wünschte mir, die Männer und auch Mrs. Tillinger würden gleich loslachen. Doch mein Wunsch wurde nicht erfüllt. Der Albtraum ging gnadenlos weiter.
»Es tut mir leid, aber die Lage hat sich ... verschärft«, versuchte sie zu erklären. »Wir sind gezwungen, deine Schwester und dich in Sicherheit zu bringen.«
»Was meinen Sie mit ›verschärft‹? Und wo sind überhaupt die Doyles?«
»Um ehrlich zu sein«, mischte sich der Director ein, »werdet ihr ins Opferschutzprogramm aufgenommen, dein Vater ebenfalls. Nur so lange, bis alle Unklarheiten beseitigt sind. Ihr müsst für eine Weile untertauchen, deshalb möchten wir dich bitten, alles, was du brauchst, jetzt aus deinem Zimmer zu holen. Die Zeit drängt. Was die Doyles betrifft, sie sind außer Haus. Leider könnt ihr euch nicht mehr von ihnen verabschieden.«
Egal wie lange ich sprachlos auf seinen Mund starrte, mein Verstand weigerte sich, seine Worte zu erfassen. Völlig durcheinander und kaum in der Lage, auch nur einen vernünftigen Gedanken zu formen, brabbelte ich nur das Wort nach, welches in meinem Hirn widerhallte. »Opferschutz?« Mein Mund war staubtrocken. Das konnte doch nicht deren Ernst sein! Fanden die das nicht übertrieben? Angst stieg in meiner Brust auf. Wieso passierte uns so etwas? Tat die Polizei überhaupt gewissenhaft ihre Arbeit? Da musste ein gewaltiger Fehler vorliegen. Meine Schwester und ich waren doch nicht ernsthaft in Gefahr, oder etwa doch? Ich musste einen entsetzten Gesichtsausdruck gemacht haben, denn Mrs. Tillinger legte wieder ihren Arm um meine Schulter. »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du kannst uns vertrauen. Es ist wirklich das Beste für euch, wenn ihr hier so schnell wie möglich verschwindet.«
Wie stellten die sich das vor? Wir konnten doch nicht einfach aus unserem bisherigen Leben aussteigen. Ich hatte Pläne für diesen Sommer. Aufgebracht, weil diese Sache mein ganzes Vorhaben durcheinanderwirbelte, stieß ich den Atem aus. »Cathrin ist krank, braucht Medikamente, ärztliche Betreuung … Und von wie viel Zeit sprechen wir überhaupt? Ein paar Tage, Wochen ... Monate? Die Sommerferien beginnen jetzt, ich habe einen Job angenommen und meine Schwester soll eine neue Therapie bekommen. Wir können nicht sang- und klanglos von hier verschwinden!« Wieso begriffen sie das nicht? Ich war hilflos, völlig überfordert mit der gesamten Situation.
»Es wird alles gut werden. Wir sorgen dafür, dass euch nichts geschehen wird.« Director Bennet gab seinen Männern mit einer Kopfbewegung die Anweisung, den Raum zu verlassen. Nacheinander verschwanden sie.
Ich war den Tränen nahe. Die ganze Zeit über hatte ich nicht geweint, und das würde ich auch jetzt nicht tun. »Wer will uns denn etwas antun? Und warum? Wir haben doch niemandem etwas getan.«
»Um dir das zu erklären, fehlt uns die Zeit. Du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, dass du und deine Schwester für ein paar wirklich üble Kerle sehr wertvoll seid. Sie schrecken vor nichts zurück. Um das Schlimmste zu verhindern, sollten wir euch so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Verstehst du?«
Seine ruhige und entschlossene Art schüchterte mich ein. Mit jedem Wort strahlte er so viel Selbstsicherheit aus, dass ich nahe dran war, ihm diese verrückten Befürchtungen zu glauben.
»Dein Vater wird in ein paar Tagen nachkommen. Es ist wirklich wichtig, dass ihr aus Pasadena verschwindet – vorerst.« Mrs. Tillinger redete sanft auf mich ein. »Geh hinauf und hol deine persönlichen Dinge. Ihr müsst jetzt gleich los.«
Tränen verschleierten mir die Sicht. Tapfer schluckte ich sie hinunter und versuchte, nicht hysterisch zu werden. Ich brauchte einen kühlen Kopf. Egal, was sie sagten, ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Dad etwas Unrechtes getan hatte. Niemals. Das passte einfach nicht zu ihm.
In Begleitung von Mrs. Tillinger ging ich in mein Zimmer und stopfte meine Klamotten wahllos in eine Reisetasche. Ich hatte ohnehin nicht viel mitgenommen – ein paar Hosen, Shirts und Unterwäsche. Aus meiner Schultasche nahm ich meine Zeichenmappe und meinen MP3-Player. Ohne die Ledermappe würde ich keinen Schritt tun – sie war mein wertvollster Besitz. Sie hatte einst meiner Mutter gehört. Darin hatte sie immer ihre Zeichnungen und Skizzen aufbewahrt. Liebevoll strich ich über das Leder, dabei flackerten Erinnerungen in mir auf. Oft hatte ich mit Mum auf der Wiese in unserem Garten gesessen. Die Mappe lag auf ihrem Schoss und sie zeichnete. Dabei kommentierte sie ihre Malbewegung und erklärte mir, wie wichtig die Details waren. Sie trainierte meinen Blick für Feinheiten, Nuancen, Licht und Schatten. Stundenlang versuchte ich mich an Augen, Haaren und Konturen. Sie war meine Lehrerin gewesen.
Mrs. Tillinger riss mich aus meinen Gedanken. »Bist du soweit?«
Kurz sah ich auf, öffnete meine Ledermappe und vergewisserte mich, dass mein Stift noch an der Gummischlaufe befestigt war. Schon öfter war mein Kohlestift hinausgerutscht, da das Gummi mit der Zeit ausgeleiert war. Ohne ihn konnte ich nicht zeichnen und wäre aufgeschmissen.
Von nebenan hörte ich Cathrins Stimme. Sie ahnte nicht, wie verworren unsere Situation wirklich war. Ich hatte ihr erzählt, dass Dad auf einer Geschäftsreise wäre und wir Ferien bei einer Familie machen durften, aber der Keks war nicht dumm. Sie spürte genau, dass etwas geschehen und anders war.
Eilig schloss ich den Reißverschluss meiner Tasche.
Zurück in der Wohnküche nahm ich einen Stoffbeutel und packte sämtliche Medikamente ein, auf die meine Schwester angewiesen war. Fieberhaft dachte ich nach, ob ich auch keines vergessen hatte. Das wäre wirklich übel. Alles, was Cathrins Herz schneller schlagen ließ, versetzte mich in Alarmbereitschaft.
Kapitel 2
»Mia, Mia! Da bist du ja endlich!« Cathrin sprang von ihrem Bett und hüpfte in meine Arme. Ich fing sie lachend auf.
»Wir machen Urlaub, Mia. Das hat Nicole gesagt.« Sie deutete auf die Beamtin, die neben ihrem Bett stand. »Und wir spielen ein neues Spiel.«
»Was für ein Spiel?«
»Ich darf mir einen neuen Namen aussuchen.« Sie wirkte ein wenig durcheinander und sofort machte ich mir Sorgen. Ich strich ihr eine verirrte Haarsträhne hinters Ohr. »Das wird bestimmt Spaß machen, Keks«, versuchte ich sie zu beruhigen.
»Darf Mr. Floppy auch mitkommen?«
»Natürlich. Ohne ihn gehen wir nirgendwo hin. Das wichtigste ist, wir bleiben zusammen.« Ich war selbst nicht so wirklich davon überzeugt, aber wenn ich ihr zeigte, wie unbekümmert ich bei all den Ereignissen reagierte, würde sie vielleicht keine Angst haben. »Hey, das wird lustig! Ich finde, du solltest Lottje heißen, oder Adalind«, neckte ich sie.
»Iiiihhhh«, kreischte Cathrin. »Ich will einen schönen Namen haben.«
Ich setzte mich mit ihr aufs Bett, sodass sie auf meinem Schoss saß. »Weißt du denn, warum wir fortgehen?«, begann ich vorsichtig.
Sie senkte ihren Blick und nickte traurig. »Wir gehen wegen Daddy.«
Ich schluckte, weil sie es gespürt hatte. Nur wie sollte ich es ihr erklären? Sie hing an unserem Vater. Ich überlegte. »Wir machen jetzt Ferien, damit die Polizei das alles genau klären kann.«
»Und Daddy?«
Ich lächelte unsicher. »Ihm geht es gut, Keks. Er wird bald nachkommen.«
Die Beamtin trat ungeduldig von einem Bein aufs andere. »Ich störe euch nur ungern, aber die Zeit wird knapp.« Ich nickte ihr zu und richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf meine kleine Schwester. »Bist du soweit? Können wir los?« Sie nickte. Hand in Hand verließen wir das Zimmer.
***
Seit Stunden waren wir in einem dunklen Van durch Texas unterwegs. Die bunten Lichter unserer Stadt hatten wir schon längst hinter uns gelassen und fuhren dem Sonnenuntergang entgegen. Eine sehr romantische Vorstellung, aber mitten im nirgendwo, in Gewahrsam von mehreren Polizeibeamten und ohne das Ziel zu kennen, fröstelte es mich in dem klimatisierten Wagen. Die Sonne tauchte den Himmel in rosa und orangene Farbtöne. Ich mochte das Farbspiel, aber jetzt konnte ich der Schönheit nichts abgewinnen.
Holly – wie meine Schwester von nun an hieß – schlummerte an mich gelehnt, während ich aus dem Fenster starrte. Es fiel mir schwer, sie so zu nennen. Daran musste ich mich erst gewöhnen. Der Director meinte, es wäre sehr wichtig, uns mit den neuen Namen anzusprechen, und wir sollten uns so schnell wie möglich daran gewöhnen.
Holly war so aufgeregt gewesen, sie hatte die erste Stunde im Van munter vor sich hingeplappert. Der Director studierte mit uns neue Lebensläufe ein und interessiert hatte Holly alles wie ein Papagei wiederholt, was er ihr vorgesagt hatte. Für sie war das ein tolles Spiel. Wir hatten Anweisung bekommen, mit niemanden zu sprechen und auch sonst keinen Kontakt zu jemandem aufzunehmen. Dabei hatte er mir einen Blick durch den Rückspiegel zugeworfen, der mich warnen sollte.
Den Kellnerjob in Ginger‘s Bar und den Zeichenunterricht konnte ich jetzt wahrscheinlich vergessen. Dabei hatte ich es endlich geschafft, Dad zu überreden, den Sommer über arbeiten zu dürfen. Der Minijob war nichts Besonderes, aber ich hatte mich auf mein erstes selbstverdientes Geld gefreut. Ich wollte Dad nicht ständig auf der Tasche liegen. Ewig hatte er sich gesträubt, weil er der Meinung war, dass ich das nicht nötig hätte. Das sah ich anders. Ich wollte frei und unabhängig sein, meine eigenen Entscheidungen treffen und mich auf diesem Weg ausprobieren dürfen. In Dads Augen war ich immer noch sein kleines Mädchen, das er vor allem und jedem beschützen wollte. Ich musste unbedingt mit ihm sprechen, brauchte eine Erklärung von ihm.
Verdammt, wie lange dauerte es noch, bis das FBI herausfand, dass es auf dem Holzweg war? Ich weigerte mich noch immer, an ein Schuldeingeständnis meines Vaters zu glauben. Er würde niemals unsere Sicherheit aufs Spiel setzen.
Meine Gedanken wurden unterbrochen, als wir die Landesgrenze von Texas passierten und durch Louisiana fuhren. »Wo zum Teufel bringen Sie uns hin?«
»Keine Sorge, wir haben es bald geschafft. Wir fahren zu einem Regionalflughafen in Shreveport. Niemand vermutet euch dort. Meine zwei besten Männer werden euch von dort an begleiten und bewachen.«
»Wir fliegen?«, entfuhr es mir eine Spur zu schrill. »Und wohin? Jetzt sagen Sie es doch endlich!« Mein Magen grummelte ungeduldig. Was hatten sie vor?
»Ich weiß, wie dir zumute sein muss, Joy, aber ...«
»Einen Scheiß wissen Sie«, blaffte ich zurück, weil er mich immer noch im Unklaren ließ. Der Typ neben Director Bennet kicherte. Bevor wir losgefahren waren, hatte der Director ihn mir als Special Agent Logan Smith vorgestellt. Smith war deutlich jünger als sein Chef, hatte blondes kurzes Haar und blaue Augen, die mich freundlich angeschaut hatten. Bisher hatte er auf der ganzen Fahrt kein Wort gesprochen, doch jetzt hörte ich ihn leise lachen. Director Bennet warf ihm einen warnenden Blick zu. Smith verschluckte sich beinahe an seinem Glucksen und räusperte sich schnell.
»Ich habe auch eine Tochter«, begann er, »und weiß sehr wohl, wie schwierig es für dich sein muss. Glaub mir, es wird einfacher, wenn du wenigstens versuchst, dich mit der Situation zu arrangieren. Ich mache diesen Job schon ein paar Jahre, Joy. Ich weiß, wovon ich spreche.« Ich biss mir auf die Lippen, schluckte einen bissigen Kommentar hinunter und schwieg.
Keine zwanzig Minuten später erreichten wir das Gelände des Flughafens. Ich weckte Holly, die sich müde die Augen rieb. »Sind wir schon da?«, fragte sie schlaftrunken.
»Gleich. Wir fliegen mit einem Flugzeug weiter«, flüsterte ich mit einem Lächeln. Sie sollte nicht sehen, wie nervös ich war. Sie gähnte, war dann schlagartig wach und machte große Augen. »Im Ernst? Wir fliegen?« Neugierig blickte sie aus dem Fenster. Es war nicht zu übersehen, wie aufgeregt sie war.
Director Bennet steuerte auf das Flughafengebäude zu. Auf einem riesigen Parkplatz angekommen, stiegen wir aus. Die Männer trugen unser Gepäck, während ich Hollys Hand nahm. Sie war warm und vertraut, linderte meine Nervosität ein wenig.
Es war viel los in der Abflughalle. Überall waren Leute, die eilig ihre Koffer hinter sich herzogen und durcheinander in die verschiedensten Richtungen liefen. Schweigend folgten wir dem Director, der uns zielstrebig in einen ruhigeren Teilbereich der Halle führte.
»Setzt euch. Wir müssen hier noch auf einen Mitarbeiter warten.« Er deutete auf eine Sitzbank aus Metall.
»Danke, ich steh lieber.« Mir tat vom vielen Sitzen schon der Hintern weh. Director Bennet überhörte meine schnippische Antwort und sah dem Treiben in der Abflughalle zu. Dabei blickte er ständig auf seine Armbanduhr und warf Smith verärgerte Blicke zu. Der arme Kerl zuckte unschuldig mit den Schultern. »Ich weiß auch nicht, wo er steckt, Sir. Sie kennen ihn doch, er kommt grundsätzlich immer zu spät.«
»Das würde ich ihm nicht raten«, brummte Bennet schlechtgelaunt. Der Director zog sein Telefon aus der Innentasche der Jacke und entfernte sich ein paar Schritte.
»Was ist denn los?«, wollte ich wissen und beobachtete, wie er genervt in sein Handy tippte.
»Ihr Mädchen habt bestimmt Hunger, oder?«, lenkte Smith grinsend von meiner Frage ab. Der glaubte wohl, uns mit seinem Charme um den Finger wickeln zu können. Da musste er früher aufstehen.
»Ich habe Hunger. Können wir zu McDonald’s?«
Mir klappte der Mund auf. Meine verräterische kleine Schwester hatte er wohl schon am Haken. Honigsüß lächelte sie ihn an und ihre kugelrunden braunen Augen leuchteten. Das gleiche Lächeln setzte sie bei Dad auch immer ein, wenn sie etwas haben wollte, und erweichte damit sein Herz.
So süß sie mit ihren langen braunen, leicht gewellten Haaren, ihren rosa Pausbäckchen und ihrem unschuldigen Hundeblick auch aussah – sie hatte es faustdick hinter den Ohren. Aber genau das war es, was sie so unwiderstehlich und liebenswert machte. Grinsend schüttelte ich den Kopf und blickte von ihr zu Smith. »Das ist keine Antwort und Sie lenken vom Thema ab. Auf wen warten wir?«
»Nenn mich Logan, okay?«, grinste er und wandte sich meiner Schwester zu. »Also McDonald‘s habe ich hier nicht gesehen, aber wenn du willst, können wir nach etwas anderem schauen.« Holly war natürlich einverstanden und legte ihre Hand in seine, was mich erstaunte. Normalerweise war sie Fremden gegenüber nicht so vertrauensselig.
Während ich den beiden nachsah, steckte der Director sein Handy wieder in die Innentasche seiner Jacke und trat auf uns zu. »Ich erreiche den Mistkerl nicht. Smith, sorgen Sie dafür, dass er es diesmal nicht vermasselt, sonst ...« Er hielt inne, besann sich und schluckte seinen Ärger hinunter. »Schaffen Sie seinen Hintern hierher, und zwar sofort.«
Logan war sichtlich verunsichert. Ich wusste ja nicht, wer ›er‹ war, aber so langsam hatte ich den Eindruck, dass der Director doch nicht alles unter Kontrolle hatte, wie er vorgab. Und der arme Logan musste das nun ausbaden. »Wir haben noch Zeit, Sir. Er wird schon rechtzeitig kommen. Die Mädchen haben Hunger, Sir.«
»Dann besorgen Sie etwas, verdammt!« Logan nickte und verschwand mit Holly im Getümmel.
***
Director Bennet telefonierte wieder und ignorierte mich. Ich überkreuzte die Arme und wartete. Es war die Gelegenheit, offen und ehrlich mit ihm zu sprechen, da meine Schwester mit Logan unterwegs war. Er musste mir endlich mehr Details verraten; ich hielt diese Ungewissheit nicht länger aus. Vor wem flohen wir? Wer wollte uns etwas antun und warum? Hatte die Justiz Irrtümer und Fehlinformationen ausgeschlossen? Welche Beweise lagen vor, die meinen Vater belasteten?
Als er sein Gespräch beendet hatte, trat Director Bennet nachdenklich zu mir. Er nickte, als wollte er mir damit sagen, dass alles in bester Ordnung war.
»Es dauert nicht mehr lange, dann seid ihr in Sicherheit.«
Ich senkte den Blick. »Wo werden Sie uns hinbringen?«
»Nach Illinois, in die Nähe eines kleinen Ortes namens Virginia. Dort ist das Safe House. Euch wird es an nichts fehlen, versprochen, aber eine Weile müsst ihr dort ausharren.«
»Dann kommt Dad wirklich zu uns?«
»Ja, seine Sicherheit ist im Gefängnis nicht gewährleistet, deshalb hat der Staat Texas beschlossen, ihn gesondert zu schützen. Ich schätze, in ein paar Tagen wird er nachkommen.«
Ich konnte es kaum erwarten, Dad wiederzusehen. Dann würde ich endlich alle Fragen, die mir auf der Seele brannten, beantwortet bekommen. Auch wenn mir das alles eine Heidenangst einjagte, so war ich doch neugierig zu erfahren, was wirklich geschehen war. In all den Tagen seit Dad fort war, hatte mir niemand erzählt, was das alles zu bedeuten hatte. Niemand sah sich in der Verantwortung, mich genau ins Bild zu setzen. Mrs. Tillinger war die Einzige gewesen, die mit mir über Dad gesprochen und mir Mut machte. Alle anderen hatten mich über unser Leben nur ausgefragt. Alle Vorwürfe und Informationen hatte ich der Presse entnommen.
»Und wer ist hinter uns her?«
»Dein Vater hat für den größten Verbrecher der Staaten gearbeitet. Ich denke, du weißt, wer Die graue Eminenz ist. So jemand hat nicht nur viele Feinde, sondern ist auch daran interessiert, dass dieser Deckname ihn weiter schützt. Dein Vater stellt sich mit seiner Aussage auf die Abschussliste fast aller Kriminellen. Sie werden alles tun, um zu verhindern, dass die wahre Identität ans Licht kommt. Dabei schrecken sie vor nichts zurück.«
Nachdenklich schüttelte ich den Kopf. Natürlich kannte ich Die graue Eminenz, jedes Kind wusste, dass dieser Kerl echt übel war. »Ich kann nicht glauben, dass Dad mit solchen Leuten überhaupt etwas zu tun hat.«
»Im Augenblick sieht alles danach aus. Tut mir leid.«
Ich wollte das einfach nicht wahrhaben. Logan und Cath… Holly kamen zurück und unterbrachen unser Gespräch. Oh Mann, es würde dauern, bis ich ihren Fake-Namen verinnerlicht hatte.
»Hier, ein Käse-Schinken-Sandwich.« Sie streckte es mir entgegen und grinste mich kauend an. Die Worte des Directors hallten in mir nach, als ich in ihr Gesicht sah. Wenn er wirklich recht behielt und alle Anschuldigungen stimmten, dann ... Eine Gänsehaut bildete sich auf meinen Armen. Plötzlich erschienen mir der Sommerjob und mein Kunststudium in New York nicht mehr so wichtig. Vielleicht war die ganze Sache doch ernster, als ich anfangs hatte glauben wollen. Doch was würde das bedeuten?
»Hier, hast du Durst?« Logan hielt mir eine Flasche Wasser unter die Nase und riss mich damit aus den Gedanken. Dankbar nahm ich sie an und trank ein paar Schlucke.
»Smith? Hat er sich bei Ihnen gemeldet?«
»Nein, Sir.«
Director Bennet verzog das Gesicht. »Das gibt es doch nicht! Wir haben noch zehn Minuten, wo steckt der verdammte Kerl?« Nervös lief er auf und ab, zog wiederholt sein Handy heraus und tippte etwas ein.
»Auf wen warten wir eigentlich?«, wandte ich mich an Logan.
»Auf Parker«, seufzte er und blickte ins Gewimmel der Abflughalle.
»Und warum ist dieser Parker noch nicht da?«
»Weil er ... eben Parker ist.« Ein schiefes Grinsen erschien auf seinen Lippen.
»Wie soll ich denn das verstehen?«
»Na ja, Parker ist ... anders. Aber er ist der Beste, und das weiß er leider auch. Bennet wird ihm die Hölle heißmachen, wenn er nicht bald auftaucht«, sagte er mehr zu sich selbst. »Parker und ich sind seit drei Jahren Partner. An seine ... Eigenarten habe ich mich längst gewöhnt, nur unser Boss kommt damit nicht ganz klar.«
Was verstand Logan unter Eigenarten? Dieser Parker schien etwas chaotisch zu sein und meine Neugier war mehr als geweckt. Ich blickte ebenfalls in die Menge. Im Grunde konnte es jeder sein, ein Schlipsträger oder ein Typ in Bermudashorts.
»Gott! Nicht auch das noch!«, entfuhr es dem Director. Er rieb sich genervt den Nasenrücken. Logan stierte zur Mitte der Halle und schüttelte grinsend den Kopf. Ich folgte seinem Blick und plötzlich kapierte ich, was Logan vorhin mit ›anders‹ gemeint hatte.
Aus dem Gewimmel der Leute kam der absolut heißeste Typ, den ich je gesehen hatte, direkt auf uns zu. Nie und nimmer hätte ich ihn für einen Polizeibeamten gehalten; er wirkte eher wie ein heruntergekommener Rockstar. Das lag nicht nur an seinen verwaschenen und zerrissenen Jeans, auch nicht an seiner Lederjacke oder der dunklen Sonnenbrille. Es war seine ganze Erscheinung. Der Haarschnitt war schon längst rausgewachsen und einzelne Strähnen hingen ihm lässig in die Stirn. Er war unrasiert. Der Dreitagebart wirkte sehr sexy. Er hatte unglaublich breite Schultern und durch das T-Shirt konnte man seine Bauchmuskeln ansatzweise erahnen. An seinem Hals konnte ich einen Teil eines Tattoos erkennen. Er trug Bikerboots und eine große Reisetasche locker über seiner Schulter. Ich hielt den Atem an, als er direkt vor uns stehen blieb, und konnte nicht anders, als ihn anzustarren. Er erinnerte mich an einen Rebell, einen Bad Boy, wie er im Buche stand. Mein Verstand signalisierte sofort Gefahr.
»Parker! Endlich! Was hat dich diesmal zu spät kommen lassen? Nein, lass mich raten.« Theatralisch hob der Director seine Hände. »Haben deine nächtlichen Gespielinnen dich nicht gehen lassen oder warst du noch zu besoffen?« Er schüttelte den Kopf. »Du glaubst auch, du kannst dir alles erlauben!«, blaffte er ihn jetzt verärgert an.
»Director, bitte!«, ermahnte ihn Logan und deutete auf Holly, die mit offenem Mund und genauso sprachlos wie ich den Typen anstarrte.
Parker ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, schob lässig seine Sonnenbrille ins Haar und nickte Smith kurz zu, bevor er mich von oben bis unten betrachtete. Er hatte schöne, warme Augen, wenn man von dem Veilchen absah, das auf der linken Seite in allen Farben schillerte. Sie wirkten so lebendig und gleichzeitig voller Geheimnisse. Er besaß markante Gesichtszüge und unglaubliche Lippen. Dieser Parker wusste genau, wie er wirkte, und schien es zu genießen. Ein arroganter Zug legte sich um seine Mundwinkel. Mir wurde heiß und kalt, als er mich von meinem Gesicht abwärts zu meinen Brüsten bis hin zu meinen Beinen musterte.
»Ob Sie es glauben oder nicht, Boss, mein Motorrad hatte eine Panne«, sagte er, ohne seinen Blick von mir zu nehmen. Ein Schauer fuhr mir den Rücken hinunter, was ich ärgerlich registrierte. Seit wann reagierte ich so auf einen Kerl? Als seine Augen meine trafen, veränderte sich etwas in ihnen. Ich konnte es nicht erklären, aber die Wärme und das Strahlen, das ich eben noch gesehen hatte, wichen einem dunklen und verwirrten Ausdruck.
»Verkaufe mich nicht für dumm, Parker.« Offensichtlich glaubte der Director ihm kein Wort. Er winkte ab. »Egal. Hauptsache, du bist endlich hier. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Also, darf ich vorstellen: Das ist Special Agent Chris Parker. Er und Special Agent Logan Smith werden euch begleiten. Sie sind ab jetzt für eure Sicherheit verantwortlich.«
»Was hat die Kleine angestellt?«, brummte Parker, während er weiter auf meine Brüste starrte. Director Bennet sah verdutzt von mir zu ihm. »Jetzt sag bloß, du hast die Akte nicht gelesen?« Die Gesichtsfarbe des Directors änderte sich in wütendes Rot.
»Doch, hat er«, beeilte sich Logan einzuwerfen. »Er hat es nur vergessen, stimmt‘s?« Seine Ausrede war mehr als lahm, das wussten wir alle.
Bennet rang um Fassung, strich sich über die Stirn und seufzte. »Eines sage ich dir, Parker, ich habe dich im Auge. Ein weiterer Fehler und du bist suspendiert. Deinen Einsatz vor dem Senat zu rechtfertigen, war sowieso nicht so einfach. Gerade in diesem Fall hast du die Chance, einiges wiedergutzumachen, was dein Vater vermasselt hat. Also reiß dich gefälligst zusammen. Klären Sie ihn unterwegs auf, Smith.« Damit wandte er sich von den Männern ab und redete mit Cathrin und mir.
Logan nahm seinen Partner beiseite. »Warst wohl länger nicht beim Friseur, was?« Parker fuhr sich durchs Haar und die beiden unterhielten sich leise, während wir uns von Director Bennet verabschiedeten.
Meine Güte, und so jemandem sollte ich mein Leben und das meiner Schwester anvertrauen? Halleluja!
Kapitel 3
Während Holly beim Start der Maschine ihre hellste Freude hatte, starb ich tausend Tode. Es war mein erster Flug und schon jetzt spürte ich, wie das Schinken-Käse-Sandwich meine Speiseröhre hinaufklettern wollte. Gefühlte hundert Mal hatte ich Hollys und meinen Sicherheitsgurt überprüft, und verdammte im Stillen meinen Vater, der uns das alles eingebrockt hatte. Als der Flieger dann mit Vollgas abhob und wir in unsere Sitze gedrückt wurden, hatte ich das Gefühl, gleich in Panik verfallen zu müssen. Wir waren die einzigen Fluggäste, was mich anfangs verunsicherte. Ich hielt die Luft an und meine Finger verkrampften sich um die Armlehnen. Holly neben mir kicherte und blubberte, während ich betete, dass wir heil zur Erde kommen mögen.
»Das kitzelt im Bauch! Bei dir auch?«, fragte sie kichernd.
»Nein«, presste ich leise hervor. Kitzeln war definitiv etwas anderes.
»Wow! Sieh nur, die Wolken! Das musst du dir ansehen.«
Ich wünschte, ich wäre so cool wie sie und könnte den Flug genießen. Holly tippte mich an, aber ich wagte es noch nicht mal zu blinzeln.
»Jetzt schau doch mal, die Wolken sehen wie Zuckerwatte aus, und diese vielen Lichter … Das ist wunderschön.«
Ich konzentrierte mich darauf, meinen Mageninhalt bei mir zu behalten. Mir war absolut schleierhaft, wie sie all das so locker nehmen konnte. Ein Signal ertönte und ließ mich panisch aufschrecken.
»Ganz ruhig, Joy. Der Ton bedeutet nur, dass ihr die Sicherheitsgurte öffnen könnt.« Logan stand an unserer Sitzreihe und deutete auf das kleine Lämpchen oberhalb des Cockpitbereichs. »Chris meinte, ich sollte mal nach dir sehen, du würdest so verkrampft wirken.«
Auch das noch! Seit wir im Flugzeug saßen, hatte ich ihn erfolgreich aus meinem Gedächtnis verbannt, und war froh, dass sich sein Sitzplatz nicht in meinem Blickfeld befand.
»Soll ich dir etwas zu trinken ordern?«
»Ich will auch was«, quatschte Holly dazwischen.
»Dann werd ich mal sehen, was ich für euch tun kann.« Er lief den Gang hinunter.
»Kannst du noch Desinfektionstücher besorgen?«, rief ich ihm nach. Mist, verdammter, wieso hatte ich sie nicht in meine Tasche gesteckt? Ich sah Logan nach, wie er hinter dem Vorhang verschwand.
»Und was trägst du darunter? ... Oh Baby, das macht mich echt scharf.«
Ich traute meinen Ohren nicht. Telefonierte Chris etwa? Neugierig beugte ich mich vor und wandte mich ihm zu. Er saß zwei Reihen hinter mir und hatte sein Handy ans Ohr geklemmt. Ein schiefes Grinsen spielte um seine Mundwinkel, welches erstarb, als er meinen Blick erwiderte. »Ich muss Schluss machen, Babe. Ich rufe dich wieder an.«
In mir brodelte es. Jedes Kind wusste, dass es absolut verboten war, im Flugzeug das Handy einzuschalten. Das durfte doch nicht wahr sein! »Hast du sie noch alle? Willst du uns umbringen?«, fuhr ich ihn an.
Das dämliche Grinsen verschwand, dafür legte er eine Unschuldsmiene auf, die mich noch wütender werden ließ. »Sorry, war ein wichtiges Gespräch«, meinte er achselzuckend und steckte das Telefon in seine Jeans zurück.
Wollte der Kerl mich etwa verarschen? »Wenn wir abstürzen, bist du schuld.«
Er lachte verächtlich. »Wir stürzen schon nicht gleich ab.«
»Hast du noch nie gehört, dass Handys die Instrumente eines Fliegers beeinflussen können?«
Jetzt prustete er noch lauter, was mich fast rasend machte. Wie konnte der Kerl darüber lachen? Meine Zweifel, ob er uns beschützen könnte, verhärteten sich sekündlich. Ich lehnte mich wieder zurück und starrte nach vorn. Meine Hände waren noch immer schweißnass.
»Alles okay? Ist dir etwa schlecht?« Logan war mit zwei Wasserflaschen und den Desinfektionstüchern zurückgekommen und musterte mich besorgt.
»Mir geht‘s gut, alles okay«, log ich und zwang mich zu einem Lächeln.
»Das sieht aber nicht danach aus. Hier!« Er drückte mir eine Flasche und eine Papiertüte in die Hand. »Nur für den Notfall.«
»Danke, aber die werde ich nicht brauchen.« Ich klemmte die Tüte an den Vordersitz und öffnete Hollys Flasche. Ich war froh, dass sie mir eine kleine Auszeit verschaffte, indem sie minutenlang fasziniert aus dem winzigen Fenster auf die Erde schaute. Ich nahm ein paar Desinfektionstücher heraus und begann die Armlehnen unserer Sitze und Hollys Hände abzuwischen. Sicher war sicher!
Mein Blick blieb stur an der blinkenden Lampe hängen. Stück für Stück ebbte das flaue Gefühl in mir ab und es ging mir langsam besser. Nur nicht bewegen und schon gar nicht aus dem Fenster schauen, ermahnte ich mich in Gedanken.
»Ich muss mal«, drängelte Holly neben mir.
Nein! Bitte nicht jetzt!
»Ich muss dringend.«
»Kannst du es nicht noch ein wenig aushalten?«
»Nein, ich muss jetzt. Sonst ...«
»Schon gut, schon gut!« Ich schluckte, wischte meine schweißnassen Hände an meiner Jeans ab und öffnete den Gurt. Als ich aufstand, fühlten sich meine Beine wie Wackelpudding an, aber ich schaffte es stehenzubleiben. Ich sah mich um und entdeckte das WC-Schildchen im hinteren Teil der Maschine. Mit Holly an der Hand lief ich den Flur hinunter, ohne Agent Parker eines Blickes zu würdigen. Mir war immer noch schwindlig und heiße Übelkeitswellen schwappten in meinem Magen umher.
»Beeil dich, okay?«, sagte ich zu Holly, als sie die WC-Tür öffnete.
Während ich auf sie wartete, wünschte ich, ich hätte die Papiertüte doch mitgenommen. Erleichtert hörte ich die Spülung und meine Schwester kam wieder heraus. »Das ist ja ein komisches Klo. Da drin ist alles so klein.«
»Gibt es ein Problem?« Überrascht sah ich auf. Ich hatte Parker nicht kommen gehört. Er hatte seine Lederjacke ausgezogen und jetzt sah man deutlich, wie sich das T-Shirt eng um seine Muskeln schmiegte. Meine Augen hingen an seinen Oberarmen, wo mehrere Tattoos unter dem Stoff verschwanden. Seit wann war ich unter die Gaffer gegangen?
Ich zwang mich, den Blick von ihm abzuwenden, und konzentrierte mich auf Holly. »Schon okay, Keks. Das ist normal im Flugzeug«, wiegelte ich ab. Ich musste so schnell wie möglich an unseren Platz zurück.
»Deine Schnürsenkel sind offen«, sagte sie stattdessen zu Parker. Sie bückte sich und machte sich daran, sie zuzubinden. »Hat dir niemand beigebracht, wie man bindet? Wenn man mit offenen Schnürsenkeln läuft, stolpert man und fällt hin.« Sie blickte kurz zu ihm auf.
Parker schien amüsiert. Er sah auf sie herab und wartete, bis sie mit ihren kleinen Kinderhänden die langen Schnüre miteinander verknotet hatte.
»Ich glaube, ich habe es in der Eile einfach vergessen.«
»Aber dann fällst du auf die Nase. Bist du noch nie hingefallen? Mein Daddy sagt, man muss die Schuhe festschnüren, damit man besser laufen kann.«
»Dein Daddy scheint ein schlauer Mann zu sein.«
Sie war fertig und musterte ihre Arbeit. Zwei übergroße Schleifen zierten jetzt die riesigen Boots. »Wenn du willst, kann ich dir später zeigen, wie man das macht«, verkündete sie, zufrieden mit ihrem Ergebnis.
Parkers Grinsen wurde breiter. »Oh, da sage ich nicht Nein.« Er verschränkte seine Arme und war sichtlich amüsiert über Mrs. Neunmalklug.
»Prima.« Vergnügt hüpfte Holly zurück zu unserem Platz, während ich immer noch völlig dämlich vor ihm stand und gegen eine neue Übelkeitswelle ankämpfte.
»Ist alles in Ordnung? Du bist bleich.«
Na toll, musste er mich darauf hinweisen, dass ich scheiße aussah? Noch bevor ich die Möglichkeit hatte, rot anzulaufen, wurde der Druck in meinem Magen viel zu schnell übermächtig. Er fuhr mit solch einer Heftigkeit meine Speiseröhre empor, dass ich unkontrolliert würgte. Ehe ich es verhindern konnte, landete ein Schwall meines heißen Magensaftes direkt auf Parkers T-Shirt.
Oh nein! Nicht doch! Geschockt riss ich die Augen auf und konnte nicht fassen, was ich angerichtet hatte. Ungläubig sah er auf sein Shirt und dann in mein Gesicht. »Hey! Verdammte Scheiße, kannst du nicht aufpassen?«, fuhr er mich an. Angewidert verzog er seinen Mund.
»Es tut mir ...« Weiter kam ich nicht. Eine zweite Welle presste sich einen Weg hinauf und gerade noch rechtzeitig wandte ich mich ab und übergab den Rest in die Toilette. Schlimmer konnte es nicht mehr werden. Als ich meinen gesamten Magen entleert hatte, beruhigte er sich wieder. Noch ein wenig wacklig auf den Beinen, hielt ich mich am Waschbecken fest und stöhnte erleichtert. Jemand drückte das Wasser an, damit ich mir den Mund ausspülen konnte, und reichte mir ein Tuch zum Abwischen.
Oh. Mein. Gott! Ich hatte tatsächlich einen Agenten angekotzt. Ich wagte es vor Scham kaum, ihn anzuschauen. Der tellergroße Fleck auf seinem Shirt war nicht zu übersehen.
»Es tut mir leid, wirklich«, stammelte ich.
Er musterte mich mit seinen braunen Augen. Sofort wich die Verärgerung und etwas Warmes flackerte auf – aber nur für einen Moment, dann war dieser belustigte Ausdruck wieder sichtbar. »Also, normalerweise reagieren die Weiber anders auf mich.«
Was für ein arroganter Schnösel.
Kurzerhand zog er sein T-Shirt aus und mir verschlug es die Sprache. Erneut fing mein Magen an zu spinnen, diesmal allerdings aus einem anderen Grund. Chris Parker war unglaublich durchtrainiert, seine Muskeln traten deutlich hervor. Ein riesiges Tattoo, das sich über Schultern, Oberarme bis hinunter zu seinem Rücken erstreckte, zierte seine Brust. Ich schluckte und widerstand dem Drang darüberzustreichen. Wow! Mal wieder musste ich ihn anstarren und konnte nichts dagegen tun.
»Du schuldest mir ein frisches T-Shirt.« Wie dämlich ich aus der Wäsche schaute, wurde mir erst klar, als er mich frech angrinste. Er warf das Shirt in den Müllbehälter und lief den kleinen Mittelgang zurück. Verwirrt durch das Spiel seiner Rückenmuskeln, war ich kaum in der Lage, meine Augen von ihm abzuwenden. Na super, das konnte ja noch lustig werden.
***
Kaum hatte ich wieder festen Boden unter den Füssen, verflüchtigte sich die Übelkeit, die mich fast den ganzen Flug begleitet hatte. Wenn wir wieder nach Hause durften, würde ich ganz sicher den Bus nehmen, auch wenn wir dann Tage unterwegs wären.
Am Flughafen in Springfield wartete schon ein Geländewagen auf uns. Parker setzte sich ans Steuer, während Logan ihn aus dem dichten Verkehr lotste. Das Radio war eingeschaltet und Musik dudelte leise vor sich hin.
»Wann sind wir denn endlich da?«, jammerte Holly. Sie war müde und auch ich wurde ungeduldig. Wir sehnten uns nach einem Bett und etwas Ruhe.
»Es dauert nicht mehr lange. Kannst du noch fünfundvierzig Minuten aushalten?«, wollte Logan wissen. Holly nickte und bettete ihren Kopf in meinen Schoß. Liebevoll legte ich meinen Arm um sie und spielte mit einer ihrer Haarsträhnen.
»Kannst du mir mein Schlaflied vorsingen?« Bittend sah Holly zu mir auf.
»Was? Jetzt?«
»Ja, bitte.« Das war etwas Intimes zwischen meiner Schwester und mir. Ihr jetzt vor den beiden Agenten ihr Schlaflied vorzusingen, war mir irgendwie unangenehm. »Nicht hier, Keks. Später, okay?«, flüsterte ich ihr zu.
»Du kannst singen?«, fragte Logan. Parkers Blick begegnete mir im Rückspiegel.
»Oh ja! Mia ... äh, Joy singt mir jeden Abend mein Schlaflied vor«, antwortete Holly und richtete sich begeistert auf. »Daddy hat es uns beigebracht.«
»Wie wäre es, wenn du uns etwas vorsingst?«, warf ich ein.
»Ihr zwei seid musikalisch?«, Logan drehte sich zu uns.
»Nicht wirklich«, erwiderte ich.
»Joy kann aber sehr gut zeichnen. Sie wird bestimmt mal eine berühmte Malerin.«
Ich lachte. Hollys Fantasie ging mal wieder mit ihr durch. So gut war ich nun wirklich nicht, aber beim Zeichnen konnte ich mich völlig verlieren. Wenn mein Kohlestift über die weiße Fläche fuhr, schaffte ich es fast immer, alles andere auszublenden, meinem Alltag zu entfliehen und mich auf das Bild einzulassen. Es entspannte mich. »Die meisten Maler sind erst berühmt geworden, als sie schon viele Jahre tot waren. Wenn mir das auch passiert, habe ich ja nichts davon.«
Holly dachte nach. »Das ist aber blöd. Ich finde deine Bilder jetzt schon super.«
»Danke, Keks. Willst du jetzt singen?«
»Na gut. Und was?«
»Such dir etwas aus.«