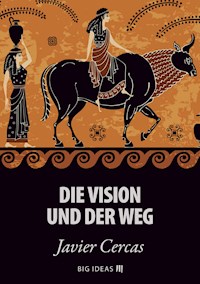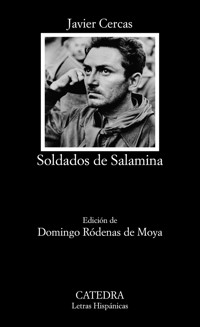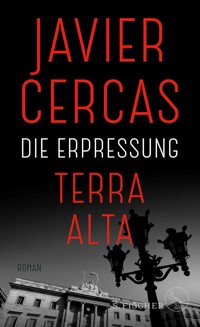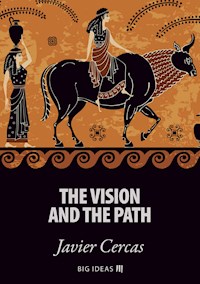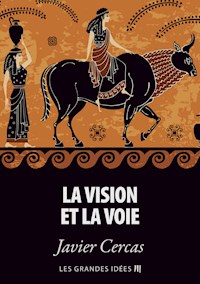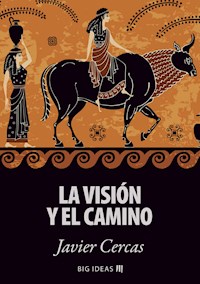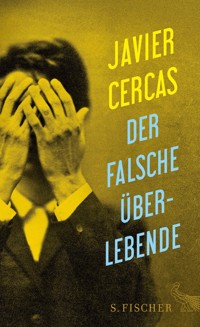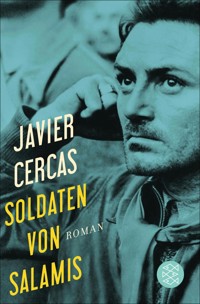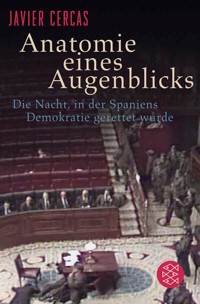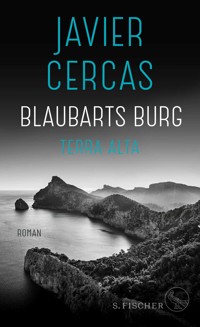
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Terra-Alta-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Abschluss der Terra-Alta-Trilogie: Melchor Maríns Tochter verschwindet spurlos auf Mallorca »Blaubarts Burg« ist der letzte Teil der Terra-Alta-Trilogie von Javier Cercas: Melchor hat seinen Job als Polizist endgültig an den Nagel gehängt. Er arbeitet in der Terra Alta als Bibliothekar, die Bücher und seine 17-jährige Tochter Cosette erfüllen sein Leben. Als Cosette von einer Reise nach Mallorca nicht zurückkehrt, wird Melchor nervös. Ist es bloß die Laune eines Teenagers? Oder ist sie auf den wilden Partys der Insel in die falschen Hände geraten? Doch dann bricht der Kontakt zu seiner Tochter vollständig ab, und Melchor muss handeln. Mit Hilfe seiner ehemaligen Polizeikollegen gelingt es ihm, die Spur aufzunehmen. Sie führt in die Villa eines Oligarchen, in der immer wieder junge Frauen verschwinden. Auf der verzweifelten Suche nach seiner Tochter sieht sich Melchor Marín mit der Korruption und Vetternwirtschaft der Urlaubsinsel konfrontiert. Doch er weiß sich zu helfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Javier Cercas
Blaubarts Burg
Roman
Über dieses Buch
»Blaubarts Burg« ist der letzte Teil der Terra-Alta-Trilogie von Javier Cercas: Melchor hat seinen Job als Polizist endgültig an den Nagel gehängt. Er arbeitet in der Terra Alta als Bibliothekar, die Bücher und seine 17-jährige Tochter Cosette erfüllen sein Leben.
Als Cosette von einer Reise nach Mallorca nicht zurückkehrt, wird Melchor nervös. Ist es bloß die Laune eines Teenagers? Oder ist sie auf den wilden Partys der Insel in die falschen Hände geraten?
Doch dann bricht der Kontakt zu seiner Tochter vollständig ab, und Melchor muss handeln. Mit Hilfe seiner ehemaligen Polizeikollegen gelingt es ihm, die Spur aufzunehmen. Sie führt in die Villa eines Oligarchen, in der immer wieder junge Frauen verschwinden.
Auf der verzweifelten Suche nach seiner Tochter sieht sich Melchor Marín mit der Korruption und Vetternwirtschaft der Urlaubsinsel konfrontiert. Doch er weiß sich zu helfen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Javier Cercas, geboren 1962 in Ibahernando in der spanischen Extremadura, lebt als Schriftsteller, Publizist und Universitätsdozent in Girona. Mit seinem Roman »Soldaten von Salamis« wurde er international bekannt. Heute ist sein Werk in mehr als 30 Sprachen übersetzt und wurde vielfach ausgezeichnet. 2021 erschien »Terra Alta« (Premio Planeta), der erste Band der gleichnamigen Trilogie. Ein Jahr später folgte der zwei Band: »Die Erpressung«.
Susanne Lange lebt als freie Übersetzerin bei Barcelona und in Berlin. Sie überträgt lateinamerikanische und spanische Literatur, sowohl klassische Autoren wie Cervantes als auch zeitgenössische wie Juan Gabriel Vásquez, Javier Marías oder Javier Cercas. Zuletzt wurde sie mit dem Johann-Heinrich-Voß-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung ausgezeichnet.
Impressum
Die Übersetzung dieses Buches wurde durch die Acción Cultural Española, AC/E, gefördert.
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »El castillo de Barbazul. Terra Alta III« bei Tusquets Editores S.A., Barcelona
© Javier Cercas, 2022
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Rudyard Kiplings Gedicht »Wenn« (»If«) wurde von Lother Sauer übersetzt.
Coverabbildung: plainpicture/Carsten Görling
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491756-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Erster Teil Terra Alta
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Zweiter Teil Pollença
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Dritter Teil Terra Alta
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Vierter Teil Pollença
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Epilog
Anmerkung des Autors
Für Raül Cercas y Mercè Mas, mein Terra Alta
Erster TeilTerra Alta
Cosettes erste Erinnerung an ihren Vater war eindringlich: Sie saß hinten im Auto in einem Kindersitz, er saß am Lenkrad und teilte ihr mit, dass ihre Mutter gestorben war. Sie verließen gerade Terra Alta, und ihr Vater sah sie nicht einmal im Rückspiegel an, blickte nur in sich hinein oder nach vorne auf dieses Asphaltband, das sie immer weiter weg führte, Richtung Barcelona. Dann versuchte ihr Vater zu erklären, was das eben Gesagte bedeutete, bis sie schließlich begriff, dass sie ihre Mutter nie mehr sehen würde und sie beide von nun an allein waren, auf sich gestellt. Mit dieser ersten Erinnerung verband sie zwei weitere, nicht weniger eindringliche, beide mit dem Schimmer des Unheimlichen überzogen. In der einen tauchte neben ihrem Vater der Winkeladvokat Vivales auf, der für ihn das gewesen war, was einem eigenen Vater am nächsten kam. Diese Erinnerung spielte sich unmittelbar nach der ersten ab, in einer trostlosen Cafeteria mit großer Fensterfront, die sie viele Jahre später als die Raststätte El Mèdol auf der Mittelmeerautobahn identifizieren würde. Ihr Vater und Vivales unterhielten sich, während sie im Spielbereich eine Rutsche hinaufkletterte und hinunterglitt (intuitiv wusste sie, dass die beiden Männer von ihr sprachen, von ihr und ihrer toten Mutter). Dann war ihr Vater zurück nach Terra Alta gefahren und sie mit Vivales nach Barcelona. Die dritte Erinnerung stammte aus Barcelona, und auch in ihr tauchte Vivales auf, jedoch nicht ihr Vater, das heißt, er kam erst am Ende hinzu, nachdem sie mehrere Tage beim Anwalt verbracht hatte, zusammen mit dessen engsten Freunden Manuel Puig und Chicho Campà, die nicht von ihrer Seite wichen, als schwebte eine dunkle Gefahr über ihr und als wäre es die Mission dieses skurrilen Trios alter Wehrdienstkumpane, sie zu beschützen. Bis eines frühen Morgens wie ein Ritter in glänzender Rüstung ihr Vater auftauchte, die Gefahr verscheuchte und sie zurück nach Terra Alta brachte.
Cosettes Erinnerungen an ihre Mutter dagegen waren verschwommen oder geliehen. Eher verschwommen als geliehen, denn so sehr sie als kleines Mädchen in ihren Vater gedrungen war, er hatte ihr kaum etwas über die Mutter erzählt, als gäbe es da nichts zu erzählen oder so viel, dass er nicht wusste, wo anfangen. Die Verschlossenheit des Vaters trug dazu bei, dass Cosette ihre Mutter idealisierte. Obwohl sie aus anderen Gründen auch ihren Vater idealisierte, was sich als schwieriger erwies, denn letztlich war er ein Wesen aus Fleisch und Blut, ihre Mutter dagegen ein Gespenst oder Trugbild, das sie sich nach Belieben verschönern konnte. Als kleines Mädchen hatte Cosette in ihrem Vater, vor allem als er noch Polizist gewesen war, eine Art Held gesehen, eben den Ritter in glänzender Rüstung, der zu Vivales gekommen war, um sie zu retten. Oft hatte sie ihn sagen hören, die schlimmsten Bösewichte seien die vermeintlich Guten, und sie war überzeugt, dass er die Gabe hatte, sie ausfindig zu machen und zu bekämpfen, und aus dem gleichen Stoff gemacht war wie die Protagonisten der Abenteuerromane, die er ihr, seit sie denken konnte, abends vorlas, aus dem gleichen Stoff wie die Sheriffs und Helden aus den alten Western, die Vivales so gern gesehen hatte.
Vor allem in ihrer Kindheit war die Beziehung zum Vater eng gewesen. Zwar ging er eher kühl mit ihr um – zumindest auf Außenstehende wirkte es so – und zeigte sich ihr gegenüber zerstreut, gedankenverloren, fast abwesend. Das machte Cosette nichts aus, denn sie kannte es nicht anders und dachte, dass die Helden im wirklichen Leben nun einmal so waren: kühl, zerstreut, schweigsam, gedankenversunken, fast abwesend. Außerdem konnte Cosette darauf zählen, dass ihr Vater jeden Tag wenigstens eine oder eineinhalb Stunden lang seine Versunkenheit aufgab und sich nur ihr widmete. Das war der Augenblick, in dem er ihr Romane vorlas, bevor der Schlaf sie mit sich riss. Dann kam in ihm Wärme auf, Intimität und Begeisterung, die tiefer waren als jedes äußere Zeichen der Zuneigung, und sie empfand eine Verbundenheit mit ihm, die sie mit niemandem mehr empfinden sollte, als hüteten sie beide allein ein wichtiges Geheimnis. Während Cosette zum Teenager heranwuchs, wuchs jedoch auch ihre Überzeugung, dass die finstere Verschlossenheit des Vaters keine Charaktereigenschaft war, sondern die vergiftete Frucht der abwesenden Mutter. Und zudem überfiel sie der Verdacht, dass der Vater bisweilen die tote Mutter in ihr suchte und nur eine plumpe, minderwertige Version fand. So verwandelte sich das Gespenst (oder Trugbild), gegen das sie unbewusst ankämpfte oder auf dessen Höhe sie zumindest sein wollte. Der Kampf war von vornherein verloren und ihr nicht einmal wirklich bewusst; er hätte sie sogar zerstören oder zu einem eingeschüchterten, unsicheren Wesen ohne Rückgrat machen können.
Das war nicht der Fall. Während Cosettes Kindheit führten sie ein geordnetes, ruhiges Leben. Ihr Vater brachte sie morgens zur Schule und holte sie, wenn er vormittags Dienst auf dem Revier hatte, nachmittags ab; wenn nicht, übernahm das die Mutter von Elisa Climent, ihrer besten Freundin, die mit den beiden zum Fußballtraining fuhr oder nach Hause zum Schulaufgabenmachen, bis Cosettes Vaters sie nach seinem Arbeitstag dort abholte. Nachdem ihr Vater die Stelle im Revier aufgegeben hatte, gingen die beiden Freundinnen gewöhnlich zur nahe gelegenen Bibliothek, in der er nun arbeitete, machten dort ihre Hausaufgaben, lasen oder bereiteten sich auf Prüfungen vor, und anschließend fuhr ihr Vater sie zum Fußball oder brachte sie nach Hause. Manche Wochenenden übernachtete Cosette bei Elisa, manche Elisa bei Cosette.
Cosette war keine schlechte, aber auch keine ausgezeichnete Schülerin. Sie las gern, hatte aber weder Interesse am Literatur- noch am Geschichtsunterricht, an keiner der Geisteswissenschaften, dagegen eine Begabung für Mathematik. Ihre Tutoren beschrieben sie als brave, unauffällige, aufrichtige, eigenwillige Schülerin ohne Ehrgeiz. Doch sie begeisterte sich für den Sport und trat der Fußballmannschaft der Schule bei, zeigte außerdem Talent für das Schachspiel und nahm an mehreren Turnieren teil – drei davon gewann sie: zwei lokale und eines im Landkreis –, sie zwang ihren Vater sogar, die Spielregeln zu lernen, damit er mit seiner Tochter Partien austragen konnte, die er anfangs demütigend schnell verlor. Ebenso beschrieben die Tutoren sie als ein phantasievolles Mädchen, das sich im Nu in ihre Vorstellungswelt flüchten konnte.
Keine dieser Beschreibungen erstaunte ihren Vater. Cosette lag nur teilweise richtig: Er mochte ein gedankenverlorener, zerstreuter Vater sein, verbrachte jedoch viele Stunden mit ihr und kannte sie gut. Die beiden lebten gern in Terra Alta, gönnten sich jedoch hin und wieder einen Ausflug nach Barcelona und verbrachten im Sommer ein paar Tage in El Llano de Molina, Murcia, bei Pepe und Carmen Lucas, Freunde, die ihr Vater von seiner Mutter geerbt hatte. Das alte Pärchen hielt ständig Kontakt mit ihnen, sie schrieben Mails, riefen an und ermunterten sie, auch zu anderen Jahreszeiten zu Besuch zu kommen, was sie mehrmals auch taten. Cosette liebte sie, und sie liebten Cosette, die im Laufe der Jahre Freunde im Dorf gefunden hatte, von denen manche ganzjährig in El Llano lebten. Cosette wusste, dass ihr Vater diese bukolischen Auszeiten ebenfalls genoss, obwohl er dort kaum etwas anderes tat, als zu lesen, lange Siesta zu halten, in der Umgebung des Gemüsegartens zu joggen und mit Pepe und Carmen zu plaudern, vor allem mit Carmen. Für die Gartenarbeit hatte sich ihr Vater nie erwärmen können, begleitete aber die ehemalige Prostituierte und letzte Freundin seiner Mutter nachmittags zu ihrem Gemüsegarten und saß dort stundenlang auf der Erde und las, an die Wand des Geräteschuppens gelehnt. Was Barcelona anging, so verbrachten Cosette und ihr Vater manche Wochenenden in der Wohnung, die ihnen der Winkeladvokat im Stadtzentrum vererbt hatte. Ihr Vater wollte sie so bewahren, wie Vivales sie hinterlassen hatte, nicht etwa aus dem sentimentalen Aberglauben, die gespenstische Gegenwart des Anwalts an dem Ort heraufzubeschwören, an dem er gelebt hatte, seit er ihn kannte, sondern weil er nicht wusste, was er sonst damit anstellen sollte. Bei diesen Ausflügen in die katalanische Hauptstadt gingen sie in den Zoo, ins Naturwissenschaftliche Museum oder ins Kino, oft aßen sie auch mit Puig und Campà zu Abend, fast immer bei Letzterem, der zu Ehren von Vivales wahre Bankette mit ihnen feierte, bei denen sie wie die Schlemmer schaufelten. Samstags gingen sie vor- oder nachmittags meist ins Internet Begum, den Callshop, den der »Franzose« im Raval-Viertel besaß, unterhielten sich mit ihm, lasen, spielten Schach oder halfen dem alten Freund ihres Vaters sogar, das Geschäft zu führen. Der belohnte sie für ihren Besuch mit einer Einladung in ein Restaurant auf der Rambla oder im Raval. Nachdem sie einmal zu dritt im Amaya zu Mittag gegessen hatten, fragte Cosette, fasziniert vom sprudelnden Wortfluss und der tiefen Menschlichkeit des ehemaligen Gefängnisbibliothekars von Quatre Camins, ihren Vater, wo sie sich kennengelernt hätten.
»Hier in der Gegend«, sagte er.
»In der Gegend ist kein Ort«, gab Cosette zurück.
Sie waren gerade in einem Laden im Eixample-Viertel und kauften etwas fürs Frühstück ein, ihr Vater drehte sich mit einem Paket Kellogg’s in der Hand zu ihr um, und sein Gesicht verriet deutlich, dass Cosette, mochte sie auch erst zehn sein, keine Lüge verdient hatte.
»Später erzähle ich es dir«, sagte er.
Damals wusste Cosette nicht, ob ihr Vater dieses Versprechen gegeben hatte, um sie abzuwimmeln oder um es zu erfüllen, doch als sie ihn zwei Stunden später daran erinnerte, begriff sie, dass er ihr nicht die Wahrheit erzählen würde. Nie hatte er seine Vergangenheit vor Terra Alta erwähnt. Er hatte ihr nicht gesagt, dass seine Mutter Prostituierte gewesen war wie Carmen Lucas, auch nicht, dass sie brutal ermordet worden war, er hatte ihr nicht von seiner wilden Kindheit im Viertel Sant Roc erzählt, nicht von seinem unbekannten Vater oder seiner wütenden Jugend als Waise, auch nicht von seinem Weg durch die Erziehungsanstalten und seiner Arbeit als Großdealer und Gorilla für ein kolumbianisches Kartell, auch nicht von seiner Festnahme bei einer Schießerei in Barcelonas Gewerbegebiet Zona Franca, nicht von dem Prozess vor dem Nationalen Gerichtshof in Madrid, nicht einmal von der Haft in Quatre Camins und der anhaltenden Freundschaft mit dem Franzosen. Nie hatte ihr Vater Cosette davon erzählt und tat es auch jetzt nicht. Er entledigte sich ihrer Neugier, indem er ihr flüchtig erklärte, er habe den Franzosen als Bibliothekar kennengelernt und dank seiner Die Elenden und dank der Elenden seine Berufung zum Polizisten entdeckt. Cosette ahnte, dass ihr Vater sie anlog, sie jedoch zugleich mit der Wahrheit betrog.
»Das glaube ich nicht«, sagte sie lachend. »Nie im Leben hat der Franzose in einer Bibliothek gearbeitet.«
Cosette sah sich in ihrer Ahnung bestätigt, als ihr Vater erleichtert antwortete: »Ehrenwort.«
Aus jenem Abend zog sie drei Schlüsse: Der erste, dass die besten Lügen nicht reine Lügen sind, sondern halb wahre, die nach Wahrheit schmecken. Der zweite, dass ihr Vater seine Vergangenheit bewusst verheimlichte, was seiner Aura eines Ritters in glänzender Rüstung jedoch keinen Abbruch tat, auch nicht der eines Helden aus Abenteuerromanen, eines Sheriffs oder Westernhelden, in die ihre Phantasie ihn gehüllt hatte. Der dritte war, dass sie Die Elenden lesen musste.
Noch in derselben Woche bat sie den Vater, ihr Die Elenden vorzulesen. Diese Bitte schien ihn zu überrumpeln, jedenfalls zögerte er, hielt dagegen, er habe den Roman zum letzten Mal kurz nach Vivales’ Tod gelesen und wisse nicht, ob es eine gute Idee sei, ihn jetzt vorzulesen; der Roman, der sein Leben verändert habe, gefalle ihr womöglich gar nicht oder noch nicht (vielleicht erst später, wenn sie in dem Alter sei, in dem er ihn zum ersten Mal gelesen habe); er führte den Umfang an und zitierte einen Satz des Franzosen: »Die Hälfte eines Buchs kommt von dem, der es schreibt, die andere Hälfte von dem, der es liest.« Cosette, die wusste, dass sie ihren Namen der Tochter des Protagonisten von Die Elenden verdankte, hielt all die Einwände für unzureichend oder widersinnig. Sie steigerten nur den Wunsch, dass ihr Vater den Roman vorlas.
Schließlich setzte sie sich durch. Dreieinhalb Monate brauchten sie für die Lektüre von Die Elenden. Cosette gab sich jede erdenkliche Mühe, den Roman zu mögen, aber ihre Enttäuschung war gewaltig. Von Anfang an wirkte er auf sie wie ein überladener Schinken, sentimental, demagogisch und letztlich langweilig, und Javert – der gerechtigkeitsliebende, unnachgiebige Polizist, der den Exhäftling Jean Valjean den ganzen Roman hindurch verfolgt, für ihren Vater jahrelang ein lebenswichtiges Vorbild – war für sie eine unsympathische Figur, spröde, engstirnig und ohne einen Hauch von moralischem Mut und tragischer Größe, die ihr Vater an ihm bewundert hatte. Cosette hätte den Eindruck, den Figur und Roman auf sie machten, nicht mit diesen Worten beschrieben, doch genauso empfand sie es. Schlimmer noch, denn obwohl ihr Vater den Roman mit noch mehr Wärme, Intimität und Begeisterung als sonst vorzulesen versuchte, stellte sich die übliche Verbundenheit nicht mehr ein, als fehlte dem Roman dieses wichtige Geheimnis, das sie beide bisher geteilt hatten, oder als würde es in dem Roman offenbart und hätte sich in seiner dramatischen Leere oder Falschheit gezeigt. Dennoch bat Cosette ihren Vater nicht, die allabendliche Lektüre zu beenden, und zwang sich während des Experiments zu der übermenschlichen Anstrengung, ihre Ernüchterung zu verbergen. Vielleicht hoffte sie, dass der Roman sich noch entwickelte, sich zu später, einzigartiger Fülle aufschwang; vielleicht dachte sie, verantwortlich für ihre Enttäuschung sei nicht das Buch, sondern ihre Unfähigkeit, ihm die andere notwendige Hälfte hinzuzufügen, durch die es seinen ganzen Sinn entfaltete und die ihr Vater sehr wohl hatte hinzufügen können. Wie auch immer, nachdem er die letzte Seite gelesen hatte, konnte Cosette auf die vorhersehbare Frage ihres Vaters nur mit einer lapidaren Gegenfrage antworten:
»Ein bisschen lang, oder?«
Es war das letzte Buch, das sie gemeinsam lasen.
1
Melchor wartet in der Cafeteria von Gandesas Busbahnhof auf Cosette, trinkt eine Cola und liest Iwan Turgenjews Roman Rauch. Außer ihm sitzt dort nur ein altes Paar händchenhaltend an einem Tisch, auf dem Stuhl eine Reisetasche, und an der Theke unterhält sich ein Mann mit der Wirtin. Melchor kennt das alte Pärchen nicht, dafür jedoch die Frau hinter der Theke. Die Wirtin ist um die dreißig, aus Arnes, hat eine Tochter und lebt getrennt; der junge Mann, tätowiert und igelhaarig, ist der Cousin der Wirtin, er lebt in Gandesa, ist arbeitslos und kommt jeden Nachmittag zum Kaffeetrinken, unterhält sich eine Weile mit ihr und packt, falls nötig, mit an. Es ist halb acht Uhr abends. Das Bernsteinlicht der Wandleuchten verleiht der Cafeteria die diffuse Atmosphäre eines Aquariums. Jenseits der Fensterfront hat sich die Nacht auf die Avinguda de Catalunya gesenkt, auf das Hotel Piqué, auf die schroffen Konturen der Serra de Cavalls weiter hinten, auf ganz Terra Alta.
Cosette war fünf Tage lang mit Elisa Climent im Urlaub, und Melchor kann es kaum erwarten, sie wiederzusehen, ist auch etwas unruhig. Er will seine Tochter überraschen, hat ihr also nicht gesagt, dass er sie vom Busbahnhof abholt. Mit ihren siebzehn Jahren ist Cosette nicht zum ersten Mal für ein paar Tage verreist, auch nicht zum ersten Mal ohne die Begleitung Erwachsener. Doch dieses Mal ist es anders. Cosette und Elisa hatten monatelang auf die Reise gespart, die dem Plan nach für die beiden Freundinnen ein Symbol oder eine Grenzüberschreitung war oder werden sollte: In diesem Jahr machen sie an Terra Altas Gymnasium Abitur, und im nächsten Jahr wollen beide, ebenfalls dem Plan nach, die Gegend verlassen und auf die Universität gehen, wobei sich ihre Wege vermutlich trennen. Seit einigen Wochen werden Cosettes Pläne jedoch von Unschlüssigkeit untergraben. Sie ist sich nicht mehr sicher, ob sie nächstes Jahr nach Barcelona gehen und Mathematik studieren will, wie sie es seit Jahren vorhat, sie weiß nicht einmal, ob sie sich für die Aufnahmeprüfung der Universität anmelden soll. Diese plötzliche Unsicherheit hat einen bestimmten Grund: Ein paar Wochen vor der Reise hat Cosette zufällig erfahren, dass ihr Vater sie seit vierzehn Jahren über den Tod ihrer Mutter belügt. Sie ist nicht bei einem Unfall gestorben, wie er ihr damals erzählt hatte, sie wurde umgebracht. Der tödliche Zusammenstoß war kein Zufall gewesen, wie sie immer geglaubt hatte, sondern Absicht. Zu verantworten hatte ihn Rosas Ex-Mann, der Hauptverdächtige im Mordfall ihrer Eltern, der Melchor hatte einschüchtern und daran hindern wollen, weiter im Fall Adell zu ermitteln. Die zufällige Exhumierung dieses begrabenen Verbrechens hat Cosette empört, die nicht nur wütend ist, weil sie begriffen hat, dass der Tod ihrer Mutter auf den blinden Gerechtigkeitswahn ihres Vaters zurückgeht, sie ist auch wütend, weil ihr Vater ihr die Wahrheit verschwiegen hat. Seitdem nistet sich in Cosette das Gefühl ein, dass ihr ganzes Leben auf einer Fiktion beruht, die irrationale Überzeugung, dass sie ihren Vater nicht kennt und alles, was sie über ihn zu wissen glaubte, Lüge ist, alles, was er an Werten für sie verkörpert hatte, ein toxischer Irrtum und alles, was sie seitdem erlebt hat, letztlich eine Täuschung. Deshalb ist die Beziehung zwischen Vater und Tochter vergiftet, und ein paar Tage vor ihrem Aufbruch hat Cosette die Konfrontation mit Melchor gesucht und ihn beschuldigt, sie getäuscht zu haben. Melchor stritt es nicht ab, protestierte nicht, die Anklage war berechtigt. Mochte er sie auch nicht getäuscht haben, die Wahrheit hatte er ihr zumindest vorenthalten (eine raffinierte Form der Täuschung). Und nun hofft er, dass Cosette in den fünf Tagen Zeit zum Nachdenken hatte und womöglich die Gründe seines damaligen Handelns versteht. Er hat sich auch mit Argumenten gerüstet, mit denen er sie davon überzeugen will, dass er sich vielleicht geirrt haben mag, es jedoch in der besten Absicht getan hat, im Glauben, dass er das Richtige tue. Deshalb sitzt er jetzt in der Cafeteria des Busbahnhofs, voller Ungeduld, sie wiederzusehen, bereit, ihr alles zu erklären, sie um Entschuldigung zu bitten und zu erreichen, dass sie ihm vergibt.
Um acht kommt der Bus aus Tortosa, parkt am Bussteig, setzt einige Passagiere ab und nimmt das greise Pärchen aus der Cafeteria auf, in der jetzt eine Gruppe von Ausflüglern Einzug hält. In zwanzig Minuten wird der letzte Bus aus Barcelona erwartet, und Melchor hat Lust auf eine weitere Cola, bestellt jedoch keine, weil die Neuankömmlinge nun die Bar belagern, begierig nach Sandwichs und Erfrischungsgetränken, und sogar der tätowierte Cousin der Wirtin aushelfen muss.
Melchor wendet sich wieder Turgenjews Rauch zu. Noch immer liest er unermüdlich Romane, vor allem aus dem 19. Jahrhundert. Zu Beginn seiner Beziehung mit Rosa Adell hatte er das Repertoire erweitern wollen und versucht, sich für Krimis zu erwärmen, damals Rosas Lieblingslektüre. Er las recht viele davon, manche gefielen ihm, doch mit der Zeit wurde er sie leid, oder sein Geschmack entwickelte sich zurück, und er griff wieder zu den Romanen des 19. Jahrhunderts, an denen Rosa, eine Leserin mit schwankendem, eklektischem Geschmack, inzwischen auch Gefallen gefunden hat. Seine Beziehung mit Rosa nennt Melchor so, weil er keinen anderen Namen dafür hat. Er nennt sie nicht Ehe, weil sie nicht verheiratet sind, obwohl Rosa es gern wäre; mehrmals hat sie es Melchor vorgeschlagen, ist aber immer auf Ablehnung gestoßen. Melchors Argument bleibt stets das gleiche: Die reichste, mächtigste Frau in Terra Alta verdient etwas Besseres als einen Ex-Polizisten, nun Bibliothekar. Über kurz oder lang werde sie es bereuen, lautet sein Fazit. Rosa weiß nicht, ob Melchor das im Ernst oder im Scherz sagt (weiß nicht einmal, ob er es selbst weiß), hat jedoch versucht, sein Argument zu entkräften, immer vergebens. Früher hatte sie als wahren Grund für Melchors Ablehnung vermutet, dass er keine fünfzehn Jahre ältere Frau heiraten wolle, dazu noch die Kindheitsfreundin seiner ersten Frau. Wie auch immer, Rosa hat klaglos das Leben akzeptiert, das sie führen, und ist glücklich dabei, viel glücklicher, versichert sie jedem, der es hören will, als sie je gewesen ist.
Melchor und Rosa leben nicht unter einem Dach, doch sie sehen oder sprechen sich täglich, schlafen so häufig miteinander wie frisch Verheiratete, und Rosa hat ein herzliches Verhältnis zu Cosette, Melchor ebenso zu Rosas vier Töchtern, allerdings kein so enges, denn Rosas Töchter leben nicht mehr in Terra Alta. Melchor mag Rosa sehr, bewundert ihre Güte, ihre Freude, ihre Intelligenz und Disziplin, ihren unglaublichen Elan bei der Arbeit, doch vielleicht weil sich seine Gefühle von denen für Olga damals unterscheiden, weiß er nicht, ob er in sie verliebt ist, will es auch gar nicht herausfinden. Und so ganz begreift er nicht, warum sie in ihn verliebt ist, und glaubt insgeheim, dass Rosas Liebe auf einem Missverständnis beruht, das sich früher oder später aufklären und ihrer Beziehung ein Ende setzen wird. Im Übrigen wissen alle rundum, dass die Direktorin und Eigentümerin von Gráficas Adell, ja von halb Terra Alta, die Lebensgefährtin eines der Polizisten ist, die vor vierzehn Jahren mit der Aufklärung des Falls Adell, der Ermordung ihrer Eltern, betraut waren. Dieser leicht makabre Umstand wurde anfangs überall kommentiert, man gab dem Paar keine Zukunft, doch inzwischen akzeptiert man es als eine der Absonderlichkeiten, die diese sonst wenig absonderliche Gegend auszeichnen.
Melchor blickt von Turgenjews Roman auf, als der letzte Bus aus Barcelona in Gandesa einfährt und in die Avinguda de Catalunya Richtung Busbahnhof biegt. Also bezahlt er seine Cola und geht hinaus, um seine Tochter zu empfangen. Aus dem Fahrzeug steigt eine Gruppe von Passagieren, die sich vor dem Gepäckraum drängen, um an ihre Habseligkeiten zu gelangen, und sich flüchtig mit der Gruppe vermischen, die an der Tür darauf wartet, einzusteigen. Melchor sucht in der Menge auf dem Bussteig Cosette, findet sie jedoch nicht; dagegen sieht er sofort Elisa, die mit prallem Rucksack auf ihn zugeht, frühlingshaft gebräunt und mit zwei achteckigen Ensaimada-Schachteln, die an bunten Bändern baumeln. Das Mädchen bleibt vor Melchor stehen, der immer noch vergebens im Gewimmel nach seiner Tochter Ausschau hält und fragt: »Und Cosette?«
Verlegen antwortet Elisa, Cosette sei auf Mallorca geblieben. Dann blinzelt sie, als wüsste sie nichts weiter zu sagen oder wüsste nicht wie. Melchor mustert sie. Das Mädchen ist so alt wie seine Tochter, hat Sommersprossen, helle Augen und blondes, glattes, ein wenig wirres Haar. Sie trägt Sandalen mit Hanfsohlen, ein fast sommerliches Kleid und eine Jeansjacke. Melchor weiß, dass etwas passiert ist, und fragt:
»Ist etwas passiert?«
»Nein.« Elisa stellt den Rucksack ab, aber nicht die Ensaimada-Schachteln, und will sicherer wirken. »Cosette geht es gut. Sie hat gesagt, sie bleibt noch, weil sie nachdenken muss. Ich sollte Sie anrufen und Ihnen Bescheid geben.«
»Nachdenken?«
»Ja. Sie sagt, nur ein paar Tage und …«
Bevor sie den Satz beenden kann, hat Melchor schon sein Handy hervorgeholt und wählt die Nummer seiner Tochter, während er Elisa auffordert, weiterzureden:
»Und was?«
»Sie wird nicht drangehen«, warnt Elisa.
Sie hat recht: Cosettes Handy klingelt, aber niemand antwortet. Als sich die Mailbox meldet, wendet Melchor Elisa den Rücken zu und entfernt sich ein paar Schritte Richtung Avinguda de Catalunya. »Cosette«, sagt er. »Ich bin’s, Papa. Ich bin am Busbahnhof mit Elisa, sie ist eben angekommen. Ruf mich bitte an.« Er legt auf und geht zurück zu dem jungen Mädchen, die sich den Rucksack wieder aufgeladen hat.
»Machen Sie sich keine Sorgen«, sagt Elisa. »Cosette geht es gut. Sie will nur ein paar Tage länger Urlaub machen.«
»Und du? Warum bist du nicht auch geblieben?«
»Weil ich hier zu tun habe.«
Melchor nickt, nicht überzeugt. Zwar hat er sich noch nie richtig mit Elisa unterhalten, kennt sie jedoch, seit sie ein Baby war, glaubt sie einschätzen zu können und ist sich sicher, dass sie ihn nicht anlügen, aber Cosette decken will. Ein wenig benommen fragt er:
»Hat Cosette jemanden kennengelernt?«
Elisa schüttelt energisch den Kopf.
»Nein«, sagt sie. »Na ja, nicht so jemanden, wie Sie meinen.«
Eine WhatsApp klingelt auf Melchors Handy, während das Mädchen etwas sagt, was Melchor nicht versteht. Die WhatsApp ist nicht von Cosette, sondern von Rosa: »Ist sie schon da? Essen wir bei mir zu Abend?« Melchor blickt zu Elisa auf, doch bevor sie ihren Satz beenden oder er etwas sagen kann, kommt noch eine WhatsApp, diesmal von Cosette. »Papa, ruf mich bitte nicht an«, steht da. »Ich will nicht mit dir reden. Es geht mir gut. Mach dir keine Sorgen, lass mir etwas Luft zum Atmen.« Melchor sieht wieder Elisa an, und zwei Sekunden lang scheint er durch sie hindurchzublicken.
»Ist sie von ihr?«, fragt Cosettes Freundin.
Melchor zeigt ihr die WhatsApp seiner Tochter.
»Ich habe ja gesagt, sie geht nicht dran«, erklärt Elisa. »Sie will allein sein. Auch das hat sie mir gesagt.«
Nun weiß Melchor keine Antwort. Nach der ersten Überraschung hat er das Gefühl, dass er nicht allzu erstaunt ist und vielleicht schon mit der Ahnung auf Cosette gewartet hat, es könne nicht unbedingt das, aber etwas Ähnliches geschehen. »Hast du Geld?«, tippt Melchor ins Handy. »Ja«, antwortet Cosette sofort. »Ich komme zurück, wenn es ausgeht.« Melchor will schon eine weitere WhatsApp schreiben und seine Tochter bitten, auf sich aufzupassen, doch das kommt ihm zu platt, zu väterlich vor, und so überwindet er sich, beschließt, ihr zu vertrauen, und schickt ein verschwörerisches Emoji: eine gelbe Hand mit erhobenem Daumen.
»Gut«, sagt Elisa, als Melchor wieder wie abwesend vom Handy aufsieht und durch sie hindurchblickt. »Ich muss los. Meine Mutter erwartet mich.«
Melchor reagiert, nimmt ihr den Rucksack ab, bietet an, sie nach Hause zu bringen, während er eine WhatsApp an Rosa schreibt, er komme allein zum Abendessen.
Elisa lebt mit ihrer Mutter außerhalb des Ortes, an der Carretera de Bot, nicht weit entfernt von Melchors erster Wohnung in Terra Alta vor achtzehn Jahren, als er untertauchen sollte, nachdem er vier bewaffnete Islamisten auf der Strandpromenade von Cambrils erschossen hatte. Während der Fahrt löchert er Elisa mit Fragen. Die erzählt, die ersten beiden Urlaubstage hätten sie in Palma verbracht, in einem Hotel in der Nähe von S’Arenal, hätten sich vormittags am Strand gesonnt, seien nachmittags durch die Altstadt gegangen und nachts in Bars und Clubs. Sie erzählt auch, am dritten Tag seien sie nicht wie vorgesehen nach Magaluf gefahren, sondern hätten den Bus nach Pollença genommen, genauer gesagt, nach Port de Pollença, seien dort in einem billigen Hotel abgestiegen und hätten die Tage am Strand verbracht, gebadet und in einem Club in der Nähe getanzt, den Hafenort hätten sie nur an zwei Nachmittagen verlassen, um Pollença und Cala Sant Vicenç zu besichtigen. Melchor hört der Freundin seiner Tochter zu, hängt an ihren Lippen. Kurz vor seiner Auseinandersetzung mit Cosette, die schon seit Wochen ungewöhnlich spröde und distanziert gewesen war, hatte Melchor mit Elisa gesprochen und von ihr erfahren, in seiner Tochter gehe etwas vor, aber sie wisse nicht was, und jetzt kann er sich nicht zu der Frage durchringen, ob sie es herausgefunden und ob Cosette ihren Streit kurz vor der Reise erwähnt hat, vielleicht weil er sich sicher ist, dass sie beides bejahen müsste. Dagegen ringt er sich zu der Frage durch, ob seine Tochter ihr während dieser Tage besorgt vorgekommen sei. Elisa verneint, verbessert sich jedoch und sagt, ein wenig, aber nicht besorgter als seit einigen Wochen, seit ihr Zweifel über ihr Studienfach gekommen seien, ja darüber, ob sie sich überhaupt für die Aufnahmeprüfung der Universität einschreiben solle.
»Hat sie dir gesagt, sie will nicht studieren?«, fragt Melchor.
»Sie hat gesagt, sie weiß nicht, was sie tun soll«, entgegnet Elisa. »Vielleicht wollte sie deshalb noch ein paar Tage bleiben. Um sich darüber klar zu werden. Um nachdenken zu können.«
Das hört er schon zum zweiten Mal von Elisa, doch ihre Worte klingen ihm jetzt fast aufgesetzt, als hätte das Mädchen sie einstudiert, sie weniger gesagt als aufgesagt.
Sie erreichen Elisas Haus, und er will sie nicht länger bedrängen. Er steigt mit ihr aus, begleitet sie mit dem Gepäck bis zur Tür, küsst sie auf die Wangen und bestellt Grüße an ihre Mutter, kann sich aber am Ende die Frage nicht verkneifen, ob sie am Abend noch mit Cosette telefonieren werde.
»Ich weiß nicht.« Elisa zuckt mit den Schultern. »Ich glaube nicht. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Wenn sie sich meldet, schicke ich Ihnen eine Nachricht.«
Melchor dankt ihr und versucht ein Lächeln, das ihm nicht gelingen will.
2
Die fünf Kilometer zwischen Gandesa und Corbera d’Ebre legt Melchor fast wie ein Schlafwandler zurück. Noch vor dem Ortseingang biegt er von der Landstraße auf einen unbefestigten Weg, bremst kurz darauf vor dem Tor von Rosas Landhaus und öffnet es per Fernbedienung. Während das Tor aufgeht, überprüft er seine WhatsApps und zur Sicherheit auch seine Mails: Keine neue Nachricht, weder von Cosette noch von Elisa. Dann fährt er durchs Tor einen Kiesweg hinauf und parkt vor dem Haupteingang neben Rosas BMW.
Melchor geht ins Haus und in den ersten Stock hinauf, dort in die Küche, wo er auf Ana Elena stößt, Rosas bolivianische Haushaltshilfe, die ihn lächelnd begrüßt, vom Herd abrückt, sich die Hände mit einem Lappen abwischt und sagt, Rosa sei unter der Dusche.
»Sie sollen im Wohnzimmer auf sie warten«, fügt sie hinzu.
»Ich warte hier auf sie«, sagt Melchor. »Kann ich dir helfen?«
»Nein, Señor, auf keinen Fall«, entgegnet Ana Elena, fast entsetzt. Und schon ist sie beim Kühlschrank, holt eine Cola-Dose heraus, öffnet sie und tut Eis in ein Glas. Beides zeigt sie Melchor und fragt. »Wo soll ich es hinstellen?«
Melchor nimmt ihr Dose und Glas ab und setzt sich an den Küchentisch. Ana Elena ist eine kleine, rundliche Frau mit roten, fleischigen Wangen und unbestimmbarem Alter, die seit Jahren bei Rosa lebt und sich um den Haushalt kümmert. Als er immer öfter ins Landhaus kam, versuchte er ihr auszureden, ihn »Señor« zu nennen, musste am Ende jedoch aufgeben. Ana Elena hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, die in einem Dorf in der Nähe von Cochabamba bei den Großeltern leben. Melchor weiß, dass sie ihnen jeden Monat fast den gesamten Lohn schickt. Die beiden reden oft über die Kinder, und jetzt, das Cola-Glas in der einen, das Handy in der anderen Hand, erkundigt sich Melchor nach ihnen. Um nicht an Cosette zu denken, versucht er sich auf Ana Elenas Antwort zu konzentrieren, doch es gelingt ihm nicht oder nur zum Teil. Kurz darauf erscheint Rosa, küsst Melchor auf den Mund, breitet die Arme in einer fragenden Gebärde aus und sagt:
»Und Cosette?«
Rosas Haar ist feucht, sie ist jugendlich salopp gekleidet, ein Kontrast zu der Förmlichkeit, zu der ihre Arbeit sie zwingt: Flipflops, weite Jeans und ein weißes T-Shirt, das ihre großen Brüste mit den spitzen Brustwarzen durchscheinen lässt. Sie ist gerade fünfundfünfzig geworden (wie Olga, wenn sie noch lebte) und bereits dreifache Großmutter, hat jedoch immer noch eine frische Haut, ein junges Gesicht, leuchtende Augen, ein breites und helles Lächeln und kein Gramm Fett am Leib. Melchor zuckt mit den Schultern.
»Ich weiß nicht«, sagt er. »Sie ist auf Mallorca geblieben.«
»Mit Elisa?«
»Nein. Elisa ist zurückgekommen. Ich habe sie eben nach Hause gebracht. Sie hat gesagt, Cosette gehe es gut, sie sei noch geblieben, weil sie nachdenken müsse. Das hat auch sie mir gesagt.«
»Cosette?«
Melchor nickt. Rosa beugt sich zu ihm und fragt, die Hände auf die Knie gestützt:
»Habt ihr telefoniert?«
»Wir haben uns geschrieben«, entgegnet Melchor und schwenkt sein Handy. »Sie hat gesagt, ich solle mir keine Sorgen machen. Ihr Luft zum Atmen lassen.«
In Rosas Miene hat sich die Ungewissheit erst in Verblüffung, dann in Verständnis verwandelt.
»Wenn sie sagt, du sollst dir keine Sorgen machen, dann mach dir keine Sorgen.« Sie richtet sich wieder auf und fügt hinzu: »Gleich reden wir darüber.«
Ana Elena hat den Tisch in einem kleinen Zimmer mit Fensterfront gedeckt, das auf die Terrasse im ersten Stock hinausgeht, und während Melchor und Rosa die Gemüsecremesuppe löffeln und die Seezunge in Mandelsoße essen, sprechen sie über Cosette, doch keine Sekunde lässt er sein Handy aus den Augen. Zu Beginn ihrer Beziehung hatten sie kaum von ihren Kindern gesprochen, als wollten sie das Familienleben aus ihrer Beziehung heraushalten. Dieser stillschweigende Pakt war schnell brüchig geworden und längst zerbröckelt, lange bevor Cosettes plötzliche Bitterkeit vor ein paar Wochen das Verhältnis zum Vater verdorben hatte. Melchor hatte Rosa auf dem Laufenden darüber gehalten, sie sogar gebeten, bei seiner Tochter vorzufühlen, um herauszufinden, was mit ihr los war. Das hatte Rosa getan, doch ohne großen Erfolg. Cosette hatte ihr nichts erzählen wollen oder es vielleicht nicht über sich gebracht. Den Grund von Cosettes Wut und Unruhe erfuhren beide erst später, als sie es ihrem Vater so kurz vor der Mallorca-Reise offenbarte.
»Du hast dir nichts vorzuwerfen, Melchor«, versichert Rosa nach dem Abendessen. »Du hast getan, was du tun musstest: deine Tochter vor der Wahrheit beschützen.«
Ana Elena hat die Teller abgeräumt, die Gläser jedoch nicht, und Rosa streichelt den Stiel ihres halb vollen Glases Weißwein. Melchor fragt:
»Kann man jemanden vor der Wahrheit beschützen, und sei es die eigene Tochter?«
»Natürlich«, entgegnet Rosa. »Señor Grau hat immer einen Ausspruch zitiert, von Santiago Rusiñol, glaube ich: Wer die Wahrheit sucht, hat die Strafe verdient, sie zu finden.«
Melchor unterdrückt den selbstzerstörerischen Impuls, Rosa zu fragen, ob er sich also nicht darauf hätte versteifen sollen, die Mörder ihrer Eltern zu suchen, weil dann seine Frau nicht gestorben wäre.
»Ich will damit sagen, dass die Wahrheit manchmal schlecht fürs Leben ist«, fährt Rosa fort, die vielleicht Melchors Miene entnimmt, dass Rusiñols Spruch einer Erklärung bedarf. »Und wenn man sie seinen Kindern ersparen kann, muss man das tun. Bei meinen Töchtern habe ich es damals versucht, als das mit meinen Eltern passierte, konnte es aber nicht. Die Wahrheit, die ich ihnen ersparen wollte, war zu überwältigend. Allzu offensichtlich und allzu entsetzlich. Und da ich meine Töchter nicht beschützen konnte, haben sie gelitten. Du dagegen hast Cosette beschützen können. Dank dir hatte sie eine glückliche Kindheit, und jetzt, da sie fast erwachsen ist, kann sie der Wahrheit besser gewappnet ins Gesicht sehen. Das ist keine Meinung, das ist eine Tatsache. Und wenn du es schaffst, ihr das zu erklären, dann wird Cosette es verstehen. Da bin ich mir sicher. Das mag seine Zeit dauern, aber sie wird es verstehen.«
Rosa argumentiert mit einer Überzeugung, die Melchor verdächtig vorkommt. Er weiß nicht, ob sie das wirklich denkt oder ob sie glaubt, dass sie ihm damit helfen kann. Melchor bewundert Rosas Stärke. Bis zur Ermordung ihrer Eltern hatte sie ein unbeschwertes, fast irreales Leben geführt, eingelullt von der Sicherheit, die ihr die finanzielle Macht ihrer Familie gab und die eigene Entscheidung, im Schatten ihres Mannes zu bleiben, sich trotz eines hervorragenden Abschlusses in Betriebswirtschaft der Erziehung ihrer vier Töchter zu widmen, und auf eine Karriere zu verzichten. Die Ermordung ihrer Eltern, von ihrem Mann in Auftrag gegeben, hatte sie brutal in die Realität zurückgestoßen, und von da an hatte sie alle ihre Energie zwei Zielen gewidmet: ihren Töchtern über die familiäre Katastrophe hinwegzuhelfen und das Firmenimperium, das ihr Vater während eines halben Jahrhunderts aufgebaut hatte, zu erhalten und möglichst zu vergrößern. Soweit Melchor beurteilen kann, hat Rosa an beiden Fronten einen eindeutigen Sieg errungen. Gráficas Adell macht momentan fast den doppelten Umsatz wie vor vierzehn Jahren, als die Firma noch von Rosas Vater geleitet worden war, sie hat fast doppelt so viele Angestellte und drei Filialen mehr, alle in Lateinamerika (eine in Trujillo, Peru, und zwei in Kolumbien, in Medellín und Pereira). Dieser Triumph ist nicht nur Rosa zu verdanken, sondern auch, wie sie selbst bei jeder Gelegenheit unterstreicht, Señor Grau, seit eh und je Geschäftsführer von Gráficas Adell, seit eh und je Freund der Familie und Rosas Mentor, nachdem sie die Firma übernommen hatte. Vor drei Jahren war er mit fünfundneunzig, wie ein Vögelchen auf dem Chefsessel in seinem Büro von Gráficas Adell sitzend, an Altersschwäche gestorben. Was Rosas Töchter angeht, so haben alle das Trauma des Falls Adell überwunden, zumindest scheint es Melchor so. Wie auch immer, alle führen ein normales Leben, drei von ihnen sind verheiratet oder haben eine feste Beziehung, zwei sind Mütter, und obwohl keine in Terra Alta lebt, besuchen sie regelmäßig ihre Mutter. Alle haben sie den Kontakt zum Vater abgebrochen, der kürzlich nach dreizehn Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen wurde und seitdem anscheinend in Salou lebt, nicht weit weg von Terra Alta.
Rosa trinkt ihr Glas aus und wiederholt, immer noch in Bezug auf Cosette:
»Sie wird es verstehen.« Dann gießt sie sich Wein nach und sagt abschließend: »Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut ausgehen. Du wirst sehen.«
Um Melchor abzulenken, erzählt ihm Rosa dann von ihrer Reise nach Medellín, von der sie erst vor zwei Tagen zurückgekehrt ist, und von ihrem Freund, dem Schriftsteller Héctor Abad Faciolince, den sie vor ein paar Jahren kennengelernt hat; sie erzählt auch von einer Reise nach La Inés, dem Landgut der Familie Abad, dreieinhalb Stunden Autofahrt von Medellín entfernt, im Bezirk Támesis in den Bergen, wo sie das letzte Wochenende zusammen mit Héctor, seiner Frau und einigen Freunden verbracht hat.
»Wetten, du weißt nicht, mit wem Héctor befreundet ist«, sagt Rosa und antwortet gleich selbst: »Mit Javier Cercas.«
Melchor hat diesen Namen schon einmal gehört, weiß aber nicht, wo.
»Erinnerst du dich nicht?«, fährt Rosa fort. »Der die Romane geschrieben hat, die von dir handeln. Hast du sie immer noch nicht gelesen?«
»Nein.«
»Solltest du aber. Dieser Cercas erfindet zwar alles, doch unterhaltsam sind sie. Héctor hat nicht glauben wollen, dass ich dich kenne. Er dachte, du existierst gar nicht, sein Freund hätte dich auch erfunden. Diese Romanciers sind ein Haufen Schwindler. Glaubst du, im 19. Jahrhundert waren die auch schon so?«
Nach dem Abendessen gehen sie hinauf in Rosas Zimmer und schlafen miteinander. Sie tut es wie immer mit ihm: besessen von Verzweiflung und Euphorie und zugleich sanft wie ein Teenager, als wollte sie sich in seinem Körper verstecken. Anschließend lacht sie, schwitzend und glücklich.
»Was bin ich für eine geile Alte«, keucht sie.
»Geil schon«, räumt Melchor ein. »Aber alt nicht.«
Sie lacht.
»Du solltest besser lügen lernen«, rät sie ihm.
Melchor will ihr schon sagen, dass eben das auch Olgas Worte waren, hält sich aber noch rechtzeitig zurück. Rosa steht auf und entfernt sich Richtung Bad, nackt und schweißglänzend, und Melchor denkt, dass er keineswegs gelogen hat. Und er denkt es wieder, als sie zurückkehrt, unter die Laken schlüpft und sich an ihn schmiegt. Im Schlafzimmer herrscht ein Halbdunkel aus Mahagonitönen, die von einer Stehlampe neben einem Sessel weiter hinten kommen. Als wüsste Rosa genau, dass Melchors Gedanken weiterhin bei Cosette sind, bemerkt sie nach einigen Sekunden Schweigen:
»Señor Grau hat immer gesagt, eine Tragödie ist ein Kampf, bei dem beide Kämpfer im Recht sind.«
»Du zitierst Señor Grau heute Abend schon zum zweiten Mal.«
»Ja?«
»Ja.«
Wieder Schweigen.
»Mag sein«, sagt Rosa. »Jedenfalls ist die Beziehung zwischen Eltern und Kindern eine Tragödie.«
Melchor denkt, nachdem Rosa vier Töchter aufgezogen hat, weiß sie, wovon sie spricht; ebenso denkt er, dass sie Señor Grau weit mehr vermisst als ihren Vater, weshalb auch zweieinhalb Jahre vertraulicher Beratungen und fehlgeschlagener Versuche nötig waren, um bei Gráficas Adell einen Ersatz für ihn zu finden, wenn sie ihn denn gefunden und nicht bloß hingenommen hat, dass es für Señor Grau keinen Ersatz gibt. (Sein Nachfolger oder der Anwärter auf seinen Posten ist Daniel Silva, der ehemalige Vorstand der Finanzabteilung, der vor vierzehn Jahren unbewusst dazu beigetragen hatte, dass Melchor den Fall Adell lösen konnte.) Rosa fährt fort:
»Wir haben recht, wenn wir versuchen, unsere Kinder zu beschützen. Und unsere Kinder haben recht, wenn sie sich dagegen wehren, dass wir sie beschützen, wenn sie uns zur Seite, aus dem Weg schieben, sich von uns befreien wollen, damit sie sich allein durchschlagen können. Das ist der Kampf. Und eben das passiert mit dir und Cosette, Melchor: eine Tragödie. Aber eine unumgängliche. Hättest du Cosette nicht beschützen wollen, wärst du ein Mistkerl gewesen, und würde Cosette deinen Schutz nicht abschütteln wollen, würde sie nie selbstständig, nie erwachsen werden.« Rosa schmiegt sich noch enger an Melchor, der sie um die Schulter fasst und an sich drückt. »Ich habe dir schon gesagt, dass du gut daran getan hast, ihr die Wahrheit vorzuenthalten. Was hättest du Cosette erzählen sollen? Dass mein Ex-Mann ihre Mutter unabsichtlich getötet hat, damit du nicht weiter im Mordfall meiner Eltern ermittelst? Wie erklärt man das seinem Kind? Welcher Vater würde ihm das nicht ersparen wollen? Aber es ist auch logisch, dass sie wütend auf dich ist, letztlich hast du ihr etwas sehr Wichtiges vorenthalten. Beides ist wahr, und beide Wahrheiten widersprechen sich. Hättest du es besser machen können? Natürlich, alles kann man besser machen. Wäre es weniger schlimm gewesen, wenn sie es nicht auf diese Art erfahren hätte? Bestimmt. Dass sie das verstört hat? Selbstverständlich. Aber alles wird sich klären.« Rosa macht eine Pause. »All das ist normal, nichts Außergewöhnliches. Eigentlich gibt es nur ein Problem.«
»Das da wäre?«
»Dass du ihr nicht genug vertraust.«
»Mag sein. Cosette ist ein wenig naiv.«
»Warst du in ihrem Alter nicht naiv.«
»Ich war in ihrem Alter im Gefängnis. Oder kurz davor.«
»Was bedeutet, dass du noch naiver warst als Cosette. Und warum soll sie nicht naiv sein? Sie ist auch klug und stark. Und womöglich hilft ihr diese Sache, ihre Naivität abzulegen. Und den Vater umzubringen. Nicht, dass ich jetzt freudianisch werde, aber …«
»Ich habe meinen Vater nicht umgebracht.«
»Musstest du auch nicht, Melchor. Du hattest keinen. Na ja, sieht man von Vivales ab.«
»Vivales war nicht mein Vater.«
»Bist du dir sicher?«
»Nein.«
Rosa lacht. Obwohl sie Vivales kaum gekannt hat, taucht er immer wieder in ihren Gesprächen auf. Vielleicht vermisst Melchor den alten Winkeladvokaten ebenso wie Rosa Señor Grau. Ohne sich aus Melchors Umarmung zu lösen, richtet sie sich ein wenig auf, um ihm in die Augen zu blicken und etwas zu sagen, was sie seit langem schon sagen will.
»Cosette wird es guttun, sich ein wenig von dir zu lösen.« Da Melchor schweigt, fügt sie hinzu: »Sie hat schon immer zu sehr an ihrem Vater gehangen. Nicht, dass ich etwas an ihrem Geschmack auszusetzen hätte, aber …«
»Inzwischen nicht mehr«, unterbricht sie Melchor. »Jetzt hasst sie mich. Soll ich dir noch einmal die Szene von neulich erzählen?«
Rosa lässt sich wieder auf ihn sinken.
»Cosette hasst dich nicht«, murmelt sie. »Sie ist nur wütend und verstört. Das ist verständlich, wie gesagt. Sie wird es bewältigen. Und ein paar Tage allein auf Mallorca schaden ihr nicht. Im Gegenteil, höchstwahrscheinlich bekommen sie ihr hervorragend. Cosette muss auf eigenen Beinen stehen. Und wenn sie zurück ist, redet ihr beide mit offenem Visier, und dann ist Ruhe.«
Rosa beendet ihr Plädoyer mit einem Kuss auf Melchors Lippen, und während sie sein krauses Brusthaar streichelt, greift er zum Handy, stellt fest, dass immer noch keine WhatsApp, keine Mail von Cosette oder Elisa eingetroffen ist, und versucht sich einzureden, dass Rosa mit ihren Vorhersagen recht hat. Dann fährt sie ihm mit der Zunge über die Brustwarzen, gleitet hinab zu seinem Bauch, nimmt sein Glied in den Mund und ruft eine sofortige Erektion bei ihm hervor. Sie vögeln wieder. Als er anschließend pinkeln geht, sich die Hände wäscht und im Spiegel betrachtet, fragt er sich, was Cosette gerade macht, allein in Pollença. Als er ins Zimmer zurückkehrt, ist Rosa eingeschlafen.
3
»Verdammter Scheißdreck«, klagt Inspector Blai. »Die Frau scheucht mir den ganzen Hühnerstall auf. Das hat mir gerade noch gefehlt.«
Es ist halb neun Uhr morgens, und Melchor sitzt vor der Bar am Platz und trinkt Kaffee. Neben ihm wettert der Revierleiter von Terra Alta, ordentlich uniformiert, gegen die Verantwortliche der Ermittlungseinheit, die er vor vierzehn Jahren selbst geleitet hatte, als Melchor wie ein Ufo in der Gegend gelandet war und bei ihm zu arbeiten anfing. Die Leiterin der Ermittlungseinheit ist eine Sargento, die erst seit kurzem im Revier ist. Sie heißt Paca Poch.
»Außerdem macht sie, was ihr in den Kram passt«, fährt Blai fort. »Erinnerst du dich an Vàzquez in seiner besten Zeit? Ungefähr so.«
Obwohl es noch kalt ist, verspricht die leuchtende Sonne am wolkenlosen Himmel einen Frühlingsvormittag, und der Kellner hat Stühle und Tische nach draußen gestellt, wo Melchor und Blai sich unterhalten, während um sie herum der Arbeitstag beginnt. Der Inhaber ist ein Japaner mit Namen Hiroyuki, der sich vor ein paar Jahren nach Terra Alta verirrt hat. Er war nach Spanien gekommen, um Flamenco zu studieren, wie er erzählt, aber einer lokalen Legende nach, die er selbst mit schallendem Lachen und übertriebenen Gesten abstreitet, soll er sich vor einem besonders grausamen Yakuza-Clan verbergen, der ihn verfolgt und vierteilen will. Hiroyuki nennt Melchor und Blai in seinem Kauderwelschspanisch »die Terra Alta zwei Freunde« und begrüßt und verabschiedet sie tagtäglich mit geneigtem Kopf, zusammengefügten Handflächen und japanischer Verbeugung. Melchor und Blai trinken jeden Morgen Kaffee in Hiroyukis Bar, zumindest an jedem Wochentag, seit Blai vor zweieinhalb Jahren die Leitung des Zentralbereichs für Personenfahndung in der Zentrale von Egara aufgegeben und das Revier übernommen hat, während Melchor seine Stelle dort aufgab.
»Sie war zweimal in der Bibliothek.« Melchor meint die Sargento. »Wir haben uns unterhalten, ich sollte ihr Romane empfehlen. Ich muss sagen, ich mag sie.«
»Nur zweimal?«, fragt Blai, halb ironisch, halb argwöhnisch. »Wohl mindestens viermal.«
Melchor blickt seinen Freund verständnislos an. Der Inspector wird bald sechzig, wirkt aber zehn, fünfzehn Jahre jünger, obwohl er, seit Melchor ihn kennt, einen säuberlich rasierten Schädel zur Schau stellt. Er hat nie geraucht, trinkt kaum Alkohol, achtet peinlich genau auf seine Ernährung und hat seinen Körper jeden Morgen, bevor er mit Melchor Kaffee trinkt und aufs Revier geht, eine oder eineinhalb Stunden lang in einem neu eröffneten Fitnessstudio gepeinigt, in der Nähe seiner Wohnung in Horta de Sant Joan. Melchor weiß, dass Blai ihre morgendlichen Sitzungen dazu benutzt, sich Luft zu machen, aber es stört ihn nicht. Erstens (und vor allen anderen Dingen), weil er sein bester Freund ist und er ihm gern zuhört. Zweitens, weil er weiß, dass er sich bei niemandem sonst Luft machen kann, nicht einmal bei seiner Frau, die nicht versteht, was im Revier passiert, (und sich auch nicht dafür interessiert). Und drittens, weil ihm scheint, dass sein Freund mehr als genug Grund dazu hat, sich Luft machen zu wollen: In den letzten Jahren hat sich die Kriminalitätsrate in Terra Alta verzehnfacht, während die personellen und materiellen Ressourcen für den Kampf gegen das Verbrechen halbiert wurden. Diese beiden düsteren Fakten betreffen nicht nur ihre Gegend – an manchen Orten in Katalonien ist die Lage noch desolater –, aber Blai ruft es Melchor ständig in Erinnerung. »Das ist der reinste Dschungel!«, sagt er schließlich jedes Mal. »Und du schiebst hier die ruhige Kugel.« »Auch in der Bibliothek gibt es Probleme«, wendet Melchor ein. »Ach, fahr zur Hölle, Sauspanier.« Damit hakt Blai das Thema ab.
»Sieh mal, Melchor«, erklärt der Polizist, »Paca gehört zu diesen Auszubildenden, die auf der Polizeischule als Erstes nach dem Helden von Cambrils fragen. Nicht zu fassen! Wusstest du, dass sie Fünfte ihres Jahrgangs war? Und warum glaubst du, dass die Nummer fünf sich nach Terra Alta versetzen lässt?«
»Mir hat sie erzählt, sie hat einen Freund in Tortosa.«
»Bockmist!«, ereifert sich Blai. »Von wegen Freund, die ist seit fünf Wochen hier und hat schon die Hälfte des Reviers flachgelegt. Hab ich nicht gesagt, die scheucht mir den Hühnerstall auf? Und ich verstehe das, durchaus. Halt mich nicht für blöd. Hast du gesehen, was die Kleine hermacht? Aber verdammt, ein bisschen Ernst muss sein, oder? Sind wir etwa nicht Polizisten?«
Damit sein Freund nicht noch mehr in Fahrt kommt, erinnert ihn Melchor daran, dass er seit fünf Jahren nicht mehr Polizist ist. Die beiden führen eine dieser altmodischen Männerfreundschaften, die fast jede Vertraulichkeit ausschließen. Das erklärt, dass Blai zwar täglich mit Melchor Kaffee trinkt, aber von der Beziehung seines Freundes mit Rosa Adell erst durch seine Frau erfahren hat, als das Verhältnis bereits in ganz Terra Alta bekannt war. Und das erklärt auch, dass Melchor Blai letzte Woche zwar erzählt hat, dass Cosette über Ostern ein paar Tage auf Mallorca verbringt, an diesem Morgen aber nicht einmal erwähnt, dass sie die Reise überraschend verlängert hat und allein auf der Insel geblieben ist, obwohl ihm ihre Abwesenheit seit zwölf Stunden schwer im Magen liegt. Als Melchor vor zwei Monaten die ersten Anzeichen bemerkt hat, dass mit Cosette etwas nicht stimmt, wollte er zunächst nicht mit Blai darüber reden, dachte dann aber, die Erfahrung eines Vaters mit kinderreicher Familie könne ihm vielleicht von Nutzen sein. Die Reaktion seines Freundes, nachdem er ihm von seinen Sorgen erzählt hatte, belehrte ihn eines Besseren. »Mach dir keine Gedanken«, versicherte ihm Blai mit Expertenstolz. »Das hat mit den Hormonen zu tun. So geht’s allen Jugendlichen. Als meine Töchter in Cosettes Alter waren, bin ich durch die Hölle gegangen. Ich habe die Vorstellung nicht ausgehalten, dass so ein Klotzkopf, dem das Testosteron aus den Ohren kommt, mit meinen Töchtern vögelt. Ich kam nicht dagegen an. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich jeden kastriert, der sich ihnen auf drei Meter nähert. Die einzige Medizin ist Durchhalten, Melchor, schluck die Durchhaltepille.«
»Noch mehr Kaffee für zwei Freunde?« Hiroyuki beugt sich aus der Tür der Bar. »Kaffee gut für alles. So sagt tausendjährige östliche Weisheit.«
»Ach komm, Japs«, Blai lacht. »Von Weisheit hast du doch keinen blassen Schimmer. Ob östlich oder westlich.«
Sie bestellen einen zweiten Kaffee, und als Hiroyuki ihn bringt und wieder geht, fängt Blai erneut von Sargento Poch an:
»Den Braten habe ich gerochen, sobald sie sich nach der Bibliothek erkundigt hat«, fährt er fort. »Sieh an, hab ich mir gesagt. Noch so eine Leseratte. Ich wette, sie hat die Bücher von diesem Cercas gelesen und all den Blödsinn geschluckt, den er über dich verzapft. Bestimmt denkt sie, das mit der Bibliothek ist eine Tarnung oder so. Deine Legende verfolgt dich, Sauspanier.«
Blai ist ein sturer Gesprächspartner. Wenn er sich in ein Thema verbissen hat, lässt er nicht mehr locker, bringt es immer wieder an, ob es passt oder nicht, manchmal über Wochen oder Monate. Seit ein paar Tagen redet er unentwegt von Paca Poch, so wie vor Jahren Ernest Salom seine Obsession gewesen war. Inzwischen ist der frühere Caporal aus dem Gefängnis entlassen worden und wieder zurück in Terra Alta, nach fast sechs Jahren Abwesenheit, sieht man von dem einen oder anderen Freigang ab. Saloms Verurteilung im Fall Adell hatte zu seiner Entfernung aus dem Korps der Mossos d’Esquadra geführt. Seine vorzeitige Freilassung war dadurch erleichtert worden, dass eine Anstellung auf ihn wartete.
»Er lebt in Prat de Comte«, hatte Blai an dem Morgen berichtet, an dem er Melchor auch erzählt hatte, dass Salom wieder zurück war. »Anscheinend kümmert er sich um die Landhäuser seiner Töchter.«
Das war die Anstellung. Nach der Inhaftierung von Melchors Freund und unmittelbarem Vorgesetzten in Terra Altas Ermittlungseinheit hatten seine beiden Töchter auf ihre akademische Laufbahn verzichtet und waren in die Gegend zurückgekehrt. Claudia, die Ältere, unterrichtete Physik am Gymnasium; Mireia, die Jüngere, war verheiratet, hatte eine Tochter und war Geschäftsführerin einer Winzerkooperative in Arnes. Keine der beiden hatte ein gutes Auskommen, doch dank jahrelanger Opfer hatten sie es geschafft, ein verfallenes Haus als Feriendomizil für den Landtourismus instand zu setzen, und hatten nach einiger Zeit ein zweites gemietet und hergerichtet. Zunächst kümmerte sich Claudia darum, was sie nur anfangs mit dem Unterricht am Gymnasium vereinbaren konnte. Als ihr Vater dann aus dem Gefängnis kam, fand sie eine gute Stelle als Wartungstechnikerin in Ascós Kernkraftwerk, und Salom übernahm nach kurzer Einarbeitung beide Häuser.
»Die Arbeit gefällt ihm«, sagte Blai, der Salom auch einige Male in Lledoners besucht hatte, wo der ehemalige Corporal seine Strafe absaß. »Das sagt er selbst. Wer hätte das gedacht? Salom im Gastgewerbe … Na ja, zumindest wird es ihm nicht an Kunden fehlen.«
Das stimmte. Der Tourismus war seit Jahrzehnten eine Quelle wachsenden Reichtums in Terra Alta. Paare, ob mit Kindern oder ohne, Freunde oder Verwandte verbrachten Wochenenden oder längere Zeit in der Gegend, während der Sommerferien, über Ostern oder Weihnachten, manchmal nahmen sie auch die Stadtfeste zum Anlass, machten Ausflüge auf der Grünen Route – ein Weg über die Berge, entlang einer ehemaligen Eisenbahnstrecke –, tummelten sich in der Berglandschaft, mieteten Fahrräder, ritten oder machten Motorradtouren, trieben Abenteuersport oder sahen sich die Schützengräben an, die Museen und Informationszentren zur Ebro-Schlacht. Die beiden Häuser, um die Salom sich kümmerte, wurden über das Internet gebucht, über das Portal Booking.com, und der Ex-Polizist und Ex-Häftling hielt die Häuser sauber und bezugsfertig, gab den Gästen bei der Ankunft die Schlüssel und nahm sie bei ihrer Abreise wieder entgegen. Er zeigte sie den Interessierten, backte inzwischen sogar Willkommenskuchen und bot zusätzliche Dienstleistungen an, etwa einen Frühstücksservice jeden Morgen, mit Kaffee, frischem Obst, Buttertoast und Marmelade, Wurst, Tortilla, Tomatenbrot und Orangensaft.
»Er wirkt tatsächlich zufrieden«, fasste Blai zusammen, nachdem er seinem Freund all das berichtet hatte. »Kein Wunder, nach all den Jahren im Gefängnis.«
Melchor hatte die Nachricht vom Treffen seiner beiden ehemaligen Kollegen mit Misstrauen aufgenommen und hörte Blais Bericht nun aufmerksam zu. Als er ihn beendet zu haben schien, fragte Melchor, wie oft er Salom gesehen habe.
»Zwei-, dreimal«, antwortete er. »Ungefähr vor einem Monat hat er mich auf dem Revier angerufen, und wir haben uns auf einen Kaffee verabredet. Es hat mich gefreut, ihn auf freiem Fuß zu sehen. Letztlich waren wir ganz schön viele Jahre lang Kollegen.«
»Das hast du mir nicht erzählt.«
»Dass wir ganz schön viele Jahre lang Kollegen waren?«
»Dass du ihn gesehen hast.«
»Ich erzähle es dir jetzt.«
Melchor nickte, ließ aber keine Frage oder Bemerkung folgen, und das Gespräch war zu Ende. Tage später erzählte ihm Blai, er habe den früheren Caporal wieder gesehen.
»Weißt du, was er gesagt hat?«
»Was?«, fragte Melchor.
»Ich habe viel nachgedacht über das, was geschehen ist«, hatte Salom gesagt.
»Was meinst du?«, hatte Blai gefragt.
»Du weißt, was ich meine«, sagte Salom, bezog sich vage auf den Fall Adell, ohne ihn direkt zu nennen, und fügte schließlich hinzu: »Ihr habt getan, was ihr tun musstet. Den Fehler habe ich begangen.«
»Das hat er gesagt?«, fragte Melchor.
Blai bejahte. Dann fügte er hinzu:
»Er hat auch nach dir gefragt.«
»Es heißt, er arbeitet nicht mehr auf dem Revier«, hatte Salom gesagt.
»Nein«, hatte Blai gesagt. »Er ist jetzt in der Bibliothek. Wo Olga gearbeitet hat.«
»Das habe ich gehört«, sagte Salom. »Vielleicht besuche ich ihn einmal da.«
»Tu das«, sagte Blai. »Er wird sich freuen, dich zu sehen.«
»Bist du sicher?«, fragte Salom.
»Natürlich«, entgegnete Blai. »Anfangs war er wütend auf dich, deshalb wollte er nichts mehr von dir wissen. Verständlich, oder? Nach der Sache mit seiner Frau.«
»Damit hatte ich nichts zu tun«, sagte Salom. »Das war Albert.«
»Weiß ich doch«, sagte Blai. »Und Melchor weiß das auch. Trotzdem …«
»Sag ihm, er soll nicht in die Bibliothek kommen«, sagte Melchor. »Sag ihm, ich will ihn nicht sehen.«
»Du machst einen Fehler«, sagte Blai.
»Mag sein. Aber ist mir egal.«
»Ein Kumpel ist und bleibt ein Kumpel«, entgegnete Blai. »Auch wenn er einen Fehler gemacht hat. Auch wenn du ihn ins Gefängnis gebracht hast.«
»Wie du meinst«, sagte Melchor. »Doch ich will ihn nicht sehen.«
»Er bereut es bitter«, beharrte Blai. »Das habe ich dir schon gesagt. Er wird dir keinerlei Vorwurf machen. Eigentlich will er dich nur um Entschuldigung bitten.«
»An Melchors Stelle«, hatte Salom gesagt, »hätte ich das Gleiche getan.«
»Sich mit dir versöhnen«, sagte Blai. »Eben das will Salom. Mehr nicht.«
»Sag ihm, das ist nicht nötig«, entgegnete Melchor. »Sag ihm, ich sei nicht im Streit mit ihm, also müssen wir uns nicht versöhnen.«
»Ich verstehe, dass er wütend auf mich ist«, hatte Salom gesagt. »Er hat allen Grund dazu.«
»Das stimmt«, antwortete Blai. »Mehr Grund als ich.«
»Mehr als du«, stimmte Salom zu. »Wir waren wie Pech und Schwefel. Und ich habe ihn hintergangen. Habe versucht, einen Mord zu vertuschen, und ihn dann auch noch hintergangen.«
»Das hat er dir gesagt?«, fragte Melchor.
»Wortwörtlich«, gab Blai zurück. »Ich sagte doch, er bereut es. Und du machst einen Fehler. Weißt du warum?« Melchor schwieg, Blai fuhr fort: »Du hast einmal gesagt, jemanden hassen ist, als würdest du ein Glas Gift trinken, im Glauben, dass du den tötest, den du hasst.«
»Das habe nicht ich gesagt«, stellte Melchor richtig. »Das war Olga.«
»Egal, wer es gesagt hat«, entgegnete Blai. »Jedenfalls stimmt es. Wenn du Salom weiterhin hasst, wirst du dich am Ende selbst vergiften.«