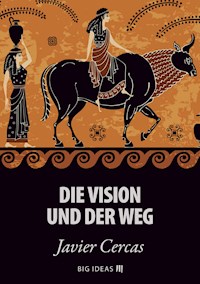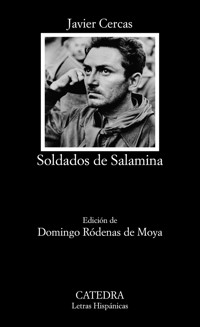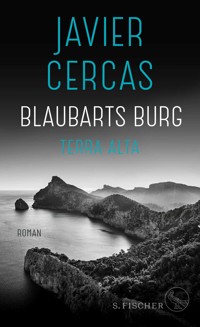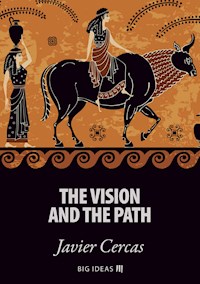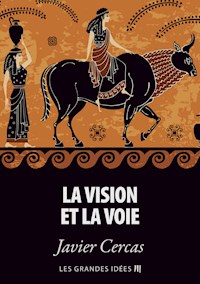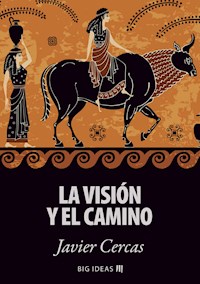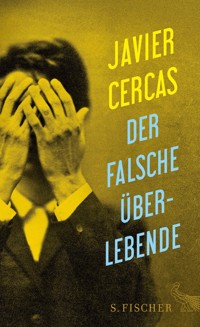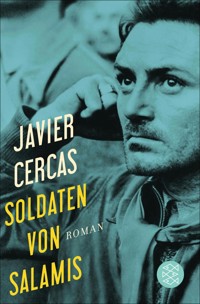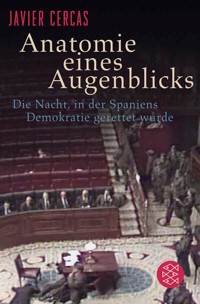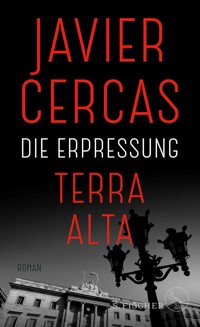
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Terra-Alta-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Aus der Abgeschiedenheit der Terra Alta ins politische Herz Barcelonas. Melchor Marín auf der Spur eines Erpressers Aus der Abgeschiedenheit der Terra Alta kehrt Melchor Marín ins hitzige Leben Barcelonas zurück. Als die Bürgermeisterin der Metropole auf schamlose Weise erpresst wird, droht ein politischer Skandal. Melchor ermittelt mit seinem unbeugsamen Sinn für Gerechtigkeit gegen einen mysteriösen Täter, dessen Absicht unklar bleibt. Seine Suche führt zu den Wortführern der katalonischen Unabhängigkeit, wo Zynismus, Skrupellosigkeit und hemmungslose Gier herrschen. Und völlig unerwartet sieht er sich mit der eigenen Vergangenheit konfrontiert. Dieser fesselnde und wilde Roman führt in die Hinterzimmer der Macht und ist ein wütendes Plädoyer gegen Korruption und Populismus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Javier Cercas
Die Erpressung
Terra Alta 2
Roman
Über dieses Buch
Aus der Abgeschiedenheit der Terra Alta kehrt Melchor Marín ins hitzige Leben Barcelonas zurück. Als die Bürgermeisterin der Metropole auf schamlose Weise erpresst wird, droht ein politischer Skandal. Melchor ermittelt mit seinem unbeugsamen Sinn für Gerechtigkeit gegen einen mysteriösen Täter, dessen Absicht unklar bleibt.
Seine Suche führt zu den Wortführern der katalonischen Unabhängigkeit, wo Zynismus, Skrupellosigkeit und hemmungslose Gier herrschen. Und völlig unerwartet sieht er sich mit der eigenen Vergangenheit konfrontiert.
Dieser fesselnde und wilde Roman führt in die Hinterzimmer der Macht und ist ein wütendes Plädoyer gegen Korruption und Populismus.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Javier Cercas, geboren 1962 in Ibahernando in der spanischen Extremadura, lebt als Schriftsteller, Publizist und Universitätsdozent in Girona. Mit seinem Roman »Soldaten von Salamis« wurde er international bekannt. Heute ist sein Werk in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Für »Der falsche Überlebende« (S. Fischer 2017), erhielt er u.a. den Prix du livre européen 2016 und den chinesischen Taofen-Preis 2015 für das beste ausländische Buch. Für seinen zuletzt erschienenen Roman »Terra Alta« wurde er mit dem Premio Planeta 2019 ausgezeichnet.
Susanne Lange lebt als freie Übersetzerin bei Barcelona und in Berlin. Sie überträgt lateinamerikanische und spanische Literatur, sowohl klassische Autoren wie Cervantes als auch zeitgenössische wie Juan Gabriel Vásquez oder Javier Marías. Zuletzt wurde sie mit dem Johann-Heinrich-Voß-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung ausgezeichnet.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Die Übersetzung dieses Buches wurde durch die Acción Cultural Española, AC/E, gefördert.
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Independencia. Terra Alta II« bei Tusquets Editores S.A., Barcelona
© Javier Cercas, 2021
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2022 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Coverabbildung: Getty Images/John Elk
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491518-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Für Raül Cercas und Mercè Mas, mein Terra Alta
Melchor platzte in das Lokal, bahnte sich einen Weg zur Theke, setzte sich auf einen Hocker und bestellte Whisky. Der Barkeeper starrte ihn an wie einen Außerirdischen.
»Was willst du hier?«, fragte er.
»Keine Angst«, entgegnete Melchor. »Ich bin nicht auf dem Kriegspfad.«
»Auf dem Kriegspfad?«
»Nein. Bekomm ich nun den Whisky?«
Der Barkeeper ließ sich Zeit mit der Antwort.
»Pur oder mit Eis?«
»Pur.«
Es war nach drei Uhr morgens, das Lokal aber noch gut besucht. Unter Garben von Stroboskoplicht tanzten ein paar Frauen nackt oder halb nackt auf einem erleuchteten Laufsteg, der quer durch den Hauptsaal verlief, und wurden von Männern mit gierigen Blicken taxiert. Hier und da warteten andere junge Frauen allein, paarweise oder in Grüppchen auf die letzten Kunden. Oder auf das Ende der Nacht. Über die Lautsprecher erklang Like a Virgin, der alte Madonna-Song.
»Das gibt’s doch nicht«, hörte Melchor hinter seinem Rücken.
Während der Barkeeper ihm den Whisky eingoss, setzte sich der Mann, der da gesprochen hatte, neben den Polizisten. Er war ein dunkel gekleideter mulato, kahl und stämmig, mindestens zwei Meter groß. Melchor nahm einen großen Schluck, und der andere zeigte auf das Glas.
»Hast du die Cola aufgegeben?«
»Ja«, sagte Melchor. »Zur Feier des Tages.«
Der Mann zeigte zwei Reihen blitzend weißer Zähne.
»Sag bloß«, entgegnete er. »Und was feierst du? Dass der Richter uns recht gegeben hat und ihr mit nacktem Arsch dasteht?«
»Recht hat euch der Richter nicht gegeben, Trottel«, korrigierte Melchor. »Er hat bloß gesagt, es fehlen Beweise gegen euch. Aber keine Sorge, ich finde schon welche. Noch einen Whisky.«
Der Barkeeper, der sich nicht entfernt hatte und die Flasche noch immer in der Hand hielt, goss nach. Der andere lächelte weiter, drehte sich auf dem Hocker, bis er mit dem Rücken zur Theke saß, stützte die Ellbogen darauf und musterte die Tänzerinnen auf dem Laufsteg. Melchor nahm einen weiteren Schluck.
»Weißt du, warum ich den Laden hier so mag?«, fragte er herausfordernd.
Der Mann entgegnete nichts. Melchor führte wieder das Glas zum Mund.
»Weil er mich an meine Kindheit erinnert«, sagte er, nachdem er getrunken hatte. »Meine Mutter war eine Nutte, weißt du. Also bin ich in solchen Läden aufgewachsen, umgeben von Nutten wie ihr und von Zuhältern wie dir. Und das feiere ich: die Heimkehr.«
Der Madonna-Song ging zu Ende, und das Lachen des Mannes neben ihm dröhnte durch die zunehmende Stille im Bordell. Madonna wurde rasch von Rosalía abgelöst, und zwei, drei Frauen machten sich auf, zwischen den Kunden und ihren Kolleginnen zu tanzen. Der Mann legte seine Pranke auf Melchors Schulter.
»So hab ich’s gern, Bulle«, sagte er. »Man muss verlieren können.« Er stand auf, zwinkerte dem Barkeeper zu und sagte, auf Melchor deutend: »Geht aufs Haus.«
Melchor trank weiter, ohne von seinem Glas aufzublicken, und obwohl die Frauen ihn alle kannten, kam keine zu ihm. Als er den dritten Whisky bestellte, setzte sich doch eine neben ihn: Spanierin, braun gebrannt, schon älter und füllig, im schwarzen Bustier, aus dem die Brüste hervorsahen. Sie legte ihm eine Hand in den Nacken und bestellte ein Glas Cava. Der Barkeeper warnte Melchor:
»Die Drinks der Mädchen gehen nicht aufs Haus.«
Melchor nickte, und der Barkeeper goss der Frau ihren Cava ein. Sie tranken und warteten ab, bis der Barkeeper sich entfernt hatte. Als er am anderen Ende der Theke beschäftigt war, fragte Melchor:
»Ziehen wir’s durch?«
»Natürlich«, sagte sie.
»Sicher?«, fragte Melchor. »Wenn sie uns erwischen, sieht’s übel für dich aus.«
Die Frau setzte eine gleichgültige Miene auf.
»Ich mach mir nicht ins Hemd, Kleiner.«
Melchor nickte, ohne sie anzusehen.
»Also gut«, sagte er. »Warten wir noch kurz. Wenn ich auf dem Weg nach oben bin, gehst du zu ihnen. Du lässt die Tür offen und sagst, ich komme gleich.«
»Die haben ganz schön Schiss. Soll ich bleiben, bis du da bist?«
»Nein. Beruhige sie. Sag ihnen, es passiert schon nichts. Sag, ich bin gleich da. Und dann öffnest du die anderen beiden Türen, die zum Balkon, und gehst nach Hause oder kommst hierher zurück. Nein, geh besser nach Hause.« Er hielt kurz inne. »Alles klar?«
»Ja.«
Melchor nickte wieder, doch diesmal sah er sie an.
»Sei vorsichtig«, sagte sie.
»Du auch.«
Die Frau ließ das halb volle Glas auf der Theke stehen und entfernte sich.
Melchor trank weiter, sprach mit niemandem außer dem Barkeeper, ging nicht einmal pinkeln. Als das Lokal fast leer war, tauchte der Mann von vorhin wieder auf und lächelte verärgert bei Melchors Anblick.
»Immer noch hier?«, fragte er.
»Beim sechsten Whisky«, antwortete der Barkeeper für ihn. »Schade, dass es keine Cola war. Dann wär er jetzt tot.«
»Ich muss zu deinem Chef«, verkündete Melchor.
Der andere runzelte die Stirn; sein Lächeln war mit einem Mal fort, verschlungen vom violetten Polster der Lippen.
»Der ist nicht da.«
Melchor schnalzte.
»Hältst du mich für blöd? Natürlich ist er da. Der geht erst, wenn ihr schließt: nicht dass ihr mit der Kasse durchbrennt.«
Der Mann musterte ihn mit einer Mischung aus Neugier und Misstrauen.
»Was willst du vom Chef?«
»Geht dich nichts an.«
»Klar geht mich das an.«
»Er sagt, er ist nicht auf dem Kriegspfad«, schaltete sich der Barkeeper ein.
Der Blick des Mannes sprang vom Barkeeper zu Melchor und von Melchor zum Barkeeper, der schließlich mit den Schultern zuckte.
»Ich will mich bei ihm entschuldigen«, sagte Melchor. »Der Prozess. Der ganze Ärger. Du weißt schon.«
Der andere schien sich zu entspannen.
»Klar. Find ich gut. Aber dafür musst du nicht extra zu ihm. Ich geb’s weiter. Entschuldigung angenommen.«
»Ich will ihm auch einen Vorschlag machen.«
Der andere wurde wieder misstrauisch.
»Was für einen Vorschlag?«
»Das werd ich dir grad auf die Nase binden.«
»Dann vergiss das mit dem Chef.«
»Wie du willst. Aber es ist ein guter Vorschlag, er wird ihn interessieren.« Er blickte zum Barkeeper und fügte hinzu: »Er hört bestimmt nicht gern, dass du mich daran gehindert hast, ihm davon zu erzählen.«
Der Mann kam offenkundig ins Grübeln; er warf wieder einen Blick zum Barkeeper, dann einen prüfenden auf Melchor, entfernte sich nach ein paar Sekunden, nur so weit, um telefonieren zu können, ohne gehört zu werden. Dann winkte er widerwillig dem Polizisten, er solle ihm folgen.
Sie überquerten die verlassene Tanzfläche, gingen über eine enge Treppe zwei Stockwerke hinauf, dort öffnete er eine Tür und ließ Melchor zuerst eintreten. Er befand sich im Büro des Chefs, der bei seinem Anblick nicht aufstand, ihm auch nicht die Hand gab. Der Mann saß hinter einem klapprigen Tisch, darauf gut sichtbar die leeren Hände, in den Augen ein spöttischer Glanz.
»Warum hast du nicht gesagt, dass du hier bist?«, fragte er und deutete auf einen Stuhl ihm gegenüber. »Ich wäre nach unten gekommen, um dich zu begrüßen.«
Melchor setzte sich nicht. Der Chef gab sich mit seinem Aussehen sichtlich Mühe, er war um die fünfzig, das Haar gegelt, der grau melierte Bart gepflegt, die Hände schwer von Ringen; er war hemdsärmelig, trug Hosenträger und über der Brust eine silberne Kette mit großem Goldmedaillon. Er hieß Eugenio Fernández, aber aus unerfindlichem Grund nannte ihn alle Welt Papa Moon.
»Ich höre, du willst dich entschuldigen«, fügte er hinzu. »Und ertränkst deinen Kummer im Whisky. Recht so. Ich hatte dich gewarnt, dass du dich aufs Glatteis begibst. Das ist der Vorteil, wenn man in einer Demokratie lebt, Kleiner: Hier sind wir alle unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Sogar ich, der ich keine Bücher lese wie du. Aber so weit reicht’s noch. Willst du dich nicht setzen?«
Melchor antwortete nicht. Papa Moon warf Melchors Begleiter einen fragenden Blick zu, der zuckte hinter dem Polizisten mit den Schultern. Das Zimmer wurde durch die Schreibtischlampe und eine Stehlampe hinter ihm in ein schwaches Licht getaucht. In die Wand, dem Schreibtisch gegenüber, war ein Plasmabildschirm eingelassen, auf dem ganz leise ein Basketballspiel der NBA lief.
»Du sagst gar nichts?«, bemerkte Papa Moon.
»Ich will dir etwas vorschlagen«, sagte Melchor schließlich.
»Das hat mir Samuel schon erzählt.« Papa Moon drehte sich ein wenig auf dem Stuhl und breitete freundlich die Arme aus. »Ich bin ganz Ohr.«
Melchor wandte sich kurz zu dem anderen, dann wieder zum Chef.
»Keine Sorge.« Papa Moon wollte ihn beruhigen. »Du kannst offen reden, Samuel ist vertrauenswürdig.«
Melchor wandte den Blick nicht von Papa Moon, der nach ein paar Sekunden seufzte und seinen Gorilla mit einer leichten Kopfbewegung fortschickte. Der zögerte einen Moment und durchsuchte Melchor dann, der ihn gewähren ließ. Er trug keine Waffe bei sich, hatte nur zwei Handschellen in der Tasche. Dann fragte Samuel:
»Sind Sie sicher, Chef?«
Papa Moon nickte.
»Geh schließen«, befahl er. »Ich komme gleich runter.«
Widerwillig verließ der Schläger das Zimmer und schloss die Tür hinter sich.
»Gut.« Der Chef lehnte sich zurück. »Schieß los.«
Melchor machte zwei Schritte vorwärts, stützte die Fingerknöchel auf den Schreibtisch und beugte sich über die Tischplatte, kam Papa Moon so nahe, als wollte er ihm etwas zuflüstern.
»Es geht um die Mädchen«, sagte er.
Der Chef setzte eine gelangweilte Miene auf.
»Schon wieder?«
Melchor wandte den Blick nicht von ihm ab. Papa Moon fragte:
»Also, was ist mit den Mädchen?« Melchor schwieg weiter, und im Gesicht des Mannes schien ein verschwörerisches Lächeln auf. »Ach so!«, sagte er. »Auch du hast ein Faible für die, stimmt’s?«
Er wollte etwas hinzufügen, kam aber nicht dazu. Melchor versetzte ihm einen Kopfstoß gegen die Stirn, ließ ihm keine Zeit zur Gegenwehr, sondern packte ihn am Nacken und donnerte seinen Schädel auf die Platte, dass es krachte. Dann umrundete er den Tisch, zog den Mann am Kragen hoch und schlug wieder zu, zuerst die Faust in den Magen, dann ein Tritt in die Eier. Papa Moon ging mit einem Aufheulen zu Boden.
»Nicht schreien«, warnte Melchor. Er griff sich die Silberkette und schnürte ihm damit den Adamsapfel ab, als wollte er ihn erwürgen. »Wenn du noch mal schreist, schlag ich dir den Schädel ein.«
Papa Moon lag auf den Knien und schnappte nach Luft.
Melchor schmetterte ihm den Kopf gegen die Tischkante, schlug ihm ins Gesicht und drehte ihm mit derselben Hand, mit der er die Kette hielt, die Arme auf den Rücken, während er ihn mit der anderen durchsuchte, bis er sein Handy fand. Er zertrümmerte es auf dem Boden.
»Wo hast du die Pistole?«, fragte er.
»Du brichst mir den Arm.«
»Ich habe gefragt, wo du die Pistole hast?«
»Welche Pistole?«
Papa Moon schlug mit dem Gesicht auf dem Boden auf. Blut rann ihm aus der Nase und übers Kinn, als Melchor es wieder anhob und die Frage wiederholte. Der Chef beantwortete sie, und ohne ihn loszulassen, öffnete Melchor die Schublade, holte die Pistole heraus und vergewisserte sich, dass sie geladen war. Dann zerrte er Papa Moon auf die Beine.
»Jetzt drehst du völlig durch, Bulle«, brachte er hervor. »Damit bist du erledigt.«
Melchor verdrehte ihm den Arm noch mehr und presste ihm den Pistolenlauf gegen den Kiefer.
»Darüber reden wir später, Chef«, sagte er. »Los, wir gehen, und immer schön brav, kapiert?« Er wedelte mit der Pistole und warnte: »Ein Schrei und die geht los. Eine Dummheit und die geht los. Klar?« Papa Moon schwieg. Melchor verdrehte ihm wieder den Arm, und der Mann nickte. »Fein«, sagte Melchor. »Vorwärts.«
Aneinandergepresst verließen sie Papa Moons Büro, gingen die Treppe hinunter, die Melchor eben heraufgekommen war, und auf dem ersten Absatz öffnete der Polizist vorsichtig eine Tür und sah durch den Spalt. Dort befand sich eine Art Balkon, eher eine Galerie an der Bordellfassade, von der aus man Eingang und Parkplatz übersah, auf dem noch einige Autos standen. Hastig gingen sie die Galerie entlang, vorbei an einer Treppe zum Parkplatz, und wieder öffnete Melchor behutsam eine Tür und vergewisserte sich, dass niemand dahinter stand. Dann öffnete er sie ganz, und sie traten ins kalte Licht eines Gangs mit mehreren Türen, aus denen Stimmen, Geräusche, ein Lachen drangen. Melchor öffnete die letzte Tür. Drinnen warteten drei junge Frauen. Zwei kauerten auf dem Bett, die dritte stand mitten im Zimmer; alle drei waren schwarz wie die Nacht und starrten die Hereinkommenden erwartungsvoll und panisch an. Melchor schloss die Tür hinter sich, musterte die drei und fragte, ob sie bereit seien.
Nur die Stehende nickte, aber die anderen beiden erhoben sich sofort. Melchor kannte die drei. Sie stammten aus Lagos, Nigeria, und ihre Geschichten unterschieden sich kaum voneinander. Vor Jahren waren sie nach Madrid gekommen, auf der Flucht vor dem Elend und auf das Versprechen hin, in Spanien studieren zu können. Nach ihrer Ankunft hatte man ihnen Pass und Handy abgenommen, ihnen verboten, Kontakt mit der Familie aufzunehmen und das Haus zu verlassen, und verlangte sechzigtausend Euro für die Reisekosten; um sie einzuschüchtern, wurden ihnen als eine Art Ritual Fingernägel und Haare geschnitten, Scham und Achseln rasiert und ein halluzinogener Trank eingeflößt. Dann zwang man sie zur Prostitution. So begannen sie eine Reise durch die Animierclubs halb Spaniens, in denen sie von fünf Uhr nachmittags bis vier Uhr früh arbeiteten, um die Schulden abzubezahlen, die sie theoretisch bei der Organisation hatten, von der sie praktisch jedoch entführt worden waren. Eine Reise, der Melchor nun ein Ende setzen wollte, in dieser Nacht.
Er zwang Papa Moon, sich neben das Bett der Frauen auf den Boden zu setzen, holte die Handschellen heraus, fesselte mit einer dessen rechtes Handgelenk an den einen Bettpfosten und mit der zweiten das linke an den anderen.
»Du bist völlig wahnsinnig, Bulle.« Papa Moon sprach mit der dumpfen Wut, die ihm die Schläge eingegeben hatten. »Dafür wirst du bezahlen.«
Das war das Letzte, was er sagte. Melchor stopfte ihm ein Taschentuch in den Mund, schob es ihm bis in die Kehle. Zitternd vor Angst beobachteten die drei jungen Mädchen von der Zimmertür aus die Szene.
»Jetzt hör mir gut zu, du Stück Scheiße«, sagte Melchor und hockte sich vor Papa Moon. »Da es auf die sanfte Tour nicht ging, dann eben auf die harte. Die drei hier nehme ich mit. Komm ja nicht auf die Idee, dir neue zu holen. Und erst recht nicht darauf, mich anzuzeigen. Weißt du, was passiert, wenn du mich anzeigst? Pass gut auf, denn ich sage es nur einmal. Wenn du mich anzeigst, brenne ich den Schuppen hier nieder. Ich töte deine Kinder und deine Frau. Deine ganze Familie. Und am Ende dich. Genau das tue ich. Das hast du kapiert, oder?« In Papa Moons Augen hatte sich die Wut in eine animalische, unbezähmbare Angst verwandelt. Melchor kam ihm noch näher und fügte hinzu: »Das hast du doch kapiert, ja oder nein?« Papa Moon nickte. Melchor tätschelte ihm zufrieden die Wange und sagte: »Hervorragend.«
Er stand auf und drehte sich zu den Mädchen. Die Wirkung des Whiskys war verflogen; sein Geist war klar, er fühlte sich leicht und glücklich.
»Bereit?«, fragte er.
Die drei Frauen nickten. Sie hießen Alika, Joy und Doris. Alika und Joy waren siebzehn, Doris achtzehn. Sie waren im Einheitslook gekleidet, wie für einen Straßenlauf oder eine Demonstration: dunkles T-Shirt, billige Jeans, Turnschuhe. Die drei sahen ihn mit aufgerissenen Augen flehend und erschrocken an, als würde im nächsten Moment ein Meteorit im Bordell einschlagen, und nur er könnte sie vor der Katastrophe retten. Melchor spähte durch den Türspalt, ob jemand im Gang war, steckte die Pistole in den Hosenbund und nahm Alika und Joy, die beiden Jüngeren, bei der Hand.
»Keine Angst«, sagte er. »Bleibt dicht bei mir, und alles wird gutgehen.« Er öffnete die Tür nun ganz und fügte hinzu: »Also los.«
Erster Teil
1
Melchor tauscht das Wasser in der Vase aus, wechselt einen welken Blumenstrauß gegen einen frischen und wischt mit einem Lappen über den Grabstein, auf dem geschrieben steht: »Olga Ribera, Gandesa, 1978–2021«. Und wie an jedem Samstagvormittag seit vier Jahren (wenn er nicht Bereitschaftsdienst hat) verbringt er dort eine Weile am Grab seiner Frau, erzählt ihr von Cosette und berichtet von den wenigen Ereignissen der Woche.
Der Friedhof liegt am Fuß eines Hügels außerhalb von Gandesa, und Melchor hört nur Vogelzwitschern und in der Ferne ab und an das Brummen eines Autos, das die Serpentinen Richtung Vilalba dels Arcs und die Berge von La Fatarella erklimmt, deren Kämme sich zu seiner Linken vor dem makellos blauen Himmel abzeichnen, gespickt mit weißen Windrädern, die sich in der fast stehenden Hitze des Julivormittags schwerfällig drehen.
Nach einer halben Stunde wirft er sich die Tasche über die Schulter und geht. Er kommt am Familiengrab der Adells vorbei, ein prächtiges Grabmal aus schwarzem, weiß geädertem Marmor, und folgt einem schmalen Weg, von Zypressen beschattet und von Grabsteinen flankiert. Als er den Friedhof verlässt, nimmt er einen ungepflasterten Pfad und landet kurz darauf bei dem Kreisverkehr am Ortseingang. Er ist nicht überrascht, als er in der Mitte des Rondells auf den Stufen unter dem Steinkreuz Rosa Adell sitzen sieht.
»Ich frage mich, warum ich nie auf den Friedhof gehe«, sagt sie anstelle eines Grußes.
Melchor tritt zu ihr. Rosa trägt eine dunkelblaue Bluse ohne Ärmel, eine leichte braune Hose und Sandalen, die winzige Füße präsentieren, die Zehennägel rot lackiert. Melchor sieht ihre Augen nicht, eine Sonnenbrille verbirgt sie.
»Dabei liegt meine ganze Familie da begraben«, fügt Rosa hinzu. »Muss ich ein schlechtes Gewissen haben?«
Melchor denkt an das Adell-Grab und antwortet:
»Und wie.«
»Im Ernst?«
»Nein. Was da liegt, hat nichts mehr mit deinen Eltern zu tun.«
»Und mit Olga?«
»Auch nicht.«
»Warum gehst du dann hin?«
Melchor zuckt mit den Schultern. Rosa Adell mustert ihn kurz, verzieht verblüfft den Mund, steht auf und klopft sich den Staub von der Hose.
»Wo ist Cosette?«, fragt sie.
»Im Stadtbad.« Melchor deutet in Richtung eines Gebäudes an die fünfzig Meter entfernt, zwischen Feuerwache und Sportklub. »Bis zwölf.«
Rosa blickt auf die Uhr.
»Das reicht gerade für einen Kaffee.«
Sie gehen die Avinguda Joan Perucho hinunter zum Hotel Piqué. Beide schweigen, als hinderte sie die immer brennendere Sonne am Sprechen, schweigend gehen sie an Terra Altas Gymnasium vorbei, vorbei am Landgericht mit seiner pseudoklassizistischen Fassade.
In den letzten Monaten haben sich die beiden oft getroffen, mal zufällig, mal nicht ganz so zufällig, und immer oder fast immer ist für den Zufall Rosa verantwortlich, die es sich zur Gewohnheit gemacht hat, Melchor jeden Samstagvormittag beim Friedhof zu erwarten. Wie alle anderen weiß Rosa nicht, welche Rolle Melchor tatsächlich bei der Aufklärung des Falls Adell gespielt hat, der Terra Alta vier Jahre zuvor aus seiner Schläfrigkeit gerissen und ihren Exmann Albert Ferrer schließlich ins Gefängnis gebracht hatte, ebenso wie Ernest Salom, ehemaliger Caporal der Polizei, enger Freund von Ferrer und Melchors Kollege im Polizeirevier von Gandesa, der Erste verurteilt wegen Anstiftung zum Mord am Ehepaar Adell und ihrer rumänischen Hausangestellten, der Zweite wegen Beihilfe zum Mord und Strafvereitelung. Obwohl Rosa schon bald vermutet hat (zumindest vermutet das Melchor), dass die offizielle Version nicht ganz der Wahrheit entspricht und Melchor Dinge verheimlicht, hat sie es nie über sich gebracht, ihn danach zu fragen. Sie reden eigentlich nie über die Sache, obwohl sie sich damals kennengelernt haben; und wie Rosa damit umgegangen ist und welche Konsequenzen der Fall für sie hatte, weiß Melchor fast nur aus anderen Quellen, nicht von ihr selbst. Im Grunde kennt er nur Bruchstücke, etwa dass Rosa ihren Exmann seit dem Prozess nicht mehr gesehen hat und ihre vier Töchter sich wegen seiner Tat vom Vater abgewandt haben. Rosa Adell lebt nun allein im Landhaus bei Corbera d’Ebre, das sie vor vier Jahren noch mit Albert Ferrer geteilt hatte – ihre Töchter arbeiten oder studieren in Barcelona –, und sie hat versucht oder versucht noch immer, über den Mord an ihren Eltern und die Verurteilung ihres Mannes hinwegzukommen, indem sie sich mit Leib und Seele in die Führung des Firmenimperiums stürzt, das ihr Vater aus dem Nichts geschaffen hatte, allen voran Gráficas Adell, ein Unternehmen für Papierverpackungen. Sie arbeitet viel, reist viel und verbringt das Wochenende manchmal in Barcelona mit ihren Töchtern, ruft aber, wenn sie in Terra Alta ist, Melchor an oder passt ihn in letzter Zeit beim Friedhof ab.
Sie lassen den Busbahnhof rechts hinter sich, überqueren die Straße und den ungepflasterten Platz vor dem Hotel Piqué, gehen hinein und weiter zum Café, in dem sich um die Zeit eine Horde lärmender Touristen an der Theke versammelt hat, sonst sind dort nur zwei Fahrradausflügler und ein altes Ehepaar. Rosa setzt sich an einen Tisch mit Blick auf den Parkplatz, während Melchor an der Theke ansteht. Nachdem man ihn endlich bedient hat, bringt er die beiden Kaffee an den Tisch.
»Es heißt, bei euch läuft es gut«, sagt Melchor, als er sich Rosa gegenübersetzt.
Im Café, das ganz in Sonnenlicht getaucht ist, hat die Frau die dunkle Brille abgenommen und sieht den Polizisten mit ihren braunen Mandelaugen ruhig an und rührt in ihrem Kaffee.
»Nachrichten verbreiten sich schnell in Terra Alta«, stellt sie fest. »Du weißt also schon von Medellín?«
Melchor nickt.
»Das war Señor Graus Idee«, sagt Rosa und versucht, ihre Rolle herunterzuspielen; ein Hauch Lippenstift glänzt auf ihren vollen Lippen. »Kolumbien ist ein Land, das hervorragend funktioniert, ideal für Investitionen. Eine Fabrik dort aufzubauen, ist genau das Richtige. Und Medellín ist ein herrlicher Ort.«
»Alles in Ordnung mit ihm?«
»Mit Medellín?«
»Mit Señor Grau. Ich habe ihn eine Ewigkeit nicht mehr gesehen.«
Rosa Adell senkt den Blick, deutet ein Lächeln an und nimmt einen Schluck Kaffee.
»Er ist alt«, sagt sie ohne Wehmut. »Aber immer noch Gewehr bei Fuß. Ich wüsste wirklich nicht, was ich ohne ihn tun sollte.«
Melchor nickt wieder. Im Geist hat er das Bild des ewigen Geschäftsführers von Gráficas Adell vor Augen: ein beinharter Greis, bleich, gebildet und kurzsichtig, dürr, schütteres Haar, mit einem erprobten Spürsinn fürs Geschäft, der tagtäglich makellos gekleidet, wenn auch mit neunzig immer gebeugter, in seinem Büro im Gewerbegebiet La Plana am Stadtrand von Gandesa erscheint und das Flaggschiff des Imperiums Adell steuert. Kurz muss sich Melchor wieder wundern, dass dieser Inbegriff von Unternehmensintegrität mit einer unerschütterlichen Loyalität gegenüber seinem lebenslangen Arbeitgeber Adell, der erste Verdächtige im Mordfall an Rosas Eltern gewesen war, in dem Melchor zusammen mit Salom unter Subinspector Gomà ermittelt hatte.
»Nun, darüber solltest du dir allmählich Gedanken machen«, rät ihr Melchor.
»Ich weiß«, sagt Rosa und blickt aus dem Fenster. Auf dem Hotelparkplatz, durch ein Strohdach vor der Sonne geschützt, stehen nicht mehr als zwei Autos und ein Lieferwagen. Der Verkehr am Ortseingang ist minimal. »Übrigens«, plötzlich blickt sie zu Melchor auf, »Señor Grau kommt heute zum Mittagessen zu mir. Warum schließt du dich nicht an, mit Cosette? Bestimmt freut er sich, mit euch zu essen.«
»Danke, aber ich kann nicht. Wir haben verabredet, zu Hause einen Film anzusehen. Außerdem«, fügt er hinzu und klopft auf seine Tasche, die er beim Hinsetzen über die Armlehne gehängt hat, »heute Nachmittag habe ich zu tun.« Rosa blickt auf die Tasche, dann zu Melchor, der erklärt: »Beiträge für den Literaturwettbewerb.«
Die Frau lächelt spontan: ein breites, spöttisches, leuchtendes Lächeln.
»Dann haben sie dich also doch für die Jury rekrutiert.«
Melchor wendet den Blick ab, weiß aber nicht, wohin ihn richten.
»Offenbar haben sie keinen anderen gefunden und …« Nervös, da der Satz in eine falsche Richtung geht, setzt er neu an. »Und das ist noch nicht das Schlimmste.«
»Ach nein?«
»Nein. Das Schlimmste ist, ich muss bei der Preisverleihung eine Rede halten. Sie haben mich gebeten, ein paar Worte über das Lesen zu sagen. Oder über die Literatur. Oder über Romane, die mir gefallen. Etwas in der Art.«
»Eine hübsche Idee.«
»Wunderschön. Bloß hab ich mein Lebtag keine Rede gehalten.«
»Sag nicht, du hast Angst.«
Melchor blickt Rosa wieder an.
»Angst nicht«, gesteht er. »Panik.«
Sie lacht herzhaft auf.
»Sei nicht dumm, Bulle«, sagt sie. »Du wirst das hervorragend machen.«
»Natürlich.«
»Ich meine es ernst. Soll ich dir bei der Vorbereitung helfen?«
In Melchors Augen blitzt ein Funke Hoffnung auf, der wieder erlischt, als er begreift, dass seine Freundin, so sehr sie ihren Ernst beteuern mag, einen Scherz gemacht hat.
Bevor Rosa das Gegenteil versichern kann, geht Melchor zwei weitere Kaffee holen. Als er zurückkommt, sprechen sie trotz seiner kategorischen Weigerung, noch einmal die Sache mit der Rede zu diskutieren, über den Literaturwettbewerb. Veranstaltet wird er von der Bibliothek und dem Gymnasium, und die Jury bilden zwei Lehrer, ein einheimischer Dichter, die Bibliotheksleiterin und Melchor; die Preisverleihung ist für Anfang September angesetzt, wenn das neue Schuljahr beginnt. Melchor erzählt von der Sience-Fiction-Story, die er gerade gelesen und die ihm gut gefallen hat; er fasst sie für Rosa zusammen, die sich zwar nicht für Science-Fiction, nicht einmal für Literatur interessiert, aber seinen Eindruck teilt. Sie reden auch über einen Vorschlag von Gandesas Bürgermeister, Rosa solle die Hauptfabrik von Gráficas Adell in La Plana vergrößern, und über ihre bevorstehende Geschäftsreise zur Niederlassung in Timișoara, Rumänien. Dann tauschen sie sich über ihre Ferienpläne aus: Rosa will mit ihren vier Töchtern für zwei Wochen durch die USA reisen und Melchor Anfang August das Gleiche tun wie letzten Sommer: ein paar Tage mit Cosette in El Llano de Molina de Segura, Murcia, verbringen, bei der letzten Freundin seiner Mutter, Carmen Lucas, und ihrem Mann Pepe.
»Da kommt ihr doch um vor Hitze«, warnt Rosa.
»Letztes Jahr war es sehr schön«, entgegnet Melchor. »Weißt du, was Cosette am besten gefallen hat? Dass ihre Freundinnen dort sie Cosé genannt haben.«
Rosa lacht noch immer, als Melchors Handy klingelt, der nicht reagiert, als er sieht, wer anruft.
»Gehst du nicht ran?«, fragt Rosa.
»Es ist Vivales. Ich rufe ihn später zurück.« Nun sieht Melchor auf die Uhr. »Cosette kommt gleich raus. Gehen wir?«
Rosa Adell weiß über Domingo Vivales kaum mehr, als sie über Carmen und Pepe weiß. Melchor hatte ihn ihr vorgestellt, als er einmal in Gandesa zu Besuch gewesen war, doch sie begreift nicht, in was für einer Beziehung diese beiden so unterschiedlich alten Männer zueinander stehen, die gut und gern Vater und Sohn sein könnten. Über den Anwalt weiß sie eigentlich nur, dass er wie Carmen Lucas ein Freund seiner Mutter war und Melchor diese Freundschaft geerbt hat, wie man ein Haus erbt. Mehr hat ihr der Polizist nicht erzählt, und sie fragt auch nicht, denn es ist die erste ungeschriebene Regel ihrer Freundschaft, sich der Privatsphäre des anderen mit größter Vorsicht zu nähern.
Während Rosa die vier Kaffee bezahlt – eine weitere ungeschriebene Regel ihrer Freundschaft: immer oder fast immer zahlt sie –, kommt eine WhatsApp auf Melchors Handy an. Es ist Sargento Blai, der nicht mehr Sargento ist, sondern Inspector, und auch nicht mehr in Terra Alta arbeitet, sondern in der Zentrale des Polizeikorps, im Complex Egara am Rand von Sabadell. »Was gibt’s, Sauspanier?«, schreibt Blai. »Wo bist du?« »Im Hotel Piqué«, antwortet Melchor. »Beim Vögeln?«, fragt Blai. »He, he, ein Scherz. Ich bin bei meinen Schwiegereltern, wir müssen uns so schnell wie möglich sehen. Heute Nachmittag.«
»Lass dich nicht stören«, sagt Rosa Adell, die Melchor an der Hoteltür einholt und die Sonnenbrille aufsetzt. »Antworte, wem du antworten musst.«
Sie überqueren den ungepflasterten Vorplatz, und während sie den Verkehr auf der Landstraße abwarten, tippt Melchor auf seinem Handy: »Ich kann nicht.« »Hör auf, Mann, hast du deine Freunde abgeschrieben?«, antwortet Blai sofort und fügt hinzu: »Im Ernst. Wir müssen reden. Es ist dringend.« In der glühenden Mittagssonne gehen sie die Avinguda Joan Perucho zurück.
»Arbeit?«, fragt Rosa Adell.
Melchor nickt.
»Am Wochenende lasse ich mein Diensthandy im Büro«, verrät Rosa. »Was Wichtiges?«
»Glaub kaum, obwohl es den Anschein hat.«
Als sie am Gericht vorbeikommen, schreibt Melchor: »Ich ruf nachher an.« »Aber nicht so spät«, antwortet Blai. »Um sieben gibt’s eine Megafamilienfeier. Wir müssen uns vorher sehen.« Melchors Antwort ist ein Emoticon: eine gelbe Faust mit erhobenem Daumen.
Als er vom Handy aufblickt, öffnet Rosa Adell gerade die Wagentür.
»Bist du sicher, dass ihr nicht zum Essen kommen wollt?«, beharrt sie.
»Ganz sicher. Grüß Señor Grau von mir.«
Sie verabschieden sich mit zwei Küssen auf die Wangen.
Es gibt eine Änderung der Pläne. Als Cosette aus dem Stadtbad kommt, fragt sie, ob sie bei ihrer Freundin Elisa Climent zu Mittag essen und den Nachmittag bei ihr verbringen darf, und nachdem Melchor mit der Mutter der Freundin geredet und mit Cosette verhandelt hat, gibt er nach. »Aber um sechs hole ich dich ab«, warnt er. Kaum ist er allein, kommt ihm der Gedanke, Rosa Adell anzurufen und doch mit ihr und Señor Grau zu essen, aber sofort verwirft er den Einfall und geht zum Gemeindeplatz. Dort sitzt er den Rest des Vormittags vor der Bar, trinkt Cola und liest in den eingereichten Beiträgen für den Literaturwettbewerb. Die Texte, die ihm wenig oder gar nicht gefallen, versieht er mit einem Minuszeichen, die besseren mit einem Pluszeichen, die besten mit zwei; diese will er am Ende noch einmal lesen, um die Gewinner auszuwählen.
Gegen zwei Uhr nachmittags geht er nach Hause, macht sich einen Salat mit Käse und Nüssen, brät sich ein Steak, isst alles in der Küche und spült es mit seiner dritten Cola an diesem Samstag hinunter. Ab und an blickt er zu dem leeren Stuhl auf der anderen Seite des Tischs, wo Olga immer saß.
Fünf Jahre sind seit dem Nachmittag vergangen, an dem sie von einem Auto überfahren wurde, das Albert Ferrer am Abend zuvor in Tortosa gemietet hatte. Beim Verhör und bei der Hauptverhandlung im Fall Adell hatte er versichert, er habe sie nicht töten, sondern Melchor nur Angst einjagen wollen, damit er nicht länger auf eigene Faust und eigenes Risiko im Mordfall an Ferrers Schwiegereltern ermittelte, obwohl der Fall offiziell ad acta gelegt worden war. Jedenfalls ist seit Olgas Tod kaum ein Tag vergangen, an dem Melchor nicht an sie gedacht hat. Wenn es doch geschieht und er seine Frau kurzzeitig vergisst, fühlt er sich miserabel, er weiß nicht, warum. Mit neurotischem Detailwahn hat er versucht, Woche für Woche, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute der dreieinhalb Jahre zu rekonstruieren, die er mit seiner Frau erlebt hat, aber es ist ihm nicht gelungen, und manchmal blickt er mit widerstreitenden Gefühlen zurück auf seine glückliche Anfangszeit in Terra Alta, als er Olga kennengelernt und sich in sie verliebt, sie geheiratet und mit ihr Cosette bekommen hatte: Zum Teil wirkt diese Vergangenheit nun irreal, als hätte er sie nicht erlebt, sondern in einem Film gesehen oder geträumt; zum Teil scheint ihm aber auch, als hätte er nie etwas so Reales erfahren wie sein Leben mit Olga. Nach dem Tod seiner Frau hatte er sich ständig gefragt, was sie über dies und jenes gesagt hätte, aber schließlich ist er dieser sinnlosen Folter entkommen. Allerdings kann er immer noch mit niemandem über sie sprechen, nicht einmal mit Cosette, und wenn das Mädchen nach ihrer Mutter fragt, an die sie sich kaum erinnert, weiß er nicht, was antworten, und weicht aus.
Die erste Zeit ohne Olga war schwer gewesen. Er wurde den Gedanken an ihren Tod nicht los, auch nicht das Gefühl, dass er seine Frau im Stich gelassen hatte. Irgendwo hatte er gelesen, solange die Reue dauert, dauert die Schuld, und an ihm nagte immer noch die Reue. Das erklärt, warum er nach ein paar Monaten beschloss, von Terra Alta fortzuziehen, in der Hoffnung, das Verlassen des Ortes, der dank Olga zu seinem Zuhause geworden war, würde ihm über ihren Tod hinweghelfen. Damals waren fünf Jahre seit den islamistischen Anschlägen von 2017 vergangen, viele seiner Kollegen wussten, dass er es gewesen war, der die vier Terroristen in Cambrils erschossen hatte, und zumindest im Polizeikorps war er – das wussten seine Vorgesetzten – zu einer Symbolfigur geworden. Also hatte er zum ersten Mal seine Sonderstellung genutzt, Comisario Fuster angerufen und um Versetzung gebeten.
Fuster hatte wie erwartet reagiert. Der Comisario fragte nicht, warum er versetzt werden wolle, sondern nur wohin. Melchor antwortete wenig überraschend: Barcelona. Wenig überraschend, weil er zwar schon lange fern der katalanischen Hauptstadt lebte, sie aber immer noch als sein Zuhause ansah. Nie hatte er an einem anderen Ort gewohnt, bis man ihn nach den Anschlägen – ein Schutz vor möglichen islamistischen Vergeltungsmaßnahmen – nach Terra Alta versetzt hatte. In Barcelona lebte außerdem Vivales, der seit dem Tod von Melchors Mutter eine verlässliche Stütze war und ihm gewiss dabei helfen würde, Cosette großzuziehen. »Willst du bei den Ermittlern bleiben?«, hatte Fuster gefragt, aufmerksam wie immer. »Etwas anderes kann ich nicht«, entgegnete Melchor. »Nun, du hast Glück«, sagte der Comisario. »Ich habe gerade mit dem Chef des KED gesprochen, und der hat gesagt, bei Entführung und Erpressung fehlen Leute. Was hältst du davon, wenn du zu uns nach Egara kommst?« »Hervorragend«, sagte Melchor, der damals so schnell aus Terra Alta fortwollte, dass er die schlimmste Stelle im schlimmsten Dezernat des schlimmsten Polizeireviers angenommen hätte. »Aber Vorsicht«, warnte Fuster. »Das ist kein bequemer Tausch. Die Einheit ist sehr anspruchsvoll. Du wirst dich nicht langweilen und eine Menge lernen, allerdings auch schuften wie ein Ochse.« »Perfekt«, sagte Melchor.
Er meinte es ernst, denn gerade die mangelnde Beschäftigung und die ländliche Geruhsamkeit in Terra Altas Polizeirevier, die ihm vor Jahren, während seiner Zeit mit Olga, so gutgetan hatten, waren ihm jetzt unerträglich geworden, und je mehr ihn die Arbeit in Anspruch nehmen würde, dachte er, desto besser. Außerdem wusste Melchor, dass Cosette voller Neugier und Energie steckte, sich anpassen konnte und dass Olgas Tod sie keineswegs verstört, sondern ihren Charakter gestärkt hatte. Obwohl Cosette so fest in Terra Alta verwurzelt war wie er und die Gegend vielleicht nicht gern verließ, war er überzeugt, dass sie den Orts- und Schulwechsel, die Erfahrung der Großstadt, die Herausforderung neuer Freundschaften wie ein Abenteuer erleben würde. Er war sich auch sicher, dass sie liebend gern Vivales um sich haben würde.
Die Zentraleinheit für Entführung und Erpressung war Teil der Personenfahndung, die ihrerseits vom Kriminal- und Ermittlungsdienst (KED) abhing, und als Melchor dort anfing, begriff er, dass Comisario Fuster es ebenfalls ernst gemeint hatte. Allerdings hatte er ihn nicht davor gewarnt, dass die Einheit Entführung und Erpressung nicht nur anspruchsvoll, sondern einzigartig war. Damals bestand sie aus zwölf Mitgliedern, neun Männern und drei Frauen, die unter Sargento Vàzquez arbeiteten, einem kahl geschorenen Typ um die vierzig, muskulös und hyperaktiv, einer Bulldogge ähnlich und mit dem Ruf eines geradlinigen, kampflustigen Ermittlers. Ständig beschwerte sich Vàzquez bei seinen Vorgesetzten über den Personalmangel in seiner Einheit und mit gutem Grund: Das Team von Entführung und Erpressung arbeitete tatsächlich rund um die Uhr, an jedem Tag im Jahr und auf dem gesamten katalanischen Territorium. Einzigartig in ihrem Charakter und Vorgehen war die Einheit jedoch, weil sie die unauffälligste im ganzen Korps sein musste. Die Zurückhaltung war der Schlüssel zu ihrer Effizienz. Als Erstes lernte Melchor bei Entführung und Erpressung, dass die Chance, einen Fall zu lösen, umso größer ist, je weniger Leute von den Ermittlungen wissen. Einzigartig machte die Einheit auch der hohe Grad an Fachwissen, das sich Melchor im Eiltempo aneignen musste. Während der ersten Monate nahm er an vier Fortbildungen teil: über Verhandlungsmethoden, über Entführungen, über das organisierte Verbrechen und über fortgeschrittene Ermittlungstechniken. Es waren Sonderkurse, für die sich nur Ausgewählte anmelden konnten (aus der Einheit oder ähnlichen Einheiten der Guardia Civil, der Policía Nacional oder der baskischen Ertzaintza), der Stoff unterlag strenger Geheimhaltung, nichts durfte durchsickern, nicht einmal schriftliche Unterlagen wurden verteilt. »Wenn die Bösen mitbekommen, wie wir sie bekämpfen, ist alles im Eimer«, warnte Vàzquez alle im Kurs. »Also, was ihr hier lernt, bleibt in diesen vier Wänden. Wie mal ein Weiser gesagt hat: Nichts kommt gegen das Schweigen an.«
Einige Monate lang gefiel Melchor seine neue Stelle. Er arbeitete viel, kümmerte sich um Cosette, las Romane und plauderte mit Vivales (der ihm dabei half, sich um Cosette zu kümmern). Er war noch immer ein leidenschaftlicher Leser, aber nun teilte er seine Lesezeit zwischen den eigenen Büchern und denen, die er vor dem Schlafengehen seiner Tochter vorlas. Die hatte sich so begeistert und mühelos in der Großstadt eingelebt, wie er erwartet hatte. Melchor wusste natürlich, dass das Mädchen Terra Alta vermisste, hörte sie jedoch nie klagen. Auch er vermisste die Gegend manchmal. Außerdem begriff er bald, dass er noch so viel arbeiten, noch so weit weg von Terra Alta sein konnte, es würde ihm nicht gelingen, Olgas Tod zu verdrängen, und so fand er sich damit ab, dass er für immer mit dieser dornigen Erinnerung würde leben müssen.
Zu seiner Überraschung hatte die Rückkehr nach Barcelona eine andere Erinnerung geweckt, nicht weniger dornig, die Jahre vor sich hin geschlummert hatte: die an die Ermordung seiner Mutter. In Terra Alta hatte er hin und wieder an sie gedacht, jedoch nie oder fast nie an die Art ihres Todes. Diese heilsame Verdrängung hatte vermutlich damit zu tun, dass er nach all den Jahren besessener Ermittlungen – in seiner Freizeit auf eigene Faust und unter Verletzung elementarster Regeln – kurz vor seinem Umzug nach Terra Alta zufällig den Namen der Begleiterin seiner Mutter in jener unheilvollen Nacht herausbekommen hatte, Carmen Lucas, und nachdem er sie in einer kleinen Gemeinde in der Huerta de Murcia ausfindig gemacht hatte, war er hingefahren und hatte sie zwei Tage lang befragt, ohne dass sich eine einzige Spur zu den Mördern ergeben hätte, und schließlich fand er sich damit ab, dass dieses Verbrechen niemals aufgeklärt werden würde. Doch nun war die Erinnerung wieder da, brennend und hartnäckig, als würde ihn die Rückkehr nach Barcelona darauf stoßen, auf seine eigene und auf all die schrecklichen Erinnerungen anderer: seine Mutter, die sich zusammen mit Carmen Lucas und ihren Schicksalsgefährtinnen in der Gegend des Camp Nou prostituierte; ein brauner BMW, ein dunkler Volkswagen oder ein schwarzer Skoda, je nach befragtem Zeugen, in den seine Mutter nach gescheiterten Verhandlungen mit den Insassen (»eine Bande verwöhnter Söhnchen, die sich mit Papas Wagen vergnügen wollen«, hatte Carmen Lucas gesagt) zuerst nicht hatte einsteigen wollen und in den sie später dann doch gestiegen war, die Verzweiflung einer Nacht ohne Kunden; der Leichnam seiner Mutter, der im Morgengrauen auf einem freien Feld bei La Sagrera in Sant Andreu gefunden worden war, ihr Schädel mit einem Stein zerschmettert. All diese Erinnerungssplitter verschmolzen zu einer einzigen stechenden Erinnerung, die nun mit aller Gewalt zurückdrängte, als hätte ein widerständiger Winkel in Melchor noch immer nicht akzeptiert, dass dieser lang zurückliegende Mord nie gesühnt werden würde. Kurzum: Aus Terra Alta war er vor einem gelösten Verbrechen geflohen, und in Barcelona hatten ihn zwei eingeholt, eines gelöst, das andere nicht.
Nachdem er begriffen hatte, dass ihn seine schlimmsten Erinnerungen, so sehr er sie auch abschütteln wollte, nicht losließen, beschloss er, nach Terra Alta zurückzukehren. Um seine Versetzung wollte er erst gegen Ende des Schuljahrs bitten, doch in der Zwischenzeit sorgte ein Fall dafür, dass sich die Einheit Entführung und Erpressung praktisch auflöste.
Die Tochter eines venezolanischen Drogenbosses, der mit seiner Familie in einer Villa in Ampuriabrava lebte, ein Dorf am Meer, nah der französischen Grenze, war entführt worden. Eine rivalisierende Bande, die der Venezolaner hatte betrügen wollen, hatte das Mädchen verschleppt und für die Freilassung ein Lösegeld verlangt, das er unter keinen Umständen aufbringen konnte. Die gesamte Einheit arbeitete monatelang an dem Fall, mit Vàzquez als Hauptunterhändler zwischen den Narcos. Es waren zähe, komplizierte und nervöse Verhandlungen, in deren Verlauf der venezolanische Drogenboss, einen nach dem anderen, drei Finger seiner Tochter erhielt, sie war gerade erst fünf geworden. Schließlich glaubte Vàzquez, das Mädchen in einer Lagerhalle am Stadtrand von Molins de Rei ausfindig gemacht zu haben, und mit einem Aufgebot von achtzig Leuten, beteiligt auch die Guardia Civil und die Policía Nacional, startete er einen Rettungseinsatz. Die Operation scheiterte. Es gab drei Verhaftungen und einen Toten, doch die Tochter des Drogenbosses konnten sie nicht retten. Melchors eindringlichste Erinnerung an jenen Tag war der Anblick von Vàzquez, der auf dem Betonboden der Lagerhalle in einer Blutlache saß, den abgetrennten Kopf des Mädchens im Schoß, die Augen weit aufgerissen, zitternd und kreischend wie ein Besessener.
Man musste Vàzquez den Kopf aus den Händen winden und lieferte den Sargento noch am selben Tag in ein Krankenhaus ein, das er erst nach einer Woche wieder verließ, jedoch kehrte er nicht zu Entführung und Erpressung zurück, sondern ließ sich auf eigenen Wunsch nach La Seu d’Urgell in der Provinz Lleida, in den Pyrenäen, versetzen, woher er stammte. All das erfuhr Melchor erst nach und nach, bereits wieder zurück in Terra Alta. In den folgenden Jahren verließ er die Region nicht, widmete sich seiner Tochter und der Arbeit auf dem Revier. In seiner reichlichen Freizeit half er in der Bibliothek aus, in der Olga gearbeitet hatte, und studierte an der Universitat Oberta de Catalunya Information und Dokumentation. Natürlich las er auch Romane, hatte allerdings seit Olgas Tod Die Elenden nicht wieder zur Hand genommen, bislang sein Lieblingsroman, der Spiegel, in dem er sich betrachtete, die Waffe, mit der er sich gegen die Angriffe des Lebens verteidigte. Eine andere, mehr oder weniger geheime Angewohnheit hatte er dagegen nicht ablegen können. Darauf war Verlass: Wurde in Terra Alta jemand wegen Misshandlung einer Frau angezeigt, bezog dieser Jemand Prügel; von wem, das wussten alle, zumindest auf dem Revier, und alle mussten wegsehen.
Nach dem Mittagessen wäscht Melchor ab, macht sich einen Kaffee und liest auf dem Esszimmersofa weiter in den Manuskripten. Um fünf stellt sich mit routinierter Pünktlichkeit Inspector Blai ein.
»Frauen aus Terra Alta sind echt das Letzte«, lauten seine ersten Worte, als er schwitzend Melchors Wohnung betritt. »Keine Chance, die hier rauszureißen.«
Seit der ehemalige Leiter von Terra Altas Ermittlungseinheit nach Barcelona gegangen ist, hat Melchor diese Klage schon abertausendmal von ihm gehört: Dass seine Frau sich an ein Leben fernab nicht gewöhnen kann und die Familie deshalb jedes Wochenende zu seinen Schwiegereltern fährt, nach La Pobla de Massaluca. Melchor bietet seinem Freund einen Kaffee an, und während er die Maschine bedient, klagt Blai weiter, den massigen Körper gegen den Rahmen der Küchentür gelehnt.
»Die ganze Woche über arbeite ich wie ein Ochse, dann kommt das Wochenende, und auf in den Wagen und den Kragen riskiert auf diesen elenden Straßen, damit wir so schnell wie möglich nach Terra Alta gelangen, sonst geht die Welt unter. Anstatt mich also auszuruhen wie jeder normale Mensch, geht es Samstag und Sonntag bergauf, bergab, damit die Kinder die Heimat ihrer Mutter kennenlernen und ihre Wurzeln nicht vergessen. Ich scheiß auf die verdammten Wurzeln. Als wir noch hier gelebt haben, waren uns die Wurzeln scheißegal, allen voran meiner Frau. Ganz zu schweigen von der Überdosis Schwiegereltern, die mir hier reingewürgt wird. Von den Kindern fang ich erst gar nicht an: Kein Mensch hält die aus. Aber sag, wo ist eigentlich Cosette?«
»Bei einer Freundin.«
»Geht’s ihr gut?«
»Sehr gut.«
»Und dir?«
»Mir auch.«
»Na los, Mann, ich will eine gute Nachricht, komm schon. Sag, dass du dir eine Freundin angelacht hast. Rette meinen Tag, nötig wie ich’s hab. Aber beherzige einen Gratisratschlag: Nimm bloß keine aus Terra Alta. Die kriegst du später nicht mehr von hier weg.«
»Dann komm eben zurück«, sagt Melchor. »Du weißt sicher, dass wir seit Mai keinen Chef mehr haben, oder?«
»Ob ich das weiß?«
Die Kaffeemaschine hat mit einem Knirschen wie von zerriebenem Schotter zu Ende gemahlen, und bevor Melchor den blinkenden Knopf drückt, damit aus zwei Röhrchen aus rostfreiem Stahl die Flüssigkeit zu fließen beginnt, wendet er sich zu Blai, der nun neben ihm steht.
»Kannst du ein Geheimnis bewahren?«, fragt der Inspector.
Melchor hat gerade einen Roman von G.K. Chesterton gelesen, in dem eine Figur genau dieselbe Frage stellt und der andere antwortet: »Wie sollte ich, wenn nicht einmal du das Geheimnis bewahren kannst?« Aber er will seinen Freund nicht verärgern und antwortet:
»Natürlich.«
»Den Posten hat man mir angeboten.«
»Den des Revierchefs?«
Blai nickt bekümmert. Melchor fragt:
»Und was hast du gesagt?«
»Was soll ich schon sagen?«, faucht er wild gestikulierend. »Nach all der Mühe, die es mich gekostet hat, aus dem Loch hier rauszukommen …«
Das stimmt. Vor zweieinhalb Jahren, als er noch Sargento und Leiter von Terra Altas Ermittlungseinheit gewesen war, hatte Blai auf Anraten seiner Vorgesetzten das Auswahlverfahren für den Posten eines Inspectors durchlaufen. Man war der Ansicht gewesen, das Polizeikorps könne von der Aura des Superermittlers profitieren, die ihn nach all den Radio- und Fernsehauftritten zum Fall Adell umgab, dessen Aufklärung öffentlich ihm zugeschrieben worden war. Weder Blai noch sonst jemand in Terra Altas Revier hatte das geringste Interesse daran, die offizielle Version zu dementieren, nach der er und nicht Melchor den Fall gelöst hatte. Anfangs war es Melchor ein wenig unbehaglich gewesen, denn er dachte, Blai halte sich insgeheim vielleicht für einen Schwindler; doch seine Bedenken wurden zerstreut, als er begriff, dass sein früherer Chef so unzählige Male und in allen Einzelheiten öffentlich erklärt hatte, wie es ihm gelungen war, den Fall Adell zu lösen, dass er selbst die Wirklichkeit völlig vergessen hatte, und wenn Blai nicht gerade allein mit Melchor auf den Fall zu sprechen kam, schien er überzeugt zu sein, dass tatsächlich er und nicht Melchor den Verantwortlichen dieses Dreifachmords auf die Spur gekommen war.
Blai besteht noch einmal darauf, dass sein Freund Stillschweigen bewahrt (»Sei so gut, eh, Sauspanier? Du kennst meine Frau nicht: Wenn die mitbekommt, dass ich den Posten abgelehnt habe, kassiert sie meine Eier«). Er schimpft weiter über sein Leben zwischen Barcelona und Terra Alta, bis ihm Melchor seine Kaffeetasse reicht und auf Olgas Stuhl deutet, er setzt sich und sagt:
»Weißt du, was mich für den ganzen Scheiß ein wenig entschädigt?«
Melchor errät die Antwort, denn er kennt seinen ehemaligen Chef so gut wie der ihn.
»Was?«, fragt er dennoch.
Melchor weiß, Erleichterung von den familiären Leiden verschafft Blai nicht, dass die hohen Tiere, die ihn zum Auswahlverfahren ermuntert und ihm unter der Hand Unterstützung versprochen hatten, am Ende Wort hielten und ihn zum Inspector beförderten; auch nicht, dass er bei seinem Aufstieg eine Stufe übersprungen, also nicht erst Subinspector hatte werden müssen; nicht einmal, dass er trotz dieser skandalösen Bevorzugung sehr bald schon bewiesen hatte, was für ein kompetenter Polizist er ist – unabhängig von seinen tatsächlichen Leistungen in der Vergangenheit – und die Beförderung verdient hatte. Denn bald darauf wurde ihm die Leitung des Dezernats für Personenfahnung anvertraut, und er landete im Hauptquartier in Egara, schon immer sein Traum, denn dort verfügt man über alle Mittel, trifft alle relevanten Entscheidungen.
Nein: Blais Entschädigung ist anderer Natur.
»Jeden Tag Gomà zu begegnen«, verkündet der Inspector, führt die Tasse an die Lippen und lässt sich weniger den Kaffee schmecken als den eben ausgesprochenen Satz. Die beiden Polizisten sitzen einander gegenüber, zwischen ihnen der Tisch, auf dem die Zutaten für Cosettes Frühstück stehen: eine Schachtel Kellogg’s Corn Flakes und eine mit Schokomaiswaffeln, für die ein Fernsehkoch wirbt. Blai setzt, die Tasse noch in der Hand, eine selige Miene auf. »Ihm auf dem Gang zu begegnen, ihn bei den Sitzungen zu sehen, einen Kaffee zu trinken, wenn er am Nebentisch sitzt«, zählt er auf. »Gott, was für eine Genugtuung. Hätte er sich vor vier Jahren wohl nicht träumen lassen, der Angeber, eh? Hätte sich nicht träumen lassen, dass der Sargento, den er so rücksichtslos vom Fall Adell abgezogen hat, damit er den Triumph allein genießen kann, jetzt sein Vorgesetzter in Egara ist und er immer noch ein jämmerlicher Subinspector, weil er in dem Auswahlverfahren, das ich bestanden habe, durchgefallen ist. Und er hätte sich wohl nicht träumen lassen, dass ihm das eben deshalb passiert, weil er mich vom Fall Adell abgezogen hat, denn er hat ihn nicht lösen können, und ich musste für ihn die Kastanien aus dem Feuer holen. Ja, ja, ich weiß, jetzt sagst du, man hat mich nicht bloß wegen der Aufklärung des Falls Adell befördert, ich hatte schon vorher Verdienste genug, um Inspector zu werden, aber … Wie das Leben so spielt, was, Sauspanier? Ach ja, hast du das von Salom gehört?«
Melchor blickt von der karierten Wachstuchdecke auf und mustert Blai.
»Von Salom weiß ich nichts«, sagt er.
Blai scheint nicht überrascht zu sein; er kippt den Kaffee in einem Zug hinunter und stellt die Tasse auf das Tellerchen. Er ist bald ein halbes Jahrhundert alt, und obwohl kein einziges Haar auf seinem Schädel wächst, wirkt er durch seinen Körper ohne jedes Fettpolster, durch seine muskulöse Erscheinung eines Fitnessfanatikers zehn oder fünfzehn Jahre jünger; er ist eins neunzig groß, trägt eng anliegende Sportkleidung, und seine blauen Augen bohren sich erbarmungslos in sein Gegenüber.
»Du hast ihn also nicht in Quatre Camins besucht, stimmt’s?«
Melchor schüttelt den Kopf.
»Du solltest nicht so unversöhnlich sein. Schließlich war er dein bester Freund.«
»Ich bin nicht unversöhnlich. Ich habe ihm bloß nichts zu sagen.«
»Nun, er aber dir. Ich soll dich zu ihm schicken. Er will sich wohl entschuldigen.«
»Das hat er bereits.«
»Er will sich wirklich entschuldigen. Es tut ihm aufrichtig leid.« Blai legt eine etwas theatralische Pause ein. »Wir machen doch alle Fehler, oder?«
Melchor lächelt.
»Hältst du mir jetzt eine Predigt?«
»Fahr zur Hölle, Sauspanier.«
Melchor bewahrt sich ein Lächeln auf den Lippen, während die beiden Männer einander kurz mustern. Hohe Kinderstimmen dringen aus der Carrer de Costumà zu ihnen, und Melchor fragt sich, ob Blai ihn so dringend sehen wollte, um von dem ehemaligen Caporal zu erzählen.
»Was ist los mit Salom?«, fragt er.
»Nichts«, entgegnet der Inspector. »Neulich habe ich die Richterin getroffen, die den Strafvollzug überwacht und für ihn verantwortlich ist; sie hat gesagt, sie haben seine Strafe wieder verkürzt. In zwei Jahren kommt er raus. Vielleicht früher.«
Die Kinderstimmen sind verstummt, eine unbehagliche Stille hat sich der Küche bemächtigt.
»Das freut mich für ihn«, sagt Melchor. »Und für seine Töchter.«
»Siehst du sie manchmal?«
»Hin und wieder, vor allem Claudia. Sie unterrichtet an der Schule.« Nach einer Pause fügt er hinzu: »Aber keine von ihnen grüßt mich.«
Blai seufzt, schüttelt den Kopf, schnalzt.
»Ist normal, findest du nicht?«, sagt er. Plötzlich beleben die Kinderstimmen wieder den trägen Nachmittag. »Die Mutter tot, der Vater im Gefängnis und ihre Träume im Eimer. Mit Mitte zwanzig. Die ewig gleiche Geschichte in Terra Alta, deshalb wollte ich weg von hier … Das Leben wurde ihnen versaut.«
»Von uns. Zumindest haben wir den letzten Schubs gegeben.«
»Schwachsinn. Versaut hat es ihnen der Vater, weil er getan hat, was er getan hat.«
»Mag sein, aber wir haben ihn vor Gericht gebracht. Außerdem hat er es für sie getan. Wir beide wissen das.«
»Was denn? Diesem hirnverbrannten Ferrer zu helfen, die Adells umzubringen? Das hat er für seine Töchter getan? Hör bloß auf, Mann! Er hat’s getan, weil ihm die Sache aus dem Ruder gelaufen ist, denn zu viel gepackt, zerreißt den Sack, so sagt man doch?«
»Eben hast du ihn noch verteidigt.«
»Ihn verteidigen ist eines, aber behaupten, er sei nicht verantwortlich für seine Taten, etwas ganz anderes. Warum er es getan hat, weiß ich nicht, aber er hat es nun mal getan. Ich finde es gut, dass er Reue zeigt, aber getan hat er es. Und Schluss.« Aufgebracht wendet Blai den Blick ab, fixiert Melchor jedoch gleich wieder, auf einmal neugierig: »Sag, du bereust es doch nicht etwa, ihn vor Gericht gebracht zu haben, oder?«
Genervt schiebt Melchor die Cornflakesschachtel an die Wand und steht auf.
»Hör schon auf mit der Reue«, sagt er. »Noch einen Kaffee?«
Blai nickt, und Melchor wirft die Kaffeemaschine wieder an. Während die Küche sich erneut mit dem Knirschen der Bohnen im Mahlwerk füllt, fragt sich Melchor, ob Blai Saloms Freilassung beunruhigt.
»War es das, was du mir so dringend erzählen wolltest?«, fragt er.
»Nein«, sagt der Inspector in verändertem Ton, steht auf und geht in der Küche umher. »Ich bin gekommen, weil ich ein Problem habe.«
Melchor wartet, bis die Bohnen gemahlen sind, drückt auf den leuchtenden Knopf, und die beiden Röhrchen sondern die dunkle Flüssigkeit ab.
»Was für ein Problem?«, fragt er, ohne sich umzudrehen.
»Ich erzähle es dir, wenn du versprichst, mir zu helfen.«
Als die Röhrchen nichts mehr von sich geben, stellt er eine weitere Tasse darunter und drückt noch einmal auf den Knopf.
»Ich soll dir bei einem Fall helfen?«
»Genau.«
»Ich soll wieder bei Entführung und Erpressung einsteigen?«
»Ja. Nur für ein paar Tage, bis die Sache geklärt ist.«
Wieder herrscht Schweigen in der Küche, diesmal durchsetzt von dem elektronischen Surren der Kaffemaschine. Seit einer Weile schon sind keine Kinderstimmen mehr zu hören.
»Ich springe nicht ein«, sagt Melchor. »Ich habe mich zurückgezogen. Außerdem kenne ich dort niemanden mehr.«
»Du irrst dich. Vàzquez ist zurück.«
Melchor dreht sich um und zieht eine fragende Augenbraue hoch.
»Seit fast einem Jahr«, erläutert Blai. »Der neue Comisario des Kriminaldezernats hat ihn überzeugt. War wohl nicht so schwer: Anscheinend hat er sich in La Seu d’Urgell zu Tode gelangweilt.«
»Das hast du mir nicht erzählt.«
»Du hast mich nicht gefragt.«
Melchor macht eine vage Geste der Zustimmung und wendet dem Inspector wieder den Rücken zu.
»Gut, das freut mich, denn das heißt, du brauchst mich nicht«, argumentiert er. »Vàzquez ist hervorragend.«
»Das weiß ich, aber bei dem ist eine Scheißschraube locker. Du kennst ihn: Der kocht sein eigenes Süppchen. Ich kann ihm nicht vertrauen, zumindest nicht in diesem Fall. Deshalb brauche ich dich.«
»Vergiss es.«
»Es ist nur für kurze Zeit, mit etwas Glück haben wir die Sache in einer Woche erledigt. Außerdem habe ich Vàzquez schon gesagt, dass du kommst. Er ist begeistert.«
»Tja, das war eine Lüge.«
»Komm mir nicht damit, Sauspanier.«
»Ich komme mit gar nichts. Gib’s auf. Such dir einen andern.«
Blai protestiert, flucht, schnaubt. Der Kaffee ist wieder durchgelaufen, und Melchor hält nun schon seit ein paar Sekunden seinem Kollegen die halb volle Tasse hin, doch der scheint nicht bereit zu sein, sie entgegenzunehmen, als stünde diese Weigerung für eine andere: die Weigerung, die Diskussion für beendet zu erklären. Scheinbar fügt er sich schließlich, nimmt die Tasse, trinkt einen Schluck, dann noch einen und fragt:
»Was heißt das, du hast dich zurückgezogen?« Sein beiläufiger Ton täuscht Melchor nicht: Blai hat nicht aufgegeben, nur die Strategie geändert. »Willst du dich pensionieren lassen, oder was?«
Melchor, ebenfalls mit seiner Tasse in der Hand, entgegnet:
»So ungefähr. Sobald eine Stelle in der Bibliothek frei wird, bewerbe ich mich und verlasse das Revier.«
Blai starrt Melchor an, als hätte er ihm mitgeteilt, er wolle sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen.
»Sag mal, bist du völlig durchgedreht?«
Melchor trinkt seinen Kaffee aus, stellt die Tasse in die Spüle und schaltet die Kaffeemaschine ab.
»Ich dachte, ich hätte dir erzählt, dass ich an der UOC Bibliothekswissenschaft studiere.«
»Ja, aber …«
»Eigentlich muss ich nicht mal zu Ende studieren. Nur wenn ich Bibliotheksdirektor werden will. Sobald also eine Stelle als Bibliotheksassistent frei wird, bewerbe ich mich. Ich verdiene dann weniger als bei der Polizei, aber es wird genügen. Cosette und ich, wir kommen mit wenig aus.«
Blai hat sein Staunen noch immer nicht überwunden.
»Du nimmst mich auf den Arm, oder?«
»Nein«, sagt Melchor.
Nun mischt sich Ärger in Blais Verblüffung.
»Du bist völlig verrückt geworden, Mann«, urteilt er und wiegt den Kopf. »Du, ein Bibliothekar? Was zum Teufel geht in dir vor? Willst du Olga ersetzen oder was?«
»Natürlich nicht«, entgegnet Melchor. »Wie kommst du auf die Idee?«
»Verzeih, wenn ich dich dran erinnern muss«, fährt Blai fort, als hätte er seinen Freund nicht gehört. »Aber deine Frau ist tot, gestorben vor vier Jahren, begreif das endlich, es wird Zeit.« Melchor gelingt es nicht, ihn zu unterbrechen, Blai hat sich in Fahrt geredet: »Außerdem wirst du’s fern vom Revier nicht aushalten. Ab und an in der Bibliothek aushelfen ist eines, etwas ganz anderes, den ganzen Tag dort verbringen, Bücher ordnen, alte Leute bedienen, Kindern Geschichten vorlesen und Romane zum Stadtbad karren, damit die Halbwüchsigen vielleicht Lust aufs Lesen bekommen, die sonst bloß ans Vögeln denken, glaub mir, ich hab ein paar von der Sorte zu Hause. Also, das hältst du keine Woche durch. So wahr ich Blai heiße. Mir ist noch keiner untergekommen, der so durch und durch Bulle ist wie du, Mann!«
»Nicht mehr«, kann Melchor kurz einwerfen. »Das war früher.«
»Ach ja? Die Berufung kann man also ausheilen lassen wie eine Bindehautentzündung?«
»Das mit der Berufung ist ein Märchen, Blai.«
»Ach, papperlapapp.«
Die beiden Polizisten stehen an der marmornen Arbeitsplatte und messen sich mit dem Blick. Blai hat die Fäuste geballt, seine Unterarme zittern, die Kinnlade scheint zu bersten, wie üblich, wenn er in Wut gerät. Melchor hingegen verspürt das, was er früher oder später immer spürt, wenn er mit seinem ehemaligen Chef spricht: Dass er sein Getobe vermisst.
»Na komm, trink deinen Kaffee«, sagt er. »Er wird kalt.
Frustriert und widerstrebend, um weitere Vorwürfe verlegen, trinkt Blai den Kaffee aus, und Melchor blickt zur Wand auf die Küchenuhr in Form eines Apfels. Es ist nach sechs.
»Ich hole jetzt Cosette ab«, kündigt er an. »Kommst du mit?«
Blai packt Melchor beim Arm.
»Weißt du, warum ich deine Hilfe brauche?«
Der Kaffee hat Blai nicht entspannt. Seine Hand ist eine Klaue.
»Weil ich keinem vertraue«, antwortet er selbst und sucht verzweifelt Melchors Blick. »Egara schön und gut, aber da wimmelt es von Schnöseln und Schaufensterpuppen; kaum ein echter Polizist. Außerdem hat man mir einen wirklich wichtigen Fall übertragen. Was sage ich, einen Ausnahmefall. Meine Chefs denken schon, sie hätten sich in mir getäuscht. Sie sagen es nicht, aber ich weiß es, das merkt man, Melchor, wie wenn deine Frau dich betrügt. Sie fragen sich allmählich, ob das mit dem Fall Adell nicht bloß ein Glückstreffer war, ob ich nicht ein Blender bin. Ich mache mir Sorgen, das verstehst du doch, oder?«
»Solltest du aber nicht«, entgegnet Melchor.
Blais Blick verändert sich, die Beklemmung wird zu Neugier, echter Neugier.