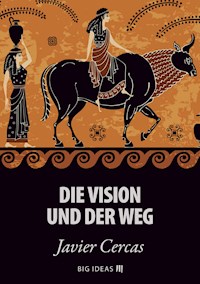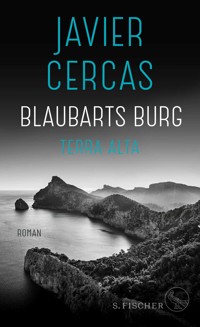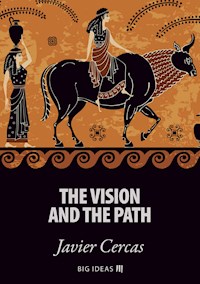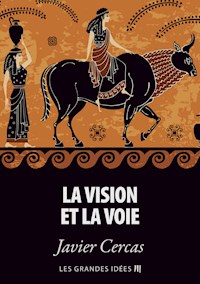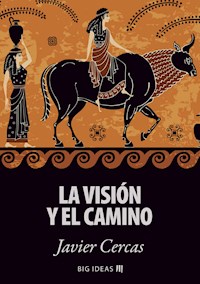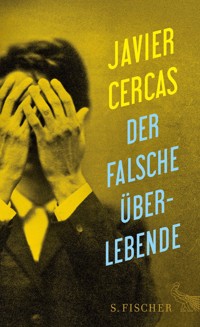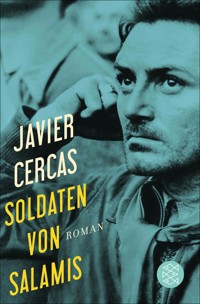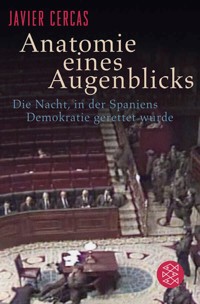9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie kiffen, klauen, hängen ab. Der Anführer Zarco, der allen Angst einjagt, die verführerische Tere mit den grausam grünen Augen, und all die anderen, die kein Zuhause haben. Als Ignacio dazustößt, werden aus Kleinkriminellen bewaffnete Gangster. Banküberfälle, Nutten und harte Drogen sind jetzt ihr Alltag. Dann gibt es den ersten Toten, und Ignacio weiß: wenn er leben will, muss er aussteigen, auch wenn er die schöne Tere nie wiedersehen wird. Jahre später treffen sie sich vor Gericht wieder: Zarco als Angeklagter und Ignacio als Strafverteidiger. Aufwühlend und sehr einfühlsam erzählt Javier Cercas von den zerrissenen Freundschaften einer verlorenen Jugend in Spanien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Javier Cercas
Outlaws
Roman
Aus dem Spanischen von Peter Kultzen
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Raül Cercas und Mercè Mas
Für die ganze Clique,
für über vierzig Jahre Freundschaft
Nous sommes si accoutumés à nous déguiser aux autres qu’enfin nous nous déguisons à nous-mêmes.
François de La Rochefoucauld
Erster TeilJenseits
1
»Fangen wir an?«
»Ja, fangen wir an. Vorher möchte ich Ihnen aber noch eine Frage stellen, die letzte.«
»Also gut.«
»Warum haben Sie sich darauf eingelassen, dieses Buch zu schreiben?«
»Hab ich das noch nicht gesagt? Des Geldes wegen. Ich lebe vom Schreiben.«
»Ja, ich weiß. Aber war das der einzige Grund?«
»Na gut, dass man über jemanden wie Zarco schreiben kann, kommt natürlich nicht allzu oft vor, wenn Sie das meinen.«
»Das heißt, für Zarco haben Sie sich schon vorher interessiert, vor dem Angebot, über ihn zu schreiben?«
»Natürlich, das geht doch allen so.«
»Ja. Wie auch immer, ich erzähle Ihnen jetzt jedenfalls nicht die Geschichte von Zarco, sondern die von meiner Beziehung zu ihm – zu ihm und zu …«
»Ja, ich weiß. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Können wir anfangen?«
»Ja, fangen wir an.«
»Erzählen Sie, wann haben Sie Zarco kennengelernt?«
»Im Sommer 1978, am Anfang. Das war eine komische Zeit. Heute kommt es mir wenigstens so vor. Franco war schon seit drei Jahren tot, aber die franquistischen Gesetze galten immer noch, und im ganzen Land roch es auch noch so wie unter Franco: nach Kacke. Ich war damals sechzehn, genau wie Zarco. Wir haben ganz nah und ganz weit voneinander gewohnt.«
»Wie meinen Sie das?«
»Kennen Sie die Stadt?«
»Nur ein bisschen.«
»Ist vielleicht besser so – die Stadt von damals und die von heute haben kaum was miteinander zu tun. In Gerona war es damals, als befände man sich immer noch in der Nachkriegszeit, ein düsteres Kaff fest im Griff der Kirche, ringsum bedroht durch das Land und im Winter in dicken Nebel gehüllt. Nicht dass das heutige Gerona besser wäre – in gewisser Hinsicht ist es sogar schlechter –, es ist einfach anders. Zu der Zeit wohnten zum Beispiel in den Vorstädten überall Charnegos. Das Wort hört man heute nicht mehr so oft, damals benutzte man es für die Migranten, die aus dem übrigen Spanien nach Katalonien kamen, fast immer Habenichtse, die auf der Suche nach einem Lebensunterhalt waren … Aber das wissen Sie ja selbst. Trotzdem wissen Sie vielleicht nicht, dass die Stadt, wie gesagt, Ende der siebziger Jahre von lauter Charnego-Vierteln eingekreist war: Salt, Pont Major, Germans Sàbat, Vilarroja. Da hockte der ganze Abschaum aufeinander.«
»Und Zarco wohnte auch dort?«
»Nein, Zarco wohnte in den sogenannten Behelfsunterkünften, an der nordwestlichen Stadtgrenze, unter dem Abschaum des Abschaums. Und ich wohnte gerade mal zweihundert Meter entfernt. Allerdings wohnte er jenseits der Grenze, also gleich dort, wo man landet, wenn man vom La-Devesa-Park aus den Río Ter überquert. Und ich diesseits, kurz vor der Brücke, in der Calle Caterina Albert. Der Stadtteil heißt heute immer noch La Devesa, aber damals war da nichts, oder so gut wie nichts, nur eine Ansammlung von Gemüsegärten und Brachen, in die die Stadt auslief. Zehn Jahre davor, Ende der sechziger Jahre, hatte man hier ein paar Wohnblocks hochgezogen, und meine Eltern hatten in einem davon eine Wohnung gemietet. In gewisser Hinsicht war auch das ein Charnego-Viertel, allerdings waren die Leute dort nicht ganz so arm wie die normalen Charnegos. Die meisten Familien bei uns waren Beamtenfamilien und gehörten zur Mittelschicht, meine auch – mein Vater hatte eine Stelle bei der Provinzverwaltung, nichts Besonderes. Diese Familien stammten nicht aus der Stadt, sie betrachteten sich aber trotzdem nicht als Charnego-Familien. Jedenfalls wollten sie mit den echten Charnegos nichts zu tun haben, zumindest nicht mit den armen Charnegos, mit denen aus Salt, Pont Major, Germans Sàbat und Vilarroja. Und natürlich erst recht nicht mit den Leuten aus den Behelfsunterkünften. Ehrlich gesagt, ich bin mir sicher, dass die allermeisten Bewohner der Calle Caterina Albert nie in den Behelfsunterkünften gewesen sind – um von den Leuten aus der Stadt gar nicht zu reden. Manche wussten vielleicht nicht mal, dass es diese Unterkünfte gab, oder sie taten wenigstens so. Ich wusste es sehr wohl. Ich wusste nicht genau, worum es sich dabei handelte, und dort gewesen war ich auch nie, aber ich wusste, dass sie existierten oder dass die anderen behaupteten, sie würden existieren. Für mich waren sie eine Art Mythos, der nie bewiesen oder widerlegt wurde – wir, die Jungen aus diesem Viertel, dachten bei dem Wort ›Behelfsunterkünfte‹, glaube ich, an eine Art rustikaler Berghütten, in denen man bei schlechtem Wetter Zuflucht finden konnte, wie in einem Abenteuerroman, was dem Ganzen einen irgendwie verwegenen Anstrich verlieh. Deshalb habe ich vorhin gesagt, dass ich ganz nah und ganz weit von Zarco wohnte – wir waren durch eine Grenze getrennt.«
»Und wie haben Sie diese Grenze überquert? Ich meine, wie kommt es, dass ein Junge aus der Mittelschicht sich mit einem Jungen wie Zarco anfreundet?«
»Mit sechzehn sind alle Grenzen durchlässig, wenigstens war das damals so. Es war aber auch Zufall. Bevor ich Ihnen diese Geschichte erzähle, müsste ich aber zuerst noch etwas anderes erzählen.«
»Nur zu.«
»Diese Geschichte habe ich noch nie erzählt – na gut, meinem Psychoanalytiker schon. Aber wenn Sie sie nicht kennen, werden Sie nie verstehen, wie und warum ich Zarco kennengelernt habe.«
»Keine Sorge, wenn Sie nicht möchten, dass sie in dem Buch vorkommt, lasse ich sie weg. Und wenn Sie nicht damit einverstanden sind, wie ich sie erzähle, streiche ich sie wieder raus. So haben wir es verabredet, und daran halte ich mich auch.«
»Gut. Wissen Sie, ich habe immer gehört, für Kinder kann das Leben ganz schön grausam sein, aber ich glaube, für Jugendliche gilt das noch viel mehr. Bei mir war es jedenfalls so. In der Calle Caterina Albert hatte ich mehrere Freunde: Mein engster Freund war Matías Giral, aber neben ihm gab es noch Canales, Ruiz, Intxausti, die Boix-Brüder, Herrero und noch ein paar. Wir waren alle ungefähr gleich alt, kannten uns seit dem achten oder neunten Lebensjahr, trieben uns die meiste Zeit auf der Straße herum und gingen alle auf die Maristenschule – das war die von uns aus nächstgelegene Schule. Außerdem waren wir natürlich alle Charnegos, bis auf die Boix-Brüder. Die kamen aus Sabadell und sprachen untereinander Katalanisch. Kurz gesagt: Brüder hatte ich keine, nur eine Schwester. Aber statt Brüdern hatte ich als Kind eben meine Freunde, ich glaube, das kann man so sagen.
Später war das nicht mehr so. Ungefähr ein Jahr bevor ich Zarco kennenlernte, änderte es sich allmählich. Damals kam zum Schuljahresanfang ein neuer Junge in unsere Klasse. Er hieß Narciso Batista und war durchgefallen. Sein Vater war der Präsident der Provinzverwaltung und der Chef meines Vaters. Wir waren uns ein paarmal begegnet, daher kannten wir uns. Deshalb und weil unsere Nachnamen aufeinanderfolgten, wurden wir nebeneinandergesetzt – Cañas kam in der Klassenliste gleich nach Batista –, und so wurde ich sein erster Freund in der Klasse. Durch mich freundete er sich mit Matías an, und durch Matías und mich mit meinen anderen Freunden. Außerdem wurde er zum Anführer unserer Gruppe, die bis dahin noch nie einen Anführer gehabt hatte – mir war es wenigstens so vorgekommen. Aber vielleicht hatten wir auch nur darauf gewartet, als Jugendlicher ist man ja vor allem ängstlich und unsicher und wartet bloß darauf, dass ein Anführer auftaucht, mit dem man seine Angst bekämpfen kann. Batista war zwei Jahre älter als wir, stärker, und er wusste, wie man sich Gehör verschafft. Außerdem hatte er alles, wovon ein Charnego nur träumen konnte: Eine angesehene wohlhabende katalanische Familie – die sich allerdings als durch und durch spanisch betrachtete und alles verachtete, was mit Katalonien, geschweige denn mit einem unabhängigen Katalonien, zu tun hatte; noch schlimmer war nur, was unmittelbar mit Barcelona zu tun hatte –, eine große komfortable Wohnung, einen Mitgliedsausweis des Tennisvereins, ein Sommerhaus in S’Agaró und für den Winter eins in La Molina, eine Lobito 75 Kubik und einen Raum ganz für sich allein, eine ehemalige Garage in der Calle de La Rutlla, wo man nachmittags Rock ’n’ Roll hören, rauchen und Bier trinken konnte.
So weit also alles ganz normal. Von da an aber überhaupt nicht mehr. Damit meine ich, dass sich Batistas Verhalten mir gegenüber innerhalb weniger Monate vollkommen veränderte, seine Zuneigung verwandelte sich in Ablehnung, die Ablehnung in Hass, und der Hass in Gewalt. Warum? Keine Ahnung. Lange Zeit habe ich versucht mir einzureden, Batista habe mich einfach zum Sündenbock erkoren, weil die Gruppe danach verlangte. Aber, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich in kürzester Zeit von seinem Freund zu seinem Opfer wurde.
Opfer klingt ziemlich pathetisch, ich weiß, aber lieber lasse ich mir vorwerfen, ich hätte einen Hang zum Kitsch, als dass jemand mich als Lügner bezeichnet. Anfangs machte Batista sich bloß über mich lustig. Seine Muttersprache war Katalanisch, aber wenn ich Katalanisch sprach, lachte er mich aus. Nicht, weil ich Fehler gemacht hätte, er fand es nur blöd, wenn jemand Katalanisch sprach, der gar kein Katalane war. Außerdem machte er sich über mein Aussehen lustig und nannte mich Dumbo, weil meine Ohren angeblich so groß wie die von dem Walt-Disney-Elefanten waren. Und auch weil ich nicht wusste, wie man Mädchen aufreißt, verspottete er mich, genauso wegen meiner Streber-Brille und meiner Streber-Noten. Sein Spott wurde immer aggressiver. Ich wusste nicht, was ich dagegen tun sollte, und meine Freunde, die anfangs bloß mitlachten, fingen schließlich an, sich auch über mich lustig zu machen. Irgendwann reichten Batista bloße Worte nicht mehr, und schon bald kannte er nichts Schöneres, als mir halb im Scherz, halb im Ernst gegen die Schulter oder die Rippen zu boxen. Manchmal verpasste er mir auch eine Ohrfeige. In meiner Hilflosigkeit fiel mir nichts anderes ein, als die Schläge lachend einzustecken und so zu tun, als würde ich gleich zurückschlagen. Es war, als hätte ich mich selbst überzeugen wollen, dass das Ganze nicht ernst gemeint war. So ging es eine Zeit lang. Bis ich mir irgendwann nichts mehr vormachen konnte: Die scheinbaren Späße waren genauso grob und brutal, wie sie sein sollten. Da lachte ich nicht mehr darüber, sondern weinte und versuchte, den anderen aus dem Weg zu gehen. Batista verhielt sich nämlich, wie schon gesagt, nicht als Einziger so. Er schlug am heftigsten zu, und von ihm gingen die Attacken normalerweise aus, aber der Rest meiner Freunde schloss sich regelmäßig an, bis auf Matías, der versuchte wenigstens manchmal, Batista zurückzuhalten. Jahrelang habe ich mich bemüht, das Ganze zu vergessen, bis ich mich vor kurzem selbst gezwungen habe, mich wieder daran zu erinnern, und da habe ich gemerkt, dass mir manche Wunden aus dieser Zeit noch tief in der Seele sitzen. Einmal schubste Batista mich in einen eiskalten Bach, der durch den Devesa-Park fließt, oder zumindest floss er damals dort hindurch. Bei einer anderen Gelegenheit – in Batistas Garage in der Calle de La Rutlla – zogen meine Freunde mich aus und sperrten mich nackt in eine stockfinstere Kammer, wo ich stundenlang nichts anderes tun konnte, als gegen die Tränen anzukämpfen und mir durch die Tür anzuhören, wie meine Freunde sich zu der lauten Musik, die sie auflegten, lachend und schreiend unterhielten. Und noch ein anderes Mal – an einem Samstag, an dem ich zu meinen Eltern gesagt hatte, ich würde bei Batista in S’Agaró übernachten – schlossen sie mich in der Garage ein und ließen mich dort fast vierundzwanzig Stunden lang allein und ohne Licht, Essen oder Trinken sitzen. Erst am Sonntagmittag durfte ich wieder raus. Und gegen Ende des Schuljahres – damals ergriff ich bereits die Flucht, wenn ich Batista außerhalb des Klassenzimmers nur zu sehen bekam – jagte er mir einmal einen solchen Schrecken ein, dass ich glaubte, er wolle mich umbringen: Zusammen mit Canales, Herrero, den Boix-Brüdern und noch einem anderen lauerte er mir in der Schultoilette auf, und als ich reinkam, fiel er über mich her und drückte meinen Kopf in eine Kloschüssel, in die sie alle zuvor gepinkelt hatten. Die anderen standen daneben und lachten. Das Ganze dauerte wahrscheinlich bloß ein paar Sekunden, aber mir kam es wie eine halbe Ewigkeit vor. Soll ich weitererzählen?«
»Wenn Sie nicht möchten, dann nicht. Aber wenn es Ihnen gut tut – bitte schön!«
»Gut tut es mir nicht – jetzt nicht mehr. Dafür finde ich es seltsam, dass ich Ihnen davon erzähle. Das ist etwas anderes. Mit der Geschichte von Batista geht es mir wie mit fast allem aus dieser Zeit: Es ist, als hätte ich es nicht erlebt, sondern geträumt. Aber Sie werden sich natürlich fragen, was das mit Zarco zu tun haben soll.«
»Nein. Ich frage mich, warum Sie damals niemandem davon erzählt haben.«
»Wem hätte ich denn davon erzählen sollen? Den Lehrern? Die Lehrer hatten eine gute Meinung von mir, aber Beweise für das, was ich zu erzählen gehabt hätte, hatte ich nicht, außerdem hätten die anderen mich dann als Lügner oder Petzer oder beides zusammen betrachtet, und das hätte alles nur noch schlimmer gemacht. Und meine Eltern? Meine Eltern waren nett, sie liebten mich, und ich liebte sie, trotzdem hatte unsere Beziehung seit einiger Zeit gelitten, so sehr, dass ich nicht den Mut aufbrachte, ihnen etwas von der Sache zu sagen. Außerdem – wie hätte ich es ihnen erzählen sollen? Und was genau? Dazu kommt, dass Batistas Vater, wie gesagt, der Chef meines Vaters war. Ich hätte meinen Vater in eine unmögliche Lage gebracht, wenn ich zu Hause von der Geschichte erzählt hätte. Trotzdem war ich mehrmals nahe dran, mehrmals hätte ich es wirklich fast getan, aber zuletzt habe ich es dann doch immer sein lassen. Und wem außer meinen Eltern hätte ich sonst davon erzählen sollen?
Die Schule wurde für mich dadurch jedenfalls zur Hölle. Monatelang heulte ich, wenn ich abends ins Bett ging, und auch morgens, beim Aufwachen, heulte ich. Ich hatte Angst. Und ich empfand Hass und Wut und fühlte mich gedemütigt, vor allem aber hatte ich Schuldgefühle. Am schlimmsten, wenn man gedemütigt wird, ist ja, dass man sich schuldig fühlt. Ich sah keinerlei Ausweg, am liebsten wäre ich gestorben. Aber glauben Sie bloß nicht, ich hätte dadurch etwas gelernt, im Gegenteil: Früher als die anderen zu begreifen, was das absolut Böse ist – und Batista war für mich das absolut Böse –, macht einen nicht besser, sondern schlechter. Und es bringt einem überhaupt nichts.«
»Immerhin haben Sie dadurch Zarco kennengelernt.«
»Stimmt. Aber sonst hat es mir nicht das Geringste gebracht. Kennengelernt habe ich ihn kurz nach Ende des Schuljahrs. Meine Freunde hatte ich damals schon eine Weile nicht mehr gesehen. In den Ferien war es einfacher, ihnen aus dem Weg zu gehen, völlig von der Bildfläche zu verschwinden war in einer so kleinen Stadt allerdings kaum möglich, so gut es gewesen wäre, um meine Freunde dazu zu bringen, mich zu vergessen. Ich tat, was ich konnte, um ihnen nicht in die Quere zu kommen, schlug einen großen Bogen um unsere üblichen Treffpunkte und einen noch größeren um die Garage in der Calle de La Rutlla, und wenn Matías vorbeikam oder anrief, um zu fragen, ob ich Lust hätte, etwas mit ihm und den anderen zu unternehmen, ließ ich mir irgendwelche Ausreden einfallen – ihn trieb wahrscheinlich sowieso nur das schlechte Gewissen, oder er glaubte, durch sein scheinbar großmütiges Verhalten davon ablenken zu können, wie sie in Wirklichkeit mit mir umsprangen. Wie auch immer, mein Ziel war, mich in diesem Sommer so wenig wie möglich auf der Straße blicken zu lassen, bis wir im August verreisen würden. Die Zeit bis dahin wollte ich mit Lesen und Fernsehen verbringen. So hatte ich es mir vorgestellt. Aber als Sechzehnjähriger den ganzen Tag zu Hause rumsitzen, das schaffst du nicht, da kannst du noch so deprimiert und eingeschüchtert sein, ich zumindest war nicht in der Lage dazu. Deshalb habe ich mich irgendwann doch rausgewagt, wenigstens ab und zu, und so landete ich eines Tages im Spielsalon Vilaró.
Dort bin ich Zarco zum ersten Mal begegnet. Der Spielsalon Vilaró war in der Calle Bonastruc de Porta, noch im Devesa-Viertel, gegenüber der Eisenbahnbrücke. Von solchen Spielhallen für Jugendliche gab es in den siebziger und achtziger Jahren jede Menge. Soweit ich mich erinnere, befand sich diese hier in einer Halle mit nackten Wänden und verfügte über eine sechsspurige Scalextric-Autorennbahn, mehrere Kickertische und Arcade-Automaten und sechs oder sieben Flipper, die an einer Wand aufgereiht standen. Hinten waren der Getränkeautomat und die Toiletten, und am Eingang die kleine Glaskabine von Herrn Tomàs. Herr Tomàs war ein vom Alter gebeugter, dickbäuchiger Mann mit Halbglatze, der den Kopf nur von seinem Kreuzworträtselheft hob, wenn ein technisches Problem zu beheben war – wenn zum Beispiel ein Spielautomat nicht richtig funktionierte oder eine der Toiletten verstopft war – oder irgendwo Streit ausbrach. Dann schmiss er die Störenfriede entweder raus oder sorgte mit seiner schrillen Stimme für Ordnung. Eine Zeit lang war ich mit meinen Freunden ziemlich regelmäßig hier gewesen, aber ungefähr seit Batistas Auftauchen nicht mehr, und meine Freunde auch nicht. Vielleicht glaubte ich deshalb, jetzt an diesem Ort sicher zu sein – ungefähr so, wie man sich während eines Bombardements in einem frischen Krater am geborgensten fühlt.
An dem Nachmittag, als ich Zarco kennenlernte, war ich, kurz nachdem Herr Tomàs aufgemacht hatte, in der Spielhalle erschienen und hatte angefangen, mit meinem Lieblingsflipper zu spielen, einem Rocky Balboa. Das war ein sehr guter Flipper: Man bekam fünf Kugeln, schon nach wenigen Punkten eine Extrakugel und am Schluss Bonuspunkte, mit deren Hilfe man ziemlich leicht gewinnen konnte. Eine Zeit lang war ich allein in der Halle, aber dann kamen ein paar Jungen, die mit der Rennbahn spielen wollten. Und kurz danach ein Pärchen, ein Junge und ein Mädchen, auf jeden Fall älter als sechzehn, aber höchstens neunzehn. Meinem ersten Eindruck nach waren sie möglicherweise Geschwister, vor allem aber handelte es sich um Charnegos von der harten Sorte, irgendwo aus der Vorstadt, vielleicht zwei Quinquis.[1] Herr Tomàs witterte Gefahr, kaum dass sie an seiner Kabine vorbeigingen. ›He, ihr da‹, rief er und stand schon in der Kabinentür. ›Wohin wollt ihr?‹ Die beiden blieben ruckartig stehen. ›Was is’, Chef?‹, fragte der Junge zurück und hob die Arme, als wollte er sich durchsuchen lassen. Obwohl er nicht lächelte, schien die Situation ihn zu amüsieren. Dann sagte er: ›Wir wollen bloß ein bisschen spielen. Dürfen wir?‹ Herr Tomàs musterte die beiden misstrauisch vom Scheitel bis zur Sohle und murmelte schließlich etwas, was ich nicht verstand. Dann verstand ich: ›Ich will hier keine Probleme. Wer Probleme macht, fliegt raus, klar?‹ ›Sonnenklar‹, sagte der Junge und ließ mit einer besänftigenden Geste die Arme sinken. ›Wegen uns brauchen Sie sich keine Sorgen machen, Chef.‹ Herr Tomàs schien durch die Antwort halbwegs besänftigt und zog sich wieder in seine Kabine zurück, wo er sich wahrscheinlich wieder ganz seinem Kreuzworträtsel widmete. Das Pärchen dagegen setzte den Weg ins Innere der Spielhalle fort.«
»Das waren sie.«
»Ja, der Junge war Zarco, und das Mädchen Tere.«
»War Tere Zarcos Freundin?«
»Gute Frage. Hätte ich die Antwort rechtzeitig gewusst, hätte ich mir viele Schwierigkeiten erspart. Später sage ich Ihnen, wie es war. Als ich Zarco und Tere reinkommen sah, war ich jedenfalls sofort verunsichert, genau wie Herr Tomàs, ich hatte das Gefühl, ab jetzt könne jeden Augenblick etwas Unangenehmes passieren, und deshalb hätte ich auch fast den Flipper Flipper sein lassen und wäre gegangen.
Ich blieb. Ich versuchte, das Pärchen zu vergessen und einfach weiterzuspielen, als wären die beiden gar nicht da. Das gelang mir aber nicht, wenig später hieb mir jemand mit der Pranke auf die Schulter, dass ich das Gleichgewicht verlor und fast zu Boden gestürzt wäre. ›Was is’ los, Brillenschlange?‹, fragte Zarco und übernahm meinen Platz am Flipper. Er sah mich aus tiefblauen Augen an, seine Stimme klang heiser, das Haar trug er in der Mitte gescheitelt, und seinen Oberkörper bedeckte eine enge Jeansjacke über einem engen beigefarbenen T-Shirt. Herausfordernd wiederholte er: ›Is’ was?‹ Ich sah ihn erschrocken an. Dann hielt ich ihm die Handflächen entgegen und sagte: ›Ich war sowieso gerade fertig.‹ Als ich mich daraufhin umdrehte, um wegzugehen, stellte sich mir Tere in den Weg und brachte ihr Gesicht so nah an meins, dass kaum eine Handbreit Abstand blieb. Zuerst war ich überrascht, dann überwältigt. Genau wie Zarco war Tere sehr schlank, hatte sehr dunkle Haut und war nicht besonders groß. Dafür strahlte sie eine Spannkraft und Beweglichkeit aus, wie nur ein weitgehend auf der Straße, unter freiem Himmel zugebrachtes Leben sie einem schenkt – zu der Zeit zeichneten sich alle Quinquis dadurch aus. Ihr Haar war glatt und dunkel, die Augen waren grün und grausam, und neben der Nase hatte sie ein Muttermal. Sie schien völlig in sich zu ruhen, ihre Selbstsicherheit war die einer schon erwachsenen Frau, nur ein kleiner Tic störte den Eindruck: Ihr linkes Bein bewegte sich unaufhörlich auf und ab wie ein Kolben. Sie trug Jeans und ein weißes T-Shirt und den Gurt ihrer Handtasche quer über der Brust. ›Gehst du schon?‹, fragte sie und ihre fleischigen erdbeerroten Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. Ich kam nicht dazu, zu antworten, denn Zarco packte mich am Arm und zwang mich, mich halb zu ihm umzudrehen. ›Hiergeblieben, Brillenschlange‹, befahl er und setzte den Flipper in Gang.
Er spielte ziemlich schlecht, deshalb war die Partie bald zu Ende. ›Scheiße‹, sagte er und schlug mit der Faust gegen den Apparat. Er sah mich wütend an, aber bevor er etwas sagen konnte, lachte Tere auf, schob ihn zur Seite und steckte eine neue Münze in den Schlitz. Zarco stützte sich neben mir auf den Flipper und sah Tere mürrisch beim Spielen zu. Ohne mich zu beachten, kommentierten sie die Partie, Tere sah mich allerdings immer wieder einmal zwischen zwei Kugeln aus dem Augenwinkel an. Unaufhörlich strömten Leute in die Spielhalle, und Herr Tomàs kam viel öfter als sonst aus seiner Kabine. Allmählich beruhigte ich mich wieder, ganz und gar begriff ich aber immer noch nicht, was vor sich ging, geschweige denn, dass ich gewagt hätte zu gehen. Teres Partie war auch rasch zu Ende. Daraufhin trat sie einen Schritt zurück, zeigte auf den Flipper und sagte: ›Du bist dran.‹ Ich bekam den Mund nicht auf, rührte mich nicht vom Fleck. ›Was is’ los, Brillenschlange?‹, fragte Zarco. ›Willst du auf einmal nicht spielen?‹ Ich sagte immer noch nichts. Zarco fuhr fort: ›Hat dir ’ne Katze die Zunge abgebissen?‹ – ›Nein‹, erwiderte ich. – ›Na dann …‹ – ›Ich hab kein Geld mehr‹, sagte ich. Zarco sah mich verwundert an. ›Du hast keine Kohle mehr?‹, fragte er erneut. Ich nickte. ›Wie viel hattest du denn dabei?‹ Ich sagte die Wahrheit. ›Leck mich, Tere‹, sagte er lachend. ›Das reicht uns nicht mal zum Arschabwischen.‹ Tere lachte nicht. Sie sah mich an. Zarco schob mich wieder zur Seite und sagte: ›Na gut, wer kein Geld hat, hat verkackt.‹
Er steckte die nächste Münze in den Schlitz und fing wieder an zu spielen. Dabei unterhielt er sich mit mir. Besser gesagt: Er fing an, mich auszufragen. Er fragte, wie alt ich sei, und ich sagte es ihm. Er fragte, wo ich wohnte, und ich sagte es ihm. Er fragte, ob ich auf die Sekundarschule ginge, und ich sagte ja und auch, auf welche. Dann fragte er, ob ich Katalanisch spräche. Ich wunderte mich über die Frage, sagte aber wiederum ja. Dann fragte er, ob ich oft in die Spielhalle käme und ob ich Herrn Tomàs kennen würde und wie hier die Öffnungszeiten wären und noch mehr solche Fragen, an die ich mich im Einzelnen nicht erinnere, ich weiß aber noch, dass ich sie alle beantwortete, zumindest soweit ich konnte. Ich weiß auch noch, dass er mich zuletzt fragte, ob ich Geld brauchte, und dass ich nicht wusste, was ich darauf antworten sollte. Da antwortete Zarco für mich: ›Wenn du Geld brauchst, sag’s mir. Komm ins La Font und sag mir Bescheid. Dann unterhalten wir uns mal geschäftlich.‹ Er fluchte, weil ihm wieder eine Kugel durchgeflutscht war, und hieb noch einmal mit der Faust auf den Apparat. Dann fragte er: ›Einverstanden, Brillenschlange, ja oder nein?‹ Ich sagte nichts. Bevor ich dazu imstande war, näherte sich uns ein großer Typ mit hellem Haar und einem Fred-Perry-Polohemd, der kurz zuvor in die Spielhalle gekommen war. Er grüßte Zarco, tuschelte eine Weile mit ihm, und dann gingen die beiden hinaus. Tere sah mich weiterhin an. Ich betrachtete meinerseits ihre Augen, ihren Mund und das Muttermal neben der Nase, und ich weiß noch, dass ich mir sagte, dass sie das hübscheste Mädchen war, das ich je zu Gesicht bekommen hatte. ›Und, kommst du?‹, fragte sie. ›Wohin?‹, fragte ich. ›Ins La Font‹, sagte sie. Ich fragte, was das La Font sei, sie sagte, eine Bar, im Rotlichtviertel. Dann fragte sie noch mal, ob ich ins La Font kommen würde. Und obwohl ich mir sicher war, dass ich das nicht tun würde, sagte ich: ›Ich weiß nicht‹, fügte aber gleich darauf hinzu: ›Kann schon sein.‹ Tere lächelte, zuckte die Schultern und strich mit dem Finger über das Muttermal neben ihrer Nase. Dann zeigte sie auf den Rocky-Balboa-Flipper und sagte: ›Du hast noch drei Kugeln.‹ Anschließend ging sie hinaus zu Zarco und dem Typen mit dem Fred-Perry-Shirt.
Das war unsere erste Begegnung, genauso lief sie ab. Als ich wieder allein war, atmete ich erleichtert auf, und dann spielte ich mit den drei verbliebenen Kugeln, ob einfach nur, weil ich Lust dazu hatte, oder weil ich annahm, Zarco und Tere würden sich noch in der Nähe der Spielhalle herumtreiben, kann ich nicht sagen – auf jeden Fall wollte ich es nicht riskieren, ihnen noch einmal über den Weg zu laufen. Als ich gerade mit der ersten Kugel beschäftigt war, kam Herr Tomàs zu mir. ›Weißt du, wer das war, Kleiner?‹, fragte er und deutete in Richtung Ausgang. Natürlich meinte er Zarco und Tere. Ich sagte, nein. ›Worüber habt ihr euch unterhalten?‹, fragte er. Ich sagte es ihm. Er schnalzte mit der Zunge und ließ es sich noch einmal erzählen, wenigstens einen Teil davon. Er wirkte beunruhigt, und nach einer Weile zog er, leise vor sich hin brummelnd, wieder ab. Am nächsten Tag kam ich am späteren Nachmittag in die Spielhalle. Als ich an Herrn Tomàs’ Kabine vorbeiging, klopfte dieser mit dem Fingerknöchel an die Scheibe und sagte, ich solle bitte warten. Als er rauskam, legte er mir eine Hand auf die Schulter. ›Hör mal, Kleiner‹, fing er an. ›Hättest du Interesse an einer kleinen Beschäftigung?‹ Ich sah ihn überrascht an. ›Wie meinen Sie das?‹, fragte ich. ›Ich brauche jemanden, der mir hilft‹, sagte er. Mit einer wenig präzisen Armbewegung wies er auf das Innere der Spielhalle. Dann erläuterte er sein Angebot: ›Du hilfst mir abends beim Zusperren, und dafür lass ich dich zehn Partien pro Tag umsonst spielen.‹
Da gab es für mich nichts zu überlegen. Ich nahm das Angebot an, und ab sofort verliefen alle meine Nachmittage auf einunddieselbe Weise: Gleich nachdem Herr Tomàs öffnete, manchmal etwas später, kam ich in den Spielsalon Vilaró, absolvierte – wo ich wollte, meistens an dem Rocky-Balboa-Flipper – meine zehn Gratispartien, und gegen halb neun oder neun half ich Herrn Tomàs beim Zusperren. Während er die Automaten aufmachte und das Geld rausnahm, zählte und die Summe in eine Art Tabelle eintrug, kontrollierte ich, dass niemand mehr in der Halle oder auf den Toiletten war, woraufhin wir gemeinsam das Rollgitter an der Tür hinabließen. Anschließend bestieg Herr Tomàs seine Mobylette, und ich kehrte zu Fuß nach Hause zurück. Das war alles. Heißt das, dass ich Zarco und Tere gleich wieder vergaß? Natürlich nicht. Anfangs hatte ich Angst, sie würden wiederkommen, aber nach ein paar Tagen wünschte ich mir zu meiner Verwunderung genau das, oder wenigstens wünschte ich mir, Tere würde wiederkommen. Zarcos Einladung anzunehmen und ins La Font zu gehen, also ins Rotlichtviertel, auf den Gedanken wäre ich allerdings nie gekommen. Ich war sechzehn und hatte eine ungefähre Vorstellung davon, wie es dort zugehen musste, und das fand ich nicht gerade verlockend, im Gegenteil, ich fand es beängstigend. Wie auch immer, schon bald machte ich mir jedenfalls klar, dass ich Zarco und Tere nur deshalb kennengelernt hatte, weil sie an dem Tag ausnahmsweise, durch einen bloßen Zufall, ihr angestammtes Gebiet verlassen hatten, was sich keinesfalls wiederholen würde, weshalb ich sie auch niemals wiedersehen würde.
An dem Tag, an dem ich zu dieser Einsicht gelangte, hatte ich ein furchtbares Erlebnis, das mich zu Tode erschreckte. Auf dem Rückweg vom Spielsalon kam mir in der Calle Joaquim Vayreda eine Gruppe von Jungen entgegen. Insgesamt waren es vier, sie kamen aus der Richtung der Calle Caterina Albert, gingen auf derselben Straßenseite wie ich, und obwohl sie noch weit entfernt waren und es bereits dunkel wurde, erkannte ich sie sofort: Es handelte sich um Batista, Matías und die Boix-Brüder, Joan und Dani. Ich wollte weitergehen und so tun, als wäre nichts, aber schon bei den nächsten zwei, drei Schritten wurden meine Knie weich und mir brach der Schweiß aus. Ich versuchte, mich nicht von der Panik überwältigen zu lassen, und machte mich daran, die Straße zu überqueren. Noch bevor ich auf der anderen Seite angekommen war, merkte ich, dass Batista mir folgte. Da gab es für mich kein Halten mehr: Ich fing an zu laufen, erreichte die andere Seite und bog an der nächsten Ecke rechts in eine kleine Straße ein, die zum Devesa-Park führte. Als ich diesen gerade betreten hatte, fiel Batista von hinten über mich her, warf mich zu Boden, bohrte mir das Knie in den Rücken und drehte mir den Arm um, dass ich mich nicht mehr rühren konnte. ›Wohin gehst du, Arschloch?‹, fragte Batista. Ich hatte meine Brille verloren. Während ich mich verzweifelt danach umsah, sagte ich zu Batista, er solle mich bitte loslassen, aber der wiederholte nur seine Frage. ›Nach Hause‹, sagte ich. ›Hier lang?‹, erwiderte Batista, bohrte mir das Knie fester in den Rücken und drehte meinen Arm noch weiter um, dass ich schrie. ›Dreckiger Lügner!‹, keuchte Batista.
Da hörte ich, dass Matías und die Boix-Brüder neben uns eintrafen. Im fahlen Licht einer Straßenlaterne erblickte ich mehrere Beinpaare in Jeans und Füße in Turnschuhen oder Sandalen. Und meine Brille entdeckte ich auch: Sie lag ganz in der Nähe und schien heil zu sein. Ich sagte, sie sollten sie bitte aufheben, und einer von ihnen, allerdings nicht Batista, tat, worum ich gebeten hatte, gab sie mir aber nicht. Matías und die Boix-Brüder wollten wissen, was los war. ›Nichts‹, sagte Batista. ›Der Scheiß-Katalane da meint bloß, er kann mich einfach so anlügen.‹ ›Ich hab dich nicht angelogen‹, entgegnete ich. ›Ich hab nur gesagt, ich gehe nach Hause.‹ ›Seht ihr?‹, sagte Batista und verdrehte meinen Arm noch mehr. ›Schon wieder lügt er!‹ Erneut schrie ich vor Schmerz. ›Lass ihn, bitte‹, sagte Matías. ›Er hat uns nichts getan.‹ Ich spürte, dass Batista sich zu ihm umwandte, allerdings ohne den Griff zu lockern. ›Er hat uns nichts getan? Bist du bescheuert, oder was? Wenn er uns nichts getan hat, wieso rennt er dann vor uns weg, hm? Und warum versteckt er sich? Außerdem erzählt er eine Lüge nach der anderen.‹ Er machte eine kurze Pause und fügte hinzu: ›Na los, Dumbo, dann sag doch zur Abwechslung mal die Wahrheit: Woher kamst du gerade?‹ Ich sagte kein Wort. Nicht nur mein Rücken und mein Arm taten weh, auch mein Gesicht, das gegen den Boden gepresst wurde. ›Seht ihr?‹, erklärte Batista. ›Er sagt nichts. Und wer nichts sagt, der hat was zu verbergen. Genau wie einer, der davonrennt, wenn er dich sieht. Oder etwa nicht?‹ ›Lass mich bitte los‹, stöhnte ich. Batista lachte. ›Doof bist du auch noch‹, sagte er. ›Glaubst du, wir wissen nicht, wo du dich versteckst? Für wie dumm hältst du uns eigentlich? Was bildest du dir ein?‹ Er tat, als erwartete er eine Antwort auf diese Fragen. Dann zerrte er plötzlich noch heftiger an meinem Arm und fragte: ›Was hast du gesagt?‹ Ich hatte überhaupt nichts gesagt, und das sagte ich jetzt auch. ›Was soll das heißen?‹, sagte Batista. ›Ich hab gehört, dass du mich Arschloch genannt hast.‹ Ich antwortete: ›Stimmt nicht.‹ Batista brachte sein Gesicht ganz nah an meins und drehte meinen Arm dabei unerbittlich weiter um. Ich glaubte schon, gleich werde der Arm brechen. Ich spürte Batistas Atem im Gesicht und schrie. Batista kümmerte sich nicht darum. ›Du sagst also, ich lüge?‹, fragte er. Erneut schaltete Matías sich ein und versuchte Batista dazu zu bringen, von mir abzulassen. Batista fiel ihm ins Wort, sagte, er solle den Mund halten, und nannte ihn einen Idioten. Dann fragte er mich noch mal, ob ich sagen würde, dass er lügt. Ich sagte nein, was ihn seltsamerweise zu besänftigen schien, denn kurz darauf spürte ich, dass der Druck an meinem Arm nachließ. Ohne noch etwas zu sagen, gab Batista mich frei und stand auf.
Hastig tat ich es ihm nach und rieb mir die Erde ab, die an meiner Backe klebte. Matías reichte mir die Brille, aber bevor ich sie nehmen konnte, griff Batista danach. Ich sah ihn an. Er lächelte. Im Halbdunkel des Parks, unter den Platanen, erinnerte sein Gesicht von ferne an das einer Katze. ›Willst du sie?‹, sagte er und hielt mir die Brille hin. Als ich die Hand danach ausstreckte, versteckte er die seine hinter dem Rücken. Dann holte er sie wieder hervor und sagte: ›Wenn du sie zurückhaben willst, musst du mir die Schuhe ablecken.‹ Ich sah ihn eine Weile unverwandt an, dann richtete ich den Blick auf Matías und danach auf die Boix-Brüder, die mich ihrerseits erwartungsvoll anstarrten. Schließlich ging ich vor Batista in die Knie, leckte seine Schuhe ab – sie schmeckten nach Leder und Staub –, richtete mich wieder auf und sah Batista erneut an. In seinen Augen schien es kurz aufzublitzen, bevor er ein Schnauben, das sich wie ein Lachen, oder ein Lachen, das sich wie ein Schnauben anhörte, von sich gab. ›Feigling‹, sagte er und ließ die Brille vor mir zu Boden fallen. ›Du ekelst mich an.‹
Die ganze Nacht wälzte ich mich im Bett und versuchte, gegen die Scham und das Gefühl völliger Erniedrigung anzukämpfen und mir das Geschehene in irgendeiner Weise schönzureden – nichts davon gelang mir. Am nächsten Morgen beschloss ich, nie mehr in den Spielsalon Vilaró zu gehen. Ich hatte Angst, Batista könne die Wahrheit gesagt haben und wisse tatsächlich, wo ich mich versteckte. ›Na und?‹, werden Sie sagen, ›dann hätte er Sie dort eben gefunden.‹ Vermutlich haben Sie recht – was hätte schon groß passieren sollen? Aber Angst und Vernunft sind zweierlei, und ich hatte Angst. Wie auch immer, es dauerte jedenfalls nicht lange, bis die Einsamkeit und die Langeweile sich gegen alle meine Befürchtungen durchsetzten, und so erschien ich schon nach zwei, drei Tagen wieder im Spielsalon. Herr Tomàs fragte, was mit mir gewesen sei, und ich sagte, ich sei krank gewesen, und fragte meinerseits, ob unsere Abmachung noch gelte. ›Na klar, Kleiner‹, antwortete Herr Tomàs.
Was später an diesem Nachmittag geschah, veränderte mein Leben für immer. Als ich bereits seit einer ganzen Weile mit meinem Rocky-Balboa-Flipper beschäftigt war, kamen plötzlich mehrere Leute in den Spielsalon. Zuerst dachte ich in panischem Schrecken, es handele sich um Batista und meine Freunde. Doch dann stellte ich erleichtert, ja erfreut fest, dass es Zarco und Tere waren. Allerdings kamen sie nicht allein, zwei Typen, die ich noch nie gesehen hatte, begleiteten sie. Diesmal hielt Herr Tomàs sie beim Hineinkommen nicht zurück. Er beschränkte sich darauf, ihnen, die Arme in die Seiten gestemmt und in einer Hand das Heft mit den Kreuzworträtseln, von der Kabinentür aus zuzusehen. Meine anfängliche Freude und Erleichterung wichen jedoch schon bald einem Gefühl der Unruhe, erst recht, als die vier unmittelbar auf mich zusteuerten. ›Na, wie geht’s, Brillenschlange?‹, sagte Zarco. ›Wolltest du nicht ins La Font kommen?‹ Ich trat zur Seite und überließ ihm den Platz am Flipper, woraufhin Zarco ruckartig stehen blieb, auf mich zeigte und sich lächelnd zu seinen Begleitern umwandte: ›Seht ihr? So ist er, man braucht ihm gar nicht erst sagen, was er zu tun hat.‹ Dann stellte er sich an den Flipper und setzte die Partie fort, die ich ihm zuliebe unterbrochen hatte. Währenddessen übernahm Tere die Unterhaltung mit mir. Sie begrüßte mich, sagte, sie hätten mich im La Font erwartet, und fragte, warum ich nicht gekommen sei. Die anderen beiden sahen mich neugierig an. Wie ich später erfuhr, hießen sie der Dicke und der Alte – der Dicke, weil er so dünn war, dass man ihn sozusagen immer nur im Profil vor sich zu haben glaubte, der Alte, weil er beim Sprechen ständig das Wort ›Alter‹ einflocht. Der Dicke trug enge, weit ausgestellte Hosen, und sein Markenzeichen war eine geschwungene Haartolle, die offenbar von einer ordentlichen Portion Haarlack zusammengehalten wurde. Der Alte war etwas kleiner als der Dicke, und obwohl er der Älteste der Gruppe war, hatte er etwas Kindliches, denn die meiste Zeit ließ er den Unterkiefer leicht herabhängen, so dass sein Mund halboffen stand. Ich antwortete ausweichend auf Teres Frage, aber niemand kümmerte sich um meine Worte. Zarco war ganz in das Spiel mit dem Rocky Balboa vertieft, und der Dicke und der Alte hatten sich dem danebenstehenden Automaten zugewandt. Auch Tere schien gleich nach ihrer Frage jedes Interesse an mir verloren zu haben. Für alle Fälle blieb ich neben ihr stehen, solange ihre Freunde sich an den Automaten betätigten. Ich brachte nicht den Mut auf, fortzugehen, anders gesagt: Ich dachte gar nicht daran. Stattdessen verfolgte ich die kurzen Bemerkungen, die die vier untereinander austauschten, und nahm gleichzeitig wahr, dass Herr Tomàs wieder in seiner Kabine verschwand, nur um kurz darauf erneut aufzutauchen, während die Stammkunden des Spielsalons uns verstohlen aus dem Augenwinkel beobachteten.
Als Zarco die Partie beendet und Tere seinen Platz am Flipper eingenommen hatte, erschien auf einmal der Typ von neulich, der mit dem Fred-Perry-Shirt. Zarco und er wechselten ein paar Worte, der Dicke und der Alte hörten auf zu spielen, und schließlich gingen alle vier auf die Straße hinaus. Nur Tere setzte ihre Partie fort. Ich beobachtete mittlerweile nicht mehr nur das Spielfeld, sondern warf ihr immer wieder heimliche Blicke zu, wobei sie mich irgendwann überraschte, woraufhin ich, um abzulenken, fragte, wer der Typ mit dem Fred-Perry-Shirt sei. ›Ein Dealer‹, antwortete Tere. Dann fragte sie, ob ich rauchte. ›Ja‹, sagte ich. ›Dope, meine ich‹, sagte Tere. Ich wusste, was ›Dope‹ war – und ich wusste auch, was ein ›Dealer‹ war –, hatte aber noch nie welchen geraucht, was ich jedoch nicht sagte. Tere erriet es auch so. ›Willst du’s mal ausprobieren?‹, fragte sie. Ich zuckte die Achseln. ›Wenn ja, dann komm ins La Font‹, sagte Tere. Zwischen zwei Kugeln sah sie mich an und fragte: ›Und, kommst du oder nicht?‹ Ich hatte es keinesfalls vor, wollte ihr das aber nicht sagen. Ich sah mir – wohl zum tausendsten Mal – die Figur des Rocky Balboa an, der über dem Spielfeld thronte: ein triumphierender Muskelprotz, der nichts anhatte außer einem in den Farben der USA bedruckten Paar Boxershorts. Vor seinem zu Boden gestreckten Gegner im Ring stehend, präsentierte er sich mit hochgerissenen Armen einem begeistert brüllenden Publikum. Während ich diesen Anblick mit der Erinnerung verglich, wie ich Batista die Schuhe ableckte, überkam mich einmal mehr das Gefühl grenzenloser Demütigung. Als fürchtete ich, mein Schweigen könne verraten, was in mir vorging, beantwortete ich Teres Frage hastig mit einer Gegenfrage: ›Seid ihr jeden Tag da?‹ Ich meinte das La Font, was Tere ohnehin klar war. ›Mehr oder weniger‹, erwiderte sie und spielte die nächste Kugel. Als auch die verloren war, fragte sie noch einmal: ›Und, kommst du?‹ ›Ich weiß nicht‹, sagte ich und fügte hinzu: ›Ich glaub nicht.‹ ›Warum nicht?‹, fragte Tere. Ich zuckte die Achseln, und sie spielte weiter.
Ich sah sie weiterhin an. Ich tat, als würde ich aufs Spielfeld blicken, sah in Wirklichkeit aber Tere an. Sie merkte es. Was sich daran zeigte, dass sie auf einmal mitten im Spielen sagte: ›Ich seh ganz schön scharf aus, was, Brillenschlange?‹ Ich wurde rot. Gleich darauf ärgerte ich mich, dass ich rot geworden war. Im Spielsalon Vilaró war es ziemlich laut, trotzdem kam es mir auf einmal so vor, als wäre inmitten des Trubels völlige Stille eingetreten, was jedoch nur ich wahrnahm. Ich tat, als hätte ich ihre Worte nicht richtig verstanden. Tere wiederholte sie nicht. Sie spielte in aller Ruhe die Kugel zu Ende, unterbrach daraufhin die Partie, nahm mich an der Hand und sagte: ›Komm.‹
Habe ich Ihnen schon gesagt, dass mir manches davon, was in dem Sommer passierte, wie ein bloßer Traum vorkommt? Das gilt auch für das, was jetzt geschah. Zwischen all den Leuten hindurch, die sich mittlerweile im Spielsalon eingefunden hatten, zog Tere mich hinter sich her bis ans Ende des Raums, wo wir, ohne dass sie meine Hand losgelassen hätte, die Frauentoilette betraten. Dort sah es genauso aus wie in der Herrentoilette: Es gab einen langen Gang mit einem großen Spiegel auf der einen Seite, dem gegenüber sich die Kabinen aneinanderreihten. In diesem Augenblick war kaum jemand dort, nur zwei Mädchen mit hohen Absätzen und Miniröcken, die sich vor dem Spiegel die Wimpern tuschten. Sie sahen uns an, sagten aber kein Wort. Tere öffnete die erste Kabinentür und forderte mich auf, hineinzugehen. ›Wohin willst du?‹, fragte ich. ›Geh rein‹, erwiderte sie. Verwirrt blickte ich die beiden Mädchen an, die uns weiterhin anstarrten. ›Was is’ los‹, fuhr Tere sie an, ›was gibt’s da zu glotzen?‹
Beleidigt wandten die Mädchen sich wieder ihrem Spiegelbild zu. Tere schob mich in die Kabine, ging hinter mir hinein, schloss die Tür und legte den Riegel vor. Im Inneren war kaum genug Platz für eine Toilettenschüssel und den dazugehörigen Wasserbehälter. Der Boden war aus Beton, und die Seitenwände aus Brettern, die kurz über dem Boden endeten. Ich lehnte mich an eine der Wände. Tere schob sich die Tasche auf den Rücken und befahl: ›Zieh die Hose runter!‹ ›Was?‹, fragte ich. Ihre Antwort bestand in einem langen feuchten Zungenkuss. Zum ersten Mal im Leben küsste mich eine Frau. ›Los, zieh die Hose runter‹, wiederholte Tere anschließend. Wie ein Schlafwandler öffnete ich meinen Gürtel und schob mir die Hose runter. ›Die Unterhose auch‹, sagte Tere. Ich tat, was sie sagte. Als ich so weit war, ergriff sie mein Glied. ›Und jetzt pass auf, Brillenschlange.‹ Sie ging in die Knie, schob sich mein Glied in den Mund und fing an, mir einen zu blasen. Es war schnell vorbei, denn so sehr ich mich anstrengte, es zurückzuhalten, ich kam sofort. Tere stand wieder auf, küsste mich auf die Lippen und hinterließ dort einen Geschmack nach Samen. ›Hat’s dir gefallen?‹, fragte sie dann, mein schlaffes Glied noch in der Hand haltend. Mühsam stammelte ich irgendetwas. Da lächelte sie – ganz kurz, aber vollendet schön –, ließ mich los und sagte, bereits den Türgriff umklammernd: ›Morgen warte ich auf dich im La Font.‹
Wie lange ich noch so dastand, mit bis auf die Knöchel heruntergerutschter Hose, und das soeben Erlebte zu verarbeiten versuchte, weiß ich nicht. Irgendwann zog ich die Hose wieder hoch und verließ die Kabine. In der Toilette war niemand mehr. Und als ich aus der Toilette kam, war Tere auch nicht mehr in der Spielhalle, genauso wenig wie Zarco, der Dicke und der Alte. Ich ging zum Eingang, sah hinaus, die Straße hinunter, in beide Richtungen, konnte aber niemanden entdecken. Auf einmal stand Herr Tomàs neben mir. ›Wo warst du denn?‹, fragte er. Ich sah ihn an: Er hatte die Hände in die Hosentaschen gesteckt und merkte nicht, dass sein vorspringender Bauch zwei Hemdknöpfe abgesprengt hatte. Durch die Öffnung drängte sich ein Büschel krauser grauer Haare. Bevor ich antworten konnte, fragte er: ›Geht’s dir nicht gut, Kleiner? Du bist ganz blass.‹ Ich sagte, nein, alles sei in Ordnung, und um weitere Fragen zu vermeiden, fügte ich hinzu, es gehe mir wirklich wieder besser, ich hätte mich zwar gerade in der Toilette übergeben, aber wahrscheinlich nur, weil ich noch nicht wieder ganz auf dem Damm sei. ›Sei bloß vorsichtig, Kleiner‹, belehrte mich Herr Tomàs, ›so ein Rückfall kann verdammt unangenehm sein.‹ Dann fragte er, worüber ich mit Zarco, Tere und den anderen gesprochen hätte, und ich sagte, über nichts Besonderes. Herr Tomàs schnalzte mit der Zunge. ›Diesen Quinquis traue ich nicht über den Weg, keinem von denen‹, sagte er. ›Behalt sie immer schön im Auge, falls sie noch mal auftauchen, einverstanden?‹ ›Einverstanden‹, sagte ich und betrachtete die Autos, die unter der Eisenbahnbrücke parkten. Wieder ging mir der Gedanke durch den Kopf, dass ich Tere nie wiedersehen würde, und ich fragte: ›Glauben Sie, die tauchen noch mal auf?‹ ›Ich weiß nicht‹, sagte Herr Tomàs. Und als er sich auf den Weg zurück in seine Kabine machte, fügte er hinzu: ›Bei denen weiß man nie.‹
Am nächsten Tag ging ich ins La Font.«
2
»Ja, ich bin Polizist. Warum ich Polizist geworden bin? Ich weiß nicht. Na ja, dass mein Vater bei der Guardia Civil war, hat sicher eine Rolle gespielt. Außerdem war ich damals so idealistisch und auf Abenteuer versessen wie alle phantasiebegabten Jungs in meinem Alter. Sie wissen schon, was ich meine: Im Kino war der Polizist immer der Gute, der die anderen Guten vor den Bösen rettet, und genau so wollte ich auch sein.
Mit siebzehn habe ich mich dann jedenfalls auf die Aufnahmeprüfung bei der Polizei vorbereitet. In der Schule war ich immer faul und hab nichts getan, aber für die Prüfung habe ich neun Monate lang wie verrückt gebüffelt und auf Anhieb bestanden, sogar mit einer sehr guten Note. Tja … Als Anwärter musste ich dann von Cáceres nach Madrid ziehen. Da habe ich in einer Pension in der Calle Jacometrezo gewohnt. Von dort bin ich jeden Tag in die Polizeischule, in der Calle Miguel Ángel 5. Damals habe ich begriffen, was diesen Job vor allem ausmacht. Und wissen Sie was? Für mich war das keine Enttäuschung. Na ja, von ein paar Sachen war ich schon enttäuscht, Sie wissen schon: die ganzen Vorschriften, die zu beachten waren, und alle möglichen dämlichen Kollegen, der ewige Papierkram und so weiter. Aber dafür habe ich etwas herausgefunden, was mich eigentlich hätte überraschen müssen, und wie! Aber es hat mich überhaupt nicht überrascht: Das Leben als Polizist war genau so, wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Ich hab Ihnen ja gesagt, ich war total idealistisch, und das bin ich wirklich lange geblieben, und die ganze Zeit habe ich mir eingeredet, mein Job sei der beste Job der Welt. Heute, vierzig Jahre später, bin ich schlauer, heute weiß ich, dass es keinen mieseren Job gibt, mit Abstand nicht.
Wovon haben wir gerade gesprochen? Ach ja, meine Zeit als Polizeianwärter. Da will ich Ihnen nichts vormachen: Madrid fand ich ganz schön beängstigend, einerseits, weil ich in einer Kleinstadt aufgewachsen war, andererseits war das damals eine ziemlich schwierige Zeit, auf Patrouille sind ich und meine älteren Kollegen ständig in irgendwelche heiklen Lagen geraten, unangemeldete Demonstrationen, Terroranschläge, Banküberfälle, was weiß ich. Ich habe mir jedenfalls gleich gesagt, dass das für mich zu viel Durcheinander ist und dass eine große Stadt wie Madrid für mich erst mal nicht in Frage kommt.
Auch deshalb habe ich, als meine Zeit als Anwärter rum war, beschlossen, mich auf eine Stelle hier in Gerona zu bewerben. Eigentlich wollte ich zurück nach Cáceres, aber irgendwie auch doch nicht. Ich mochte Cáceres, aber wieder dort wohnen wollte ich auf keinen Fall, erst recht nicht bei meinen Eltern. Da habe ich mir gesagt, Gerona ist eigentlich gar nicht schlecht, es ist nicht Cáceres, aber ziemlich ähnlich – beides sind ruhige Provinzhauptstädte, mit einer großen Altstadt und so, und deshalb habe ich geglaubt, dass ich mich in Gerona schnell einleben würde. Wahrscheinlich habe ich auch geglaubt, in Gerona könnte ich erst mal die nötige Erfahrung sammeln, bevor ich nach Hause zurückkehre oder mir was Besseres suche, und dass ich da nicht so hart rangenommen werde wie in einer Großstadt. Außerdem – auch wenn Sie das vielleicht für Quatsch halten, aber für mich war es sehr wichtig –, außerdem wollte ich einfach wissen, wie die Katalanen sind, vor allem die Leute aus Gerona, warum, weiß ich auch nicht. Stimmt nicht, ich weiß es genau: Es hat mich interessiert, weil ich während der Zeit als Anwärter Gerona gelesen habe, diesen Roman von Benito Pérez Galdós. Kennen Sie den? Das ist ein Porträt der Stadt während der Belagerung durch die Truppen Napoleons. Als ich das vor vierzig Jahren gelesen habe, war ich begeistert. Das war der reinste Wahnsinn. Ein totales Kriegsdrama, eine Stadt, die sich mit allem zur Wehr setzt, was sie hat, die Leute sind eisern entschlossen, sich zu verteidigen, und angeführt werden sie von einem echten Helden, General Álvarez de Castro, ein wahrer Gigant, der sich weigert, den Franzosen die völlig zerstörte und ausgehungerte Stadt zu übergeben, wirklich umwerfend, so wie Galdós ihn darstellt, gab es im ganzen 19. Jahrhundert keinen größeren Patrioten. Tja, 1974 war ich gerade mal neunzehn, da hat mich so was beeindruckt, und deshalb habe ich mir gesagt, Gerona ist für den Anfang genau das Richtige.
Also habe ich mich um die Stelle in Gerona beworben und sie bekommen.
An den Ankunftstag erinnere ich mich noch, als wäre es heute. Als ich mit fünf weiteren Neulingen am Bahnhof aus dem Zug stieg, ging es zuerst ins Hotel Condal, wo wir Zimmer reserviert hatten. Das war ungefähr um sieben oder halb acht, und weil Februar war, war es bereits stockfinster. Das ist der erste Eindruck von Gerona, den ich im Gedächtnis behalten habe: die Dunkelheit. Der zweite Eindruck ist der von Feuchtigkeit. Der dritte, Schmutz. Der vierte (und stärkste) das Gefühl von Einsamkeit – eine so grenzenlose und vollständige Einsamkeit, wie ich sie nicht einmal während der ersten Tage in Madrid empfunden hatte, als ich allein in meinem Zimmer in der Calle Jacometrezo lag. Im Hotel packten wir die Koffer aus, machten uns kurz frisch und begaben uns auf die Suche nach einem Restaurant, um zu Abend zu essen. Einer meiner Kollegen war aus Barcelona und kannte die Stadt, also schlossen wir uns ihm an. Zuerst sind wir die Calle Jaume I entlanggegangen, dann über den Marquès-de-Camps- und über den Sant-Agustí-Platz, wo die Statue von General Álvarez de Castro steht, die ich damals aber nicht sah oder übersah. Dann überquerten wir den Onyar. Auch im Dunkeln ahnte man, wie schmutzig das Wasser war und wie trist die Fassaden der Häuser am Ufer – überall hatte man Wäsche zum Trocknen aufgehängt. Anschließend trotteten wir eine Zeit lang durch die Altstadt, gingen dann die gesamte Rambla hinauf und überquerten zuletzt die Plaza de Catalunya. Als wir uns irgendwann fast geschlagen gaben und nur noch die ganze Stadt zum Teufel jagen und uns mit leerem Magen ins Bett fallen lassen wollten, stießen wir doch noch auf ein Lokal, das geöffnet hatte. Es befand sich ganz in der Nähe des Hotels und hieß Rhin Bar. Nach längerem Feilschen mit dem Inhaber, der eigentlich gerade zumachte und nichts mehr servieren wollte, bekam jeder von uns ein Glas Milch. So brauchte ich nach der anstrengenden Reise und dem deprimierenden Marsch durch die Stadt wenigstens nicht völlig nüchtern ins Bett zu gehen. Doch das Erste, was ich mir sagte, als ich endlich unter der Decke lag, war, dass ich einen Fehler begangen hatte und so bald wie möglich meine Versetzung beantragen würde, um dieses gottverlassene Kaff auf Nimmerwiedersehen hinter mir zu lassen.
Dazu ist es nie gekommen. Weder habe ich jemals meine Versetzung beantragt, noch bin ich nach Cáceres zurückkehrt oder in eine andere Stadt gezogen. Im Gegenteil, heute ist dies meine Stadt. Meine Frau ist von hier, meine Kinder auch, meine Eltern sind hier beerdigt, und ich liebe oder hasse diese Stadt so, wie man das, was einem am wichtigsten ist, eben liebt oder hasst. Obwohl das eigentlich nicht stimmt, in Wirklichkeit ist meine Liebe zu dieser Stadt viel größer als mein Hass, sonst hätte ich es hier nicht so lange ausgehalten, glauben Sie nicht? Manchmal bin ich sogar stolz auf Gerona, auch weil ich mit am meisten dazu beigetragen habe, dass die Stadt heute so ist, wie sie ist. Und glauben Sie mir, jetzt ist es hier viel besser als zu der Zeit, als ich ankam … Damals war die Stadt, wie gesagt, schrecklich, und dennoch hatte ich mich schon bald daran gewöhnt. Meine fünf jungen Kollegen und ich teilten uns eine Mietwohnung in der Calle Montseny, im Stadtteil Santa Eugènia, und meine Arbeitsstelle war das Kommissariat in der Calle Jaume I in der Nähe des Sant-Agustí-Platzes. Gerona war immer schon ein ruhiges Pflaster, erst recht als Franco noch lebte, weshalb meine Arbeit sich, wie erwartet, wesentlich einfacher und weniger gefährlich gestaltete als die in Madrid. Ich unterstand einem Subkommissar – Subkommissar Martínez –, der die dort angesiedelte Brigade der Kriminalpolizei leitete, und einem altgedienten Inspektor – Inspektor Vives –, der einer der beiden Abteilungen der Brigade vorstand. Martínez war ein angenehmer Mensch und ein guter Polizist, Vives dagegen, wie ich bald merkte, konnte zwar manchmal witzig sein, im Grunde aber war er eine hirnlose Schlägertype. Warum soll ich Ihnen was vormachen – damals gab es bei der Polizei jede Menge solcher Leute. Zum Glück gehörte keiner der Kollegen dazu, mit denen ich arbeitete und zusammenwohnte – Sie müssen bedenken, dass wir ständig zusammen waren, den Vormittag verbrachten wir gemeinsam auf dem Kommissariat, zu Mittag aßen wir gemeinsam im Can Lloret, Can Barnet oder El Ánfora, nachmittags gingen wir gemeinsam auf Patrouille, nachts schliefen wir unter demselben Dach, und wenn wir frei hatten, versuchten wir uns gemeinsam zu amüsieren, was in Gerona damals fast schwieriger war, als seine Arbeit gut zu machen. Die Ausrüstung unserer Brigade war zwar wirklich erbärmlich – wir hatten zum Beispiel bloß zwei Zivilautos, die dazu noch jeder kannte, weil sie ständig vor dem Kommissariat parkten –, andererseits brauchten wir aber auch nicht viel mehr, weil es hier nur wenige Kriminelle gab, und die versammelten sich zum größten Teil im Rotlichtviertel, weswegen sie auch ziemlich einfach zu überwachen waren: Im Rotlichtviertel kamen alle Gauner zusammen, hier heckten sie ihre krummen Dinger aus, und hier wusste früher oder später auch jeder über jeden bestens Bescheid. Weshalb wir jeden Tag nur einmal am Abend und noch einmal in der Nacht hier vorbeizuschauen brauchten, um ohne größere Schwierigkeiten über alles Wichtige auf dem Laufenden zu sein.«
»Und da haben Sie dann auch Zarco kennengelernt?«
»Genau, da habe ich ihn kennengelernt.«
3
»Wie gesagt, vom Rotlichtviertel hatte ich schon gehört, alles, was ich wusste, war aber, dass es sich um einen wenig empfehlenswerten Ort handelte, am anderen Ufer des Onyar, in der Altstadt. Obwohl ich also eigentlich keine Ahnung hatte, fand ich das La Font auf Anhieb.
Ich überquerte den Onyar auf der Sant-Agustí-Brücke, bog in der Altstadt links in die Calle Ballesteries, die in die Calle Calderers übergeht, und als ich die Sant-Fèlix-Kirche rechts hinter mir gelassen hatte und die Calle de La Barca betrat, begriff ich, dass ich im Rotlichtviertel angekommen war. Ich erkannte es an dem Gestank nach Müll und Pisse, der in dicken Schwaden von dem in der Nachmittagshitze glühenden Pflaster aufstieg. Und an den Leuten an der Kreuzung vor dem La-Barca-Tor, die sich in dem knapp bemessenen Schatten aneinanderdrängten, den die baufälligen Häuser dort warfen: ein alter Mann mit eingefallenen Wangen, zwei jüngere Männer, um die man offensichtlich besser einen weiten Bogen schlug, und drei, vier Quinquis um die zwanzig. Sie alle rauchten und hielten Gläser mit Wein oder Bierflaschen in der Hand. Ich ging vorbei, ohne sie anzusehen, durchquerte das La-Barca-Tor und erblickte die Bar Sargento und daneben das La Font. Dort stellte ich mich an die Tür und spähte durch die Scheibe ins Innere. Es war eine kleine Bar, ein langer schmaler Gang mit einer Theke auf der linken Seite, der sich am Ende zu einem Salon erweiterte. Es war fast niemand darin zu sehen. Im Salon standen mehrere Tische, die wenigen Gäste befanden sich jedoch ausschließlich an der Theke, hinter der eine Frau Gläser ins Spülbecken tauchte. Über ihr hing ein Schild: ›Joints rauchen verboten.‹ Ich traute mich nicht hinein. Stattdessen ging ich weiter bis ans Ende des Rotlichtviertels an der Ecke Calle Bellaire. Dort trieb ich mich eine Weile unschlüssig zwischen der Eisenbahnbrücke und der Sant-Pere-Kirche herum, bis ich irgendwann meinen ganzen Mut zusammennahm, zum La Font zurückkehrte und hineinging.
Jetzt war es wesentlich voller als zuvor, weder Tere noch Zarco waren jedoch da. Schüchtern stellte ich mich ans äußerste Ende der Theke, gleich bei der Tür. Sofort näherte sich die Wirtin – eine unfreundlich dreinblickende Rothaarige mit einer fleckigen Schürze – und fragte, was ich wolle. Ich fragte meinerseits, ob Zarco da sei, und sie antwortete: ›Bis jetzt nicht.‹ Dann fragte ich, ob sie wisse, wann er komme, und sie antwortete: ›Nein‹, und starrte mich an. Bis sie irgendwann sagte: ›Und, trinkst du nichts?‹ Ich bestellte eine Cola, zahlte und richtete mich darauf ein, zu warten.
Es dauerte nicht lange, da erschienen Tere und Zarco. Beim Reinkommen entdeckten sie mich sofort. In Teres Gesicht leuchtete es auf, während Zarco mir auf die Schulter klopfte und sagte: ›Mannomann, Brillenschlange, wurde aber auch Zeit, was?‹ Sie nahmen mich mit in den hinteren Teil der Bar, wo wir uns an einem Tisch niederließen, an dem bereits zwei Jungen saßen. Der eine hatte Sommersprossen und leicht geschlitzte Augen und trug den Spitznamen Chinese. Der zweite steckte sich eine Zigarette nach der anderen an, war klein, nervös und picklig und hieß Kippe. Zarco forderte mich auf, zwischen Tere und ihm Platz zu nehmen, und als er noch dabei war, bei der Wirtin Bier zu bestellen, erschien Lina, eine Blondine in Minirock und pinkfarbenen Turnschuhen. Wie ich später erfuhr, war sie die Freundin des Dicken. Vorgestellt wurde ich niemandem, und es sprach mich auch keiner an: Tere unterhielt sich mit Lina, Kippe und der Chinese unterhielten sich mit Zarco, und als etwas später der Dicke und der Alte eintrafen, ließen sie sich durch nichts anmerken, dass sie mich schon einmal gesehen hatten. Ich fühlte mich vollkommen fehl am Platz, wäre aber niemals auf den Gedanken gekommen, wieder zu gehen.
Kurz darauf gesellte sich ein Typ zu uns, der offenbar etwas älter als die anderen war. Er trug Cowboystiefel, superenge ausgestellte Jeans, und das weit aufgeknöpfte Hemd gab den Blick auf eine glänzende Goldkette frei, die auf seiner Brust hing. Er setzte sich rittlings auf einen Stuhl neben Zarco, legte die Arme auf die Lehne und zeigte auf mich: ›Und der Bubi da?‹ Alle verstummten, und ich spürte, dass sich acht Augenpaare auf mich richteten. Irgendwann unterbrach Zarco das Schweigen. ›Du Idiot, Guillle‹, fuhr er den anderen an. ›Das ist der Typ aus der Spielhalle. Ich hab dir doch gesagt, dass er kommt.‹ Guille sah ihn an, als wüsste er nicht, wovon die Rede ist. Als Zarco gerade weitersprechen wollte, wurde er durch die Wirtin unterbrochen, die mit noch mehr Bier ankam und von einem Jungen begleitet wurde, den die anderen Dracula nannten – unter seiner Oberlippe sah ein Eckzahn hervor. Als die Wirtin wieder abgezogen war, fuhr Zarco fort: ›Los, Brillenschlange, erzähl Guille noch mal, was du uns neulich erzählt hast.‹ Ich wusste, was er meinte, fragte aber trotzdem. ›Das mit der Spielhalle‹, erwiderte Zarco. Weil ich mich geschmeichelt fühlte, auf einmal im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, vielleicht auch, weil ich die anderen – oder bloß Tere – beeindrucken wollte, wiederholte ich alles, was ich über den Spielsalon Vilaró wusste, und fügte hinzu, dass ich Herrn Tomàs seit neuestem immer abends beim Zusperren half. Zarco stellte mir noch ein paar Fragen, unter anderem, wie viel Geld Herr Tomàs pro Tag einnahm. ›Keine Ahnung‹, sagte ich, und das stimmte. ›Mehr oder weniger‹, sagte Zarco, der sich nicht so schnell geschlagen gab. Ich nannte eine übertrieben hohe Summe, woraufhin Zarco Guille ansah und ich Tere. Im selben Augenblick dämmerte mir, dass ich wenigstens das Letzte besser nicht hätte sagen sollen.