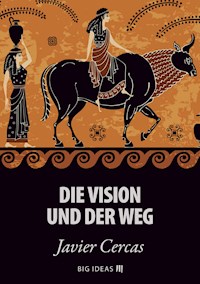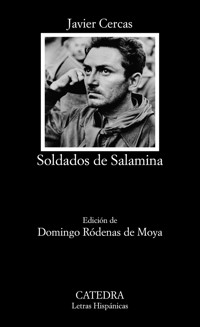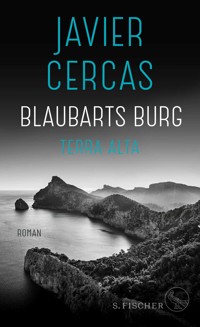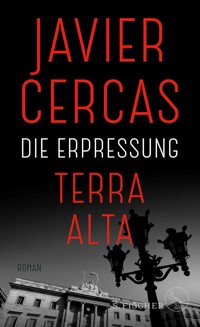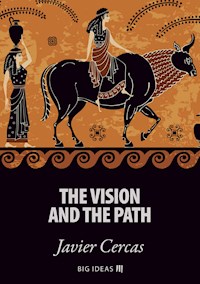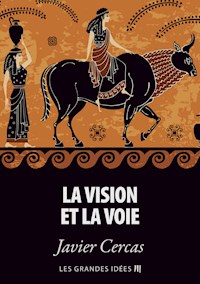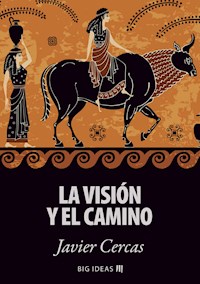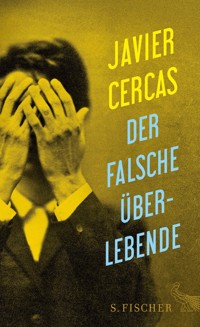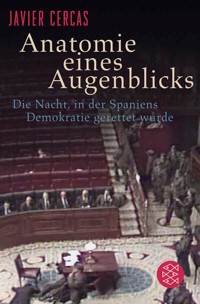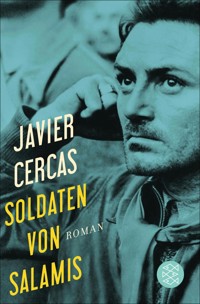
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit ›Soldaten von Salamis‹ wurde Javier Cercas international bekannt, der Roman wurde verfilmt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. In Spanien gilt er mittlerweile als moderner Klassiker. Ein junger Journalist stößt auf eine wenig bekannte Anekdote aus den letzten Tagen der Spanischen Bürgerkriegs: Rafael Sánchez Mazas, Mitbegründer und Chefideologe der spanischen Falange, war einer Einheit republikanischer Truppen in die Hände gefallen und sollte zusammen mit fünfzig anderen Franquisten in einem Kloster erschossen werden. Wie durch ein Wunder gelingt Sánchez Mazas im Moment der Erschießung die Flucht – doch als er kurz darauf von einem seiner Verfolger gestellt wird, legt dieser auf ihn an, dreht sich dann aber ohne ein Wort um und geht davon. Den Journalisten lässt die Geschichte nicht los. Was genau war dort im Wald geschehen? Wieso hatte der Soldat Sánchez Mazas davonkommen lassen, den Mann, der schließlich unter Franco Minister wurde? Im Zuge seiner Recherchen stößt der Journalist auf mehrere Zeitzeugen, nur der rätselhafte Soldat, der Sánchez Mazas laufen ließ, bleibt unauffindbar. Bis er einen wertvollen Hinweis bekommt, der ihn endlich auf die richtige Spur zu bringen scheint. »Ein großartiges Buch, eines der besten, das ich seit langem gelesen habe.« Mario Vargas Llosa
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Javier Cercas
Soldaten von Salamis
Roman
Über dieses Buch
Bei seinen Recherchen zum Spanischen Bürgerkrieg stößt ein Journalist auf einen verstörenden Vorfall: In den letzten Kriegstagen gelang Rafael Sánchez Mazas, einem Vordenker der faschistischen Falange, die Flucht vor einem republikanischen Erschießungskommando. Aber kurz darauf konnte einer seiner Verfolger ihn aufspüren – doch er ließ ihn ohne ein Wort laufen. Während Sánchez zum Minister unter Franco aufstieg, verlor sich von seinem Lebensretter jede Spur. Diese – wahre – Geschichte lässt dem Journalisten keine Ruhe: Wer war jener Soldat, der das Leben seines Feindes verschonte?
Mit ›Soldaten von Salamis‹ wurde Javier Cercas international bekannt, der Roman wurde verfilmt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
»Dieses Buch über den Spanischen Bürgerkrieg und seine Folgen ist erschütternd human.« Hessischer Rundfunk
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Javier Cercas, geboren 1962 in Ibahernando in der spanischen Extremadura, lebt als Schriftsteller, Publizist und Universitätsdozent in Girona. Mit seinem Roman ›Soldaten von Salamis‹ wurde er international bekannt. Heute ist sein Werk in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Im S. Fischer Verlag sind bereits erschienen: ›Anatomie eines Augenblicks‹ (2011), ›Outlaws‹ (2014) und ›Der falsche Überlebende‹ (2017), für das er u.a. den Prix du livre européen 2016 erhielt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die spanische Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel ›Soldados de Salamis‹ bei Tusquets Editores, Barcelona
© Javier Cercas, 2001
Das Buch erschien 2002 zum ersten Mal auf Deutsch im Berlin Verlag, Berlin.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: bürosüd, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403809-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Für Raül Cercas und [...]
Verborgen haben die Götter,
Anmerkung des Autors
Erster Teil Die Freunde des Waldes
Zweiter Teil Soldaten von Salamis
Dritter Teil Begegnung in Stockton
Für Raül Cercas und Mercè Mas
Verborgen haben die Götter,
was die Menschen am Leben erhält.
Hesiod, Werke und Tage
Anmerkung des Autors
Dieses Buch ist die Frucht endloser Lektüre und langer Gespräche. Viele Personen, in deren Schuld ich stehe, werden im Text namentlich genannt; von denen, deren Name nicht erwähnt wird, möchte ich hier nennen: Josep Clara, Jordi Gracia, Eliane und Jeanmarie Lavaud, José-Carlos Mainer, Josep Maria Nadal und Carlos Trías, vor allem aber Mónica Carbajosa, deren Dissertation mit dem Titel Die Prosa von 27: Rafael Sánchez Mazas mir von größtem Nutzen war. Ihnen allen meinen Dank.
Erster TeilDie Freunde des Waldes
Vor über sechs Jahren, im Sommer 1994, hörte ich zum ersten Mal von der Erschießung Rafael Sánchez Mazas’. Damals hatten sich gerade drei Dinge in meinem Leben ereignet: Mein Vater war gestorben, meine Frau hatte mich verlassen, und ich hatte meine Karriere als Schriftsteller aufgegeben. Falsch. Die Wahrheit ist, dass von diesen drei Dingen die ersten beiden stimmen, unbestreitbar; nicht so jedoch das dritte: In Wirklichkeit hatte meine Schriftstellerkarriere überhaupt nie angefangen, so dass ich sie schwerlich aufgeben konnte. Richtiger wäre es wohl, zu sagen, dass ich sie aufgab, kaum dass sie begonnen hatte. 1989 war mein erster Roman veröffentlicht worden. Wie der zwei Jahre zuvor erschienene Band mit Erzählungen wurde das Buch mit allgemeiner Gleichgültigkeit aufgenommen, doch gelang es meiner Eitelkeit, im Verbund mit der lobenden Rezension eines Freundes jener Tage, mich davon zu überzeugen, dass ich ein Schriftsteller werden könnte und dass ich dafür meine Arbeit in einer Zeitungsredaktion am besten aufgab und mich ausschließlich dem Schreiben widmete. Das Ergebnis dieser Umstellung meines Lebens waren fünf Jahre wirtschaftlicher, physischer und metaphysischer Ängste, drei unvollendete Romane und eine grauenvolle Depression, die mich zwei Monate lang an einen Sessel vor dem Fernseher fesselte. Meine Frau hatte es irgendwann satt, immer nur Rechnungen zu bezahlen, einschließlich der für die Beerdigung meines Vaters, und mich heulend vor dem ausgeschalteten Fernsehapparat sitzen zu sehen; sie zog aus, als ich gerade wieder auf die Beine kam, und so blieb mir nichts anderes übrig, als meine literarischen Ambitionen für immer zu begraben und um Wiedereinstellung bei der Zeitung zu bitten.
Ich war gerade vierzig Jahre alt geworden, doch zum Glück – oder weil ich zwar kein guter Schriftsteller, aber auch kein schlechter Journalist bin, noch wahrscheinlicher allerdings, weil es in der Redaktion keinen gab, der meine Arbeit für ein so winziges Gehalt wie das meine machen wollte – stellte man mich wieder ein. Ich wurde der Kulturredaktion zugewiesen, also der Abteilung, in die man die Leute steckt, von denen man nicht weiß, was man sonst mit ihnen anfangen soll. Zu dem unausgesprochenen, jedoch offensichtlichen Zweck, meine Treulosigkeit zu bestrafen – für einige Journalisten ist ein Kollege, der den Journalismus aufgibt, um Romane zu schreiben, kaum besser als ein Verräter –, musste ich anfangs Mädchen für alles spielen (nur dem Chef den Kaffee von der Bar an der Ecke holen brauchte ich nicht), und nur wenige Kollegen sparten sich sarkastische oder ironische Bemerkungen auf meine Kosten. Mit der Zeit schien die Schwere meiner Treulosigkeit abzunehmen: Bald begann ich, redaktionelle Notizen zu verfassen, Artikel zu schreiben, Interviews zu führen. So kam es, dass ich im Juli 1994 Rafael Sánchez Ferlosio interviewte, der zu der Zeit eine Reihe von Vorlesungen an der Universität hielt. Ich wusste zwar, dass Ferlosio eine extreme Abneigung dagegen hat, mit Journalisten zu sprechen, doch mit Hilfe eines Freundes (beziehungsweise einer Freundin dieses Freundes, die Ferlosios Besuch in der Stadt organisiert hatte) konnte ich ihn schließlich dazu bringen, sich ein Weilchen mit mir zu unterhalten. Denn dieses Gespräch ein Interview zu nennen, wäre vermessen; und wenn es doch eines wurde, so war es das merkwürdigste Interview meines Lebens. Schon wie er ankam! Ferlosio erschien auf der Terrasse des Cafés Bistrot inmitten eines Schwarms von Freunden, Schülern, Bewunderern und Speichelleckern; dies in Verbindung mit seiner saloppen Kleidung und einem Aussehen, in dem sich die Aura eines kastilischen Aristokraten, der sich schämt, ein kastilischer Aristokrat zu sein, unauflöslich mit der eines alten orientalischen Kriegers verwob – der mächtige Kopf mit dem zerzausten Haar, die harten Linien in dem ausgemergelten, strengen Gesicht mit der krummen Nase und den bartbeschatteten Wangen –, hätte einen unaufmerksamen Betrachter zu der Annahme verleiten können, es mit einem von Jüngern umringten Guru zu tun zu haben. Darüber hinaus weigerte sich Ferlosio rundheraus, auch nur eine einzige meiner Fragen zu beantworten, und berief sich darauf, dass er den in seinen Büchern gegebenen Antworten keine besseren hinzuzufügen habe. Was nicht hieß, dass er nicht mit mir sprechen wollte, im Gegenteil: Als suchte er seinen Ruf eines ungeselligen Menschen Lügen zu strafen (vielleicht entbehrte dieser ja tatsächlich jeder Grundlage), war er äußerst liebenswürdig, und der Nachmittag verging unter angeregtem Plaudern. Nur – sobald ich ihn, um mein Interview zu retten, (sagen wir) nach dem Unterschied zwischen einer Charakter- und einer Schicksalsgestalt fragte, kam er mir als Antwort mit einer gelehrten Abhandlung über die (sagen wir) Ursachen des Untergangs der persischen Flotte bei der Schlacht von Salamis; während, wenn ich ihm seine Meinung über die (sagen wir) Prunkfeiern zum fünfhundertsten Jahrestag der Entdeckung Amerikas entlocken wollte, er mir gestenreich illustrierend und mit einer unerschöpflichen Vielfalt von Einzelheiten die (sagen wir) korrekte Handhabung des Grathobels erklärte. Es war ein ermüdendes Tauziehen, und erst beim letzten Bier des Tages erzählte Ferlosio die Geschichte von der Hinrichtung seines Vaters; jene Geschichte, die mich während der letzten beiden Jahre so manche Nacht um den Schlaf gebracht hat. Ich weiß nicht mehr, wer den Namen Rafael Sánchez Mazas ins Spiel brachte (vielleicht einer von Ferlosios Freunden, vielleicht Ferlosio selbst). Ich erinnere mich aber, dass Ferlosio erzählte:
»Er wurde ganz in der Nähe von hier erschossen, im alten Kloster von Collell.« Er schaute mich an. »Waren Sie mal da? Ich auch nicht, aber ich weiß, dass es in der Nähe von Banyoles liegt. Es war gegen Ende des Krieges. Der 18. Juli hatte ihn in Madrid überrascht, und er musste in der chilenischen Botschaft Zuflucht suchen, wo er mehr als ein Jahr verbrachte. Ende 1937 floh er aus der Botschaft und verließ Madrid, versteckt in einem Lastwagen, vermutlich mit der Absicht, nach Frankreich zu gelangen. In Barcelona wurde er jedoch verhaftet und, als Francos Truppen die Stadt erreichten, nach Collell gebracht, was näher an der Grenze liegt. Dort hat man ihn erschossen. Es war eine Massenhinrichtung, bei der es ziemlich chaotisch zugegangen sein muss, denn der Krieg war ja verloren, und die Republikaner flohen Hals über Kopf in die Pyrenäen, und ich glaube, sie wussten nicht einmal, dass sie einen der Gründer der Falange erschossen, zudem einen engen Freund von José Antonio Primo de Rivera. Mein Vater bewahrte zu Hause die Jacke und die Hose auf, in denen er erschossen wurde, er hat sie mir oft gezeigt, vielleicht sind die Sachen sogar immer noch da; die Hose war zerrissen, weil die Kugeln ihn nur streiften, als er das Durcheinander des Augenblicks nutzte, um in den Wald zu rennen und sich dort zu verstecken. In einem Erdloch verborgen hörte er das Gebell der Hunde, Schüsse und die Rufe der Milizionäre, die ihn suchten, wohl wissend, dass sie nicht viel Zeit hatten, weil Francos Soldaten ihnen auf den Fersen waren. Irgendwann hörte mein Vater hinter sich ein Geräusch von Zweigen, drehte sich um und sah einen Milizionär, der ihm direkt ins Gesicht starrte. Im selben Moment kam von hinten der Ruf: ›Ist er da irgendwo?‹ Mein Vater erzählte, der Milizionär habe ihn noch einige Sekunden lang angesehen und dann, ohne den Blick abzuwenden, gerufen: ›Hier ist niemand!‹ Danach habe er sich umgedreht und sei davongegangen.«
Ferlosio machte eine Pause, und seine Augen verengten sich in einem Ausdruck unendlich schelmischen Wissens, wie bei einem Kind, das sein Lachen unterdrücken muss.
»Er verbrachte mehrere Tage im Wald, ernährte sich von dem, was er fand, oder was man ihm auf Bauernhöfen zusteckte. Er kannte die Gegend nicht, außerdem war seine Brille zerbrochen, so dass er kaum etwas sah; darum sagte er immer, dass er nicht überlebt hätte, wenn er nicht ein paar jungen Männern aus einem Dorf in der Nähe, Cornellà del Terri hieß es oder heißt es, begegnet wäre, die ihn versteckten und mit Nahrung versorgten, bis die Nationalen kamen. Sie wurden gute Freunde, und als alles vorbei war, blieb er noch mehrere Tage bei ihnen. Ich glaube nicht, dass er sie danach noch einmal gesehen hat, aber mir hat er öfter von ihnen erzählt. Ich weiß noch, dass er sie immer ›Die Freunde des Waldes‹ nannte; den Namen hatten sie sich selbst gegeben.«
Dies war das erste Mal, dass ich die Geschichte hörte, und so wurde sie mir erzählt. Was das Interview mit Ferlosio betrifft, so konnte ich es doch noch irgendwie zu Ende bringen, vielleicht habe ich es zuletzt aber auch frei erfunden: Wenn ich mich recht entsinne, kamen später in der Zeitung jedenfalls weder die Schlacht von Salamis zur Sprache (sehr wohl hingegen die Unterscheidung zwischen einer Charakter- und einer Schicksalsgestalt) noch der korrekte Gebrauch des Grathobels (dafür aber die prunkvollen Feiern zum fünfhundertsten Jahrestag der Entdeckung Amerikas). Auch wurden in dem Interview weder die Erschießung in Collell noch Sánchez Mazas selbst erwähnt. Von Ersterer wusste ich nur, was ich von Ferlosio darüber gehört hatte; vom Zweiten nicht viel mehr: Damals hatte ich noch nicht eine Zeile von Sánchez Mazas gelesen, und sein Name war für mich nur einer von vielen verschwommenen Namen falangistischer Politiker und Schriftsteller, die von der jüngeren spanischen Geschichte eilends begraben worden waren, als fürchteten die Totengräber, sie könnten nicht vollends tot sein.
Sie waren es tatsächlich nicht. Jedenfalls nicht vollends. Der tiefe Eindruck, den die Geschichte der Erschießung von Sánchez Mazas im Kloster von Collell auf mich gemacht hatte, weckte meine Neugier, auf diesen Autor genau wie auf den Bürgerkrieg, von dem ich bis dahin nicht viel mehr wusste als von der Schlacht von Salamis oder der korrekten Handhabung des Grathobels; und auch auf all die anderen ungeheuerlichen Geschichten, die dieser Krieg hervorgebracht hatte, die mir aber immer nur als Vorwand für die nostalgischen Erinnerungen alter Leute oder als Zündstoff für die Einfälle einfallsloser Romanschreiber erschienen waren. Zufällig (oder auch nicht ganz so zufällig) war es damals unter spanischen Schriftstellern Mode geworden, falangistische Autoren zu rehabilitieren. In Wirklichkeit hatte das schon viel früher angefangen, Mitte der achtziger Jahre, als ebenso vorzügliche wie einflussreiche Verlage hier und da ein Buch von einem vorzüglichen, in Vergessenheit geratenen Falangisten veröffentlichten; als ich mich jedoch für Sánchez Mazas zu interessieren begann, wurden in gewissen literarischen Kreisen schon nicht mehr nur die guten falangistischen Autoren rehabilitiert, sondern auch alle mittelmäßigen und sogar die schlechten. Ein paar Einfaltspinsel, aber auch die Wächter der orthodoxen Linken sowie die Handvoll allfälliger Narren verkündeten, einen falangistischen Autor rehabilitieren heiße, die Falange rehabilitieren (oder darauf hinarbeiten, sie zu rehabilitieren). In Wirklichkeit war es genau umgekehrt. Einen falangistischen Schriftsteller rehabilitieren hieß nichts anderes, als einen Schriftsteller rehabilitieren, oder vielmehr: sich selbst als Autor rehabilitieren, indem man einen guten Schriftsteller rehabilitierte. Ich will damit sagen, dass diese Mode in den besten Fällen (auf die schlechten einzugehen lohnt sich nicht) aus dem natürlichen Bedürfnis eines Schriftstellers heraus entstand, sich eine eigene Tradition zu erfinden, aus einer gewissen Lust an der Provokation, aus der problematischen Gewissheit auch, dass Literatur eine Sache ist und das Leben eine andere, und daher ein guter Schriftsteller durchaus ein unerträglicher Mensch sein kann (oder ein Mensch, der unerträgliche Dinge unterstützt und fördert), sowie aus einem literarischen Unrechtsbewusstsein gegenüber bestimmten falangistischen Autoren, die, um es auf jene griffige Formel zu bringen, die Andrés Trapiello geprägt hat, den Krieg zwar gewonnen, die Literaturgeschichte jedoch verloren hatten. Auch Sánchez Mazas entging dieser kollektiven Exhumierung nicht: 1986 wurde zum ersten Mal sein vollständiges dichterisches Werk herausgegeben, 1995 sein Roman Das neue Leben des Pedrito de Andía in einer sehr populären Reihe neu aufgelegt. Ein Jahr später wurde auch eine Neuausgabe von Rosa Krüger herausgebracht, einem Roman, der erstmals 1984 veröffentlicht worden war. Damals las ich alle diese Bücher. Ich las sie voller Neugier, sogar mit Genuss, aber nicht mit Begeisterung: Ich brauchte nicht lange zu lesen, um zu dem Schluss zu gelangen, dass Sánchez Mazas zwar ein guter, aber kein großer Schriftsteller war, wobei ich für alles Geld der Welt nicht hätte erklären können, was einen großen Schriftsteller von einem guten Schriftsteller unterscheidet. Ich erinnere mich, dass ich in den folgenden Monaten oder Jahren, wie es eben der Zufall beim Lesen so mit sich brachte, hier und da verstreute Notizen über Sánchez Mazas fand, darunter sogar eine – wenngleich sehr oberflächliche und ungenaue – Anspielung auf die Episode in El Collell.
Die Zeit verging, und allmählich vergaß ich die Geschichte. Anfang Februar 1999 dann, sechzig Jahre nach Beendigung des Bürgerkriegs, schlug jemand in der Redaktion vor, einen Artikel zur Erinnerung an das traurige Ende des Dichters Antonio Machado zu bringen, der im Januar 1939 zusammen mit seiner Mutter, seinem Bruder José und Hunderttausenden weiterer Spanier in panischer Flucht vor den heranrückenden Truppen Francos von Barcelona nach Collioure zu gelangen suchte, auf die französische Seite der Grenze, wo er wenig später starb. Jeder in Spanien kannte die Geschichte, und ich erwartete nicht zu Unrecht, dass es wohl keine katalanische (oder nichtkatalanische) Zeitung versäumen würde, bei dieser Gelegenheit an die Episode zu erinnern, und war schon darauf eingestellt, den entsprechenden Routineartikel herunterzuschreiben, als mir Sánchez Mazas und seine gescheiterte Hinrichtung wieder einfiel, die etwa zur selben Zeit stattgefunden haben musste, nur auf der spanischen Seite der Grenze. Mir kam der Gedanke, dass die Symmetrie oder vielmehr der Gegensatz zwischen diesen beiden schrecklichen Ereignissen – gleichsam ein historischer Chiasmus – vielleicht nicht zufällig war und dass, wenn es mir gelänge, sie ohne Verlust in einem Artikel zusammenzubringen, ihre merkwürdige Parallelität ihnen möglicherweise eine ganz neue Bedeutung verleihen könnte. Dieser Aberglaube festigte sich, als ich bei meinen Recherchen zufällig auf die Reise stieß, die Manuel Machado kurz nach dem Tod seines Bruders Antonio nach Collioure unternommen hatte. Darauf setzte ich mich hin und schrieb. Das Ergebnis war ein Artikel mit der Überschrift Ein notwendiges Geheimnis. Da auch er auf seine Art notwendig für diese Geschichte ist, lasse ich ihn an dieser Stelle folgen:
»Zum sechzigsten Mal jährt sich der Tag, an dem Antonio Machado in den auslaufenden Wirren des Bürgerkriegs den Tod fand. Von allen Geschichten der Geschichte ist die Machados wohl eine der traurigsten, weil sie schlecht ausgeht. Sie ist schon oft erzählt worden. Von Valencia kommend, erreichte Machado im April 1938 in Begleitung seiner Mutter und seines Bruders José Barcelona. Zuerst wohnte er im Hotel Majestic, später im Torre de Castañer, einem alten Palais am Paseo de Sant Gervasi. Dort tat er das, was er seit Beginn des Krieges immer getan hatte: Er verfocht mit seinen Schriften die Sache der rechtmäßigen, der gewählten republikanischen Regierung. Er war alt, erschöpft und krank, und an eine Niederlage Francos glaubte er schon lange nicht mehr. Er schrieb: ›Dies ist das Ende, Barcelona kann jeden Tag fallen. Für Militärstrategen, Politiker und Historiker ist der Fall klar: Wir haben den Krieg verloren. Menschlich gesehen bin ich nicht so sicher … Da haben wir ihn vielleicht gewonnen.‹ Wer weiß, ob er damit recht hatte; mit Ersterem hatte er es zweifellos. In der Nacht zum 22. Januar 1939, vier Tage bevor Francos Truppen Barcelona einnahmen, floh Machado mit seiner Familie in einem Konvoi zur französischen Grenze. Auf diesem Wahnsinnsexodus wurden sie von anderen Schriftstellern begleitet, darunter Corpus Barga und Carles Riba. Unterwegs machten sie Station in Cervià de Ter und in Mas Faixat, in der Nähe von Figueres. In der Nacht zum 27. schließlich überquerten sie nach einem Marsch von sechshundert Metern im strömenden Regen die Grenze. Ihr Gepäck hatten sie zurücklassen müssen, Geld hatten sie keines. Dank der Hilfe von Corpus Barga gelangten sie nach Collioure und kamen dort im Hotel Bougnol Quintana unter. Keinen Monat später starb der Dichter, die Mutter überlebte ihn um drei Tage. Sein Bruder José fand in Antonios Manteltasche ein paar Aufzeichnungen, eine davon vielleicht der Anfang seines letzten Gedichts: ›Diese blauen Tage und diese Sonne der Kindheit‹.
Damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Kurz nach Antonios Tod erfuhr sein Bruder, der Dichter Manuel Machado, der in Burgos lebte, aus der ausländischen Presse vom Tod seines Bruders. Manuel und Antonio waren nicht einfach nur Brüder; sie waren auch Brüder im Geiste. Manuel wurde vom Aufstand des 18. Juli in Burgos überrascht, das zum Gebiet der Aufständischen gehörte; Antonio in Madrid, das in der republikanischen Zone lag. Man kann vernünftigerweise annehmen, dass Manuel, wäre er in Madrid gewesen, zur Republik gehalten hätte; doch ist die Frage wohl müßig, was passiert wäre, hätte Antonio sich in Burgos aufgehalten. Jedenfalls besorgte sich Manuel, kaum dass er vom Tod seines Bruders erfahren hatte, einen Passierschein und traf nach mehrtägiger Reise durch ein verbranntes Spanien in Collioure ein. Im Hotel erfuhr er, dass auch seine Mutter inzwischen gestorben war. Er begab sich zum Friedhof. Dort, vor den Gräbern der Mutter und des Bruders, traf er seinen Bruder José. Sie sprachen miteinander. Zwei Tage später reiste Manuel zurück nach Burgos.
Aber auch damit ist die Geschichte – zumindest die Geschichte, die ich heute erzählen will – noch nicht zu Ende. Ungefähr zur selben Zeit, als Machado in Collioure starb, wurde im Kloster Collell, in der Nähe von Banyoles, Rafael Sánchez Mazas standrechtlich erschossen. Sánchez Mazas war ein guter Schriftsteller; er war auch ein Freund von José Antonio Primo de Rivera sowie einer der Gründer und Ideologen der Falange. Sein Tun während des Bürgerkriegs liegt weitgehend im Dunkeln. Vor einigen Jahren hat mir der Sohn, Rafael Sánchez Ferlosio, seine Version erzählt. Ich weiß nicht, ob sie den Tatsachen entspricht; ich erzähle sie so, wie ich sie von ihm gehört habe. Im republikanischen Madrid von Francos Militärputsch überrascht, flüchtete Sánchez Mazas sich in die chilenische Botschaft. Dort verbrachte er einen Großteil des Krieges; gegen Ende versuchte er, in einem Lastwagen versteckt, zu fliehen, in Barcelona wurde er jedoch verhaftet, und als Francos Truppen die Stadt erreichten, brachte man ihn zur Grenze. Nicht weit von dieser entfernt fand die Hinrichtung statt. Die Kugeln streiften ihn aber nur, und in dem Durcheinander gelang es Sánchez Mazas, in den Wald zu fliehen und sich dort zu verstecken. Er hörte die Stimmen der Milizionäre, die ihn suchten. Einer von ihnen entdeckte ihn schließlich. Er schaute ihm in die Augen, rief seinen Kameraden zu: ›Hier ist niemand!‹ Danach drehte er sich um und ging davon.
›Von allen Geschichten der Geschichte‹, schrieb Jaime Gil, ›ist Spaniens zweifellos die traurigste, / weil sie ein schlechtes Ende nimmt.‹ Nimmt sie ein schlechtes Ende? Wir werden nie erfahren, wer jener Milizionär war, der Sánchez Mazas das Leben rettete, und auch nicht, was ihm durch den Kopf ging, als er ihm in die Augen schaute; wir werden nie erfahren, was José und Manuel Machado vor den Gräbern ihrer Mutter und ihres Bruders Antonio sprachen. Ich weiß nicht, warum, aber manchmal denke ich, wenn wir eines dieser beiden parallelen Geheimnisse lüften könnten, berührten wir vielleicht ein noch viel notwendigeres Geheimnis.«
Ich war sehr zufrieden mit dem Artikel. Als er am 22. Februar 1999 veröffentlicht wurde, genau sechzig Jahre nach Machados Tod in Collioure, genau sechzig Jahre und zweiundzwanzig Tage nach Sánchez Mazas’ Erschießung in El Collell (das genaue Datum der Massenhinrichtung erfuhr ich allerdings erst später), beglückwünschte man mich in der Redaktion. In den folgenden Tagen erhielt ich drei Briefe, und zu meiner Überraschung – ich war ja nie ein polemischer Artikelschreiber, keiner von denen, die auf Leserbriefseiten zerrissen werden; und nichts hätte auch vermuten lassen, dass sich jemand für sechzig Jahre zurückliegende Ereignisse interessierte – bezogen sich alle drei auf meinen Artikel. Im ersten, von dem ich mir vorstellte, dass ihn ein Student aus dem philologischen Seminar geschrieben hatte, wurde mir vorgeworfen, in meinem Artikel hätte ich angedeutet (was ich nicht getan zu haben glaubte beziehungsweise nicht direkt getan zu haben glaubte), wenn Antonio Machado im Juli ’36 in Burgos gewesen wäre, hätte er sich auf Francos Seite geschlagen. Der zweite Brief ging noch härter mit mir ins Gericht. Ihn hatte ein Mann geschrieben, der alt genug war, um den Krieg mitgemacht zu haben. Im unverkennbaren Tonfall beschuldigte er mich des »Revisionismus«, weil der Fragesatz im letzten Abschnitt (»Nimmt sie ein schlechtes Ende?«) ziemlich unverhohlen andeute, Spaniens Geschichte habe ein gutes Ende genommen, was seiner Einschätzung nach grundfalsch sei. »Ein gutes Ende für die, die den Krieg gewonnen haben«, schrieb er, »aber schlecht für uns, die wir ihn verloren haben. Niemand hat es uns je mit dem kleinsten Fingerzeig gedankt, dass wir für die Freiheit gekämpft haben. In jedem Dorf findet sich ein Denkmal für die Toten des Krieges. Aber auf wie vielen davon haben Sie wenigstens die Namen der Gefallenen beider Seiten gesehen?« Der Brief schloss mit den Worten: »Und Scheiß auch auf die Demokratie, die dabei herausgekommen ist! Hochachtungsvoll, Mateu Recasens.«
Der dritte Brief war der interessanteste. Unterschrieben war er von einem gewissen Miquel Aguirre. Aguirre war Historiker und hatte sich, wie er schrieb, mehrere Jahre lang mit den Geschehnissen während des Bürgerkriegs in der Region Banyoles befasst. Unter anderem stand in seinem Brief etwas, das mich zu der Zeit höchst erstaunte: Sánchez Mazas war nicht der einzige Überlebende der Hinrichtung von El Collell gewesen. Ein Mann namens Jesús Pascual Aguilar hatte ebenfalls fliehen können und war mit dem Leben davongekommen. Offenbar hatte Pascual sogar ein Buch darüber geschrieben, mit dem Titel: Wie ich von den Roten ermordet wurde. »Ich fürchte, das Buch ist kaum noch aufzutreiben«, fuhr Aguirre mit der unverkennbaren Eitelkeit des Gelehrten fort, »aber wenn Sie interessiert sind, stelle ich Ihnen mein Exemplar gern zur Verfügung.« Am Ende des Briefes hatte Aguirre seine Adresse und eine Telefonnummer notiert.
Ich rief sofort an. Nach einigen Missverständnissen, denen ich entnahm, dass er bei einer Behörde oder einer öffentlichen Institution arbeitete, bekam ich ihn an den Apparat. Ich fragte ihn, ob er Informationen über die Erschießungen in El Collell habe; er sagte ja. Ich fragte ihn, ob sein Angebot noch gelte, mir das Buch von Pascual zu borgen; er sagte ja. Ich fragte ihn, ob er Lust habe, sich mit mir zum Essen zu verabreden; er sagte, er wohne in Banyoles, fahre aber jeden Donnerstag nach Gerona, um dort eine Radiosendung aufzuzeichnen.
»Wie wäre es am Donnerstag?«, sagte er.
Wir hatten Freitag, und um mir eine Woche voller Ungeduld zu ersparen, wollte ich ihm schon vorschlagen, uns noch am selben Abend in Banyoles zu treffen.
»In Ordnung«, sagte ich stattdessen. Und im selben Moment fiel mir Ferlosio ein, wie er mit fröhlich funkelnden Augen und dem unschuldigen Nimbus eines Guru auf der Terrasse des Bistrot von seinem Vater erzählte. »Treffen wir uns im Bistrot?«
Das Bistrot ist ein Lokal in der Altstadt, ein bisschen auf Pariser Café getrimmt, mit Tischen aus Marmor und Gusseisen, gemächlich kreisenden Ventilatoren, großen Spiegeln und einer blumengeschmückten Terrasse am Fuß der zur Plaza de Sant Domènech hinaufführenden Treppe. Am Donnerstag saß ich dort lange vor der verabredeten Zeit mit einem Bier in der Hand an einem Tischchen; um mich her summten die Gespräche der Literaturdozenten aus der Universität, die sich über Mittag dort einfinden. Ich blätterte mich durch eine Zeitschrift und dachte daran, dass, als wir uns verabredeten, weder Aguirre noch mir eingefallen war, ein Erkennungszeichen zu vereinbaren, obwohl keiner von uns den anderen kannte. Ich versuchte gerade, mir mit Hilfe der Stimme, die ich vor einer Woche am Telefon gehört hatte, auszumalen, wie Aguirre aussehen mochte, als sich ein gedrungener, dunkelhaariger Typ mit Brille und einer roten Schreibmappe unter dem Arm vor meinem Tisch aufbaute; drei Tage alte Bartstoppeln und das Ziegenbärtchen eines Ganoven standen wie schwarze Flechten in seinem Gesicht. Aus irgendeinem Grund hatte ich mir Aguirre als bedächtigen, professoral wirkenden alten Mann vorgestellt und nicht als den verkatert (oder exzentrisch) aussehenden jungen Spund, der da vor mir stand. Da er nichts sagte, fragte ich ihn, ob er er sei. Er sagte ja. Dann fragte er mich, ob ich ich sei. Ich sagte ja. Wir mussten lachen. Als die Bedienung kam, bestellte Aguirre gedünsteten Reis und ein Entrecote mit Roquefortsauce; ich bestellte Salat und Kaninchen. Während wir auf das Essen warteten, sagte Aguirre, er habe mich nach dem Foto auf dem Umschlag eines meiner Bücher erkannt, das er vor einiger Zeit gelesen habe. Nachdem ich die erste Brandungswelle der Eitelkeit bewältigt hatte, brummte ich:
»Du warst das also.«
»Wie bitte?«
Ich sah mich zu einer Erklärung genötigt:
»War nur ein Scherz.«
Am liebsten wäre ich gleich zur Sache gekommen, doch da ich nicht unhöflich oder neugierig erscheinen wollte, fragte ich Aguirre nach seiner Radiosendung. Er stieß ein nervöses Lachen aus und entblößte dabei seine unregelmäßigen weißen Zähne.
»Es soll eine Unterhaltungssendung sein, aber in Wirklichkeit ist sie nur dämlich. Ich verkörpere einen faschistischen Kommissar, der Antonio Gargallo heißt und Dossiers über die von ihm Verhörten anlegt. Ehrlich, ich glaube, ich verliebe mich noch in ihn. Im Rathaus weiß man natürlich nichts davon.«
»Du arbeitest im Rathaus von Banyoles?«
Aguirre nickte mit halb beschämter, halb reuiger Miene.
»Als Gemeindesekretär«, sagte er. »Auch so eine Dämlichkeit. Der Bürgermeister ist ein Kumpel von mir, er hat mich darum gebeten, und ich konnte nicht nein sagen. Aber wenn die Legislaturperiode rum ist, verdrücke ich mich.«
Seit kurzem war das Rathaus von Banyoles in den Händen eines Teams von jungen Leuten aus der Esquerra Republicana de Catalunya, der radikalen linksnationalistischen Partei. Aguirre fuhr fort:
»Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, aber meiner Meinung nach ist ein zivilisiertes Land eines, in dem man es nicht nötig hat, seine Zeit mit Politik zu verschwenden.«
Ich störte mich an dem »Sie«, hielt mich aber nicht weiter damit auf, sondern betrat lieber umgehend die goldene Brücke, die er mir mit seinem Kommentar gebaut hatte:
»Exakt das Gegenteil von dem also, was ’36 geschah.«
»Genau.«
Der Salat und der Reis wurden gebracht. Aguirre deutete auf die rote Mappe.
»Ich habe das Buch von Pascual fotokopiert.«
»Kennst du dich aus mit der Episode von El Collell?«
»Auskennen ist zu viel gesagt, es war eine ziemlich konfuse Geschichte.«
Während er den Reis in sich hineinschaufelte und mit Rotwein hinunterspülte, erzählte Aguirre, als hielte er es für unabdingbar, mich über die Vorgänge der ersten Kriegstage in der Region Banyoles zu informieren: von dem vorhersehbaren Scheitern des Putsches, der darauffolgenden Revolution, der grenzenlosen Barbarei der Komitees, der Brandschatzung von Kirchen und Ermordung von Priestern und Nonnen.
»Es ist zwar unmodern geworden, aber ich bin immer noch antiklerikal eingestellt; doch was damals passiert ist, war kollektiver Wahnsinn«, sagte er. »Natürlich lassen sich leicht Gründe finden, die diesen Wahnsinn erklären, aber man kann ebenso leicht Gründe finden, die den Nationalsozialismus erklären … Es gibt nationalistisch gesinnte Historiker, die einem einreden wollen, dass jene, die Kirchen anzündeten und Priester ermordeten, Leute von außerhalb waren, Einwanderer und so. Alles Lüge: Die waren von hier, und drei Jahre später hat mehr als nur einer von denen die Nationalen mit Hurra empfangen. Klar, wenn du danach fragst, war keiner dabei, als die Kirchen in Brand gesetzt wurden. Aber das ist ein anderes Thema. Was mich wirklich nervt, sind diese Nationalisten, die immer noch herumlaufen und dir erzählen wollen, das Ganze sei ein Krieg zwischen Kastilien und Katalonien gewesen, wie im Film, hier die Guten und da die Bösen.«
»Ich dachte, du bist Nationalist.«
Aguirre hörte auf zu essen.
»Ich bin kein Nationalist«, sagte er. »Ich bin Independentist.«
»Und was ist der Unterschied?«
»Der Nationalismus ist eine Ideologie«, erklärte er, und seine Stimme war eine Spur härter geworden, als wäre es ihm lästig, das Offensichtliche erläutern zu müssen. »Eine unheilvolle, meiner Meinung nach. Der Independentismus ist nur eine Möglichkeit. Der Nationalismus aber ist ein Glaube, und über Glauben kann man nicht streiten; über Independentismus sehr wohl. Ihnen mag das unvernünftig erscheinen. Ich halte es für sehr vernünftig.«
Jetzt ertrug ich es doch nicht länger.
»Es wäre mir lieber, du würdest mich duzen.«
»Entschuldige«, sagte er lächelnd und machte sich wieder über seinen Teller her. »Ältere Leute sieze ich normalerweise.«
Aguirre erzählte weiter vom Krieg; er hielt sich vor allem mit Details aus den letzten Tagen auf, als die Stadtverwaltungen und die Regionalregierung schon seit Monaten handlungsunfähig waren und in der ganzen Region ein heilloses Chaos herrschte: Die Landstraßen waren von endlosen Flüchtlingskarawanen verstopft, Soldaten in den Uniformen aller nur denkbaren Ränge zogen, der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung anheimgegeben, marodierend durchs Land, in den Straßengräben türmten sich Berge abgelegter Waffen und Ausrüstung … Aguirre meinte, zu der Zeit seien im Kloster Collell, das seit den Anfangstagen des Krieges als Gefängnis genutzt worden war, an die tausend Gefangene untergebracht gewesen, die alle, oder fast alle, aus Barcelona kamen. Sie seien vor den heranrückenden aufständischen Truppen dorthin gebracht worden, da es sich bei ihnen um die gefährlichsten oder unverbesserlichsten Francoanhänger gehandelt habe. Im Gegensatz zu Ferlosio glaubte Aguirre, dass die Republikaner sehr genau wussten, wen sie hinrichteten, denn die fünfzig Ausgewählten gehörten zu den wichtigsten Gefangenen, dazu bestimmt, nach dem Krieg bedeutende Positionen in Politik und Gesellschaft einzunehmen: der Regionalchef der Falange von Barcelona, Anführer verschiedener Gruppen der Fünften Kolonne, Finanziers, Anwälte, Priester, von denen die meisten in Gefängnissen des Geheimdienstes in Barcelona gesessen hatten und später in Gefängnisschiffen wie der Argentina und der Uruguay.
Das Entrecote und das Kaninchen wurden gebracht, die leeren Teller (der von Aguirre wie geleckt) abgeräumt.
»Wer hat den Befehl gegeben?«, fragte ich.
»Welchen Befehl?«, fragte Aguirre seinerseits, den Blick begehrlich auf sein riesiges Entrecote gerichtet, Fleischmesser und Gabel angriffsbereit in den Fäusten.
»Den zur Hinrichtung.«
Aguirre schaute mich an, als hätte er für einen Moment vergessen, dass ich mit ihm am Tisch saß. Er zuckte die Achseln und holte tief und geräuschvoll Luft.
»Keine Ahnung«, antwortete er, stieß die Luft aus und schnitt ein Stück Fleisch ab. »Ich glaube, Pascual deutet an, dass ein gewisser Monroy den Befehl gab; ein harter Bursche, noch jung, der das Gefängnis möglicherweise leitete. Er hatte schon in Barcelona Geheimdienstkerker und Arbeitslager beaufsichtigt, und auch in anderen Berichten aus der Zeit wird er erwähnt … Jedenfalls, wenn Monroy es war, dann hat er ziemlich sicher nicht auf eigene Faust gehandelt, sondern Befehle des SIM ausgeführt.«
»Des SIM?«
»Servicio de Inteligencia Militar, der Militärische Geheimdienst«, erklärte Aguirre. »Eines der wenigen Organe der Armee, die zu jener Zeit noch funktionierten.« Er hörte kurz auf zu kauen, dann aß er weiter und sagte: »Die Hypothese hat was für sich. Man befand sich in einer verzweifelten Situation, und die vom SIM fackelten natürlich nicht lange. Aber es gibt andere.«
»Zum Beispiel?«
»Líster. Er war dort. Mein Vater hat ihn gesehen.«
»In El Collell?«
»In Sant Miquel de Campmajor, einem Dorf ganz in der Nähe. Mein Vater war damals noch ein Kind und hielt sich in einem Gehöft in der Nähe versteckt. Er hat mir oft erzählt, dass eines Tages eine Handvoll Männer ins Haus kam, unter ihnen Líster, etwas zu essen und einen Platz zum Schlafen verlangten und dann die ganze Nacht diskutierend in der Küche saßen. Ich habe lange geglaubt, mein Vater habe sich die Geschichte ausgedacht, zumal ich feststellte, dass die meisten der Alten, die noch am Leben waren, behaupteten, Líster gesehen zu haben, der ja beinahe eine Legende geworden war, seit er den Befehl über das Fünfte Regiment übernommen hatte; aber im Lauf der Jahre habe ich ein paar lose Enden zusammengeknüpft und bin zu dem Schluss gekommen, dass etwas Wahres daran sein könnte. Du weißt es vielleicht«, fuhr Aguirre fort und tunkte genießerisch ein Stück Brot in die Saucenlache, in der sein Entrecote schwamm. Ich hatte das Gefühl, er habe sich von seinem Kater erholt, und fragte mich, was er mehr genoss, das Essen oder die Zurschaustellung seiner Kenntnisse über den Krieg. »Líster wurde Ende Januar ’39 zum Obersten befördert. Man hatte ihm den Befehl über das Fünfte Korps der Ebro-Armee gegeben; besser gesagt, über das, was vom Fünften Korps übriggeblieben war: eine Handvoll versprengter Einheiten, die sich beinahe kampflos in Richtung französischer Grenze zurückzogen. Lísters Männer waren mehrere Wochen lang in dieser Gegend, und bestimmt sind einige von ihnen im Kloster Collell untergekommen. Doch was ich sagen wollte: Hast du Lísters Memoiren gelesen?«
Ich verneinte.
»Nun ja, Memoiren sind es nicht direkt«, fuhr Aguirre fort. »Das Buch heißt Unser Krieg