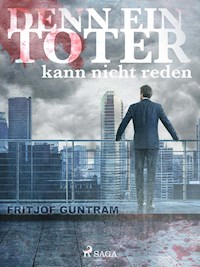Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Als Inspektor Parker das alte, vornehme Haus in der 113. Straße von Manhattan betritt, ist er fest davon überzeugt, Davis Morris überführen zu können. Die New Yorker Polizei ist schon seit Monaten hinter ihm her. Neben Brutalität verfügt er über eine gefährliche Intelligenz, doch mit dem Mord an der stillen Francis Lamy scheint Morris endlich den entscheidenden Fehler gemacht zu haben. Doch obwohl alle Beweise gegen ihn sprechen und genügend Zeugenaussagen gegen ihn vorliegen, schafft er es dennoch, seinen Kopf wieder aus der Schlinge zu ziehen. Denn Morris kennt alle Möglichkeiten, die das Gesetz auch den Gesetzlosen noch lässt. Dies ist die spannende Geschichte eines Außenseiters der Gesellschaft, der mit seinen eigenen Waffen geschlagen wird!-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fritjof Guntram
Blaulicht in Manhattan
SAGA Egmont
Blaulicht in Manhattan
Copyright © 1959, 2018 Fritjof Guntram und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711583067
1. Ebook-Auflage, 2018
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Inspektor Parker saß am Steuer seines Wagens. Der linke Arm hing lässig zum Fenster hinaus; mit dem rechten lenkte er sein schweres Oldsmobile. Als er sich jetzt eine Zigarette anzündete, war überhaupt keine Hand am Steuer. Er konnte sich diese Fahrweise leisten. Sein Wagen schlich mit höchstens zwanzig Meilen pro Stunde dahin, und die 113. Straße war eine ruhige, abseits gelegene Wohnstraße, in der nicht viel Verkehr herrschte.
Vor dem Haus 512 brachte er seinen Wagen zum Stehen. Nachdenklich musterte er das Gebäude, welches sich von seiner Umgebung insofern unterschied, als es ein Privathaus zu sein schien, während die übrigen Gebäude große Mietshäuser mit fünf und mehr Stockwerken waren. Außerdem war dieses Haus ganz aus Holz gebaut, ebenfalls etwas Ungewönliches in dieser Gegend.
Parker drückte kurz auf die Hupe und wartete. Nach ein paar Minuten erschien eine ältere Frau in der Tür des Holzhauses. Sie trug einen weißen Mantel, wie er von Aerztinnen benutzt wurde, und hatte ein freundliches, jetzt allerdings verstört aussehendes Gesicht. Als sie Parker sah, kam sie durch den Vorgarten heran und öffnete das Tor zur Einfahrt auf den kiesbestreuten Platz vor dem Haus. Parker fuhr hinein und stieg aus.
„Ich bin Inspektor Parker, Ma’am“, stellte er sich vor, „Sie haben vorhin bei uns angerufen?“
„Gott sei Dank, daß Sie kommen“, erwiderte die Frau und strich sich nervös über das Haar, „ich mache mir ja solche Sorgen. Uebrigens bin ich Mrs. Lamy. Am besten, Sie kommen gleich herein und sehen selber nach.“
„Was ist eigentlich geschehen?“ erkundigte sich Parker, während er neben ihr die Treppe emporstieg.
„Wenn ich das nur wüßte“, sagte die Frau verzweifelt, „seit heute vormittag ist meine Schwiegertochter hier in dieser Wohnung eingeschlossen und meldet sich nicht. Erst fiel es mir nicht auf, aber vorhin wurde ich mißtrauisch.“
Sie standen jetzt im Hausflur. Links führte eine Treppe in den ersten Stock. Rechts war eine Wohnungstür, an der ein angelaufenes Messingschild mit dem Namen „John Lamy“ angebracht war. Das Halbdunkel, welches hier herrschte, wurde von dem durch das Milchglasfenster fallende Licht nur schwach erhellt. Parker sah sich um. Sein Blick blieb an dem verstörten Gesicht von Mrs. Lamy hängen. Sie trug eine goldgeränderte Brille, was ihr das Aussehen einer Hausfrau mit Hochschulbildung gab.
„Ich kam herunter, um mit Francis Kaffee zu trinken“, berichtete Mrs. Lamy und wies auf die unterste Treppenstufe, „da steht noch das Tablett. Ich bringe meistens den Kaffee mit, weil mein Sohn noch kein allzu gutes Einkommen hat. Auf mein Klopfen rührte sich nichts. Auch als ich rief, kam keine Antwort. Ich ging dann um das Haus herum, aber alle Fenster waren verschlossen und die Vorhänge zugezogen.“
„Vielleicht ist Ihre Schwiegertochter fortgegangen“, mutmaßte Parker.
„Ausgeschlossen“, widersprach ihm Mrs. Lamy energisch, „ich war den ganzen Tag im Haus. Ich hätte sie sehen müssen, wenn sie fortgegangen wäre. Außerdem hätte sie mir in einem solchen Fall Bescheid gesagt; sie pflegte nie das Haus zu verlassen, ohne es mir zu sagen.“
„Halten Sie es für denkbar, daß sie schläft?“ fragte Parker.
Mrs. Lamy schüttelte lebhaft den Kopf.
„Das ist ganz unwahrscheinlich. Ich bin Aerztin, und ein solcher fester Schlaf ist mir in meinem ganzen Leben noch nie vorgekommen. Sie können mir glauben, daß ich eine ganze Menge Krach gemacht habe — aber nichts hat sich gerührt.“
„Nun“, meinte Parker, „das sieht ganz so aus, als wäre ihr etwas zugestoßen. Haben Sie keinen Schlüssel zu der Wohnungstür?“
„Leider nicht“, bedauerte Mrs. Lamy, „mein Sohn war etwas eigen. Er wollte gewissermaßen sein eigenes kleines Reich haben, und ich gab ihm alle Schlüssel, damit er nicht das Gefühl hatte, ich schnüffelte ihm hinterher.“
„Ist das Ihr Haus, Ma’am?“ wollte Parker wissen.
Sie nickte.
„Ich hatte früher meine Praxis hier, aber jetzt arbeite ich so gut wie gar nicht mehr. Ich habe ein kleines Vermögen aufgespart, verstehen Sie? Aber du lieber Himmel, wir verschwatzen hier die ganze Zeit. Wollen Sie nicht nachsehen, Inspektor?“
„Ich müßte die Tür aufbrechen“, sagte Parker zögernd.
„Deswegen habe ich Sie ja gerufen“, sagte Mrs. Lamy resolut, „die Tür kann ruhig kaputtgehen. Ich will endlich wissen, was mit Francis los ist.“
„Okay, Ma’am“, brummte Parker und lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wand. Er stemmte seine langen Beine gegen die Tür und preßte seinen Körper mit aller Kraft dagegen. Die nur aus dünnem Holz gebaute Tür zersplitterte und ließ sich mühelos öffnen. Mrs. Lamy hatte diesen Kraftakt staunend verfolgt.
„Sie haben enorme Kräfte“, sagte sie anerkennend.
„Nicht so schlimm“, brummte Parker, „es war nur eine leichte Tür.“
Er betrat die kleine Wohnung. Von dem Flur führten insgesamt vier Türen ab. Obwohl in jeder Tür eine Glasscheibe war, drang auch hier nur schwaches Licht herein. Parker blieb stehen, während Mrs. Lamy sich an ihm vorbeidrängte und die hinterste Tür öffnete. Im nächsten Augenblick stieß sie einen erschreckten, schrillen Schrei aus.
Parker war mit einem Schritt bei ihr.
„Da“, stammelte sie. Ihre Hand wies auf den Fußboden. Parker sah in die angegebene Richtung und blieb überrascht stehen.
„Damned“, murmelte er. Auf dem hellen Linoleumfußboden lag regungslos eine junge, unbekleidete Frau. Ihr Körper war seltsam verkrümmt. Ihre rechte Hand war ausgestreckt; eine Chloroformmaske lag daneben.
*
„Um Himmels willen“, sagte Mrs. Lamy mit dünner Stimme, „sie scheint zuviel von dem Chloroform abbekommen zu haben.“
„Sehen wir nach“, sagte Parker und beugte sich über die Frau. Er hatte in seiner Laufbahn schon viele Tote gesehen, und als er das wachsbleiche, regungslose Gesicht der Frau gesehen hatte, war ihm sofort klar gewesen, daß sie tot war. Wahrscheinlich Selbstmord! dachte er. Sie mußte sich mit Chloroform umgebracht haben.
Es war mehr eine routinemäßige Bewegung, mit der er den Körper der Toten umdrehte. Und da erlebte er eine Ueberraschung. Im Rükken war eine Einschußstelle. Blut war herausgesickert und bildete auf dem weißen Rükken eine schwärzliche Kruste. Parker hatte noch nie Selbstmörder gesehen, die sich selbst in den Rücken geschossen hatten. Hier lag einwandfrei ein Mord vor.
Mrs. Lamy hatte sich unbemerkt entfernt und war in den ersten Stock gelaufen. Jetzt kehrte sie mit ihrer Arzttasche wieder.
„Vielleicht ist ihr noch zu helfen“, rief sie aufgeregt.
Parker erhob sich langsam und schüttelte den Kopf.
„Da ist nichts mehr zu machen, Ma’am“, sagte er, „sie ist tot. Irgend jemand hat sie erschossen.“
Das rundliche, freundliche Gesicht von Mrs. Lamy verfärbte sich aufs neue.
„Erschossen?“ fragte sie ungläubig. „Ein Mord? Ein Mord in meinem Hause? Das gibt es nicht. Das ist ganz ausgeschlossen. Das kann ich nicht glauben.“
„Sehen Sie selber nach, Mrs. Lamy“, forderte sie Parker auf und holte aus seiner Brusttasche eine Zigarette hervor. Er hatte plötzlich das dringende Bedürfnis, zu rauchen.
Während Mrs. Lamy vorsichtig ihre Tasche beiseite stellte und sich über die Tote beugte, ging Parker zum Telefon, welches im Flur angebracht war. Er wählte eine Verbindung mit dem Polizei-Hauptquartier.
„Mord!“ sagte der diensttuende Beamte dort gelangweilt. „Gut, wir schicken die Kommission hin. Den Arzt auch, jawohl. Welche Straße ist es?“
„Die 113. Straße“, sagte Parker.
Der Beamte notierte alles. Als Parker ihm die Nummer gab, schien ihm etwas einzufallen.
„Bleiben Sie am Apparat, Inspektor“, bat er, „mir kommt die Hausnummer bekannt vor.“ Er verschwand und kehrte nach ein paar Minuten wieder.
„Sagten Sie Nummer 512?“ wollte er wissen.
Parker bejahte dies.
„Dort wohnt ein alter Bekannter von uns“, berichtete der Beamte, „David Morris. Ich habe eben noch einmal in den Akten nachgesehen, um ganz sicher zu sein. David Morris wohnt seit ungefähr einem halben Jahr als Untermieter bei Mrs. Lamy. Das ist eine Ueberraschung, Inspektor, nicht wahr?“
Parker atmete tief ein. Das war allerdings eine Ueberraschung. David Morris war der Polizei seit langem schon kein Unbekannter mehr. Er war ungefähr seit drei Jahren in New York, und seit der Zeit waren eine Reihe von Bankrauben geschehen, bei denen immer wieder die Spuren auf David Morris hinwiesen, ohne daß es der Polizei gelungen wäre, ihm etwas nachzuweisen. Parker erinnerte sich daran, daß vor ein paar Monaten zweihunderttausend Dollar aus dem Safe der Cleveland-Ohio-Bank geraubt worden waren, ohne daß man bis heute den Täter gefunden hatte. Der Mann, auf den alle Spuren hinwiesen, war David Morris. Er hatte zwei Wochen in Untersuchungshaft gesessen, dann mußte er freigelassen werden. Es gab jedoch keinen Polizeibeamten in New York, der nicht fest davon überzeugt war, daß David Morris der Täter war. Parker bildete hier keine Ausnahme.
Der Beamte sprach weiter:
„Wenn er mit dem Mord etwas zu tun hat, haben wir endlich eine Handhabe gegen ihn.“
„Ich hoffe, daß es so ist“, meinte Parker, „jedenfalls danke ich für den Tip.“
Er hängte auf und ging wieder in den Raum; in dem die ermordete Miß Lamy lag. Ihre Schwiegermutter war im Begriff, mit verstörtem Gesicht die Instrumente in ihrer Arzttasche zu ordnen.
Parker wandte sich unmittelbar an sie.
„Haben Sie heute vormittag oder in der vergangenen Nacht einen Schuß gehört?“ fragte er.
Sie schüttelte den Kopf.
„Nein“, sagte sie, „ich habe nichts gehört. Allerdings ist es möglich, daß nachts geschossen wurde. Ich leide nämlich unter Schlaflosigkeit und nehme abends immer ein Schlafmittel ein. Daraufhin schlafe ich dann so fest, daß ich nachts nichts höre.“
„Waren Sie heute vormittag allein im Haus?“ wollte Parker wissen.
Sie bejahte.
„Aber heute nacht waren mehr Leute im Haus“, setzte Parker seine Fragen fort.
„O ja“, sagte sie, „meine Tochter Josephine war da. Sie bewohnt im ersten Stock ein Zimmer. Außerdem noch Miß Handkerfield, meine Untermieterin. Mein Sohn ist seit einer Woche auf Reisen. Er ist nämlich Versicherungsvertreter und kommt nur an den Wochenenden heim.“
„Heute ist Montag“, sagte Parker, „dieses Wochenende war er wohl nicht zu Hause?“
„Nein“, sagte sie, „diesmal ausnahmsweise nicht.“
„Wer war sonst noch im Haus?“ fragte Parker.
„Niemand“, sagte sie.
Parker ließ seinen Blick durch das Zimmer schweifen. Es war fast ohne Möbel. Nur an der Wand stand eine weiße Kommode und daneben eine Waage.
„Haben Sie nicht einen weiteren, Untermieter?“ meinte Parker.
Mrs. Lamy nickte.
„Ja, Mr. Morris. Er ist allerdings seit zwei Tagen fort. Mr. Morris muß häufig geschäftlich verreisen.“
„Sind Sie sicher, daß er noch nicht zurückgekommen ist?“ erkundigte sich Parker.
„Ganz sicher“, sagte sie bestimmt, „es ist ganz ausgeschlossen, daß Mr. Morris etwas mit der Sache zu tun hat. So ein liebenswerter Mann. Jedesmal, wenn er zurückkommt, bright er mir Blumen oder Konfekt mit.“
„Ich weiß“, lächelte Parker, „er ist bei uns gut bekannt als eine Seele von Mann. Sie sind also sicher, daß in der vergangenen Nacht außer Ihnen nur noch Ihre Tochter und Miß Handkerfield im Haus waren.“
„Natürlich“, sagte sie verwundert, „aber Sie wollen doch nicht etwa behaupten, daß eine von den beiden den Mord begangen hat. Das muß ich mir ganz energisch verbitten. Für mich steht fest, daß der Mörder in das Haus eingedrungen ist. Wahrscheinlich wollte er einbrechen und wurde dabei von meiner Schwiegertochter überrascht.“
„So wird es gewesen sein“, murmelte Parker und fragte: „Darf ich mir einmal die übrigen Räume ansehen?“
„Aber selbstverständlich“, sagte sie und öffnete die Tür zum Nebenzimmer, „sehen Sie sich nur um, Inspektor. Das hier ist der Wohnraum meines Sohnes.“
Parker betrat einen ziemlich kleinen, ebenfalls spärlich möblierten Raum. In der Ecke stand ein Fernsehapparat. Davor lag ein Eisbärenfell. In der gegenüberliegenden Ecke befanden sich ein niedriger Tisch und zwei Sessel, die beide genau auf den Fernsehapparat ausgerichtet waren. Ein Schrank stand daneben, sonst war das Zimmer leer.
Der Inspektor ging auf das Eisbärenfell zu und hob einen schwarzen, metallisch glänzenden Gegenstand auf, der dort lag. Er hielt ihn mit zwei Fingern vor das Gesicht von Mrs. Lamy.
„Kennen Sie den?“ fragte er.
Sie erschrak.
„Das ist der Revolver meines verstorbenen Mannes“, sagte sie, „aber das Ding, das da auf dem Lauf steckt, kenne ich nicht.“
„Es ist ein Schalldämpfer“, sagte Parker kurz und öffnete die Verbindungstür zum Nebenzimmer. Dann stellte er sich auf das Eisbärenfell und zielte mit dem Revolver in den Nebenraum. „Von hier aus wurde wahrscheinlich der Schuß abgefeuert“, stellte er fest und sah sich um. „Das Fenster steht offen. Der Mörder kann vom Garten gekommen sein und kann von hier aus ihre Schwiegertochter erschossen haben. Wo befand sich der Revolver zuletzt?“
„Ich glaube, im Nachttischkasten meines. Sohnes“, sagte Mrs. Lamy. „Das Schlafzimmer liegt auf der anderen Seite des Flures.“
„Dann müßte der Eindringling erst in das Schlafzimmer gegangen sein, dort den Revolver geholt haben, den Schalldämpfer, den er ganz zufällig in der Tasche trug, aufgesteckt und auf dem Rückweg Ihre Schwiegertochter erschossen haben.“
Mrs. Lamy nickte lebhaft.
„So stelle ich es mir vor, Inspektor. Francis hat ihn überrascht, und deshalb erschoß er sie.“
Parker schüttelte ruhig den Kopf.
„Sie irren, Ma’am. Wenn Francis ihn überrascht hätte, hätte er sie nicht durch einen Schuß in den Rücken getötet. Wenn die Einschußstelle in der Brust säße, wäre ich gern bereit, Ihrer Theorie zu folgen, aber so?“ Er schüttelte den Kopf.
Draußen läutete es.
„Das wird die Mordkommission sein“, meinte Parker und ging, die Tür zu öffnen. Gleich darauf kamen die Beamten mit ihren Geräten herein.
„Was kann ich noch für Sie tun?“ fragte Mrs. Lamy und sah ängstlich auf die Polizisten.
„Gehen Sie hoch und kochen Sie uns einen starken Kaffee“, sagte Parker zu ihr, „ich fürchte, wir haben noch eine ganze Menge Arbeit vor uns.“
Als sie fort war, wandte er sich an den Leiter der Mordkommission, einem Inspektor aus dem Hauptquartier namens Miller.
„Was sagen Sie dazu?“ fragte er.
Der Mann schob seinen Hut zurück. Er hatte ein großes, flaches Gesicht mit ausdruckslosen Augen. Unaufhörlich bewegten sich seine Kaumuskeln.
„Großer Mist, das Ganze“, stellte er phlegmatisch fest. „Als bei uns bekannt wurde, daß hier ein Mord verübt wurde, sind wir alle erst einmal in die Höhe gesprungen. Es schien ganz klar, daß nur David Morris der Mörder sein kann.“
„Na und?“ sagte Parker.
„Der Mist ist der, daß Morris seit ein paar Tagen in Atlantic City ist. Wir sind ja über jeden seiner Schritte genauestens informiert, und wir wissen, daß er sich seit Samstag abend in Atlantic City aufhält. Daran gibt es leider keinen Zweifel. Wenn also die Frau hier in der vergangenen Nacht umgebracht wurde, kann Morris es nicht gewesen sein. Das ist so klar wie Glas, und trotzdem ärgert’s mich.“
„Schade“, sagte Parker enttäuscht, „ich hatte schon gehofft, wir hätten ihn endlich. Allerdings kamen mir sofort Zweifel. Schließlich beschmutzt keine Krähe ihr eigenes Nest, und wenn Morris wirklich den Mord begangen hätte, wäre er der dümmste Kerl von ganz Amerika.“
„Daß er das nicht ist, wissen wir“, sagte Miller. „Lassen wir also den üblichen Routineapparat anlaufen. Glauben Sie, daß Sie den Fall bekommen werden?“
„Ich denke schon“, nickte Parker.
Einer der Fingerabdruckspezialisten kam und meldete, daß auf dem Revolver keine Spuren entdeckt worden seien, ausgenommen die von Parker.
„Vielleicht bin ich’s gewesen“, grinste Parker, „fragen Sie mich mal, wo ich letzte Nacht gewesen bin.“
„Da brauche ich nicht zu fragen“, sagte Miller, „ich weiß, daß Sie in der Kneipe waren.“
„Das ist eine Gemeinheit“, entrüstete sich Parker, „ich hatte Nachtdienst im Revier und habe fünf Stunden im Archiv nach der Blutgruppe eines Posträubers gesucht. Aber ich sehe schon, mein Diensteifer wird nicht anerkannt.“
Es läutete wieder. Diesmal war es der Polizeiarzt, der kam. Er war schon ein älterer Herr mit einem roten, fleischigen Gesicht. Nachdem er die Tote untersucht hatte, stellte er fest, daß der tödliche Schuß höchstwahrscheinlich in den frühen Morgenstunden abgegeben worden war.
„Mit Sicherheit nicht gestern abend“, sagte er. „Genaueres wird erst die Untersuchung im Gerichtsmedizinischen Institut ergeben. Aber soweit ich es abschätzen kann, war es gegen fünf Uhr morgens.“
„Daher erklärt sich auch, daß die Tote unbekleidet ist“, warf Parker ein.
Mrs. Lamy kam eben mit einem Tablett voll Tassen und einer dampfenden Kaffeekanne herein. Sie hatte die letzten Worte gehört.
„Ich vermute, das hat einen anderen Grund“ rief sie. „Francis litt an Tuberkulose. Sie pflegte sich jeden Tag zu wiegen, weil sie dauernd an Gewicht verlor. Dazu entkleidete sie sich immer. Dort in der Ecke steht ja auch noch die Waage.“
„Das ist eine mögliche Erklärung“, nickte der Arzt, „aber ich wundere mich über die Chloroformmaske. Gehörte die auch der Ermordeten?“
„Sie gehörte mir“, sagte Mrs. Lamy. „Weil aber Francis mitunter an Schmerzen litt, gab ich sie ihr und zeigte ihr auch, wie man sie bedient.“
„Ah so“, nickte der Arzt und wandte sich an Parker, „ich denke mir, daß sie sich gerade gewogen hatte und dann die Chloroformmaske benützen wollte. Wahrscheinlich ist sie vor Schmerzen schon früh um fünf Uhr wach geworden. Genaues wird natürlich erst die Untersuchung im Labor ergeben. Man erlebt ja immer Ueberraschungen.“
Parker wandte sich an Mrs. Lamy:
„Ich muß Ihnen noch ein paar Fragen stellen, Ma’am“, sagte er und ging mit ihr in den Nebenraum, wo er sich in einem Sessel niederließ. Einer der Beamten folgte ihnen mit einem Notizblock, um alles mitzustenographieren.
Parker verschlang die Hände ineinander.
„Wo ist Ihre Tochter jetzt?“ fragte er.
„Im South Point Krankenhaus“, sagte Mrs. Lamy. „Sie arbeitet dort als Krankenpflegerin. Josephine wollte ursprünglich Aerztin werden wie ich auch, aber dann konnte ich ihr nach dem Tode meines Mannes das College nicht weiterbezahlen. Sie mußte abgehen und wurde Krankenpflegerin.“
„Wie lange ist Ihr Mann tot?“
„Seit achtzehn Jahren“, sagte sie.
Parker machte ein überraschtes Gesicht.
„Demnach ist Ihre Tochter schon weit in den Dreißigern“, stellte er erstaunt fest.
„Warum wundert Sie das?“ fragte Mrs. Lamy spitz. „Ist es so außergewöhnlich, daß meine Tochter siebenunddreißig ist? Ich selbst bin schließlich schon siebzig Jahre alt.“
„Nein, nein“, wehrte Parker ab, „außergewöhnlich ist es nicht. Nur — hatten Sie je das Gefühl, daß Josephine auf Francis — nun — sagen wir — eifersüchtig war?“
Mrs. Lamy stellte klirrend ihre Kaffeetasse ab.
„Das ist eine sehr merkwürdige Frage, Inspektor!“ Zwischen ihren Brauen erschien eine steile, ärgerliche Falte. „Denken Sie etwa, daß meine Tochter eine alte Jungfer ist, die ihrem verheirateten Bruder sein Eheglück mißgönnt? Da irren Sie sich gewaltig. Erstens ist. Josephine nicht so, und zweitens führte mein Sohn keine glückliche Ehe.“
„So“, meinte Parker interessiert, „hat er sich mit seiner Frau nicht gut verstanden?“
„Nein“, sagte sie abweisend, „nicht sonderlich.“
„Und woran lag das?“ erkundigte sich Parker. „Mochten sie einander nicht, war er ein Säufer, oder war sie nicht solide?“
„Es lag an ihrer Krankheit“, meinte sie kurz. „Francis war schon seit längerem nicht mehr seine Frau im eigentlichen Sinne, verstehen Sie? Die beiden lebten nebeneinander. Ihre Krankheit stand einem gesunden Eheleben im Wege, und darunter litt mein Sohn natürlich.“
„Hat er denn nie die Scheidung versucht?“ fragte Parker.
„Nein, auf so einen Gedanken wäre er nie gekommen“, sagte sie, „das wäre doch wohl unfair gewesen. Francis konnte nichts für ihre Krankheit. Mein Sohn wußte das ganz genau, und er hätte sich deshalb niemals scheiden lassen.“
„Es war ja sowieso nicht allzu schlimm, da er meistens nicht zu Hause war“, meinte der Inspektor.
Sie schüttelte heftig den Kopf.
„Sie werden sich vielleicht darüber wundern, aber wegen dieser Krankheit wurde John Vertreter. Er hätte eine gutbezahlte Stellung Mer in New York haben können, aber er entschied sich für den Beruf eines Vertreters …“
„… der ihn häufig von zu Hause fortführte“, unterbrach sie Parker. „War denn Francis unheilbar krank?“
„Höchstwahrscheinlich“, nickte sie,
„Dann ist das Verhalten Ihres Sohnes verständlich!“ Parker lehnte sich in seinem Sessel zurück und schlug die Beine übereinander. Beiläufig erkundigte er sich nach der Untermieterin von Mrs. Lamy, Miß Handkerfield.
„Sie ist ein unscheinbares, alleinstehendes Fräulein. Ich glaube, sie arbeitet irgendwo als Sekretärin“, wußte Mrs. Lamy zu berichten.
„Und sonst?“ wollte Parker wissen. „Ist sie reizvoll?“
Mrs. Lamy sah ihn streng an.
„Ich bin leider nicht imstande, so etwas zu beurteilen.“ Ihre Stimme klang vorwurfsvoll. Sie rührte heftig in ihrer Tasse.
Der Inspektor zündete sich eine neue Zigarette an.
„Sie haben noch einen weiteren Untermieter“, sagte er und blies den Rauch zur Seite.
„Mr. Morris? Der ist völlig harmlos, wie ich Ihnen schon sagte.“
Parker beugte sich vor.
„Ich zweifle nicht daran, Ma’am“, sagte er, „aber Sie müssen verstehen, daß mein leidiger Beruf mich dazu zwingt, auch alberne Fragen zu stellen. Was ist dieser Morris von Beruf?“
„Er ist Kaufmann, glaube ich.“
„Was heißt, glaube ich?“ erregte sich Parker. „Wissen Sie über Ihre Untermieter so wenig Bescheid?“
„Ich bin Aerztin“, verteidigte sie sich, „ich habe keine Zeit dazu, mich mit den Privatangelegenheiten meiner Mieter zu befassen. Das einzige, was mich interessiert, ist, daß sie ihre Miete pünktlich bezahlen. Und das tun sie. Was soll ich mich sonst um sie kümmern?“
„Ein vernünftiger Standpunkt, Ma’am“, lobte sie Parker, „da ist meine eigene Wirtin ganz anders. Stellen Sie sich vor, neulich erwischte ich sie doch, wie sie versuchte, einen Privatbrief an mich über einem Dampfkessel zu öffnen. Man soll es nicht für möglich halten, wie wenig heutzutage die persönliche Freiheit des einzelnen geachtet wird. Ich freue mich, daß Sie eine Ausnahme bilden. Man trifft so viele schlechte Menschen. Also Sie können mir gar nichts über Mr. Morris sagen?“
„Nun —“ sie überlegte —, „er selbst ist ein sehr sympathischer Mann. Ich fürchte nur, daß seine Freunde einen schlechten Einfluß auf ihn ausüben. Manchmal kommt er betrunken in Gesellschaft von Leuten heim, die ich lieber nicht in meinem Haus hätte. Ich habe ihm einmal sogar deswegen Bescheid gesagt, und er war sehr vernünftig. Er versprach, diese Leute nie wieder mitzubringen, und er hat es seither auch nicht mehr getan.“
„Wissen Sie, wann er zurückkommt?“ wollte Parker wissen.
„Er wollte morgen wieder hier sein.“
Parker meinte: „Dann werde ich ihn ja bald selber sprechen können. Und ebenso Miß Handkerfield. Ihre Tochter Josephine ist ja wohl heute abend noch zu erreichen?“
„O ja, gewiß“, sagte sie.
„Fein“, meinte Parker, „und wann kommt Ihr Sohn zurück?“
„John wollte Ende der Woche wieder hier sein“, sagte sie, „er ist seit genau einer Woche unterwegs und reist diesmal nach Vermont. Ich denke, daß er heute in Montpelier ist.“
„Na“, sagte Parker, „vielleicht erreichen wir ihn dort. Hoffentlich nimmt er die schreckliche Nachricht gefaßt auf.“
In diesem Augenblick läutete die Hausglocke. Einer der Beamten ging hinaus. Gleich darauf kam er wieder herein und flüsterte Parker etwas ins Ohr. Der Inspektor erhob sich und ging zur Tür.
Draußen stand ein Telegrafenbote.
„Telegramm für Mrs. Lamy“, sagte er, „aus Montpelier.“
„Geben Sie her“, sagte Parker. Er nahm den Umschlag und wartete, bis der Bote wieder fort war. Dann riß er ihn auf.
Das Telegramm stammte von John. Es war vor einer Stunde in Vermont aufgegeben worden. Der Text lautete:
„Soeben in Montpelier, Hotel Mount Royal, eingetroffen. Habe im Wohnzimmer Lesebrille liegenlassen. Bitte um umgehende Nachsendung.
Gruß John.“
Miller war hinter Parker getreten und hatte über dessen Schulter mitgelesen.
„Der junge Mann hat das Telegramm an seine Mutter adressiert und nicht einmal einen Gruß an seine Frau dazugeschrieben“, meinte Miller. „Die jungen Ehemänner von heute sind doch wahrhaft komische Nudeln, oder steht dieser John noch derart unter dem Pantoffel seiner Mutter, daß er nicht an seine Frau zu schreiben wagt?“
„Vielleicht“, sagte Parker dunkel, „vielleicht hat er an seine Mutter geschrieben, weil er es für sinnlos hielt, an eine Tote zu schreiben.“
Miller sah ihn sonderbar an.
„Was meinen Sie damit?“ fragte er gedehnt.
„Ich meine, daß John Lamy nicht schon eine Woche unterwegs ist, wie uns Mrs. Lamy glaubhaft machen wollte. Wenn er seine Lesebrille vergessen hat, dann wartet er nicht eine Woche, um sie dann telegrafisch anzufordern. Als Vertreter braucht er sicher seine Brille täglich, und es dürfte ausgeschlossen sein, daß er ihr Fehlen erst heute bemerkte. Es gibt nur eine Erklärung dafür.“
„Und die wäre?“ wollte Miller wissen.
„John Lamy ist erst heute früh abgereist. Das bedeutet, daß er mit großer Wahrscheinlichkeit noch zur Mordzeit im Hause war, daß seine Frau schon tot war, als er das Haus verließ. Ich kann mir einfach nicht denken, daß er die Tote nicht gesehen hat, als er abfuhr. Hätte er sie aber gesehen, hätte er zweifellos sofort die Polizei alarmiert, vorausgesetzt, daß er nicht der Mörder ist.“
„Warum sollte er sie aber erschossen haben?“ wandte Miller ein.
„Gründe gibt es genug“, sagte Parker. „Die unheilbare Krankheit seiner Frau ist ein durchaus denkbares Motiv. Es sind natürlich noch eine ganze Menge ungeklärter Fragen da, aber ich glaube, die werden wir lösen können. Auf jeden Fall werde ich mir diesen John einmal vorknöpfen.“
„Ich glaube immer noch, daß David Morris seine Finger bei der Sache im Spiel hat“, meinte Miller.
„Das“, sagte Parker, „wäre natürlich eine besonders angenehme Ueberraschung.“
Die weitere Untersuchung des Tatortes nahm dann noch geraume Zeit in Anspruch. Schließlich kam der Polizeiwagen und brachte die Tote ins Gerichtsmedizinische Institut, Das gesamte Haus war durchsucht worden, ohne daß die Polizisten etwas gefunden hätten.
Gegen vier Uhr fuhr Parker zurück ins Revier. Ein uniformierter Polizeibeamter blieb in der Wohnung zurück. Er hatte die Aufgabe, die für den Abend zurückerwartete Miß Handkerfield zur Vernehmung ins Revier zu schaffen. Dies geschah gegen fünf Uhr.
*
Miß Handkerfield war ein aufgetakeltes Weibsbild, überelegant, stark geschminkt, mit gespreiztem, affektiertem Wesen. Parker schätzte sie auf Mitte Dreißig, möglicherweise jedoch war sie auch älter. Sie wurde von dem Polizisten begleitet und gebärdete sich ganz, als habe man sie verhaftet.
„Was soll das heißen, Inspektor?“ kreischte sie, als sie in Parkers Zimmer geführt wurde. „Seit wann werden in diesem Land Damen von der Polizei belästigt? Ich gebe Ihnen überhaupt keine Auskunft, solange ich von Ihren Leuten auf diese Art behandelt werde. Ich bin schließlich ’ne Dame!“
Der Inspektor setzte ein freundliches Lächeln auf.
„Nehmen Sie bitte Platz, Ma’am!“ Er schob ihr einen Stuhl hin. „Ich bin untröstlich, daß wir Sie belästigen mußten. Hoffentlich hat man Sie nicht unhöflich behandelt.“
Sie funkelte ihn zornig an: