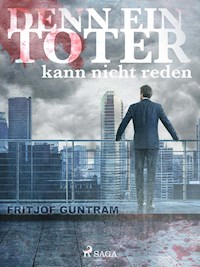Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Ein packender Krimi, der nicht so leicht aus der Hand gelegt wird!Der Mord des Polizeisergeanten Williamson, der bei seinen abendlichen Runden auf einen Dieb gestoßen war, löst ein großes Chaos bei den oberen Klassen Londons aus. Doch letztendlich scheint der Dieb und Mörder tatsächlich gefasst. Als jedoch auf einer Kreuzfahrt, wo dieselben Personen anwesend sind, die auch am Mordprozess beteiligt waren, die Crew vergiftet und ein geplanter Anschlag auf einen der Anwesenden vermutet wird, gerät die Situation aus den Fugen!-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fritjof Guntram
Kreuzfahrt des Todes - Kriminalroman
Saga
Kreuzfahrt des Todes – KriminalromanCopyright © 1960, 2019 Fritjof Guntram und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711583098
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Die Zeiger der Kirchturmuhr krochen langsam vorwärts. Als sie die volle Stunde erreichten, fielen drei tiefe, hallende Glockenschläge durch die Nacht.
„Drei Uhr schon!“ Polizeisergeant Williamson vom 119. Revier sah auf das Leuchtzifferblatt seiner Armbanduhr. Er war gerade die Fulham Street entlangpatroulliert und bog jetzt in eine der vielen kleinen dunklen Seitenstraßen ein, deren es im Osten von London unzählige gibt. Die Nacht war ungemütlich. Ein feuchter, zäher Nebel lag über der Stadt. Der Polizeisergeant sah noch einmal auf seine Uhr, als könnte er die Zeit dadurch beschleunigen. Bis fünf Uhr hatte er Dienst.
Zu beiden Seiten der Straße standen hohe, düstere Häuser. Lagerhallen, Büroräume und Armeleutewohnungen. Wer Geld hatte, wohnte im Westen. Williamson ging langsam die Straße hinunter. Ein schwacher Lichtschein kam ihm entgegen. Er blieb stehen.
Der Lichtstrahl der Fahrradlampe huschte hin und her und verlöschte ganz, als der Fahrer anhielt. Es war ein alter Mann in der schwarzen Uniform der Wach- und Schließgesellschaft.
„‘n Abend, Bill“, krächzte er, „miserables Wetter, was?“
„Kann man wohl sagen“, nickte der Sergeant, „irgend etwas Neues?“
„Hier passiert schon seit zwanzig Jahren nichts Neues mehr“, sagte der alte Mann, „das ist die toteste Gegend dieser Stadt. Ich bin froh, wenn ich mal ein offenes Tor finde, das ich abschließen kann, wie dort vorne. Man will doch wissen, wofür man bezahlt wird.“
„Na, denn auf ein Neues“, sagte der Sergeant.
„'n Abend, Bill!“ Der Mann schwang sich wieder auf sein Rad und entfernte sich langsam.
Der Sergeant ging bis zum Ende der Straße, das gleichzeitig auch das Ende seines Reviers bildete. Er blieb ein paar Minuten stehen und wartete, bis sein Kollege, Sergeant Conwall vom 130. Revier, erschien. Seit fünf Jahren trafen sie sich an dieser Stelle, und seit fünf Jahren führten sie die gleiche Unterhaltung:
„Schlechtes Wetter, was?“
„Einfach scheußlich!“
„Irgend etwas Neues?“
„Nicht das geringste!“
„Na, dann mach’s gut!“
„Bis morgen dann!“
Williamson überquerte die Straße und ging auf der anderen Straßenseite zurück. Von jetzt bis um fünf Uhr würde er niemanden mehr treffen, wenn alles seinen gewohnten Gang nahm. Es konnte ihm höchstens passieren, daß er einen Funkstreifenwagen traf, und dann würde es auch dieselbe stereotype Unterhaltung geben:
„Irgend etwas Neues, Sergeant?“
„Nicht das geringste, Sir!“
Aber das geschah selten, durchschnittlich im Monat einmal, und wenn der Wagen auf Einsatzfahrt war, hielt er nicht einmal bei ihm an, sondern raste weiter. Von jetzt an würde er allein seine Runden machen, wenn, ja wenn nicht irgend etwas Neues geschah. Und das war in dieser Nacht wirklich nicht zu erwarten, in dieser dunklen, nebligen Nacht im Osten Londons.
Als Sergeant Williamson die Straße zur Hälfte wieder zurückgegangen war, blieb er stehen. Irgend etwas fiel ihm auf, ohne daß er hätte sagen können, was das war. Nachdenklich sah er sich um. Die Straße lag verlassen vor ihm, trübe erleuchtet von den mit einem milchigen Schein umgebenen Gaslaternen. Er konnte in jeder Richtung drei Laternen sehen. Was weiter entfernt war, wurde durch den immer dichter werdenden Nebel verborgen.
Sein Blick wanderte auf die andere Straßenseite hinüber. Und plötzlich wußte er auch, was ihm aufgefallen war.
Der schwarze Personenwagen, der dort parkte, hatte vor zehn Minuten noch nicht dort gestanden. Er war sich seiner Sache ganz sicher, weil er sich an genau dieser Stelle mit dem Mann von der Wach- und Schließgesellschaft unterhalten hatte.
Ohne sonderlich aufgeregt zu sein, überquerte Sergeant Williamson die Straße. Nachdenklich blieb er vor dem Fahrzeug stehen. Es war ein großer Rootes, ein teures Auto. Er legte die Hand auf die Haube und fand das Blech noch warm.
Kein Zweifel, der Wagen war in den letzten zehn Minuten erst gekommen.
Er hatte jedoch nichts gehört, obwohl er sich höchstens zweihundert Meter von dieser Stelle entfernt hatte. Aber wo war der Fahrer? Sein Blick wanderte über die dunklen Häuserfronten. Nirgendwo konnte er einen Lichtschein entdecken. Er lauschte in die Nacht hinein, ohne jedoch das geringste zu hören.
Sergeant Williamson nahm seine Wanderung wieder auf. Als er nach zehn Minuten wieder zurückkehrte, stand das Auto immer noch an derselben Stelle.
Einen Augenblick überlegte er, ob er sich die Nummer aufschreiben sollte. Er ließ es sein, und das sollte ein schwerer Fehler sein. Statt dessen ging er zu dem großen Bürohaus, das an dieser Stelle der Straße stand, und prüfte nach, ob die Tür verschlossen war. Sie war es nicht.
Und da wurde Sergeant Williamson nachdenklich. Es war nämlich dieselbe Tür, welche der Wachmann vorhin unverschlossen gefunden und zugesperrt hatte.
Am Ende der Straße war eine Telefonzelle. Der Sergeant hätte hingehen und das Revier verständigen können. Er unterließ es ebenfalls, und das sollte sein zweiter Fehler in dieser Nacht sein.
Statt dessen drückte er die Tür auf und betrat den dunklen Flur des Gebäudes, entschlossen, erst nachzusehen, ehe er Verstärkung herbeirief.
Das Treppenhaus roch nach Bohnerwachs. Er knipste seine Taschenlampe an und ließ den Lichtstrahl umherwandern. Auf dem Fußboden waren feuchte Stellen. Jemand war hier mit nassen Füßen gegangen. Die Schritte führten die Treppe empor. Der Sergeant folgte ihnen.
Oben verloren sie sich in dem Schmutz eines täglich von vielen Menschen begangenen Ganges. Williamson wußte, daß hier eine Importgesellschaft, zwei Rechtsanwälte, ein Immobilienmakler und ein Zahnarzt ihre Geschäftsräume hatten. Langsam schritt er den Gang entlang. Die Stille in dem riesigen Gebäude hatte etwas Bedrückendes an sich. Der Schein seiner Lampe huschte über die einzelnen Türen, verweilte etwas, wanderte weiter und hielt plötzlich an.
Bei der letzten Tür steckte der Schlüssel im Schloß. Sergeant Williamson warf einen Blick auf das weiße Emailleschild, das dort angebracht war:
„Jay Vellecini Ltd. — Import“.
Nach kurzem Zögern klopfte er heftig an die Tür. Nichts rührte sich. Sergeant Williamson war ohne Zweifel ein mutiger Mann, aber es wäre besser für ihn gewesen, wenn er sich etwas zurückgehalten hätte.
Nach kurzem Zögern jedoch drückte er entschlossen die Klinke hinunter und betrat den Raum. Es war ein nüchternes Bürozimmer mit einem großen Schreibtisch, auf dem zahlreiche Papiere unordentlich durcheinander lagen, einigen Aktenschränken, zwei niedrigen Regalen und einem in die Wand eingebauten Tresor. Sergeant Williamson sah auf den ersten Blick, was geschehen war. Die schwere Eisentür des Tresors stand weit offen, und dahinter glänzten die leeren Stahlfächer im Schein seiner Lampe.
Der Einbrecher schien das Weite gesucht zu haben. Sergeant Williamson lief zum Schreibtisch und nahm den Telefonhörer hoch. Nach wenigen Sekunden war die Verbindung mit der Polizeizentrale hergestellt.
„Hier spricht Sergeant Williamson“, sagte er, „Einbruchsdiebstahl in der Regence Street 51. Ein Tresor wurde aufgebrochen. Schicken Sie bitte sofort einen Wagen her. Ich erwarte Sie hier!“ Er wartete, bis der Beamte die Meldung wiederholt hatte und legte dann auf.
Als er sich umwandte, erstarrte er. Neben der Tür stand ein fremder Mann, klein, elegant gekleidet. Eine Sekunde starrten sich die beiden verblüfft an, dann riß der Mann das neben ihm stehende Regal um und sprang zur Tür hinaus.
„Stehenbleiben!“ brüllte Williamson und sprang über das Hindernis. Draußen im Flur schaltete er die Deckenbeleuchtung an. Der andere hatte inzwischen die Treppe erreicht und raste in großen Sätzen nach unten. Williamson beugte sich über das Geländer.
„Stehenbleiben!“ schrie er noch einmal.
In diesem Augenblick hörte man in der Ferne das durchdringende Heulen einer Polizeisirene.
Mit verzerrtem Gesicht stürzte der Mann auf die Straße hinaus und rannte zu seinem Wagen. Williamson folgte nur wenige Sekunden später.
Als der Motor angesprungen war, hatte der Sergeant den Wagen erreicht und riß die Tür auf. Er packte den Mann am Anm.
„Kommen Sie ‘raus!“ keuchte er, „Sie haben keine Chance mehr.“
In der Hand des Mannes tauchte plötzlich ein schwarzer, kleiner Gegenstand auf. Eine runde Oeffnung zeigte genau auf den Sergeant.
„Nein“, schrie Williamson und wollte sich zur Seite werfen. Aber es war zu spät.
Sergeant Conwall, der in diesem Augenblick zwei Straßen weiter patroullierte, hörte einen dumpfen Knall, gefolgt von einem zweiten. Dann ertönte das Geräusch eines sich mit hoher Geschwindigkeit entfernenden Wagens.
Als ungefähr eine halbe Minute später das Aufheulen einer Polizesirene zu ihm drang, setzte er sich in Laufschritt, bis er die Regence Street erreichte.
Dort fand er seine Kollegen. Einer beugte sich gerade über den am Boden liegenden Williamson, und als er sich aufrichtete, verlangte er nach einer Decke.
Die breitete er über den Körper des ermordeten Polizisten.
Eine halbe Stunde später traf Inspektor Lee mit dem Wagen der Mordkommission am Tatort ein. Der Arzt war schon vorher gekommen. Während sich die Fachleute sofort an die Untersuchung machten, ließ Lee sich von der Besatzung des Funkstreifenwagens über die Ereignisse berichten.
Inspektor Lee hatte schon viele Mordfälle bearbeitet; aber wenn es sich um einen Mord an einem Polizeibeamten handelte, dann war ihm, als hätte er es mit einem Angriff auf seine persönliche Ehre zu tun. Dieses Verbrechen geschah nur sehr selten in England, denn es gehörte zu den wenigen, auf denen noch die Todesstrafe stand. Mit um so größerem Eifer verfolgte Lee darum diesen Fall.
„Sergeant John Peter Williamson“, sagte der Funkstreifenbeamte gerade, „achtunddreißig Jahre alt, verheiratet, ohne Kinder. Seit neun Jahren Polizeibeamter. War vorher Unteroffizer bei den Einunddreißigern.“
„Ich war beim selben Regiment“, grollte der Inspektor, „bin zwar vor Williamson dagewesen, im Krieg, verstehen Sie, aber ich möchte gefressen werden, wenn dieser Mord nicht die größte Schweinerei der beiden letzten Jahre ist.“
„Zweifellos, Sir“, nickte der Polizist.
„Wie konnte Williamson auch nur so unvorsichtig sein“, sagte Lee, „er hat Sie vor dem Mord angerufen, sagten Sie?“
„Er rief an und teilte mit, im Haus Regence Street 51 wäre ein Einbruch verübt worden.“
„Von wo aus rief er an?“
„Unmittelbar vom Tatort, Sir!“
„Wie hat er von dem Verbrechen Kenntnis erhalten? Durch eine Anzeige?“
„Nein. Sergeant Williamson tat in diesem Bezirk Dienst. Vermutlich ist ihm etwas Verdächtiges aufgefallen, und er betrat das Haus her, um darin nachzusehen. Dort muß er den Einbrecher überrascht haben. Ich nehme an, er verfolgte ihn bis auf die Straße und wurde dann von ihm erschossen.“
Der Inspektor rieb sich nachdenklich das Kinn.
„Wie weit waren Sie von hier entfernt, als Sie Befehl erhielten, hierherzukommen?“
„Wir fuhren gerade durch die Land Street, ungefähr zwölf Häuserblocks entfernt.“
„Und wie lange brauchten Sie, um hierherzukommen?“
„Etwa drei bis vier Minuten.“
„Haben Sie die Schüsse gehört?“
Nein, Sir. Vermutlich wurde das Geräusch von unserem eigenen Motorengeräusch verdeckt.“
Ein Streifenwagen kam langsam mit abgeblendeten Lichtern die Straße herunter. Es waren kaum Menschen auf die Straße gekommen. Im näheren Umkreis lagen fast keine Wohnungen, nur Büro- und Lagerhäuser. Aus dem Hause Nr. 51 war lediglich der Hausmeister gekommen, ein kleiner, alter Mann mit grauen Haaren und einem erschreckten Gesicht. Er trug einen verschlissenen roten Morgenrock und verfolgte stumm die Bewegungen der Polizeibeamten.
„Wir haben sofort veranlaßt, daß das Viertel abgesperrt wurde“, fuhr der Polizist fort, „aber wir haben kaum Chancen, den Mörder zu fassen. Es stehen hier noch ziemlich viele Ruinen vom Krieg her, und außerdem existieren hier einige tote U-Bahnschächte. Der Mörder hat tausend Unterschlupfmöglichkeiten.“
„Die Suche wird trotzdem fortgesetzt“, ordnete Lee an, „jeder Winkel wird durchgekämmt. Man soll Ihnen die Hundeführer zur Unterstützung schicken. Das hier ist kein gewöhnlicher Fall, Sergeant.“
„Nein, Sir.“
„Wir müssen den Burschen fassen, der dieses gemeine Verbrechen begangen hat. Und jetzt möchte ich mir das Büro ansehen, in welches eingebrochen wurde.“
„Einen Augenblick, Sir“, unterbrach ihn der Polizist, „Sergeant Conwall vom 130. Revier hat Ihnen noch etwas zu sagen.“
Der Sergeant, der im Hintergrund gewartet hatte, trat vor. „Ich habe die Schüsse gehört, Herr Inspektor“, sagte er, „es waren zwei Schüsse. Ich befand mich gerade auf meinem Rundgang zwei Straßen weiter. Nach den Schüssen hörte ich das Aufheulen eines Motors. Nach meiner Schätzung entfernte sich der Wagen in südlicher Richtung, während der Funkstreifenwagen von Norden kam.“
Lee machte ein ärgerliches Gesicht.
„Wenn der Mörder im Auto geflohen ist, dürfte er schon längst über alle Berge sein. Verdammter Mist. Sergeant, rufen Sie in der Zentrale an, und sagen Sie, ich wünsche über jedes gestohlene Fahrzeug informiert zu werden, das heute nacht wiedergefunden worden ist. Vermutlich kam der Mörder in einem gestohlenen Wagen und hat ihn irgendwo stehengelassen. Dann haben wir wenigstens einen Anhaltspunkt, in welche Richtung er geflohen ist. Und jetzt möchte ich das Büro sehen.“
Er betrat das Haus, gefolgt von einigen Beamten und dem Hausmeister, der stumm hinterherlief.
Oben erwartete ihn ein Polizeibeamter. Die Fingerabdruckspezialisten und der Fotograf hatten bereits ihre Arbeit begonnen. Das Einbruchsdezernat war verständigt; doch waren die Fachleute noch nicht eingetroffen.
„Von hier aus hat er telefoniert“, sagte der Polizist.
„Er muß den Einbrecher erst nach dem Telefongespräch entdeckt haben“, sagte der Inspektor. Sein Blick fiel auf das umgestürzte Regal. „Der Gangster wird hier im Zimmer versteckt gewesen sein, als Williamson telefonierte. Als er hörte, daß die Funkstreife in wenigen Augenblicken da sein würde, begann er eine überstürzte Flucht. William verfolgte ihn und wurde auf der Straße erschossen. Dann sprang der Einbrecher in seinen Wagen und raste davon. Das muß sehr schnell geschehen sein, denn zwischen dem Telefonspräch und dem Kommen des Polizeiwagens lagen nur wenige Minuten.“
Er musterte nachdenklich den geöffneten Tresor.
„Das Schloß weist keine Beschädigung auf“, sagte einer der Beamten, „entweder der Tresor stand bereits offen, oder aber der Einbrecher besaß einen Schlüssel.“
„Ich vermute das letztere“, sagte Lee, „er hat auch die Tür mit einem Schlüssel geöffnet.“
Einer der Fingerabdruckspezialisten trat zu ihm. „Hier ist der Schlüssel, Sir. Fingerabdrücke sind keine dran. Der Bursche muß mit Handschuhen gearbeitet haben.“
Nachdenklich betrachtete der Inspektor den kleinen Sicherheitsschlüssel.
„Wer ist eigentlich der Eigentümer dieses Büros?“
„Die Vellecini — Import Ltd. Eine italienische Gesellschaft, die Südfrüchte einführt.“
„Sind die Leute verständigt?“
„Noch nicht. Wir haben versucht, den Leiter des Büros telefonisch zu verständigen, aber es meldete sich niemand. Jetzt ist ein Beamter zu ihm unterwegs.“
„Wie heißt der Mann?“
„Christopher Punch!“
„Punch“, wiederholte der Inspektor sinnend. Der Name sagte ihm nichts. „Jedenfalls muß ich diesen Punch morgen früh sprechen. Er wird uns erklären, wieso der Einbrecher über sämtliche Schlüssel verfügte, die er brauchte.
Die Unterhaltung mit Punch fand am Morgen in dessen Wohnung im Westend statt. Punch, ein kleiner, beleibter Mann mit schon ergrautem Haar und unruhigen Mäuseaugen, bewohnte ein kleines, aus roten Backsteinen erbautes Haus. Er war Junggeselle; außer ihm lebte nur noch eine alte Wirtschafterin im Haus.
„Entsetzlich“, rief Punch theatralisch aus, „daß dieses fürchterliche Verbrechen gerade vor meinem Büro stattfinden mußte. Erlauben Sie mir, Inspektor, Ihnen mein tiefstes Beileid auszusprechen.“
„Mit Beileid komme ich hier nicht weiter. Ich brauche präzise Angaben.“
„Fragen Sie!“ Punch spreizte die Finger und hob die Hände. „Fragen Sie! Wissen ist Macht, sagte schon Bacon.“
„Wie viele Schlüssel zu Ihrem Büro besitzen Sie?“
„Zwei!“
„Hat außer Ihnen noch jemand Schlüssel dazu?“
„Nein.“
„Besitzen Sie noch beide Schlüssel?“
„Natürlich!“ Punch erhob sich. „Ich werde sie Ihnen zeigen.“
Er ging in den Flur und holte einen kleinen Sicherheitsschlüssel von einem Haken, an dem noch zahlreiche andere Schlüssel hingen.
„Der andere ist in meiner Jackentasche“, sagte er, und seine Hand fuhr hinein. Plötzlich nahm sein Gesicht einen verdutzten Ausdruck an. Er griff schnell in die andere Tasche. Wieder nichts. Hastig durchwühlte er alle Taschen.
„Ich hätte schwören können, daß ich ihn eingesteckt habe“, murmelte, „gestern habe ich ihn doch noch benützt. Nun, Irren ist menschlich. Sagte schon Seneca.“
Er sah sich suchend um.
„Vielleicht liegt er auf dem Schreibtisch.“ Er durchwühlte eine Reihe von Papieren, die wirr durcheinander auf dem großen Mahagonischreibtisch lagen, öffnete die Schubladen und suchte auch dort, ohne Ergebnis.
„Das verstehe ich wirklich nicht“, sagte er, „ich werde doch den Schlüssel nicht verloren haben.“
„Jedenfalls haben Sie ihn nicht“, nickte Lee, „hatte irgendeiner Ihrer Angestellten Gelegenheit, den Schlüssel an sich zu nehmen?“
„Nein, ausgeschlossen“, sagte Punch, „der Schlüssel befand sich stets in meiner Jackentasche. Und Sie werden doch nicht etwa annehmen, jemand von meinen Angestellten käme als Täter in Frage. Das ist ganz ausgeschlossen. Ich verbürge mich für meine Leute — wie sagte Schiller? Die Treue ist kein leerer Wahn.“
„Sehr schön“, knurrte Lee, „Sie werden es mir hoffentlich nicht übelnehmen, wenn ich Ihre Zuversicht nicht teile. War viel Geld in dem Safe?“
„O ja — insgesamt fünftausend Pfund. Es waren lauter neue Scheine, die erst von der Bank gekommen waren.“
„Hatten Sie öfters so viel Geld im Safe?“
„Nein, eigentlich nicht. Es war ein Ausnahmefall. Mr. Vellecini, der Inhaber unserer Firma, ist vor einigen Tagen nach London gekommen und beabsichtigte, einige größere Rechnungen in bar zu bezahlen. Dazu kommt noch, daß heute die Gehälter der Angestellten fällig sind.“
„Wer von Ihren Leuten wußte, daß vergangene Nacht so viel Geld im Safe sein würde?“
„Ich glaube, alle, die außer mir im Büro arbeiten. Das ist meine Sekretärin, Miß Beverly und unser junger Volontär, Jean Sibourg.“
Lee ließ sich die Adressen der beiden geben.
„Aber ich versichere Ihnen, daß beide völlig unschuldig sind“, rief Punch aus, „Miß Beverly arbeitet seit sechs Jahren für mich. Ich schätze sie als außerordentlich zuverlässig und gewissenhaft. Und Jean Sibourg stammt aus einer sehr vermögenden Schweizer Familie. Sein Großonkel war unser Geschäftspartner in Zürich. Der junge Mann wird einmal eine sehr große Erbschaft antreten. Warum sollte er wegen lumpiger fünftausend Pfund einen Einbruch verüben?“
„Das kann ich Ihnen auch nicht sagen“, meinte Lee und erhob sich, „ich bewundere die Gelassenheit, mit der Sie diesen schweren Schlag hinnehmen, Mr. Punch.“
Punch lächelte breit.
„Aber warum sollte ich mich aufregen, Inspektor? Natürlich bedauere ich den Tod des, armen Polizisten. Das Geld jedoch macht mir keinen Kummer. Einmal sind wir gegen Diebstahl versichert, zum zweiten könnte unsere Firma einen solchen Verlust ohne weiteres verkraften, und zum dritten vertraue ich darauf, daß Sie das Geld wieder herbeischaffen. Aeh — wir werden uns erlauben, zur Beerdigung des armen Polizisten einen Kranz zu schicken.“
„Sie sind zu gütig“, sagte Lee. „Uebertreiben Sie nicht“, wehrte Punch ab, „wir wissen nur, was unsere Pflicht und Schuldigkeit ist.“
Miß Beverley bewohnte ein möbliertes Zimmer unweit des Hyde Parks, ein typisch englisches Zimmer mit Rüschen und Spitzen, vorstehenden Erkern, bunten Fensterscheiben in der Tür, Nippesfiguren und einem zugigen Kamin. Sie war gerade aufgestanden, als Lee, begleitet von zwei Beamten, erschien. Einigermaßen erstaunt betrachtete sie den seltsamen Besuch am frühen Morgen. Sie war eine ältliche Person und hatte etwas Vertrocknetes an sich.
„Verzeihen Sie, Miß Beverly“, sagte Lee, „aber wir müssen Ihre Wohnung durchsuchen. Hier ist der Haussuchungsbefehl.“
Er legte ein weißes Papier auf den Tisch. Normalerweise war es ziemlich schwer, einen solchen Befehl zu erhalten, aber hier handelte es sich um einen Mord an einem Polizisten, und das war ein besonderer Fall.
Miß Beverly schien noch nichts von dem Einbruch gehört zu haben. Sie sah den Inspektor verdutzt an.
Mit ein paar Worten klärte Lee sie über das Ereignis der vergangenen Nacht auf.
„Unerhört“, sagte sie, als er fertig war, „Sie wollen meine Wohnung durchsuchen, weil Sie glauben, ich hätte mit dieser Sache etwas zu tun.“
„Was ich glaube, tut hier nichts zur Sache“, brummte der Inspektor, „ich tue nur meine Pflicht.“
„Die besteht wohl darin, im Privatleben einer Dame herumzuschnüffeln“, rief sie mit sicht fast überschlagender Stimme. Sie schimpfte immer noch, als die Beamten sich schon längst an die Durchsuchung des Zimmers gemacht hatten.
Lee nahm sich das Heft mit den Kontoauszügen vor. „Sieh mal einer an“, meinte er, „Sie haben ein Bankkonto von neunhundert Pfund. Es ist doch erstaunlich, wieviel man in Ihrem Beruf verdienen kann.“
„Das Geld habe ich mir in vielen Jahren zusammengespart“, erklärte sie wütend und riß ihm das Heft aus der Hand. „Ich habe nicht so ein Leben geführt wie . . .“
„Wie?“
„Wie manche andere.“
„Wen meinen Sie damit?“
„Das tut wohl nichts zur Sache“, sagte sie böse.
„O doch!“ widersprach Lee, „das interessiert mich ungemein.
„Nun — ich dachte eben an den jungen Sibourg. Das ist ein ganz übler Verschwender. Man hat mir erzählt, daß er in Nachtlokalen des Ostens verkehrt und das Geld haufenweise zum Fenster hinauswirft.“
„Sibourg“, sagte Lee sinnend, „das ist der Volontär, der in Ihrer Firma arbeitet, nicht wahr?“
„Ganz recht.“
„Er soll ziemlich reich sein.“
„Der und reich!“ rief sie, „solange sein Großonkel lebt, wird er nie mehr als sein Taschengeld bekommen. Und auch wenn der Großonkel stirbt . . .“ Sie stutzte plötzlich.
„Was ist dann?“ forschte der Inspektor.
„Man spricht davon, daß er enterbt werden soll“, sagte sie mürrisch, „aber Genaues weiß ich nicht.“
„Warum? Verträgt er sich nicht mit seinem Großonkel?“
„Ueberhaupt nicht. Jean Sibourg ist ein ganz leichtfertiger und gewissenloser Mensch, der keine Achtung vor den Gefühlen anderer Menschen und überhaupt keinen Begriff vom Wert des Geldes hat. Ich kann seinen Großonkel nur zu gut verstehen. Der alte Mann ist erbittert darüber, daß sein Vermögen eines Tages in solche Hände fallen wird.“
„Ist er denn der einzige Erbe?“ wollte Lee wissen.
„Er hat noch eine Kusine. Sie soll in Zürich leben. Sonst lebt niemand mehr von der Familie. Sein Vater starb, als er noch klein war, und das ist wahrscheinlich der Grund dafür, daß er so schlecht erzogen ist.“
„So etwas erlebt man häufig“, nickte Lee, der die ältliche Sekrätrin gern in ihrer mitteilfreudigen Stimmung erhalten wollte. Sie und Jean Sibourg schienen sich ja ganz hübsch verkracht zu haben. Wahrscheinlich hatte Sibourg die alte Jungfer häufig aufgezogen. Immerhin erfuhr er so Dinge, die er sonst erst hätte mühsam erforschen müssen.
„Sehen Sie, Miß Beverly“, sagte er vertraulich, „mein Beruf zwingt mich immer wieder, Dinge zu tun, die ich gar nicht tun möchte. Es macht mir zum Beispiel bestimmt keinen Spaß, daß meine Leute Ihr Zimmer durchsuchen müssen.“
„Sie müssen natürlich Ihre Pflicht tun“, sagte sie.
„Trotzdem — es ist nicht immer schön.“
„Machen Sie sich keinen Kummer meinetwegen.“ Seine freundliche Art hatte Sympathien erweckt und sie fast ihren Groll vergessen lassen.
Geschwätzig beugte er sich zu ihr.
„Ich hatte einmal einen Fall, Miß Beverly, da war ein junger Mann aus guter Familie auf die schiefe Bahn gekommen. Er wurde lebenslänglich ins Zuchthaus eingesperrt.“
„So wird es mit dem jungen Sibourg auch einmal gehen“, nickte sie. Er hatte sie genau da, wo er sie haben wollteu. Was immer sie an Klatsch über Jean Sibourg gehört hatte, erzählte sie ihm jetzt.
„Und gewettet hat er auch?“ fragte er nach einer Weile.
„Jawohl, gewettet!“ versicherte sie nachdrücklich, „er hat mehrmals große Summen beim Pferderennen verloren. Dann war immer hinterher große Aufregung. Die Buchmacher bestürmten ihn, endlich zu bezahlen, und er wiederum lief zu Mr. Punch und bettelte ihn um Geld an.“
„Unglaublich“, sagte Lee im Ton tiefster moralischer Entrüstung, „und hat der ihm das Geld gegeben?“
„Nie“, erklärte sie triumphierend, „da hatte ich auch ein Wörtchen mitzureden. Mr. Punch fragte mich mehrmals, ob er Jean Sibourg etwas leihen sollte, und ich erklärte stets: Mr. Punch, damit helfen Sie ihm nicht. Er wird neue Schulden machen, und das wird ewig so weitergehen, bis er endlich einmal eine empfindliche Lehre erhält. Sie wissen, wie die Buchmacher einen Mann behandeln, der nicht zahlt. Ich habe mir dir schlimmsten Geschichten erzählen lassen.‘“
„Und hat diese Lehre geholfen?“
„Leider nein“, sagte sie traurig, „im kritischen Moment sprang immer sein Großonkel ein. Ich glaube, seine Kusine verwandte sich immer wieder für ihn.“
Nach einer Weile hatten die Beamten die Durchsuchung des Zimmers beendet, ohne etwas Belastendes gefunden zu haben. Lee sah auf seine Armbanduhr.
„Wenn wir uns beeilen, erwischen wir Jean Sibourg gerade noch beim Frühstück“, meinte er.
Er verabschiedete sich von Miß Beverly, und die Männer fuhren in die Wohnung von Jean Sibourg. Als der Inspektor an seiner Tür läutete, war er über die Vergangenheit des jungen Mannes besser unterrichtet, als sich dieser je hätte träumen lassen.
Es zeigte sich, daß Jean Sibourg über die Geschehnisse der vergangenen Nacht bereits informiert war; Punch hatte ihn angerufen und ihm alles erzählt. Deshalb war er nicht überrascht, als die Polizeibeamten bei ihm erschienen.
Jean Sibourg konnte auf den ersten Blick nicht unsympathisch genannt werden. Er hatte eine jungenhafte Offenheit, die ihm gut zu Gesicht stand.
„Ich nehme an, Sie wollen mir ein paar Fragen stellen“, sagte er und lud die Männer mit einer Handbewegung zum Sitzen ein, „hoffentlich stört es Sie nicht, wenn ich inzwischen weiterfrühstücke. Ich muß um neun Uhr im Büro sein.“
„Machen Sie sich deswegen keine Sorgen“, sagte der Inspektor, „wenn Sie zu spät kommen, sind Sie entschuldigt.“ Er legte den Haussuchungsbefehl auf den Tisch.
Jean Sibourg sah ihn verdutzt an.
„Was soll das heißen?“ fragte er, „denken Sie, ich hätte mit dem Einbruch zu tun? Ich war die ganze Nacht zu Hause.“
Schweigend gab Lee den Beamten einen Wink, mit der Durchsuchung des elegant eingerichteten Appartements zu beginnen.
„Man erzählt sich von Geldschwierigkeiten, in denen Sie sich seit einiger Zeit befinden“, sagte er plötzlich unvermittelt.
„Das ist Unsinn“, rief Jean Sibourg lachend aus, „ich habe genügend Geld.“
Lee beugte sich vor.
„Wieviel verdienen Sie bei Punch?“
„Nichts.“
„Und wovon bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt?“
„Mein Großonkel schickt mir Geld aus der Schweiz.“
„Wieviel?“
„Dreißg Pfund monatlich. Außerdem bezahlt er das Zimmer für mich.“
„Können Sie von diesem Geld beim Pferderennen wetten?“
Jean Sibourg begann zu grinsen.
„Das hängt davon ab, ob ich verliere oder gewinne. Neulich habe ich an einem einzigen Tag siebzig Pfund gewonnen.“
„Gewinnen Sie immer?“
„Nein — natürlich nicht.“
„Das hätte mich auch gewundert“, knurrte
Lee, „ich habe noch nie von einem Mann gehört, der beim Wetten reich geworden ist. Wieviel verspielen Sie durchschnittlich im Monat.“
„Das ist ganz unterschiedlich.“ Jean Sibourg zögerte.