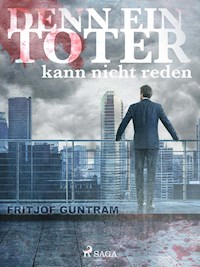Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Spannender Krimi, der den Leser von Beginn an fesselt!Roche sur Ariège ist eine kleine idyllische Stadt im Süden Frankreich. Schwer zu glauben also, dass sie einmal die Hochburg von großen Schmugglerbanden war, die durch Kommissar Mirando in die Flucht geschlagen wurden. Doch als die Leiche von Charles Bonnet gefunden wird, der ein nicht besonders beliebter aber reicher Mann in der Stadt war, wird der Kommissar vor eine neue Aufgabe gestellt. Denn mehr als eine Person hätten ein Motiv für den Mord. Nun ist es also Mirandos Aufgabe die Teile des Puzzles zusammen zu setzen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fritjof Guntram
Der Mann, der stets im Dunkeln blieb – Kriminalroman
Saga
Der Mann, der stets im Dunkeln blieb – Kriminalroman Copyright © 1958, 2019 Fritjof Guntram und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711583111
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Roche sur Ariège — das ist eine kleine Stadt im Süden Frankreichs, unweit des mittelalterlichen Carcassonne und dem Regierungsbezirk von Toulouse zugehörig. Diese Stadt ist so klein, daß sie keine eigene Schule hat. Nur ein paar Häuser scharen sich um die kleine Stadtkirche, und sobald man den Ort verlassen hat, findet man sich in einer weiten Ebene wieder, in der es nur ein paar Weingärten gibt und in der die Vegetation so dürftig ist, daß nur Schäfer mit ihren Herden ihr etwas abgewinnen können. Die Luft ist stets etwas dunstig, aber Tag um Tag scheint die Sonne und verwandelt die baumlose weite Fläche in einen riesigen Backofen. Um die Mittagszeit ist nirgendwo eine Regung menschlichen oder tierischen Lebens zu erkennen.
Und doch war hier einmal ein Zentrum großer Schmuggelbanden. Bis zur spanischen Grenze ist es nur ein Katzensprung; das Meer ist nicht weit, und die vielen verfallenen Dörfer, die in früheren Jahrhunderten von ihren Bewohnern wegen Wassermangels verlassen wurden, boten hervorragende Schlupfwinkel. Polizei gab es zwar schon, aber die Landgendarmen auf ihren Fahrrädern waren den großen, organisierten Banden mit ihrem hervorragenden Nachrichtendienst und ihrem Autopark hoffnungslos unterlegen. Bis vor wenigen Jahren noch schien es so, als gäbe es gegen diese Banden kein Mittel, schien es, als wäre die Polizei machtlos.
Da kam eines Tages Wachtmeister Mirando nach Roche sur Ariège und löste seinen pensionsreifen Vorgänger ab. Damit begann die Zeit des großen Bandensterbens. André Mirando war einer der erfolgreichsten Polizeibeamten des Südens; er räumte in der Gegend von Roche sur Ariège mit den Verbrechern in einem Tempo auf, das ihm Anerkennung sowohl von der Bevölkerung als auch von seinen Vorgesetzten einbrachte. Im Polizeipräsidium von Toulouse war man sich bald über seine Fähigkeiten klargeworden. Mehrmals wurde ihm eine Beförderung nach Toulouse angeboten, aber stets lehnte Mirando ab. Er wollte in Roche sur Ariège bleiben, in der Gegend, die ihm zur zweiten Heimat geworden war.
Mirando liebte seine Arbeit. Nur so ließen sich die erstaunlichen Erfolge erklären, die er hatte. Er erreichte es als erster Polizist Frankreichs, der in einem so kleinen Ort wie Roche sur Ariège tätig war, einen Dienstwagen zu bekommen, einen alten Citroen, mit dem seine Schlagkraft gewaltig gesteigert wurde. Mirando hatte noch einen Gendarmen unter sich, einen Wachtmeister namens Colport.
Ein Stück außerhalb von Roche sur Ariège lag an der Straße nach Carcassonne ein halbverfallenes Anwesen, welches mit einer hohen Bruchsteinmauer vor fremden Blicken geschützt war. Rings um das Haus war ein verwilderter Garten mit meterhohem Unkraut Brennesseln, Schlingpflanzen und Dornenranken. Einzig und allein der Zufahrtsweg vom Tor zum Haus und von dort zu einer eisernen Tür, die den Eingang zu einem Keller in einem dahinterliegenden Hügel verschließt, war von Unkraut frei gehalten. Der Eingang in diesen Keller liegt ein gutes Stück hinter dem Haus. Reifenspuren auf dem Boden lassen darauf schließen, daß dort öfters Waren bewegt werden. Das Ganze war das Anwesen des Weinhänhdlers Charles Bonnet.
Charles Bonnet, ein großer, wuchtiger Mann mit weißen, flatternden Haaren, die seinem. Kopf etwas Löwenähnliches gaben, stand an diesem Herbstmorgen in der Tür des Wohnhauses und schrie mit heiserer Stimme: „Igette!“
Eine Weile lauschte er mit vorgestrecktem Kopf, dann humpelte er zum Tor und spähte angestrengt in die Runde. Beim Gehen sah man, daß er das linke Bein nachzog.
Noch einmal schrie er: „Igette!“ Nichts rührte sich. Mit einem Fluch drehte er sich um und bewegte sich zum Haus zurück. Obwohl es hoch früh am Morgen war, brannte die Sonne stechend heiß vom wolkenlosen Himmel herunter.
Charles Bonnet zog die Haustür hinter sich zu und empfand angenehm die Kühle des Flurs. Dann sah er seinen einzigen Angestellten, den Marokkaner, vor sich stehen,
„Was willst du hier, verdammt noch mal?“ fragte er wütend. „Du solltest doch die Liefen scheine für Marseille ausschreiben.“
„Sie haben mir die Listen noch nicht gegeben, Monsieur Bonnet“, erwiderte der Mann. Er war klein und von dunkler Hautfarbe. Beim Sprechen bewegte er den Mund kaum. Seine großen, immer irgendwie neugierig wirkenden Augen waren unablässig auf den Weinhändler gerichtet. Er hieß Cyr.
„Geh rüber ins Büro“, befahl ihm Bonnet. „Die Listen liegen im Schrank.“
Er sah dem. Marokkaner nach, wie er aus dem Flur verschwand. Sein Blick war haßerfüllt. Er zerdrückte einen Fluch und ging zum Telefon. „Geben Sie mir die Gendarmerie“, befahl er. Seine Finger trommelten auf die dunkle Holzplatte des Tisches, Sein Blick wanderte zum Fenster hinaus über die weite, baumlose Ebene.
Was Charles Bonnet in diesem Augenblick nicht sehen konnte, war die kleine Kapelle, die am Rande der Straße etwa einen Kilometer nach dem Haus stand.
Hierher kamen die unglücklichen Liebespaare aus der ganzen Gegend, um ihren Segen zu erbitten.
Igette, die Tochter des Weinhändlers, lehnte mit dem Rücken gegen die weißgekalkte Wand der Kapelle. Sie war klein, hatte dichtes, schwarzes Haar, das in natürlichen Wellen geformt war, große, braune Augen und volle, in diesem Augenblick trotzig aufgeworfene Lippen.
Vor ihr stand ihr heimlicher Verlobter, Jean Laslet, ein junger Mann, der in einer Autowerkstatt in Toulouse arbeitete. Er war Mitte der Zwanziger, sah gut aus und hatte, vor allem den festen Willen, sich hochzuarbeiten. Vor einem halben Jahr hatte er bei Charles Bonnet um die Hand von Igette angehalten. Der alte Weinhändler hatte einen Wutanfall bekommen und ihn mit der Hetzpeitsche aus dem Haus gejagt. Dann war er auf Igette losgegangen, aber das Dazwischentreten des Marokkaners verhinderte seine Absicht. Anschließend hatte er einen Schlaganfall erlitten, als dessen Nachwirkung sein linkes Bein gelähmt blieb. Trotzdem blieb Igette bei ihrer Absicht, Jean zu heiraten; aber die Affäre hatte beiden gezeigt, daß man mit dem Alten nicht reden konnte. Seitdem trafen sie sich heimlich in der Kapelle.
„Du wirst deinen Vater einfach verlassen“, sagte Jean gerade bittend.
„Dann hetzt er mir die Polizei auf den Hals.“
„Er wird uns nie finden“ rief Jean
„Er wird nicht ruhen, bis er uns findet“, sagte sie. „Wir müssen warten, bis ich volljährig bin.“
„Ich kann nicht noch drei Jahre warten“, sagte er leidenschaftlich. „Ich kann das nicht. Das mußt du verstehen.“
„Ich kann es auch nicht.“ Ihre Stimme klang erregt. Sie legte ihre Arme um seinen Hals. „Jean, was werden wir tun?“
„Ich weiß es nicht.“ Er küßte sie leidenschaftlich. „Wir müssen zusammenbleiben, Igette. Das kann dein Vater nicht verhindern,und wenn erstatt einer Million hundert Millionen hätte.“
„Es ist furchtbar, daß mein Vater so reich ist“, sagte sie traurig. „Wenn er arm wäre, hätten wir schon längst heiraten können.“
„Er geht über Leichen“, erklärte Jean grimmig. „Er ist ein kalter Geschäftsmann. Er kennt kein Gefühl, keine menschlichen Regungen. Für ihn existieren Menschen nur als Nummern, und sein Lebensinhalt ist das Geld, bis er einmal darin erstickt. Ich wünsche es ihm, wahrhaftig.“
Sie schwieg, und er wandte sich verdrossen ab. Plötzlich fuhr er herum. „Denk an deine Mutter, Igette. Er hat sie kaputt gemacht.“
„Du sollst nicht so reden, Jean“, rief sie mit aufflammender Heftigkeit.
„Igette“, begann er, unterbrach sich aber sofort. „Still, was war das?“
In der Ferne war Motorengeräusch aufgeklungen, Auf der Straße stand weit weg eine kleine Staubwolke, die langsam größer wurde und näher kam.
„Rasch in die Kapelle“, befahl er. Sie schob ihr Fahrrad, mit welchem sie gekommen war, in den Vorraum, während er sein Motorrad hinter der Kapelle versteckte. Dann verschwanden sie in dem Gebäude.
„Wer mag das sein?“ meinte er nervös und spähte durch die kleinen, mit Blei eingefaßten Scheiben des Fensters.
Die Staubwolke kam immer näher, und endlich konnte man erkennen, daß sie von einem alten, klapprigen Citroen stammte, der auf der Landstraße in Richtung auf den Ort fuhr. Als er vorüber war, lachte Igette befreit auf. „Das war unser Gendarmeriewachtmeister“, sagte sie. „Der fährt wahrscheinlich zu meinem Vater.“
„Warum?“ fragte er mißtrauisch.
„Es ist wegen Cyr, dem Marokkaner. Mein Vater glaubt, er bestiehlt ihn und wird deshalb den Wachtmeister geholt haben.“
„Er sollte lieber deinen Vater einsperren“, murmelte Jean. „Igette, laß uns fliehen.“
„Jean“, flüsterte sie und schmiegte sich an ihn. „Oh, Jean.“
Igette hatte recht gehabt. Der Citroen bog tatsächlich in den Weg zu dem Anwesen von Charles Bonnet ein und hielt mit quietschender Bremse vor dem Wohnhaus. Charles ließ es sich nicht nehmen, hinauszuhumpeln und den Wachtmeister persönlich hereinzuführen.
„Es ist gut, daß Sie da sind, Monsieur Mirando“, begrüßte er den Wachtmeister. „Ich hätte Sie nicht belästigt, wenn die Angelegenheit nicht wirklich ernst wäre. Kommen Sie bitte herein.“
Er ging vor und führte den Wachtmeister in sein Empfangszimmer. Polizeiwachtmeister André Mirando war ein kleiner, drahtiger Mann mit intelligentem Gesicht, spärlichem Haarwuchs und flinken Augen, die alles zu durchschauen schienen. Mirando war wohl einer der erfolgreichsten Polizisten des Südens. Neben den Schmugglern, mit denen er aufgeräumt hatte, hatte es auch zahlreiche andere Elemente gegeben, die nach dem Kriege versuchten, hier unterzutauchen -
Er ließ sich jetzt in einem Sessel nieder und sah den Weinhändler fragend an.
„Ich habe Sie hierher gebeten, weil man mich bestohlen hat“, begann der Weinhändler, „und es liegt mir einiges an der Aufklärung der Angelegenheit.“
Mirando zog die Augenbrauen hoch.
„Bestohlen, Monsieur? Wer, Monsieur?“ fragte er mit seiner liebenswürdigen Stimme, aber in ungläubigem Tonfall.
„Es ist der Marokkaner“, sagte Charles grob, „er hat mir aus einem Versteck eine Menge Geld gestohlen.“
„Aber, Monsieur, sind Sie ganz sicher?“ fragte der Wachtmeister.
„Ganz sicher“, erklärte Charles. „Ich habe unten im Weinkeller einen geheimen Tresor und bewahre dort immer mein Geld auf. Wie ich neulich hinkomme, ist ein Teil des Geldes, weg.“
„Nun“, meinte Mirando zweifelnd, „Sie selbst könnten doch das Geld herausgenommen haben.“
„Ich war es nicht“, beharrte Charles eigensinnig darauf. „Es muß der Marokkaner sein. Sie müssen seine Sachen durchsuchen.“
„Dazu“, sagte Mirando kühl, „habe ich kein. Recht, Monsieur.“
„Ach was“, meinte Charles mit einer wegwerfenden Handbewegung, „das tun Sie. Der Kerl kennt sich doch nicht aus mit unseren Gesetzen.“
Mirando erhob sich.
„Wenn es das ist, was Sie von mir wollen dann bedaure ich, Monsieur.“ Er machte Anstalten, zu gehen, wurde jedoch von Charles Bonnet sofort zurückgehalten.
„Bleiben Sie, Wachtmeister. Sagen Sie mir doch, was ich tun kann. Wie soll ich die Beweise erbringen?“
Mirando setzte sich wieder und dachte einen Augenblick nach. Dann fragte er: „Wieviel Schlüssel existieren zu Ihrem Tresor?“
„Gar keiner. Mein Tresor hat ein Zahlenschloß.“
„Dürfte ich ihn einmal sehen?“ fragte Wachtmeister Mirando.
„Natürlich, kommen Sie.“
Charles Bonnet erhob sich und führte seinen Gast aus dem Haus. Er ging mühsam. Man sah ihm an, daß es ihn Ueberwindung kostete, zu laufen. Neben ihm wirkte der auch gewiß nicht mehr in jugendlichem Alter stehende Wachtmeister ausgesprochen leichtfüßig.
Mirando wußte, daß der Keller gut fünfzig Meter in den Berg hineinragte. Ursprünglich war dort ein Bergwerksstollen gewesen, in dem man Eisen gefördert hatte. Als der Abbau nicht mehr rentabel war, lag der Stollen lange Zeit leer, weil sich niemand die Mühe machte, ihn zuzuschütten. Im Kriege dann wurde er als Luftschutzkeller ausgebaut und mit elektrischem Licht versehen, aber nie benutzt, denn Roche sur Ariège erlebte keinen einzigen Bombenangriff. Nach dem Krieg kaufte ihn Charles Bonnet, der eben aus dem Norden zugereist war, vom Staat und richtete dort seinen Weinkeller ein.
Der Weinhändler tastete an die Wand, bis er den Lichtschalter fand. Dann hellten ein paar Lampen den dunklen Raum etwas auf. Vor ihnen lag ein langer Mittelgang, an dessen Seiten große Fässer auf hölzernen Gestellen ruhten. Manche waren fast doppelt so hoch wie Mirando. Im Hintergrund standen ein paar Korbflaschen sowie Ballonflaschen und andere Geräte. Die Wände glitzerten feucht, und die Luft war kühl und schwer. Der Händler hatte, als er den Keller kaufte, den Zementboden herausreißen lassen; jetzt war dort festgestampfter Lehm. „Kommen Sie hier entlang, Wachtmeister“, krächzte Bonnet und hustete. „Schlechte Luft hier, schlechte Luft.“ Er führte Mirando in einen kleinen Seitenstollen und blieb an der Ecke zwischen Seitenstollen und Hauptkeller stehen.
„Hier ist mein Tresor“, sagte er und deutete auf die Wand.
Mirando sah hin, konnte aber nichts entdecken.
„Hier war früher der Kasten mit den ganzen Sicherungen drinnen“, erklärte er. „Ich hab’ ihn herausnehmen lassen und meinen alten Tresor, den ich mitgebracht habe, hineingebaut Hier sehen Sie das Schloß, Wachtmeister.“
Mirando trat näher und sah hinein. Auf der Stahltür war ein rundes Rad, mit acht verstellbaren Ringen angebracht. Jeder dieser. Ringe trug die Zahlen eins bis neun. Es war ganz offensichtlich nicht möglich, die Tür ohne Kenntnis der richtigen Zahl zu öffnen.
„Ich sehe ein, Monsieur, daß ein Nichteingeweihter dieses Schloß nicht öffnen, kann“, sagte Mirando, nun wieder zu Charles gewandt. „Es bestellt also die Möglichkeit, daß Ihr Angestellter die Nummer kennt oder aber, daß Sie sich geirrt haben.“
„Ich habe mich nicht geirrt“, erklärte Charles bestimmt.
„Dann werden wir also ein Protokoll aufnehmen müssen“, seufzte Mirando. „Würden Sie bitte die Liebenswürdigkeit haben, morgen nachmittag in mein Büro zu kommen und dort eine Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten.“
„Hören Sie“, brauste Charles auf, „ich kann doch nicht wegen einer solchen Kleinigkeit extra zu Ihnen kommen.“
„Wieso nicht“, verwunderte sich Mirando, „ich bin ja auch zu Ihnen gekommen.“
„Verdammt, das stimmt“, sagte Bonnet wütend. Er besann sich kurz. „Also gut, ich werde morgen zu Ihnen fahren. Aber ich verspreche Ihnen, auch wenn Sie nichts herausfinden, dann weiß ich, was ich zu tun habe.“
„Sie werden vermutlich dem Marokkaner kündigen“, sagte Mirando freundlich, „und das ist Ihr gutes Recht.“ Er ging zur Tür, gefolgt von Bonnet.
„Sie müssen ihn festnehmen, bevor er die Gegend verläßt“, erklärte der Weinhändler. „Ich habe ihn nur deshalb noch nicht herausgeworfen, damit er sich nicht aus dem Staube macht.“
„Aber, Monsieur“, sagte Wachtmeister Mirando. „Was sollte ich mit ihm. Dann ist ja meine Arrestzelle besetzt. Nein, erst werden wir den Fall untersuchen. Ich sehe Sie morgen, auf Wiedersehen, Monsieur.“ Er stieg in seinen Wagen und fuhr davon. Der Weinhändler sah ihm ärgerlich nach. Dannn humpelte er mühsam ins Haus.
Nachmittags, kam Igette zurück.
„Wo, zum Teufel, hast du gesteckt?“ begrüßte sie ihr Vater.
„Ich war in der Stadt.“ Sie versuchte, an ihm vorbeizukommen, aber er versperrte ihr den Weg und stellte sich vor die Tür.
„Hast du ihn getroffen?“
„Wen?“ fragte sie, obwohl sie genau wußte, wen ihr Vater meinte. Seit dem Tag, an dem er Jean Laslet hinausgeworfen hatte, ließ er ihr keine Ruhe mehr.
„Deinen Jean“, sagte er mit drohender Stimme.
„Ich weiß nicht“, erklärte sie mit gespielter Ruhe, „wieso du immer wieder auf ihn kommst.“
„Weil ich den Kerl kenne“, brüllte er los. „Diese verdammten Gauner machen sich immer wieder an ein Mädchen heran, wenn sie wissen, daß der Vater zufällig Geld hat. Aber das sage ich dir gleich: dieser Jean kommt mir nie ins Haus. Wenn er sich noch einmal hierher wagt, nebme ich die Flinte und bringe ihn um.“
„Hör doch endlich auf“, sagte sie gereizt. ,,Er wird schon nicht kommen.“
Sein Gesicht nahm einen verschlagenen Ausdruck an.
„Du hast ihn also doch getroffen?“ sagte er.
„Nein, um Gottes willen, nein. Warum sollte ich denn.“
Er ging nicht auf ihren Einwand ein.
„Du“, sagte er langsam, „ich warne dich. Sollte ich dahinterkommen, daß ihr euch irgendwann einmal getroffen habt — und ich verspreche dir, ich komme dahinter — dann schlage ich zu. Dann enterbe ich dich. Es gibt noch andere Bonnets, die auf mein Geld scharf sind.“
„Jawohl, dein Geld“, höhnte sie, „was wärst du ohne dein Geld? Ich jedenfalls verzichte herzlich gerne darauf. Ich glaube sowieso nicht, daß es ehrlich verdient ist.“
„Igette!“ schrie er heftig.
„Ergaunert ist es“, rief sie. „Ich pfeife darauf.“
„Igette!“ Er bewegte die Lippen, brachte aber keinen Ton heraus. Er zitterte am ganzen Körper. Es schien, als sei er einem neuen Anfall nahe. Nach einer Weile würgte er heraus: „Meine Tabletten.“
Sie lief und besorgte ihm das Gewünschte. Dann verließ sie das Zimmer.
Im Gang traf sie auf Cyr, den Marokkaner.
„Mademoiselle?“
„Was gibt's, Cyr?“
„Ich kündige. Ich werde gleich zu Ihrem Vater hineingehen und es ihm sagen. Vorher wollte ich mich von Ihnen verabschieden.“
„Um Gottes willen“, sagte sie. „Wieso das? Haben Sie Streit gehabt?“
Sein Gesicht nahm einen haßerfüllten Zug an.
„Ihr Vater hat mich heute bei der Polizei angezeigt. Er behauptet, ich hätte ihm Geld gestohlen.“
Igette sah ihn erschrocken und mit einem ängstlichen Ausdruck in ihren großen braunen Augen an.
„Das ist doch nicht wahr.“
„Natürlich nicht. Ich habe es nicht nötig zu stehlen. Aber wenn ich einmal angezeigt bin, dann werde ich auch verhaftet und verurteilt. Ich gelte hier als Ausländer. Wir Afrikaner sind nicht angesehen.“ Er sagte es nicht ohne Bitterkeit,
„Aber Sie können doch jetzt nicht hineingehen zu ihm. Er hat einen Anfall“, erklärte sie ängstlich.
„Das ist mir gleich. Er nimmt ja auch nicht die allergeringste Rücksicht auf mich oder überhaupt auf irgendeinen Menschen.“
Er ging zur Tür und wandte sich noch einmal um, den Türgriff schon in der Hand.
„Ich wollte aber nicht versäumen, Ihnen, Mademoiselle, zu sagen, daß meine Auseinandersetzung mit Ihrem Vater nichts mit Ihnen zu tun hat.“ Ein Lächeln huschte kurz über sein Gesicht. „Das wäre alles. Leben Sie wohl.“ Er gab ihr die Hand und verschwand im Zimmer.
Mit einer seltsamen Mischung der Gefühle sah ihm Igette nach. Der Marokkaner war nunmehr seit drei Jahren im Haus. Er hatte sich damals mit einem Empfehlungsschreiben von einem Geschäftsfreund Bonnets bei diesem gemeldet und war eingestellt worden, weil Bonnet fand, er könnte eine Hilfe gebrauchen.
Die erste Zeit waren sie gut miteinander ausgekommen. Aber seit dem Tod von Igettes Mutter, an dem der allgemeinen Meinung nach Charles einen beträchtlichen Anteil der Schuld hatte, wurde ihr Verhältnis immer schlechter. Der Marokkaner tat schweigend seine Arbeit, und Charles wurde immer gröber. Er behandelte auch Igette nicht gut, und sie fühlte im Laufe der Zeit Haßgefühle gegen ihren Vater in sich hochsteigen. Sie hätte vorher nie geglaubt, daß ihr so etwas geschehen könnte. Nun, da Cyr gehen wollte, schien es ihr, als gehe der letzte Abschnitt zu Ende, in dem sie sich noch einigermaßen glücklich gefühlt hatte. In ihr war das gleiche Gefühl, das ein Mann hat, der zur Armee eingezogen wird, nachdem er vorher seine Jugend sorglos verbummelt hat.
Sie ging auf ihr Zimmer und lauschte nach unten, ob sie einen Wortwechsel oder einen Streit hören würde. Aber alles blieb ruhig. Sie wartete über eine Stunde am Fenster, ob sie Cyr fortgehen sah, aber er kam nicht.
Gegen elf Uhr hörte sie in der Ferne Motorengeräusch, das bald erstarb. Es schien von der Straße zu kommen, aber es mußte weiter weg sein, denn es war nicht sehr stark gewesen. Wiederum eine halbe Stunde später hörte sie ein Geräusch im Garten, das aus einem Busch nahe der Mauer kam.
Die schmale Mondsichel war durch eine Wolke verdeckt, und sie wartete, bis der Mond wieder hervorkam. Als es endlich etwas heller wurde, glaubte sie, eine Gestalt zu erkennen, die abwartend neben einem niedrigen Busch zu stehen schien.
Igette zog sich geräuschlos vom Fenster zurück und huschte barfuß in den Flur. In der Eingangshalle stand der Gewehrschrank ihres Vaters. Sie glitt dorthin und nahm die Schrotflinte heraus, die, wie sie wußte, geladen war. Beim Vorbeigehen warf sie einen scheuen Blick auf die Tür, hinter der ihr Vater sein mußte.
Als sie wieder ans Fenster zurückkam, schien der Mond zwischen zwei Wolkenbänken hindurch und beleuchtete den Garten. Die Gestalt war verschwunden.
Igette entsicherte das Gewehr und wartete. Sie war früher oft auf der Jagd gewesen und konnte mit der Flinte umgehen. Jetzt kam wieder eine Wolkenbank heran und verdunkelte den Mond. Angestrengt lauschte sie hinaus. Die Nacht war warm und windstill. Der Lauf der Flinte fühlte sich kühl und glatt an.
Plötzlich wurde die Wolke wie von einer unsichtbaren Geisterhand zur Seite geschoben, und auf dem hellen Kiesweg stand in Licht gebadet die Gestalt eines Mannes.
Sie nahm das Gewehr hoch, ließ es aber gleich wieder überrascht sinken. Ein halblauter Ausruf entrang sich ihrem Munde.
„Jean!“
„Igette.“ Er kam mit ein paar Sprüngen ans Fenster. „Igette, komm, wir müssen sofort fort von hier.“
„Nicht so laut“, flüsterte sie ängstlich, „Jean, wie kommst du hierher? Wenn dich mein Vater sieht ...“
„Er wird mich nicht sehen.“ Seine Augen glühten. Er schwang sich geschickt hoch, kletterte durch das Fenster und umarmte sie. „Komm, Igette, laß uns fliehen.“
„Warum jetzt, so plötzlich?“
Er sah sie ungeduldig an und hob seine Hände.
“Igette, seit einer Ewigkeit bin ich hier in der Gegend und versuche, über die Mauer zu kommen. Dann gelingt es mir endlich, und ich riskiere, daß mir dein Vater eine Kugel durch den Kopf schießt. Aber jetzt ist dein Vater ungefährlich. Laß uns hier fortgehen, und zwar sofort. Alles Weitere erzähle ich dir unterwegs.
„Jean“, fragte sie erschrocken, „wie meintest du das, daß mein Vater jetzt ungefährlich sei?“
„Das erkläre ich dir später“, sagte er hastig. „Auf jeden Fall müssen wir hier weg. Los, beeile dich doch.“
Sie begann hin- und herzulaufen und ein paar Sachen zusammenzupacken. Währenddessen bestürmte sie ihn mit Fragen, aber er drängte sie nur zur Eile. Mehrmals sah er nervös zum Fenster hinaus.
Schließlich war sie fertig. Er kletterte als erster zum Fenster hinaus und half ihr dann. Geduckt schlichen sie durch den Garten bis zu einer Stelle, an der die Mauer halb zerfallen war und sie leicht hinübersteigen konnten Ein. Stück weiter weg hatte er das Motorrad stehen. Nach wenigen Minuten fuhren sie ohne Sdieinwerferlicht über das weglose Gelände, auf dem kürzesten Wege zum Canal du Midi.
Monsieur Jean Pierre Salamanca besaß in Roche sur Ariège ein Transportunternehmen mit fünf schweren Lastzügen und mehreren Kleinlieferwagen. Er stand in einem festen vertragsVerhältnis mit Charles Bonnet. Einmal in der Woche holte er bei ihm einen Wagen mit Wein ab, den dieser wiederum von verschiedenen Gütern aus dem Süden bezog. Charles Bonnet begnügte sich damit, Zwischenhändler zu sein, und er war in der Gegend fast ohne Konkurrenz.
Am Tage nach Igettes Flucht fuhr Monsieur Salamanca zusammen mit dem Fahrer hinaus zu Charles, weil er mit ihm die Abrechnung für das letzte Vierteljahr machen wollte. Als sie ankamen, stand das große Tor weit offen. Nirgendwo war ein menschliches Wesen zu erblicken.
Monsieur Salamanca ließ den Fahrer in den Hof hineinfahren und dort den Motor abstellen. Er selbst stieg aus und ging zum Haus. Die Haustür war nur angelehnt.
„Hallo!“ rief er. „Ist da jemand?“
Niemand antwortete.
„Hallo!“ Monsieur Salamanca rief noch mehrmals, dann stieß er die Haustür auf und ging hinein.
„Monsieur Bonnet!“ Er lauschte, aber Totenstille umgab ihn. Vorsichtig drückte er die Klinke zum Arbeitszimmer herunter. Das Zimmer war leer.
„Chef“, rief der Fahrer von draußen, „die Tür zum Weinkeller steht offen. Er wird dort sein.“
„Ach ja“, sagte Monsieur Salamanca, „daß ich daran nicht dachte.“ Er lief rasch aus dem Haus heraus, weil er nicht wollte, daß Bonnet sah, daß er ins Haus eingedrungen war. Dann ging er den Gang hinunter zum Weinkeller, während der Fahrer sich eine Zigarette drehte und ihm gelangweilt nachsah.
Salamanca verschwand im Keller und blieb eine Weile drinnen. Dann erschien er wieder mit allen Anzeichen einer fürchterlichen Erregung.
„Georges!“ schrie er mit hoher, brüchiger Stimme, „Georges, kommen Sie schnell.“ Verstört fuhr er mit den Armen in der Luft herum, auf seiner Stirn standen Schweißperlen.
„Georges!“ Der Fahrer kam herangelaufen. „Kommen Sie, aber nehmen Sie sich zusammen. Sie werden etwas Furchtbares sehen.“
Er fuhr sich mit der Hand über die Stirn. „Da drinnen.“ Mit dem Kopf zeigte er auf den Eingang. Vorsichtig schritt Georges hinein.
Im Keller brannte das Licht. Niemand war zu sehen. Georges machte ein paar Schritte und sah sich um. Mit einem Male erstarrte er, stieß einen kleinen Schrei aus und bekreuzigte sich. An der Stirnseite eines großen Weinfasses baumelte mit schlaffen Gliedern Charles Bonnet. Sein Kopf hing schief, und seine blutunterlaufenen roten Augen starrten seltsam höhnisch ins Leere. Unterhalb des Gesichtes aber war ihmein langer Nagel durch den Hals getrieben, der ihn an dem Faß festhielt.
„Heilige Mutter Gottes“, stöhnte Georges verstört, „das kann nicht wahr sein.“
Er bewegte sich langsam rückwärts. Es schien, als verfolge die leblose Gestalt ihn mit ihrem Blick. Plötzlich drehte Georges sich um und rannte hinaus.
Draußen stieß er auf Monsieur Salamanca, der immer noch mit aufgerissenem Mund dastand.
„Haben Sie ihn gesehen?“ schnaufte er. Georges nickte. „Also war es kein Geist. Gerechter Himmel, was für ein Unglück!“ Er wurde wieder aktiv. „Georges, wir müssen sofort die Polizei anrufen. Im Haus ist ein Telefon.“
Eilig liefen sie zurück zum Wohnhaus, das friedlich in der Sonne lag. Georges nahm den Hörer hoch und verlangte die Gendarmerie. Salamanca riß ihm den Hörer aus den Fingern.
„Hallo, Wachtmeister Mirando dort?“
Eine langsame Stimme antwortete: „Nein, der Chef ist im Moment beim Angeln. Hier ist Wachtmeister Colport.“
In fliegender Hast berichtete ihm Monsieur Salamanca, was geschehen war, und fragte, was er tun solle. Colport gab ihm Anweisung, draußen zu bleiben und aufzupassen, aber nichts zu verändern. Im übrigen aber solle er das Eintreffen des Streifenwagens abwarten. Er, Colport, würde sofort veranlassen, daß Mirando vom Fluß geholt würde, und er selbst würde sofort mit dem Motorrad herausfahren. Monsieur Salamanca bat ihn, sich zu beeilen, und hängte ein. Dann sah er sich nervös um. Er hatte seit dem Anruf Angst, der Täter könnte noch in der Nähe sein, und er war deshalb sehr beruhigt als er den offenstehenden Gewehrschrank sah. Er nahm sich sofort eine schwere Kugelbüchse heraus und fuchtelte damit wild in der Gegend herum, während sein Fahrer Georges ihm verstört zusah. In die Nähe des Weinkellers wageten sie sich nicht mehr.
Zwanzig Minuten später kam das Motorrad mit Wachtmeister Colport. Auf dem Rücksitz saß noch ein anderer Gendarm. Beide machten sich sofort an die Untersuchung des Tatortes. Monsieur Salamanca erzählte ihnen anschließend lebhaft, wie er den Toten gefunden hatte. Sie hörten ihm zu, machten sich Notizen und warteten das Erscheinen ihres Chefs ab.
Es dauerte noch fast eine Stunde, bis der Citroen erschien. Wachtmeister Mirando war mit dem Paddelboot unterwegs gewesen, und man hatte den Fluß auf einer Länge von zwanzig Kilometern absuchen müssen, bis man ihn fand. Er wirkte jetzt müde und war gereizt.
Colport führte ihn in den Keller, und er prallte zurück beim Anblick des toten Weinhändlers. Dann ging er näher hin. Ihm fiel etwas auf, was sowohl Monsieur Salamanca als auch Colport entgangen war. Auf das Holz des Fasses war mit roter Kreide ein Halbmond gemalt.
Mirando ging einmal um das Faß herum, dann fragte er: „Wo ist der Marokkaner?“
„Fort“, sagte Colport. „Auch das Mädchen ist verschwunden. Im Haus ist keine Seele.“
Mirando nagte an der Oberlippe.
„Der Täter ist natürlich schon längst über alle Berge. Fatale Geschichte. Ich muß sofort in Toulouse anrufen. Colport, Sie bereiten alles für ein Protokoll vor. Wir nehmen die ganze Angelegenheit auf. Monsieur Salamanca, Sie sind so liebenswürdig und wiederholen Ihre Aussagen.“
Er ging in das Haus zum Telefon.
„Hallo, Amt? Geben Sie mir Toulouse, Polizeipräsidium, Blitzgespräch.“ Ungeduldig wartete er. Dann ließ er sich mit der Mordkommission verbinden.
Rasch, mit präzisen Worten berichtete er, was geschehen war. Er schloß mit den Worten: „Es wird am besten sein, sofort eine Großfahndung im ganzen Distrikt nach dem flüchtigen Marokkaner Mohammed Cyr einzuleiten. Beschreibung: klein, dunkelhäutig, trägt immer helle Anzüge, aufgeworfene Lippen, schwarzes Kräuselhaar, spricht akzentfreies Französisch. Außerdem sollte man die Fahndung aufnehmen nach der ebenfalls verschwundenen Tochter, Igette Bonnet, achtzehn Jahre alt, mittelgroß, dunkelbraunes, gewelltes Haar, große, braune Augen. Ich hoffe, sie lebt noch. Wann werden Sie hier eintreffen?“ fragte er zum Schluß.
„In einer reichlichen Stunde“, kam die Antwort. Mirando legte auf und ging wieder in den Flur zurück.
„Ah, Colport“, sagte er und fuhr sich über das Kinn. „Ich sehe, Sie haben schon angefangen. Monsieur Salamanca, ich hätte noch ein paar Fragen an Sie.“ Und während seine Leute das Haus durchsuchten, fertigte er das Protokoll an.
Auf der Straße von Toulouse nach Roche sur Ariège bewegte sich kurz nach dem Blitzgespräch eine Fahrzeugkolonne, die aus dem großen Aufnahmewagen mit all seinen technischen Geräten und den dazugehörigen Spezialisten sowie dem Dienstwagen des zuständigen Polizeikommissars bestand. Die Fahrzeuge rollten mit hoher Geschwindigkeit in südlicher Richtung dahin.
Am Steuer des Personenwagens saß ein Assistent des Kommissars namens Paul. Er war ein Mann von etwa dreißig Jahren mit einem gutmütigen, offenen Gesicht. Mit seinen weißblonden Haaren glich sein Kopf ein wenig einem Seehund. Er trug ungeachtet der Hitze einen schwarzgrauen Anzug aus warmem Flanell; nur den Kragen seines weißen Hemdes hatteer gelockert.
Im Fond des Wagens saß der Kommissär. Er hieß Martin und war stellvertretender Leiter der Mordkommission. Martin hatte sich einen Namen gemacht, als er an der Aufklärung der Liebespaarmorde im Gebiet von Clermont Ferrand entscheidend mitwirkte, die vor fünf Jahren die Bevölkerung beunruhigt hatten. Er war ein noch junger Mann, knapp vierzig Jahre alt, mit schwarzen Haaren und einem flachen Gesicht mit großen weißen Zähnen. Martin machte stets einen etwas geistesabwesenden Eindruck.
Außerdem saß noch der Doktor im Wagen, ein verdrossener, kleiner Mann mit raschen, unruhigen Bewegungen. Er schimpfte heftig über den Mord.
„Mit einem Nagel durch den Hals, Kommissar, das ist einfach unerhört. Das ist mir, wenn Sie erlauben, noch nie passiert. Das ist, sozusagen, völlig neu. Da muß ich mir direkt eine Frage erlauben, Kommissar.“
„Fragen Sie“, ermunterte ihn Martin.
„Gibt es überhaupt so lange Nägel?“
Der Kommissar überlegte kurz, dann meinte er:
„Es ist anzunehmen.“
„Enorm, wenn Sie erlauben. Das ist, wenn man so sagen will, kaum glaublich. Und ich bin, wie Sie wissen, ein erfahrener Mediziner.“
Paul, der am Steuer saß, mischte sich ein:
„In Roche sur Ariège ist doch Mirando Polizeichef, nicht wahr?“
Martin nickte und sagte:
„Der Mann hat seine Eigenarten, aber er ist ein erstklassiger Polizist. Ich habe ihn während des Krieges einmal kurz im Maquis kennengelernt. Er ist sehr energisch. Ich würde mich nicht wundern, wenn er uns bei unserer Ankunft den Täter schon vorführen würde.“
„Das wäre mal ein Erlebnis“, nickte Paul. „War er es nicht, der so großartig mit dem Bandenunwesen nach dem Kriege aufräumte?“
„Das ist richtig. Dabei ist er seltsam sentimental. Vor einem Monat wurde ihm eine Beförderung ins Hauptquartier nach Toulouse angeboten, aber er lehnte ab. Er sagte, er fühlte sich auf seinem jetzigen Posten am wohlsten. Freilich, er hat es auch als erster geschafft, in seinem Dorf eine vollmotorisierte Polizeitruppe aufzubauen.“ Er fügte nachdenklich hinzu: „Seine Gendarmen waren alle im Maquis. Erstklassige Leute.“