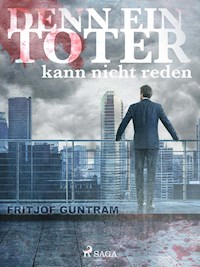Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
"Ich verstehe nicht ganz", sagte Peter Dixon zurückhaltend, "von welchem günstigen Geschick sprechen Sie?" – "Vom Tode meines Onkels", erwiderte John Shrewsburn freundlich, "Onkel Robert ist alt und reich. Auf die eine oder andere Art muss er sterben ..." – Vierundzwanzig Stunden später ist Shrewsburn tot. Und unversehens sieht sich Peter Dixon einem Fall gegenüber, der ihn für einige Zeit in Atem halten wird. Ist Merton, der Bankdirektor, wirklich ein Verbrecher, der mit unheimlicher Konsequenz sein Opfer sucht und findet? Und welche Rolle spielt Harald White, der um so manche Familienstreitigkeit weiß, in diesem Spiel? Noch ein anderer verfolgt diesen Fall mit größter Aufmerksamkeit – Kommissar Grant von Scotland Yard. Aber als er zuschlagen will, macht Peter ihm einen Strich durch die Rechnung.Guntram steigert die Technik der plötzlichen Wendungen, kühnen Schlüsse, der Verwicklungen und überraschenden Lösungen, die einen perfekten Kriminalroman ausmachen!-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fritjof Guntram
Die gefährliche Erbschaft
Saga
Die gefährliche ErbschaftCopyright © 1959, 2019 Fritjof Guntram und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711583081
1. Ebook-Auflage, 2019 Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Es mag sein, daß die Affäre Shrewsburn, in die alle Mitglieder der gesellschaftlich außerordentlich hochstehenden Familie Shrewsburn hineingezogen wurden, nie aufgeklärt worden wäre, hätte nicht Peter Dixon plötzlich Interesse für den Fall gezeigt. Dieses Interesse kam daher, daß ein Neffe des alten Sir Robert Shrewsburn Mitglied desselben Klubs war, dem auch Peter angehörte — und ausgelöst wurde die ganze Sache durch ein Gespräch.
An einem regnerischen Dienstagabend hatte Peter gerade eine Partie Schach im Spielzimmer des Hunter’s Club beendet, der im vornehmen Richmond lag, als John Shrewsburn an ihn herantrat. Peter kannte ihn flüchtig. John Shrewsburn pflegte jeden Dienstagabend im Klub zu erscheinen, sich dort zwei bis drei Stunden aufzuhalten und dann wieder zu verschwinden. Man kann nicht sagen, daß Peter besondere Sympathien für ihn empfand, obwohl er aus einer alten Familie stammte, sich mit Geschmack kleidete und gute Manieren besaß. Ihm wurde jedoch eine gewisse durch nichts begründete Arroganz nachgesagt; und dies, verbunden mit einer etwas hochmütigen Zurückhaltung, der er sich bediente, war der Grund dafür, weshalb Peter keinen näheren Kontakt mit ihm aufgenommen hatte.
Jetzt aber wartete er, bis Peter sein Spiel beendet hatte, und fragte dann:
„Sind Sie für einen Augenblick zu sprechen, Peter?“
„Jederzeit, John.“
Die jüngeren Leute im Hunter’s Club hatten die Eigenart, sich mit Vornamen anzureden, und es war nicht zu sehen, warum der junge Shrewsburn bei Peter eine Ausnahme machen sollte.
Sie gingen in den Nebenraum und setzten sich an die Bar.
„Was haben Sie auf dem Herzen“ wollte Peter wissen, nachdem der Barkeeper jedem von ihnen ein Glas Brandy hingestellt hatte.
„Es handelt sich um ein verwickeltes Problem“, erklärte John Shrewsburn und kratzte sich hinter dem Ohr, „ich weiß nicht recht, wie ich es Ihnen erklären kann. Genau genommen möchte ich Sie um etwas bitten. Sehen Sie, da existiert doch mein Onkel . . .“
„Sir Robert Shrewsburn“, sagte Peter feierlich und ertappte sich dabei, wie er den Namen genußvoll aussprach. Aber für Peter, der seit einigen Monaten in einer großen Bank in der Londoner City tätig war, bedeutete dieser Name ungeheuer viel: Macht, Einfluß, Reichtum, Geld.
Sir Robert Shrewsburn hatte die nach ihm benannte Privatbank gegründet und überaus erfolgreich geleitet, darüber hinaus war er noch bis vor wenigen Jahren in den Aufsichtsräten und Vorständen fast aller großen Unternehmen anzutreffen gewesen. Erst eine schwere Krankheit vor einigen Jahren hatte ihn gezwungen, alle seine Aemter aufzugeben und sich ins Privatleben zurückzuziehen. Sein Name jedoch lebte fort als ein Symbol fast uneingeschränkter Macht.
„Ja“, fuhr Peter fort, „der Name ist mir bekannt.“
„Wenn nicht durch meinen Onkel, so doch durch mich“, ergänzte John und lachte kurz auf. „Aber der Unterschied zwischen uns beiden ist doch recht bedeutsam. Mein Onkel — der große, alte Mann, und ich — ein Tunichtgut!“
Ueberrascht sah Peter auf den jungen Mann, der jetzt ein zerknirschtes Gesicht machte.
„Freilich ist diese Tatsache noch nicht bis in die gesellschaftlichen Kreise vorgedrungen, die sich ein Vergnügen daraus machen würden, den Shrewsburns alles Schlechte nachzusagen. Aber wenn mir nicht ein gütiges Geschick dazwischenkommt, auf das ich hoffen darf, wird das bald der Fall sein.“
„Ich verstehe nicht ganz“, sagte Peter zurückhaltend, „von welchem gütigen Geschick sprechen Sie?“
„Vom Tod meines Onkels.“
„Vom Tod . . .“
„Ja, genau davon. Er ist jetzt vierundsechzig Jahre alt und leidet an einer unheilbaren Krankheit. Jeder Anfall ist schlimmer als der vorhergehende, und es ist kein Rechenproblem, wann er sterben wird.“
„Wenn Sie den Tod Ihres Onkels als ein gütiges Geschick betrachten, dann tut es mir leid, mit Ihnen über diesen Fall gesprochen zu haben“, sagte Peter kühl und wollte sich erheben, aber Shrewsburn hielt ihn zurück.
„Einen Augenblick, junger Mann. Sie sind zu hitzig und sehen die Dinge falsch. Ich bin der Auffassung, daß sein Tod ihn von seinem schweren Leiden befreien würde, und sehe ihn deshalb als ein gütiges Geschick an, sonst nichts. Ich wollte Sie in diesem Zusammenhang um etwas bitten, aber Sie wollen davonlaufen.“
„Nun, dann sagen Sie mir Ihre Bitte“, forderte Peter ihn auf.
„Das Problem ist folgendes“, begann John mit gleichmäßig freundlicher Stimme. „Ich gelte nichts in den Augen meines Onkels, oder genauer noch, er hält mich für einen Tunichtgut. Das ist natürlich ein hartes Urteil über den eigenen Neffen, um so mehr, als ich zu seinen nächsten Verwandten gehöre. Er hat nämlich herausbekommen, daß ich gewisse Gelder, die er mir für mein Studium überwiesen hat, beim Pferderennen verspielt habe, und hat mir das sehr übelgenommen. Ich sehe ein, daß es ein Fehler war, aber ich frage Sie: Wie soll ich diesen Fehler wiedergutmachen?“
„Das kommt darauf an“, sagte Peter vorsichtig. „War es viel Geld?“
„Etwa viertausend Pfund“, sagte John kurz.
„Eine ganze Menge“, erwiderte Peter, der nicht den fünfzigsten Teil dieses Vermögens sein eigen nannte, anerkennend und pfiff durch die Zähne. „Das läßt vielleicht die Meinung Ihres Onkels über Sie verständlicher werden.“
„Schon möglich“, gab John zu, „wenn es sie auch nicht rechtfertigt. Schließlich begeht jeder Mensch einmal einen Fehler. Trotzdem hatte ich mich dazu entschlossen, zu arbeiten und dieses Geld wieder zurückzuzahlen. Aber da kam etwas dazwischen. Der Arzt meines Onkels, Dr. Johnson, teilte mir mit, daß sich das Befinden meines Onkels verschlechtert hätte.“
„Damit erledigte sich Ihr Entschluß“, mutmaßte Peter.
„Ja. Denn Sie müssen einsehen, daß es sinnlos wäre, zu arbeiten, wenn jeden Tag mit dem Tod meines Onkels zu rechnen ist. So gewiß es ist, daß sein Tod für ihn ein Segen wäre, so sicher ist es doch auch, daß er unter den Erben große Schwierigkeiten verursachen würde, wenn er, ohne sich mit mir ausgesöhnt zu haben, sterben würde.“
„Sie rechnen damit, enterbt zu werden.“
„In der Tat. Ich halte das für möglich, und sehen Sie, deswegen habe ich mich an Sie gewandt.“
„Nun, ich sehe das noch nicht ganz ein“ stellte Peter fest. „Ich persönlich gehöre nicht zu den Erben und habe auch wohl keine Aussicht, einer zu werden. Was soll ich dann in dieser Angelegenheit?“
„Mir helfen“, sagte John freundlich. „Sie müssen für mich zu meinem Onkel gehen und mit ihm sprechen. Sie müssen erreichen, daß sich sein Haß gegen mich auf ein erträgliches Maß reduziert.“
„Bedaure, John“, sagte Peter steif. „Aber diese Bitte muß ich ablehnen.“
„Nicht so eilig“, sagte John mit unverminderter Freundlichkeit. „Sie ziehen sich immer sofort in ihre moralischen Gefühle zurück, was zwar verständlich, aber trotzdem in diesem Fall unangebracht ist. Ich muß Ihnen daher das ganze Problem auseinandersetzen. Außer mir sind noch vier andere Verwandte da, die wie ich erbberechtigt sind und nun alle in Gefahr schweben, enterbt zu werden. Schuld daran bin ich allein, ich mit meiner unseligen Spielleidenschaft.“
„Ich verstehe das nicht ganz.“
„Oh, es ist leicht zu verstehen. Mein Onkel überträgt seine Abneigung gegen mich auf alle anderen Verwandten, obwohl an und für sich gar kein Grund hierfür vorhanden ist. Sie verstehen, er ist etwas schrullig und verallgemeinert gern. Wenn er aber jetzt stirbt und nicht nur ich, sondern auch meine Verwandten leer ausgehen, dann habe ich in dieser schönen Stadt kein angenehmes Leben mehr.“
Peter schien es durchaus nicht, als triebe die Sorge um das Erbe seiner Verwandten seinen Gesprächspartner, aber er sah durchaus die vorgebrachten Gründe ein. Die Shrewsburns konnten dem Familienmitglied John eine Menge Aerger bereiten, wenn er sie durch sein Verhalten um ihr Erbe brachte.
„Immerhin bleibt Ihnen Ihr Pflichtteil“, gab er zu bedenken.
„Darauf ist kein Verlaß“, erwiderte John ruhig. „Mein Onkel braucht nur zu Lebzeiten einen großen Teil seines Vermögens irgendwelchen Wohlfahrtsorganisationen zu vermachen, dann gehen wir leer aus. Ganz abgesehen davon ist es jedoch kein schönes Gefühl, wenn er stirbt, ohne sich mit uns ausgesöhnt zu haben.“
„Das ist wahr“, stimmte Peter zu und dachte nach, während John ihn aufmerksam beobachtete. Vielleicht machte man dem alten Mann eine Freude, wenn man ihn wieder mit seiner Familie versöhnte. Vielleicht brachte die Bekanntschaft mit dieser Familie auch ihm Vorteile, der er ebenfalls in einer Bank arbeitete. Peter wußte, daß die Shrewsburns großen Einfluß auf Banken hatten. Alles in allem konnte man sich die Sache überlegen.
„Was soll ich tun?“ erkundigte sich Peter.
„Meinen Onkel aufsuchen und mit ihm reden. Es ist dies der einzige Weg für mich, wieder mit ihm ins Gespräch zu kommen, nachdem mir bekannt ist, daß er alle meine Briefe zerreißt und dem Personal Anweisung gegeben hat, mich nicht ins Haus zu lassen. Ich gebe Ihnen eine Botschaft für ihn mit.“
„Und Sie meinen, er empfängt mich?“ zweifelte Peter.
„Bestimmt. Wir müssen nur einen günstigen Termin ausfindig machen.“ Er zog einen Brief aus der Tasche. „Hier ist eine Nachricht des ihn behandelnden Arztes, Dr. Samuel Johnson aus Twickenham. Insgesamt gibt er meinem Onkel noch ein Jahr, aber er schreibt, daß diese Frist sich auch verkürzen kann. Vorige Woche hatte er einen schweren Anfall, danach hat es sich aber wieder gebessert. In den nächsten Tagen ist er mit Sicherheit wieder auf dem Damm. Es ist überhaupt erstaunlich, wie gut er sich nach seinen Anfällen wieder fängt. Er macht dann einen völlig gesunden Eindruck bis zum nächsten Anfall. Wenn Sie mit ihm sprechen, dann werden Sie nicht für möglich halten, daß er krank ist.“
„Und was soll ich ihm nun genau sagen?“
„Sehen Sie“, sagte John Shrewsburn vergnügt, jetzt haben wir uns bereits geeinigt. Wir werden nun zusammen ausknobeln, wie wir dem alten Herrn am besten beikommen . . .“
Eine halbe Stunde später befand sich Peter auf dem Heimweg. Drinnen im Klub hatte man gar nicht gemerkt, wie kühl es bereits war. Der Oktober war da und brachte kalte Herbststürme mit sich, die das abgefallene Laub der Bäume vor sich her trieben. Peter schlug den Mantelkragen hoch.
Eigentlich war er sich noch nicht ganz klar darüber, warum er John Shrewsburn überhaupt versprochen hatte, zu dessen Onkel zu gehen und für den mißratenen Neffen zu bitten. ‚Sinnlose Zeitvergeudung‘, dachte er wütend und stapfte dahin.
Schuld daran war, daß er seinen Mitmenschen zu sehr entgegenkam. Sollte dieser Shrewsburn doch selber sehen, wie er zu seinem Erbe kam. Freilich — ausgesprochen unsympathisch war er nicht; und daß er sein Geld verspielt hatte, war eigentlich auch nicht das schlimmste, aber ebensowenig war er Peter sympathisch. Das beste war, er rief am anderen Morgen den jungen Mann an und teilte ihm mit, er hätte keine Lust, zum alten Shrewsburn zu gehen.
Als er mit seinen Gedanken soweit war, sah er auf der anderen Straßenseite einen jungen Mann kommen, der ihm bekannt war, einen Bankangestellten mit Namen Harald White, der früher mit ihm im Bankhaus Merton tätig war. Harald hatte den Hut tief ins Gesicht gezogen und bahnte sich, von einem großen schwarzen Regenschirm überdacht, seinen Weg durch die Fußgänger. Sein Gesicht zeigte einen geistesabwesenden Ausdruck.
Peter blieb stehen.
„Harald!“ schrie er mit Stentorstimme über die belebte Fahrbahn.
Der Angerufene hob den Kopf und erkannte Peter. Er schwenkte den Schirm und versuchte etwas zu antworten, aber der Lärm der vorbeisausenden Autos und der Wind schnitten ihm die Worte vom Mund ab.
Peter machte sich todesmutig an die Ueberquerung der Fahrbahn. Wenig später stand er dem Freund gegenüber.
„Tag, Harald“, schüttelte er ihm freudig die Hand. „Was für ein Zufall, dich zu treffen. Ich habe dich vor acht Wochen das letzte Mal gesehen.“
„Es war meine Schuld“, versicherte Harald, „aber ich werde dir den Grund erklären. Gehen wir irgendwohin etwas trinken. Hier kann man nicht reden.“
Sie fanden ein kleines Lokal und ließen sich an einem der runden Holztische nieder. Beide bestellten Glühwein und fühlten sich sichtlich wohler, als das heiße Gebräu vor ihnen dampfte.
„Scheußlich kalt heute“, stellte Harald fest, „und stell dir vor: ich soll bei diesem Wetter in ein Seebad fahren.“
„Wer verlangt das von dir?“ fragte Peter.
„Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Aber ich bekomme es heraus.“
Harald zuckte die Schultern.
„Klingt ziemlich merkwürdig“, meinte Peter. „Willst du mir nicht erst einmal erklären, was du überhaupt zur Zeit treibst?“
„Richtig, hätte ich beinah vergessen.“ Harald kramte in seiner Brusttasche und holte eine Visitenkarte heraus. „Du weißt doch, daß ich vor einem Vierteljahr bei der Merton-Bank gekündigt habe. Ich bin jetzt bei diesem Verein.“
Peter nahm die Karte und sah überrascht hoch.
„Du bist in der Bank von Sir Robert Shrewsburn?“
„Genau bei der. Ich weiß selber nicht, wie ich dazu komme, denn ich habe mich dort nie beworben. Eines Tages bekam ich ein Angebot für eine Stellung, die bedeutend besser war als meine damalige bei Merton. Daraufhin habe ich sofort zugegriffen. Bis heute habe ich es auch nicht bereut — ich bin ziemlich hochgestiegen und habe alle Aussichten, Filialleiter zu werden. Das bedeutet eine ganze Menge, wenn man erst fünfundzwanzig Jahre alt ist. Aber —“ er hielt inne und sah nachdenklich vor sich hin. Dann fuhr er mit veränderter Stimme fort: „Aber wenn ich ehrlich sein soll, dann muß ich sagen: ich bin nicht hundertprozentig glücklich dort.“
„Warum? Macht die Arbeit keinen Spaß?“
„Doch, das schon. Aber die Sache ist so: Merton, das war noch eine richtige Bank, die mit anständigen und sauberen Methoden gearbeitet hat. Aber Shrewsburn —“
„Meinst du, daß die Bank nicht in Ordnung ist?“
„So scharf möchte ich es nicht formulieren. Die Bank ist bestimmt einwandfrei. Aber der alte Robert Shrewsburn, der wirklich ein Mann von Format ist, hat fast gar keinen Einfluß mehr auf die Leitung der Bank, denn seine Krankheit wirft ihn immer wieder nieder, wenn er auch zwischendurch geistig und körperlich ausgesprochen frisch ist. Jetzt wird die Bank von seinen Verwandten geleitet, und das sind gräßliche Leute.“
Harald dehnte das „gräßlich“ sehr in die Länge und hob dazu beide Hände in die Höhe, um zu unterstreichen, wie gräßlich er die Leute fand.
„Du scheinst viel Aerger mit Ihnen zu haben“, mutmaßte Peter.
„Weniger. Es sind andere Dinge, die mich empören. Oswald Shrewsburn, der Vetter von Sir Robert und sein nächster Verwandter, jetzt der erste Direktor, hat am ersten Tage bereits angeordnet, daß Neonlampen installiert wurden. Ferner Stechuhren — stell dir das vor, bei welcher Bank gibt es so etwas? In die Wagen der Bank wurden Fahrtschreiber eingebaut — kurz, das Mißtrauen in Person ist mit ihm eingekehrt. Dazu erließ er für die Angestellten ein Rauchverbot im gesamten Bankgebäude. Ich bin überzeugt davon, daß es unter sämtlichen Angestellten keinen gibt, der Oswald Shrewsburn nicht mit Freuden umbringen würde, fände er nur Gelegenheit dazu.“
Peter hörte aufmerksam zu. Es war heute schon das zweitemal, daß jemand das Gespräch auf die Shrewsburn brachte. Anscheinend war das eine jener typischen degenerierten Familien, bei denen ein großer alter Mann da ist, um den sich die auf das Erbe gierigen Verwandten scharen. Er fragte:
„Sind denn die anderen Verwandten Shrewsburns ebenso unangenehm wie dieser Oswald?“
„Die ich kenne, schon. Oswald Shrewsburn hat eine Schwester mit Namen Mary, die eine altjungferliche Dame mit einer zweifelhaften Vergangenheit und einer großen Vorliebe für fette Möpse ist. Dann existiert noch eine Diana Dunstan-Shrewsburn, genauso alt wie Mary und die Frau des im Krieg ums Leben gekommenen Bruders von Sir Robert. Und natürlich die beiden mißratenen Neffen von Sir Robert; John und Milton, die ich allerdings beide nicht kenne, außer von den Klatschspalten der Zeitungen her.“
„Und du möchtest deswegen wieder weg von der Bank?“
Harald schüttelte den Kopf.
„Nein, es ist schon zum Aushalten. Ich verstehe nur eines nicht: Wem habe ich es zu verdanken, daß ich überhaupt bei dieser Bank gelandet bin und so gut bezahlt werde. Mit Oswald Shrewsburn verstehe ich mich nicht besonders, wie ich schon erwähnte, und die anderen kenne ich kaum.“
Peter lächelte.
„Vielleicht ist eine der Damen in dich verliebt.“
„Ich will es nicht hoffen“, antwortete Harald erschrocken und ohne auf den Scherz einzugehen. „Dann müßte ich wirklich kündigen. Aber deine Theorie könnte beinah stimmen. Ich habe nämlich eine Einladung in das Seebad Eeastbourne bekommen, und ich kann machen, was ich will, ich bekomme nicht heraus, von wem sie ist.“
„Hast du sie da?“ wollte Peter wissen.
„Ja, hier.“ Harald öffnete wieder seine dicke Brieftasche und nahm einen weißen Briefumschlag heraus, den er Peter gab. Es waren nur wenige Zeilen. Mr. Harald White wurde darin gebeten, sich am 25. Oktober im Eastbourner Hotel „Emperor“ einzufinden, um dort mit einem Mr. Sullivan zusammenzutreffen. Es handle sich um eine wichtige berufliche Angelegenheit, mehr könne in diesem Schreiben leider nicht mitgeteilt werden. Die Fahrtkosten würden ihm ersetzt werden, und sein Aufenthalt im Hotel würde ebenfalls bezahlt. Gezeichnet: Sullivan, Beauftragter!
Peter sah hoch.
„Kennst du diesen Sullivan?“
„Eben nicht. Ich habe den Namen noch nie gehört.“
„Vielleicht ist er Beauftragter einer anderen Bank, der versuchten soll, dich von Shrewsburn fortzuholen.“
„Daran habe ich auch schon gedacht“, stimmte Harald zu. „Deswegen fahre ich auch am 25. hin. Nachsehen will ich auf jeden Fall, was los ist, obwohl mir die Angelegenheit nicht so ganz geheuer ist.“
Sie unterhielten sich noch eine Weile, ehe sie sich entschlossen, aufzubrechen. An der Tür schien Harald noch etwas einzufallen.
„Ich glaube nicht, daß deine Theorie richtig ist“, sagte er unvermittelt. „Dieser Sullivan ist bestimmt nicht von der Konkurrenz.“
„Wie kommst du darauf?“
„Weil“ — Harald hielt ein Papier in die Höhe „dieser Scheck über zehn Pfund, der heute früh mit der Post kam und von dem ich wahrscheinlich die Fahrt nach Eastbourne bezahlen soll, von einer Bank stammt, die Oswald Shrewsburn kontrolliert.“
„Ja und?“ fragte Peter verständnislos.
„Menschenskind, verstehst du dehn nicht?“ rief Harald aus. „Die Konkurrenz wird doch kein Konto bei Shrewsburn unterhalten.“
Peter mußte das einsehen.
„Aber welches Interesse hat denn sonst dieser Sullivan an dir?“ fragte er.
„Ja“, sagte Harald nachdenklich, „das möchte ich auch gerne wissen.“
Die Frage beschäftigte Peter natürlich ungleich weniger als Harald, und am anderen Morgen hatte er sie fast vergessen, als er sich anschickte, John Shrewsburn anzurufen. Sein Entschluß, Sir Robert Shrewsburn nicht aufzusuchen, war durch das Gespräch mit Harald noch bekräftigt worden, und er wollte dies John telefonisch mitteilen. Er konnte nicht ahnen, daß gerade diese Weigerung ihn in einen noch viel engeren Kontakt mit den Shrewsburns bringen sollte, als er sich das je vorgestellt hatte.
John Shrewsburn war nicht zu Hause, und das Telefon klingelte vergebens.
Vormittags war Peter in der Bank und vergaß die Angelegenheit. In der Mittagspause fiel sie ihm wieder ein, und er ging zu einer Telefonzelle und rief wieder bei John an.
Er schien immer noch nicht zu Hause zu sein, obwohl er am Abend zuvor noch geäußert hatte, er werde den ganzen Tag daheim sein.
Je weiter der Nachmittag voranschritt, desto unangenehmer wurde Peter der Gedanke an das noch zu erledigende Telefongespräch. Je später er seine Weigerung John mitteilte, desto unangenehmer würde es für ihn sein. Schließlich hatte er es ihm gestern noch versprochen. Er mußte sich mit ganzer Kraft auf seine Arbeit konzentrieren.
Um vier Uhr versuchte er es noch einmal, wieder vergebens. John Shrewsburn schien den ganzen Tag über fort zu sein, dabei ging er keinem Beruf nach, sondern lebte von dem Geld, das er noch besaß. Viel konnte es nicht mehr sein, sonst hätte er sich nicht an Peter gewandt. Vielleicht war er beim Hunderennen und verspielte das letzte Geld.
Um fünf Uhr entschloß sich Peter, in die Wohnung von John zu fahren. Sollte er immer noch nicht daheim sein, konnte er ihm eine Botschaft hinterlassen und war dann nicht mehr verpflichtet, anzurufen.
Seine Wohnung lag in Kensington. Peter, der in Richmond wohnte, brauchte keinen Umweg zu machen, sondern stieg einfach einige Stationen früher aus der Untergrundbahn aus und ging das letzte Stück zu Fuß.
Das Haus, in dem John wohnte, war ein großer, alter, düsterer und ehemals sehr vornehmer Bau, mit vielen Balkons und Säulen und Steinbalustraden. Das Klingelschild zeigte die Namen von mindestens vierzig Familien; John wohnte in Untermiete bei einer Mrs. Briand. Peter läutete und wartete, bis der elektrische Türöffner summte.
Im ersten Stock öffnete ihm eine ältere Frau und sah ihn abwartend an. Peter zog seinen Hut.
„Verzeihen Sie, Madam — ich suche Mr. Shrewsburn.“
„Der ist oben in seiner Wohnung“, antwortete sie eifrig. „Ein Stock höher. Er ist zu Hause.“
„Wohnt er nicht mehr bei Ihnen?“ fragte Peter verwundert.
„Nein. Vor einem Monat wurde die Wohnung oben frei, und da zog Mr. Shrewsburn mit seinen Sachen hinauf. Sie brauchen nur hochgehen und zu läuten. Er ist zu Hause.“
„Woher wissen Sie das?“
Sie lachte.
„Weil das Radio oben geht. Ich höre es durch das offene Fenster. Um die Zeit spielt bei Mr. Shrewsburn oben immer das Radio. Und ich weiß auch warum!“ Sie beugte sich vertraulich vor zu ihm. „Um die Zeit kommen immer die Durchsagen von den Pferderennen, und deswegen stellt Mr. Shrewsburn immer das Radio ein.“
„Ach so, natürlich“, murmelte Peter und verbeugte sich. „Vielen Dank für die Auskunft, Madam.“
Er stieg die mit einem roten Läufer belegte Treppe hinauf. In der Mitte des Treppenhauses, zwischen den Stufen, war ein Fahrstuhl eingebaut, und seine Bahn war durch ein engmaschiges Drahtgitter abgesichert. In demselben Augenblick, als Peter an der Tür von John läuten wollte, hielt hinter ihm der Fahrstuhl an, und die eiserne Gittertür schob sich geräuschvoll zur Seite. Peter wandte den Kopf. Er war nicht wenig überrascht, als er sah, wie ein Polizist in seiner schwarzen Uniform und dem charakteristischen hohen Helm aus dem Fahrstuhl kam. Der Polizist hielt einen Zettel in der Hand und kam auf ihn zu.
„Wohnt hier ein Mr. Shrewsburn?“ fragte er und sah suchend auf das Türschild.
„Allerdings. Ich möchte ihn gerade besuchen. Ist ihm etwas geschehen?“
Der Polizist zuckte die Schultern.
„Wir bekamen im Revier einen anonymen Anruf, in dieser Wohnung nachzusehen. Wahrscheinlich hat die Sache nichts zu bedeuten, aber ich will auf alle Fälle nachsehen.“
Er drückte auf den Klingelknopf und wartete eine Weile, während der beide lauschten.
„Nichts“, stellte der Polizist fest und wandte sich um. „Muß eine Fehlanzeige gewesen sein. Es gibt so viele verrückte Leute . . .“
Er wollte wieder gehen, wurde aber von Peter zurückgehalten.
„Sehen Sie“, sagte Peter aufgeregt, „die Tür ist nur angelehnt“.
„Tatsächlich“, erklärte der Polizist überrascht. Vorsichtig drückte er die Tür nach innen auf. Dunkel lag der Wohnungskorridor vor ihnen.
„Man müßte Licht machen“, meinte der Polizist. Er tastete an der Wand entlang, bis er den Schalter fand.
Mit einem Schlag wurde es hell, und das grelle, erbarmungslos helle Licht der Deckenlampe beleuchtete ein grausiges Bild.
Vor ihnen, zusammengekrümmt, lag auf dem roten Läufer John Shrewsburn. Er war tot.
Peter brauchte einige Sekunden, um diese Tatsache zu begreifen. Der Tote lag so, daß sein Gesicht ihnen zugewandt war, und dieses Gesicht zeigte einen friedlichen, fast heiteren Ausdruck, als wäre der Tod völlig unerwartet über ihn gekommen. Nichtsdestoweniger bestand kein Zweifel daran, daß er tot war. Ein schwarzer Fleck neben seinem Hals verunzierte den Teppich; es war unverkennbar, woraus er bestand: Blut.
Peter wollte den Mund öffnen, um etwas zu sagen, brachte aber kein Wort über seine Lippen. Der Polizist ging mit zwei Schritten zu dem Toten und beugte sich über ihn. Gleich darauf richtete er sich wieder auf.
„Eindeutiger Mord“, sagte er und fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn. „Der Mörder hatte sogar noch die Frechheit, im Polizeirevier anzurufen, um uns darauf aufmerksam zu machen. Ich muß sofort im Kommissariat anrufen.“
„Dort steht ein Telefon“, sagte Peter mit belegter Stimme und deutete auf ein Wandbord im Korridor. Während der Polizist dann telefonierte, näherte er sich langsam dem Leichnam. Da lag nun John Shrewsburn, der elegante, auf allen Rennplätzen Englands anzutreffende Lebemann, getroffen vom Messer eines hinterhältigen Meuchelmörders. Der Stich war von hinten in den Nacken gekommen. Daher war auch der friedliche Gesichtsausdruck des Toten zu erklären. Der Tod mußte unmittelbar nach dem Einstich erfolgt sein.
Der Polizist hängte den Telefonhörer auf und sagte: „Die Mordkommission ist verständigt. Sie muß in ein paar Minuten hier sein. Rühren Sie bis dahin nichts an.“
Peter erschienen die paar Minuten bis zum Eintreffen der Kriminalbeamten wie eine Ewigkeit. Er hätte gern geraucht, wagte aber nicht, seine Zigaretten hervorzuziehen. So beschränkte er sich darauf, dem Polizisten zuzusehen, der leise fluchend hin und her ging. Schließlich blieb er vor ihm stehen.
„Wie ist eigentlich Ihr Name, Sir?“
„Dixon, Peter Dixon. Ich wohne in Richmond.“
„Waren Sie mit dem Ermordeten näher befreundet?“
„Nein“, antwortete Peter. „Keineswegs. Ich bin lediglich im selben Klub, bei dem er auch Mitglied war.“
Der Polizist wollte fortfahren zu fragen, aber in dem Moment läutete die Glocke, und er ging öffnen. Die Beamten von der Mordkommission waren da, fünf Mann, die sich in ihren Regenmänteln und nach vorn gezogenen Hüten irgendwie ähnlich sahen. Einer von ihnen trat vor und sagte:
„Mein Name ist Grant, Kommissar Grant. Das sind meine Mitarbeiter.“ Er deutete mit der Hand auf die anderen Beamten, die sich daran machten, ihre mitgebrachten Instrumente auszupacken. Dann fuhr er fort: „Sie, Sergeant, fanden den Toten?“
„Nicht allein, Sir“, meldete der Polizist, „ich kam hier gleichzeitig mit diesem Gentleman hier an.“ Damit wies er auf Peter und erzählte dem Kommissar mit knappen Worten, wie und auf welche Veranlassung hin er den Toten gefunden hatte. Es fiel Peter auf, daß der Kommissar sich den Leichnam Shrewsburns nur flüchtig ansah und dann sofort mit Fragen begann.
„Die Tür war also nur angelehnt, Sergeant?“
„Genau. Sonst wäre ich wahrscheinlich wieder gegangen, da ich zu einem Eindringen in die verschlossene Wohnung nicht befugt war.“
„Der Schlüssel steckte nicht?“
„Nein, Sir!“
Der Kommissar wandte sich an die mit ihm gekommenen Beamten und rief: „Seht mal nach, ob ihr den Wohnungsschlüssel findet.“ Wenig später brachte ihm ein Beamter ein Schlüsselbund, das sich in der Jackentasche des Toten gefunden hatte. Grant ließ es durch die Finger gleiten.
„Lauter verschiedene Schlüssel“, stellte er fest. „Wollen mal sehen, ob einer paßt.“
Er ging zur Tür und öffnete sie. Ueberrascht blieb er stehen, als draußen eine Gestalt aus ihrer gebückten Haltung, in der sie offenbar durch das Schlüsselloch geschaut hatte, hochfuhr.
Es war Mrs. Briand.
„Nanu, Madam“, sagte Grant mehr verwundert als ärgerlich, „wie kommen Sie an diese Tür? Wer sind Sie überhaupt?“
Die Zimmervermieterin wurde dunkelrot im Gesicht. „Verzeihen Sie — aber ich sah erst den Polizisten hochkommen — und dann Sie — da dachte ich, es wäre etwas passiert.“ Plötzlich entdeckte sie den auf dem Boden liegenden Leichnam Shrewsburns und stieß einen hohen, spitzen Schrei aus. Mit vor den Mund gepreßter Faust und entsetzten Augen starrte sie auf die Polizisten.
Grant gab einem der Beamten einen kurzen Wink, woraufhin dieser aus dem Nebenraum eine Decke holte, die er über den Toten breitete.
„Ja, Madam“, sagte er dann ernst zu der Zimmervermieterin gewandt, „Mr. Shrewsburn ist etwas zugestoßen. Er wurde ermordet, und ich hoffe, daß Sie uns Hinweise zur Auffindung des Mörders geben können. Ich schlage vor, wir gehen in den Nebenraum, oder halt.“ Ihm schien etwas einzufallen. „Warten Sie, ich möchte später mit Ihnen sprechen. Zuerst will ich mir diesen jungen Mann anhören.“
Damit ergriff er Peter beim Arm und ging mit ihm in den Nebenraum. Als sie allein waren, sagte er ärgerlich:
„Ich mag diese neugierigen Weiber nicht, aber wenn man sie grob behandelt, steht sofort am nächsten Tag in der Zeitung: Herzlose Polizisten mißhandeln arme Frauen.“ Unvermittelt wandte er sich um und fragte:
„Woher kannten Sie Mr. Shrewsburn?“
„Aus dem Hunter’s Club. Ich bin dort, ebenso wie er, Mitglied.“
„Waren Sie miteinander befreundet?“
„Nein, das kann man nicht sagen.“