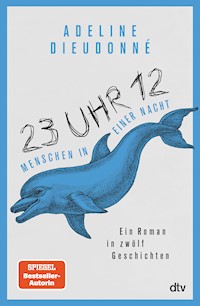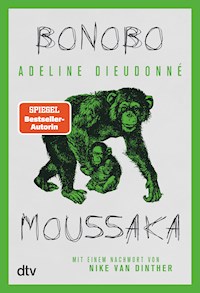10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Liebesbrief, eine Totenklage, ein Roman für das Leben Nach dem Bestseller ›Das wirkliche Leben‹ endlich der neue, große Roman der preisgekrönten Schriftstellerin Adeline Dieudonné. Eine Frau und ihr Geliebter verbringen das Wochenende in einem Chalet in den französischen Alpen. Doch mit einem Mal ist er tot. Außer sich vor Schmerz bleibt die Erzählerin mit seinem Körper zurück. In den Tagen, die folgen, weicht sie ihm nicht von der Seite. Schläft bei ihm, spricht mit ihm, fährt mit ihm auf dem Rücksitz durch die Berge. Und sie beginnt, seiner Ehefrau zu schreiben. In den Briefen erzählt sie die Geschichte einer großen Liebe – und die Geschichte einer Frau, die lernt, selbstbestimmt zu leben. Abgründig, zärtlich und humorvoll, ein Roman von emotionaler Wucht. ›Bleib‹ ist ein berührender Liebes- und Abschiedsbrief, ein schonungsloser Blick aufs Frausein in unserer Gesellschaft – und der skurrile Roadtrip einer Frau mit ihrem toten Geliebten auf der Rückbank. »Eine leuchtende Variation über die Liebe und den Tod, von einer unnachahmlichen Schönheit.« ELLE Ebenfalls von Adeline Dieudonné bei dtv erschienen sind: Das wirkliche Leben 23 Uhr 12 – Menschen in einer Nacht Bonobo Moussaka
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
»Eine leuchtende Variation über die Liebe und den Tod, von einer unnachahmlichen Schönheit.« ELLE
Eine Frau und ihr Geliebter verbringen das Wochenende in einem Chalet in den französischen Alpen. Mit einem Mal ist er tot. Außer sich vor Schmerz bleibt die Erzählerin mit seinem Körper zurück. In den Tagen, die folgen, weicht sie ihm nicht von der Seite. Schläft bei ihm, spricht mit ihm, fährt mit ihm auf dem Rücksitz durch die Berge. Und sie beginnt, seiner Ehefrau zu schreiben. In den Briefen erzählt sie die Geschichte ihrer großen Liebe – und die Geschichte einer Frau, die lernt, selbstbestimmt zu leben.
Von der Autorin des Bestsellers ›Das wirkliche Leben‹: Abgründig, zärtlich und humorvoll.
Adeline Dieudonné
Bleib
Roman
Aus dem Französischen von Sina de Malafosse
Meinem Vater Pierre
Ich habe es dir nie gesagt
Aber wir sind unsterblich
Warum bist du gegangen
Bevor ich dir das sagen konnte?
Dominique A., ›Immortels‹
Was, verdammt, soll das, dass Du nicht hier bist?
Was für ein Unsinn […]
Jana Černá, ›Totale Sehnsucht‹[1]
Erster Brief
Mittwoch, 5. April 2022.
M. liegt hier, neben mir. Er ist tot.
Er ist tot.
Dies aufzuschreiben wird mir hoffentlich helfen, die Realität zu begreifen.
Ich betrachte die Wörter, entziffere sie, während sie unter meiner Hand Gestalt annehmen, schreibe sie erneut, will sie zu fassen bekommen.
Doch sie entschlüpfen mir, rutschen aus meinem Blickfeld, ich beginne von vorn.
Ich hätte Sie bereits gestern anrufen und informieren müssen. Doch ich tue es nicht.
Während ich diese Zeilen schreibe, wissen Sie noch nichts von M.s Tod. Darum beneide ich Sie.
9 Uhr 32. Ich habe auf seine Armbanduhr geschaut, dort, auf dem Nachttisch, wo er sie zurückgelassen hat.
Ich stelle Sie mir bei einer Baubesprechung vor. Oder an Ihrem Schreibtisch, beim Plänezeichnen.
M. spricht nicht oft über Sie. Sprach. Sprach nicht oft über Sie. Aus einer Art Feingefühl heraus, nehme ich an.
Er hat Sie geliebt, daran gibt es keinen Zweifel.
Ihnen jetzt zu schreiben erlaubt mir vielleicht, von hier zu entkommen. Sie sitzen aufrecht vor Ihrem Computer, neben sich eine Tasse lauwarmen Tee – Sie haben vergessen, den Beutel herauszunehmen, er ist bestimmt bitter –, Sie zeichnen eine Garage, ziehen rote gelbe grüne blaue Linien auf dem schwarzen Bildschirmhintergrund. Sie sind ganz versunken in die Vorstellung von der zukünftigen Garage. Und Sie können darin versinken, denn in Ihnen ruht die Gewissheit, dass M. ein paar Kilometer entfernt umherläuft, dass seine Lungen sich weiten, zusammenziehen, dass sein Herz pumpt, es unter seiner Haut zuckt.
Ich strecke die Hand aus, lege sie auf seine kalte, reglose Brust.
Ich stelle mir vor, in Ihrer Haut zu stecken, in Ihrem Kopf, und ein paar Sekunden lang bin ich Sie, und ein paar Sekunden lang besteht mein größtes Problem darin, zu entscheiden, ob es ein Roll- oder ein Schwingtor für die Garage sein soll und auf welche Seite ich den elektrischen Schaltkasten setze. Ich nehme Ihnen damit nichts, denn ich lasse Ihnen Ihren Schreibtisch, Ihren bitteren Tee, Ihre Unwissenheit.
Ich muss aufstehen. Mich anziehen.
M. liegt neben mir und sieht aus, als würde er schlafen. Er ist nackt. Schon seit gestern Morgen. Ich glaube, ich gewöhne mich allmählich daran. Das ist sein neues Ich. Ich habe ihn geschüttelt, viel geweint, bin zornig geworden, habe ihn geohrfeigt, und dabei wusste ich, dass er tot war, glaube ich, ich bin nicht verrückt, aber die Wut hat mich übermannt. Warum hat er es da nicht rausgeschafft? Wie konnte er sich so gehen lassen?
Ich brauche Wein.
Das Chalet ist nicht groß. Ein Schlafzimmer, ein Bad, eine einfache Küche, die an ein verlebtes Wohnzimmer anschließt. Präparierte Forellen an den Wänden, Haken und Köder in staubigen Glasvitrinen. Ein Holzofen. Die Mauern verströmen einen Geruch von Salz, Kälte, Stein. Ich glaube, wir mochten den Ort wegen seiner Schlichtheit. Mochten es, unsere Zahnbürsten Seite an Seite auf das kleine Steinwaschbecken zu legen, die gleiche Musik zu hören, uns beim Tischdecken zu streifen, zu kochen.
Hier ist nichts. Und da hier nichts ist, ist hier alles, verzeihen Sie das Klischee, aber der Wald, der See, die Vögel, die Wildgräser, das ist alles. Wenn ich sage, dass hier nichts ist, will ich sagen, dass hier niemand ist. Niemand außer M. und mir. Ich weiß nicht, was er Ihnen all die Male erzählt hat, um seine Abwesenheit zu begründen. Ein Seminar, ein paar Tage mit Freunden, ein Schwimmkurs … Wir haben nie darüber gesprochen. Er hat sich sicher geschämt, und ich mich auch.
Hier konnten wir uns einbilden, dass wir nie nach Hause zurückkehren würden. Dass wir hier gemeinsam alt würden. Ein Hund, ein paar Hühner. Wir wären uns selbst genug. Wir liebten diese Lüge. Und manchmal glaubte ich daran.
In Wahrheit bestand die Lüge in der Auslassung. Nicht, weil sie meine Tochter außen vor ließ – Nina ist schon groß –, sondern mein Bedürfnis nach Einsamkeit. Während der paar Tage, die wir hin und wieder abknapsten, gefiel es mir, dass M. in meinen Lebensraum eindrang. Aber hätte ich ihn das ganze Jahr über ertragen?
Ja, doch. Wahrscheinlich schon. Wir waren beide alt genug, um zu wissen, wie wir unseren Raum vor dem anderen schützten. Wir kannten uns gut genug. Vielleicht hätte es genügt, wenn ich mir neben dem Chalet eine Hütte gebaut hätte, mein Atelier, ein Zimmer für mich allein.
Was also verbarg diese Lüge eigentlich?
Bestimmt unsere Angst, dass unser bis dahin endloses Zwiegespräch abreißen könnte. Ein Zwiegespräch mit Wörtern, natürlich, und ein Zwiegespräch der Körper, der gierigen Körper, die sich gerade erst kennengelernt haben.
Die Angst vor der Stille des Überdrusses, des versiegenden Verlangens.
Und natürlich klammerte die Lüge Sie aus. Und Ihren Sohn. Und die Welt in Flammen.
12 Uhr 43 auf M.s Uhr, die immer noch auf dem Nachttisch liegt. Ich wage es nicht, seine Sachen anzufassen. Ich wage es nicht, auf sein Telefon zu schauen, das auf dem Büfett neben dem Ofen liegt. Ich hätte Zugang zu seinem Leben. Zu seinen Nachrichten, zu seinen Accounts in den sozialen Netzwerken.
Wird alles mit ihm verschwinden? Wird seine E-Mail-Adresse gelöscht? Oder wird sie weiter existieren, wie ein verlassenes Haus, in dem berufliche Mailwechsel, ungelesene Newsletter, alte Rechnungen, Ihre Streitgespräche herumspuken? Ich weiß, dass Sie sich vor allem per E-Mail gestritten haben. Das hat M. mir anvertraut. Wenn Spannungen entstanden, sagten Sie nichts und führten die Diskussion schriftlich fort. Werden Sie diese Gespräche aufheben? Ich glaube, wenn es meine Geschichte wäre, meine Streitgespräche, meine Beziehung, wären diese Nachrichten für mich wertvoller als Urlaubsfotos, weniger falsch.
Ich habe Lust, sie zu lesen. Ich könnte überprüfen, ob das Bild, das M. von seiner Ehe gezeichnet hat, der Wirklichkeit entspricht. Vielleicht würde ich, wenn ich in sein Telefon schaute, einen ganz anderen M. entdecken. Vielleicht würde ich Schreckliches finden, abartige Videos, Kinderpornografisches, Katzenbabys, denen die Kehle durchgeschnitten wird. Man weiß nie.
Ihnen zu schreiben tröstet mich ein wenig. Ich habe das Schlafzimmer verlassen, ein Feuer angezündet, Musik aufgelegt. Nick Cave. Seine Stimme passt gut zur Umgebung, zum See, zu den grauen Wolken. Zu meiner weiten Strickjacke, dem Knistern des Feuers, dem Boden aus Steinen aus der Region. Alles ist stimmig. Ein echtes Klischee, wie in einer Werbung für ich weiß nicht was, für etwas, das mir scheißegal ist. Verdammt. Ich schenke mir noch ein Glas Wein ein. Aus der Flasche, die wir vorgestern geöffnet haben.
Heute ist mein Geburtstag. Na dann, alles Gute! Ich bin einundvierzig. Ich nehme an, dass irgendwo ganz unten in M.s Koffer ein kleines Geschenk für mich steckt. Aber ich denke lieber nicht darüber nach. Wann war Ihr Geburtstag? Was hat er Ihnen geschenkt? Hat er noch »Ich liebe dich« gesagt? Sie noch geküsst?
Morgen muss ich die Schlüssel zurückgeben. Morgen erwarten Sie ihn zurück. Morgen heißt es Abschied nehmen.
Ich könnte nun die Polizei rufen. Ich hätte sie gestern rufen können.
Ich konnte es nicht. Man hätte ihn mir weggenommen. Ihnen zurückgegeben. Und dann? Wenn er nicht bei mir ist, ist er allein. Er hätte die Vorbereitungen für die Beerdigung allein durchstehen müssen, man hätte ihn in einen Kühlraum gelegt, andere Hände als meine hätten ihn angefasst.
Allein in seinem Sarg während der Zeremonie, allein im Brennofen. Ich brauche keine Beileidsbekundungen, keine Asche. Ich bin nichts. Aber M. braucht mich. Oder ich brauche es, über ihn zu wachen. Ich werde ihn nicht im Stich lassen.
Ich weiß, dass er bei mir zu Hause niemandem fehlen wird. Meine Tochter kennt ihn kaum. Meine Freunde genauso wenig. Das ist unwichtig, ich habe ihn allein geliebt, ich kann allein um ihn weinen. Aber ich kann ihn jetzt nicht im Stich lassen.
Das ist nicht Ihre Schuld, ich weiß, dass Sie alles Nötige getan hätten. Aber es wäre nicht genug gewesen.
Ich lege mich wieder zu ihm.
Seit ich M. begegnet bin, habe ich mich gefragt, wie es enden würde. Ich habe immer geglaubt, dass er mich verlassen würde, das lag in der Ordnung der Dinge. Oder ich würde jemanden kennenlernen. Der Klassiker. Jemanden, der liebend gern seine Rente mit mir teilt. Das hatte ich vor M. versucht. Die Rentenvorsorge hatte den Kürzeren gezogen. Romain. Auf dem Papier durchaus reizvoll. Er gab einen Schreinerkurs, und ich wollte schreinern. Er wollte ein Kind, ich hatte einen Bauch.
Romain war nett und sehr klug, seine Intelligenz hatte eine erotische Wirkung auf mich, aber das beruhte nicht auf Gegenseitigkeit. Er mochte es, mich herzuzeigen, er mochte meine kurzen Shorts, er mochte meinen Arsch. Nein, er mochte meinen Arsch nicht. Er war stolz auf meinen Arsch. Der lüsterne Glanz in den Augen seiner Freunde freute ihn. Ich war sein Arsch. Und die liebe Mutter seines Kindes. Aufmerksam, präsent, ja, aber nie genug. Niemals so ergeben wie seine eigene Mutter. Vorwürfe machte er mir keine, aber er versteifte sich, bekam vor Unzufriedenheit winzige nervöse Ticks, gefolgt von einem Rat, einem Vorschlag. Es gefiel ihm nicht, wenn ich mich mehr als nötig für meine Arbeit einsetzte. Ich bin Französischlehrerin. Er hasste es, wenn ich Schulausflüge begleitete. Seine Tochter, seine Frau, seine Freunde, am Sonntag sein Rugby, und das war’s. Vier Freunde. Sie hatten sich im Kindergarten kennengelernt und nie wieder getrennt. Ich bewunderte diese Treue, diese Konstanz. Ein Trauerfall, eine Trennung, eine Alkoholphase, eine Depression, und alle nahmen sich ein paar Tage frei, packten den Lädierten ein und kamen hier rauf ins Chalet, um ihre Wunden zu lecken. Jackys Chalet. Jacky, Romains Patenonkel. Und somit ihrer aller Patenonkel. Gemeinsam war den vier Freunden der abwesende Vater. Der gegangen, nie gekommen oder tot war. Also hatte Jacky sie alle unter seine Fittiche genommen. Und er hatte dieses Chalet, diesen See.
Nach meiner Trennung von Romain bin ich mit ihm in Kontakt geblieben. Er ist auch den Ex-Frauen treu. Er hat Verständnis, hat schon so einige kommen und gehen sehen. Die Clique hat mich verstoßen, aber nicht Jacky. Dann hat er M. unter seine Fittiche genommen, fast ohne Fragen zu stellen, auch wenn M. nicht wirklich einen Vater brauchte.
Morgen muss ich ihm die Schlüssel des Chalets zurückgeben.
Morgen muss ich eine Entscheidung treffen.
Ich habe Angst vor dem Älterwerden. Das ist natürlich nicht besonders originell. Die Angst tauchte eines Tages auf, ganz überraschend. Ich hatte meinem Alter immer gelassen gegenübergestanden, hatte auf meine ersten Falten mit ziemlicher Gleichgültigkeit reagiert. War eher amüsiert, als ich in meinen späten Dreißigern ein paar graue Körper- und Kopfhaare entdeckte. Sie zu übertünchen wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Gelassen und erhobenen Hauptes ging ich auf die vierzig zu, in dem Glauben, der Angst vor dem Alter durch wer weiß welches Wunder oder welche Weisheit entkommen zu sein.
Und dann, drei Tage vor meinem Vierzigsten, bei einem Abendessen bei einer Bekannten, erwähnte eine Frau in meiner Gegenwart einen Abend, den sie mit M. verbracht hatte, ohne zu wissen, wer ich für ihn war und er für mich. Sie erzählte mit einem anspielungsreichen Lächeln, wie M. und eine ihrer Freundinnen sich nähergekommen seien. Eine charmante junge Frau, Ende zwanzig, lustig, einnehmend. Es war nicht von Flirten die Rede, sondern von M.s Faszination, ich glaube, sogar der Ausdruck »triefende Lefzen« wurde verwendet. Ich entschuldigte mich unter dem Vorwand starker Kopfschmerzen und ging im Aprilregen nach Hause. Ich war außer mir, weil ich widerspruchslos zulassen musste, dass diese Frau M. so schlecht darstellte. Und außer mir, weil mich die Anekdote so getroffen hatte. Nicht sosehr der Gedanke, dass eine andere M.s Interesse wecken könnte, das passiert, und ich habe gelernt, mein Ego in dieser Hinsicht im Zaum zu halten. Es war das Alter der anderen. Zehn Jahre jünger als ich, sechzehn jünger als M. »Der große Markt der tollen Frauen«[2]. Dort hatte ich einen Ehrenplatz, doch nun fühlte ich mich Richtung Ausgang geschoben – nicht von der jüngeren Frau, sondern von ihm und seiner Angst vor dem Älterwerden. Die er auf mich übertragen hatte.
An jenem Abend sah ich mich dieser Feststellung gegenüber wie einer von einem Wasserlauf unterspülten Straße. In drei Tagen wäre ich vierzig Jahre alt, ich stand am Rande eines Abgrunds, zugleich erschöpft und erschrocken, und fragte mich, wie ich ihn zuschütten sollte. Ein Teil von mir versuchte es vergeblich mit: »Verlass ihn, er ist das Problem, oder er hat das Problem, warum solltest du es zu deinem machen?« Aber ich wollte M. nicht verlassen. Ich dachte, ich würde mit dieser Angst leben können, diesem Damoklesschwert über mir. Eines Tages würde M. sich eine jüngere Geliebte nehmen. Noch eine letzte Runde auf dem Karussell, danke und auf Wiedersehen.
Wie leben Sie damit? Wissen Sie, dass er Sie nie verlassen wird? Nun, dass er Sie nie verlassen hätte? Denn das war wirklich so. Und es war mir recht, ich glaube, das sagte ich schon, ich weiß es nicht mehr.
Da hingen Worte zwischen uns in der Luft, die wir nicht mehr aussprechen mussten: »Leicht zu tragen und stark zu spüren.« So definierten wir unsere Verbindung, hatten daraus eine Art Devise gemacht oder ein Versprechen, das wir uns bei Camus geliehen hatten, oder bei René Char, ich weiß es nicht mehr. Der eine schrieb dem anderen: »Je älter ich werde, desto fester glaube ich, dass wir nur mit Menschen zusammenleben können, die uns befreien, die uns mit einer Zuneigung lieben, die leicht zu tragen und dabei stark zu spüren ist. Das Leben von heute ist zu hart, zu bitter, zu kräftezehrend, um hinzunehmen, dass uns diejenigen, die wir lieben, weitere Zwänge auferlegen.«
Wie spät ist es? Die Sonne erdrückt den See. Vor ein paar Minuten kam eine Herde Esel vorbei, um zu trinken. Ich frage mich, ob sie jemandem gehören. Werden sie zu einem bestimmten Zweck gezüchtet? Werden sie gegessen? Als ich klein war, erzählten mir meine Eltern, dass Bündnerfleisch Eselfleisch sei. Ich glaube, damit ich mich nicht mehr so über die Wurstplatte hermachte. Ob es funktioniert hat, weiß ich nicht mehr. Mit Sicherheit. Bestimmt habe ich an ›Cadichon – Erinnerungen eines Esels‹ gedacht und bin zu Pistazien übergegangen.
Eine Elster hatte sich auf den Nacken eines der Esel gesetzt und pickte Parasiten aus seiner Mähne. Der Esel machte den Hals lang, er schien es zu genießen. Dann flog die Elster weg, und der Esel sah ihr nach, geradezu traurig, als ob er sich verlassen fühlte. Ob sie sich kennen? Entlaust sie ihn regelmäßig? Haben sie eine gemeinsame Sprache? Zieht sie ihn den anderen vor?
Ich höre den Schrei eines Raubvogels. Ein Bussard, ein Falke, ein Adler? Ich weiß nicht, was in diesen Bergen lebt. Ich kann ihn kreisen sehen, zu weit oben, als dass ich ihn identifizieren könnte. Obwohl ich auch dann, wenn er auf meinem Arm landen würde, einen Falken nicht von einem Bussard unterscheiden könnte. Vielleicht ein Steinadler.
Ich schaue auf meinem Telefon nach, wie spät es ist, ins Schlafzimmer traue ich mich nicht mehr so recht. Nachher werde ich hineingehen, um neben ihm zu schlafen. Es gibt hier kein Netz. Selbst wenn ich die Rettung hätte rufen wollen, hätte ich es vielleicht nicht gekonnt. Aber ich habe es nicht versucht.
Habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich ihn gebadet habe?
Er liebte es zu baden. Das war gestern Nachmittag. Er war so kalt, ich wollte ihn aufwärmen. Starr war er noch nicht. Ich hatte ihn zurück ins Chalet gebracht und dabei mit seinem Gewicht und meinem Kummer gekämpft. Ich weinte pausenlos, hatte Mühe, Luft zu bekommen. Heute habe ich Muskelkater in den Armen, Schultern, Oberschenkeln. Ich zog ihn vom Strand, meine Unterarme unter seine Achseln geschoben. Sagt man da überhaupt Strand? Ab wann ist ein Uferstreifen ein Strand? Irgendwann schaue ich das nach. Auf jeden Fall der schmale Streifen Kies, wo der See angespült wird. Eine dumme Formulierung … Der See wird nicht angespült. Er nicht.
Mir wird klar, dass ich Ihnen alles durcheinander erzähle. Ich schreibe, wie es mir in den Sinn kommt, weil ich nicht weiß, was ich sonst tun soll. Und weil ich mich Ihnen nun verbunden fühle. Machen Sie sich vielleicht schon Sorgen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass Sie vertrauensvoll einschlafen – morgen Abend kommt er nach Hause –, dass Sie noch eine Nacht mit ihm haben, auch wenn er nicht da ist, mit der Gewissheit, dass er Teil Ihres Lebens ist. Die Flasche Wein habe ich geleert. Ich träume von einer Zigarette.
Ich glaube, ich habe mich geirrt. Was den Grund betrifft, warum ich Ihnen schreibe. Ich habe geglaubt, dass es ein Mittel wäre, um jetzt und hier, in diesem Chalet, dem Schmerz zu entkommen, M.s Körper, der auf dem Bett liegt. Indem ich Ihnen schreibe, so habe ich geglaubt, würde ich in Ihre Haut schlüpfen, in Ihren Zustand der Unwissenheit. Mit Ihren Augen sehen, berühren, was Sie berühren. Ist es nicht das, was ich mir insgeheim gewünscht habe, seit ich M. begegnet bin? Jede Nacht neben ihm schlafen, seine intimsten Handlungen kennen, seine täglichen Routinen, wissen, wo er beim Nachhausekommen die Schlüssel ablegt, wie er Ihren Sohn umarmt, die Einkäufe wegräumt, wie seine Stimme klingt, wenn er einen Termin beim Arzt vereinbart … Ich weiß nicht. Diese Details zu kennen hat einen Preis. Gerne hätte ich Zugang dazu gehabt, alles über M. erfahren, ohne ihn jeden Tag sehen zu müssen. Sie könnten das Gleiche sagen. Ich kenne einen anderen M. als Sie. M. in seinem Kostüm des untreuen Ehemanns. Das ist so gewöhnlich, Verzeihung. Aber darum geht es mir. Ich habe mich geirrt, ich schreibe Ihnen aus Liebe. Nicht aus Liebe zu M., obwohl, das wahrscheinlich auch. Sondern weil ich Sie liebe. Auf jeden Fall würde ich mir das gerne einreden. Das ist seltsam, ja. Die Leiche seines toten Liebhabers zu behalten ist seltsam, zu lieben ist seltsam. Ich bin seltsam, voilà. Ich liebe Sie also. Oder würde es mir gern einreden. Was soll diese Sache mit der Konkurrenz? Wir sind keine Rivalinnen. Sie hätten das vielleicht nicht so gesehen, und das ist der Grund, warum M. Ihnen nie von mir erzählt hat, aber ich kann Ihnen sagen, dass es zwischen uns keinen Wettbewerb gibt, ich habe Ihnen nichts weggenommen. Das würde ich mir gern einreden. Und ich liebe Sie, ohne Ihnen begegnet zu sein, weil M. Sie geliebt hat. Und ich zeige meine Liebe durch diese Worte, weil seine Worte für Sie liebevoll waren. Das würde ich mir zumindest gern einreden. Eigentlich habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was Sie gefühlt haben, als der Mann, den Sie lieben, der Ihnen alles versprochen hat, mit dem Sie sich tausendmal im Arm gehalten haben, mit dem Sie entschieden haben, ein Kind zu bekommen, dieser Mann, der beim Anblick Ihres Körpers vor Glück geweint haben muss, was Sie gefühlt haben, als er anfing, Sie beim Vornamen zu nennen, als sein Blick stumpf wurde, als Sie endlich verstanden haben, dass ein Teil Ihrer gemeinsamen Geschichte zu Ende war, oder tot, oder, um einen optimistischeren Ausdruck zu verwenden, sich gewandelt hatte. Liebesbeziehungen wandeln sich, da bin ich sicher, aber sterbendes Begehren ist sterbendes Begehren. Punkt.
Der See hat keinen Namen. Er wird der obere See genannt, um ihn von seinem Bruder, dem unteren See, zu unterscheiden. Der untere See ist größer. Jacky züchtet dort Forellen für die Angler, die in der Urlaubssaison auftauchen. Er war es, der mir das Angeln beigebracht hat, und ich habe es geliebt. Stundenlang den Korken auf der Wasseroberfläche beobachten. Insgeheim hoffen, einen Hecht zu fangen. Jacky sagte, dass es im See etwa zehn geben müsse. Wie gern hätte ich sein Gesicht gesehen und das von Romain und all den anderen, wenn ich einen herausgezogen hätte. Abends aßen wir, was wir gefangen hatten. Die Forellen schmeckten nach Schlamm. Jacky hat mir auch gezeigt, wie man sie tötet, öffnet, ausnimmt.
Er führt das Seehotel. Über Namen zerbricht man sich in der Gegend nicht den Kopf. Und tatsächlich, wenn vom Seehotel die Rede ist, wissen alle, was gemeint ist. Ein großes Haus aus Stein und Holz, drei Stockwerke hoch. Im Erdgeschoss die Rezeption, das Restaurant, der Laden für Anglerbedarf, ein Stockwerk mit Zimmern und ein Schlafsaal unter dem Dach. Vor dem Hotel führt ein Holzsteg bis zur Mitte der Wasserfläche. Die genaue Fläche kenne ich nicht, und ich bin schlecht im Berechnen, ich schätze, dass er so groß ist wie eineinhalb Fußballfelder, aber das ist sicher Unsinn. Ich denke mal, dass Sie es wissen würden. Eine Architektin weiß solche Dinge, oder? Warum übrigens wird alles in Fußballfeldern gemessen?
Das erste Mal war ich vor achtzehn Jahren hier, ich war mit meiner Tochter schwanger, wusste es aber noch nicht. Ihr Vater wollte mich Jacky vorstellen. Ich sage »mich Jacky vorstellen« und nicht »Jacky und mich vorstellen«. Die zweite Formulierung geht von Gegenseitigkeit aus, aber es gab keine. Romain war stolz, als würde er eine Trophäe präsentieren oder einen Orden, den er sich auf dem Schlachtfeld verdient hatte, und ich war stolz, diese Trophäe zu sein. Jacky hatte diesen bewundernden Blick, ein wenig verblüfft, und ich merkte, wie Romain sich freute. Ich hatte den Mund noch nicht aufgemacht, das war unnötig. Eine kurze Jeanshose, sexy, aber nicht übertrieben, über schlanken Beinen in Cowboystiefeln, dazu ein kurzes, weit geschnittenes T-Shirt, schlichtes Make-up, ein gesunder Teint, ein ebenmäßiges Gesicht, auf dem häufig ein Lächeln zu sehen war. Ich war hübsch, bescheiden, sympathisch, weder nervig noch hysterisch, ich wusste, wo mein Platz war. Ich war, was von mir erwartet wurde. Das hört sich verbittert an, dabei bin ich es in Wirklichkeit nicht mehr. Nicht einmal wütend. Die Jahre mit Romain waren Jahre des Verblassens. Wenn ich freundlich darüber sprechen wollte, würde ich sagen, dass ich in meinem Inneren einen dicken Samtvorhang aufgehängt habe, hinter dem ich meine Bedürfnisse, meine Ambitionen, meine Kreativität versteckt habe. Hinter dem ich verschwunden bin. Wenn ich härtere Worte finden müsste, würde ich von einem Kerker sprechen. Ich habe mir lange vorgeworfen, dass ich das ertragen habe. Romain war kein gewalttätiger Typ, ich hätte gehen sollen.
Er war vier Jahre alt, als sein Vater seine Mutter Hélène verließ. Die übliche Geschichte eines Kerls, der schon von Anfang an kaum präsent ist und eines Tages eine andere heiratet, eine andere Familie gründet. Hélène musste allein mit Romain und seiner Schwester Annabelle zurechtkommen. Jacky, der beste Freund des Vaters, sicher ein wenig verliebt in sie, unterstützte sie. Er half ihr, eine Stelle als Verkäuferin in einem Modegeschäft zu finden, brachte ihr das Fahren bei, damit sie ihren Führerschein machen konnte. Er war immer zur Stelle, loyal, verlässlich. Romain hat mir erzählt, dass er jeden Sonntagnachmittag mit Lebensmitteln für die Woche auftauchte, kleinen Geschenken. So war es ein paar Jahre lang gegangen, bis er Liliane traf. Sie hatten geheiratet und dieses Hotel gekauft, weit weg von Hélène. Aber Jacky hatte den Kontakt zu Romain und Annabelle, die inzwischen große Teenager waren, immer aufrechterhalten. Als hätte Jacky sich erst erlaubt zu gehen, als sie alt genug waren. Oder als hätte er selbst diese Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass Hélène ihn nie so lieben würde, wie er es sich gewünscht hätte.
Wenn wir hier oben waren, stand M. früh auf, um schwimmen zu gehen.
Der See ist nicht, wie der untere, nur eine einfache Senke. Er ist fünfzig Meter tief und kegelförmig. Die Legende besagt, dass die Tränen des Teufels ihn so geformt haben. Romain hat mir diese Geschichte erzählt, als ich das erste Mal mit ihm hier war. Er hat gewartet, bis es Nacht wurde. Es war kalt, wir hatten uns, in eine Decke gekuschelt, ans Ufer gesetzt, die Füße im Wasser. Wir teilten uns einen Joint. Romain hatte sich hinter mich gesetzt, seine Beine um mich geschlungen, mit der Hand, die nicht den Joint hielt, streichelte er meine Brüste. Er trug eine dünne Hose und ich konnte seine Erektion an meinem unteren Rücken spüren. Seine Freunde übernachteten unten bei Jacky, im Seehotel, im Schlafsaal unter dem Dach. Das kleine Chalet war für uns reserviert, die frisch Vermählten.
Der Joint knisterte ein paar Zentimeter von meinem Ohr entfernt.
»Es wird erzählt, dass der Teufel eine Tochter hatte. Eine schreckliche und schöne Kreatur, halb Frau, halb Ziege. Wie der Teufel stand sie aufrecht auf ihren Hinterbeinen, ihr Oberkörper und ihre Brüste waren nackt, ihr Haar struppig, ihre Augen schwarz. Sie lebte glücklich hier in diesen Bergen. In dieser Zeit lebten die Menschen friedlich, der Teufel quälte niemanden, erfüllt von der Liebe zu seiner Tochter. Er hatte sie gewarnt: ›Du kannst in diesen Bergen überall hingehen, dich mit dem Murmeltier, dem Steinbock, dem Raben, dem Luchs anfreunden. Aber du darfst nie in die Nähe der Menschen gehen.‹ Die Kleine wuchs dort oben auf dem Gletscher auf, sie kannte jeden Fels, sprach die Sprache der Blumen und Insekten, schwamm mit den Ottern, hatte gelernt, sich zu verstecken. Eines Tages jedoch erblickte sie einen Hirten und verliebte sich. Sie beobachtete ihn mehrere Wochen lang aus der Ferne, verborgen hinter einem Felsen. Schließlich wagte sie das Verbotene. Eines Morgens, als der junge Mann in der Sonne saß und über seine Herde wachte, ging sie lautlos auf ihn zu, aufgerichtet auf ihren Hinterbeinen …«
»Und der Hund des Hirten hat sie gefressen!«
»Nein.«
»Er hat das Dorf zusammengetrommelt, sie haben sie mit Fackeln und Mistgabeln über alle Berge gejagt und verbrannt?«
»Oh, du bist blöd, nein. Er hat sie abgewiesen und sie hat sich umgebracht. Also, der Teufel setzte sich auf diesen Felsen hier und weinte viele Tage lang, bis dieser See entstanden war.«
Er hatte aufgehört, meine Brüste zu streicheln, seine Erektion war verschwunden.
Ich sehe vor mir, wie Romain und ich da am Seeufer sitzen, als wären die achtzehn Jahre, die seit dieser Szene vergangen sind, so durchlässig geworden wie Dunst.
Das dunkle Wasser ist von einem Strand aus hellen, aschgrauen Kieseln gesäumt, drum herum die Zacken der Berge, die den Himmel zerreißen. Gestern fand ich das schön, majestätisch, poetisch, was immer Sie wollen. Heute erscheinen sie mir bedrohlich, finster, von einer bösen Macht beseelt.