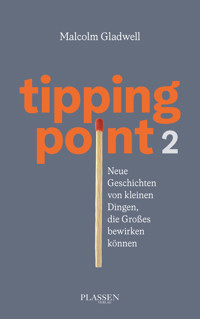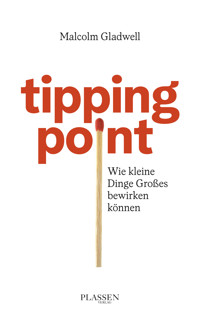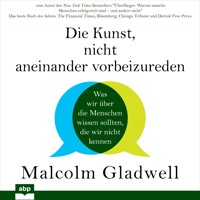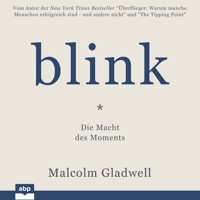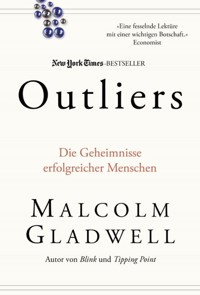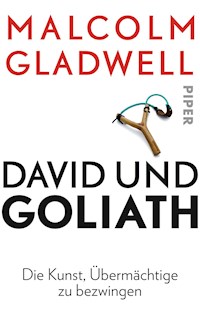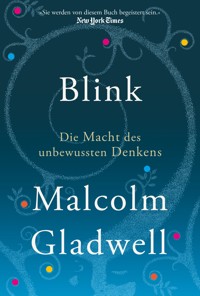
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Ein Kunstexperte sieht eine 10 Millionen Dollar teure Skulptur und erkennt sofort, dass sie eine Fälschung ist. Ein Psychologe weiß innerhalb von Minuten, ob ein Paar zusammenbleiben wird. Ein Feuerwehrmann in einem brennenden Gebäude »spürt« plötzlich, dass er sofort raus muss. In diesem Buch geht es um diese Momente, in denen wir etwas »wissen«, ohne zu wissen, warum. Der Bestsellerautor Malcolm Gladwell erforscht das Phänomen dieser »Blink«-Momente und zeigt, dass ein schnelles Urteil oft weitaus effektiver sein kann als eine vorsichtige Entscheidung. Wenn Sie Ihrem Instinkt vertrauen, so zeigt er, werden Sie nie wieder auf dieselbe Art und Weise denken. Denn wie wir denken, ohne zu denken, erklärt, warum manche Menschen brillante Entscheider sind, während andere nahezu immer danebenliegen. »Blink« veranschaulicht, dass die besten Entscheider nicht diejenigen sind, die am meisten Informationen verarbeiten oder die längste Zeit mit Überlegungen verbringen, sondern diejenigen, welche die Kunst des »thin-slicing« perfektioniert haben – das Herausfiltern der wenigen Faktoren, die wirklich wichtig sind, aus einer überwältigenden Anzahl von Variablen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Malcolm Gladwell
Blink
Malcolm Gladwell
Blink
Die Macht des unbewussten Denkens
Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
1. Auflage 2024
© 2024 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
© an der deutschen Übersetzung: Campus Verlag GmbH, Frankfurt am Main / New York
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Die englische Originalausgabe erschien 2005 bei Little, Brown and Company unter dem Titel Blink. © 2005 by Malcolm Gladwell. Nachwort © 2007 by Malcolm Gladwell. All rights reserved.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Jürgen Neubauer
Korrektorat: Rainer Weber
Umschlaggestaltung: Sabrina Pronold
Umschlagabbildung: Kai and Sunny
Fotografien in Kapitel 3: Brooke Williams
Satz: ZeroSoft, Timisoara
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-727-3
ISBN E-Book (PDF) 978-3-98609-410-2
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-411-9
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.
Inhalt
Einleitung: Eine rätselhafte Statue
Kapitel 1: Die Theorie der dünnen Scheibchen
Warum wir mit wenig Wissen weit kommen
Kapitel 2: Hinter verschlossenen Türen
Das geheime Leben unserer Intuition
Kapitel 3: Die Warren-Harding-Falle
Wie wir vorschnelle Urteile vermeiden können
Kapitel 4: Paul Van Ripers großer Sieg
Wie wir Spontaneität gezielt einsetzen können
Kapitel 5: Kennas Dilemma
Wie wir herausfinden, was Menschen wollen – und wie nicht
Kapitel 6: Sieben Sekunden in der Bronx
Wie wir die schwere Kunst des Gedankenlesens lernen können
Schluss: Mit den Augen hören
Was wir von Blink lernen können
Nachwort: Die Lektion von Chancellorsville
Anmerkungen
Dank
Für meine Eltern Joyce und Graham Gladwell
Einleitung
Eine rätselhafte Statue
Im September des Jahres 1983 kam ein Kunsthändler namens Gianfranco Becchina auf das J.-Paul-Getty-Museum in Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien zu. In seinem Besitz befinde sich eine Marmorstatue aus dem sechsten vorchristlichen Jahrhundert, die er dem Museum zum Kauf anbieten wolle. Genauer gesagt handle es sich um einen Kouros, die monumentale Statue eines nackten Jünglings, der das linke Bein leicht vorstreckt und dessen Arme gerade an der Seite des Körpers herunterhängen.
Auf der ganzen Welt gibt es heute nur rund 200 dieser Kouroi, die meisten davon sind stark beschädigt, zum Teil wurden an den Ausgrabungsstätten und auf antiken Friedhöfen sogar nur Bruchstücke gefunden. Der Kouros, den Gianfranco Becchina dem Getty-Museum anbot, war dagegen fast perfekt erhalten. Er war gut 2,10 Meter hoch und schimmerte in einem hellen Marmorton, durch den er sich von übrigen antiken Statuen abhob. Es war ein außerordentlicher Fund, für den Becchina rund 10 Millionen US-Dollar verlangte.
Das Getty-Museum überstürzte nichts. Wie in solchen Fällen üblich, nahm es das Kunstwerk zunächst als Leihgabe auf und ließ es gründlichst von Experten untersuchen. Die erste Frage war, ob diese Statue Ähnlichkeiten mit den anderen bekannten Kouroi aufwies. Die Antwort lautete ja: Es konnten gewisse stilistische Gemeinsamkeiten mit dem Kouros von Anavyssos festgestellt werden, der im Nationalen Archäologischen Museum in Athen ausgestellt ist. Alles schien darauf hinzuweisen, dass er aus etwa derselben Zeit und derselben Region stammte. Natürlich wollten die Experten von dem Kunsthändler wissen, wo und wann diese Statue ausgegraben worden war. Darauf konnte Becchina zwar keine Antwort geben, dafür legte er dem Museum einen Aktenordner mit Dokumenten vor, mit denen er eine lückenlose Reihe von Vorbesitzern aus jüngerer Zeit nachwies. Aus diesen Papieren ging hervor, dass sich der Kouros seit den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts im Privatbesitz eines Schweizer Arztes namens Lauffenberger befunden hatte, der ihn wiederum von einem bekannten griechischen Kunsthändler namens Roussos erworben hatte.
Das Museum zog mit Stanley Margolis einen Geologen der Universität Kalifornien zurate. Dieser brachte zwei Tage damit zu, die Oberfläche der Statue mit einem hochauflösenden Stereomikroskop zu untersuchen. Außerdem entnahm er unterhalb des rechten Knies des Jünglings eine Gesteinsprobe von einem Zentimeter Durchmesser und zwei Zentimetern Länge und analysierte sie im Labor der Universität mittels Elektronenmikroskop, Elektronenstrahl-Mikroprobe, Massenspektrografie, Röntgendiffraktions- und Röntgenfloureszenzuntersuchungen. Margolis kam zu dem Schluss, dass es sich bei dem Material um Dolomit-Marmor aus dem antiken Bergwerk auf der Insel Thasos in der nördlichen Ägäis handelte. Die Oberfläche der Statue war mit einer feinen Kalzitschicht überzogen, was nach Auskunft von Margolis sehr bedeutsam sei für die Einschätzung des Alters, denn Marmor verwandle sich erst im Laufe von Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden in Kalzit. Das bedeutet, dass diese Statue einen langen Alterungsprozess durchgemacht haben musste, was wiederum hieß, dass es sich unmöglich um eine zeitgenössische Fälschung handeln konnte.
Das J.-Paul-Getty-Museum vernahm diese Ergebnisse mit Genugtuung. Vierzehn Monate nachdem Gianfranco Becchina zum ersten Mal im Museum vorstellig geworden war, wurde man handelseinig. Im Herbst 1986 stellte das Museum die Statue erstmals aus, und die New York Times widmete dem Ereignis einen Artikel auf ihrer Titelseite. Einige Monate später veröffentlichte Marion True, die Kuratorin der Abteilung für Antike Kunst des Getty-Museums, einen langen und begeisterten Artikel über die Neuanschaffung in der Kunstzeitschrift Burlington Magazine. »Aufrecht stehend und ohne äußere Stütze, die geschlossenen Hände fest an die Lenden gepresst, bringt der Kouros jene selbstsichere Vitalität zum Ausdruck, die auch den besten seiner Brüder zu eigen ist.« Sie schloss triumphierend: »Ob Gott oder Mensch – in ihm verwirklicht sich die ganze strahlende Kraft der noch jugendlichen Kunst des Abendlandes.«
Leider hatte der Kouros des Getty-Museums einen kleinen Schönheitsfehler: Mit seinem Aussehen stimmte etwas nicht. Der Erste, der darauf hinwies, war ein italienischer Kunsthistoriker namens Federico Zeri, der damals im Beirat des Getty-Museums saß. Als Zeri im Dezember 1983 in die Werkstatt des Museums geführt wurde, um den Kouros zu besichtigen, starrte er lange die Fingernägel der Statue an. Irgendetwas störte ihn, ohne dass er genau hätte sagen können, was.
Evelyn Harrison, eine der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der griechischen Plastik, war die Nächste, die Zweifel an der Echtheit der Statue vorbrachte. Sie stattete dem Getty-Museum einen Besuch ab, kurz bevor der Handel mit Becchina abgeschlossen wurde. »Arthur Houghton, der damals Kurator des Museums war, führte uns in die Werkstatt«, erinnert sie sich.
»Er zog das Tuch weg, mit dem die Statue verhüllt war, und sagte: ›Noch gehört er uns zwar nicht, aber in ein paar Wochen ist es endlich so weit.‹ Worauf ich erwiderte: ›Es tut mir leid, das zu hören.‹« Was hatte Harrison gesehen? Sie konnte es nicht genau sagen. Aber in dem Moment, in dem Houghton die Statue enthüllte, hatte sie eine Ahnung, ein instinktives Gefühl, dass mit dem Jüngling irgendetwas nicht in Ordnung war.
Ein paar Monate später führte Arthur Houghton den früheren Direktor des Metropolitan Museum of Art in New York, Thomas Hoving, in die Restaurationswerkstatt, um einen Blick auf die Statue zu werfen. Hoving hat die Angewohnheit, sich immer das erste Wort zu merken, das ihm durch den Kopf geht, wenn er etwas Neues sieht. Er werde nie vergessen, was er beim Anblick des Kouros gedacht habe, erzählte er. »Er war ›frisch‹ – ›frisch‹,« erinnert er sich. Und ›frisch‹ ist normalerweise nicht gerade das erste Wort, das einem beim Anblick einer zweieinhalbtausend Jahre alten Statue einfallen sollte. Als er sich später an diesen Moment zurückerinnerte, wusste er plötzlich auch, warum er diesen Gedanken gehabt hatte: »Bei meinen Ausgrabungen in Sizilien haben wir einige Bruchstücke dieser Dinger gefunden. Die sehen einfach anders aus, wenn sie aus der Erde kommen. Der Getty-Kouros sah aus wie aus dem Ei gepellt.«
Nach einem kurzen Blick auf die Statue wandte Hoving sich um und fragte Houghton: »Habt ihr den schon bezahlt?«
Hoving erinnert sich, dass Houghton ihn verwundert angesehen habe.
»Wenn ja, dann seht zu, dass ihr euer Geld wiederbekommt«, habe Hoving zu dem Kurator gesagt. »Und wenn nicht, dann lasst die Finger davon.«
Im Getty-Museum begann man allmählich, sich Gedanken über die Echtheit der Neuerwerbung zu machen. Also berief man eine internationale Konferenz in Griechenland ein. Die Statue wurde sorgfältig verpackt, nach Athen verfrachtet und dort den wichtigsten Skulpturexperten des Landes vorgeführt. Diesmal war der Chor der ernüchternden Stimmen noch lauter.
Evelyn Harrison erzählt, sie habe während der Vorstellung neben George Despinis, dem Leiter des Akropolis-Museums in Athen gestanden. Dieser habe einen Blick auf den Kouros geworfen und sei bleich geworden. Zu ihr habe er gesagt: »Wer je dabei war, wenn eine Statue aus der Erde kommt, der erkennt doch auf den ersten Blick, dass dieses Ding nie einen Krümel Erde gesehen hat.« Auch Georgios Dontas, Leiter der Archäologischen Gesellschaft in Athen, sah die Statue und verspürte sofort ein Frösteln am ganzen Körper. Im Symposium sagte er später: »Als ich den Kouros zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich das Gefühl, uns würde eine unsichtbare Wand trennen.« Nach ihm sprach Angelos Delivorrias, Direktor des Benaki-Museums in Athen. Er führte lang und breit aus, dass eine Plastik dieses Stils unmöglich mit Marmor aus Thasos habe hergestellt werden können. Aber der Grund, weshalb er überhaupt auf diese Argumentationslinie verfiel, war ein ganz anderer. Beim Anblick des Jünglings habe er sofort ein Gefühl »intuitiver Abneigung« empfunden. Am Ende des Symposiums waren sich viele Teilnehmer einig, dass der Kouros nicht das war, was er zu sein vorgab.
Die Anwälte und Wissenschaftler des Getty-Museums waren nach monatelanger Arbeit zu einem Ergebnis gelangt, und die weltweit führenden Experten auf dem Gebiet antiker griechischer Kunst nach einem kurzen Blick und einem Gefühl »intuitiver Abneigung« zu einem anderen. Wer hatte recht?
Eine Zeit lang war die Lage unklar. Der Kouros schien eines jener zahlreichen strittigen Kunstobjekte zu werden, über dessen Echtheit sich Experten auf alljährlichen Konferenzen die Köpfe heißreden. Dann aber lösten sich die Belege des Getty-Museums nach und nach in Luft auf. Die Briefe, mit deren Hilfe die Anwälte des Museums die Statue zu dem Schweizer Arzt Lauffenberger zurückverfolgt hatten, stellten sich als Fälschungen heraus. Einer davon, der auf das Jahr 1952 datiert war, trug eine Postleitzahl, die erst mit einer Postreform 20 Jahre später eingeführt wurde. In einem weiteren Schreiben, das vorgeblich aus dem Jahr 1955 stammte, wurde ein Bankkonto erwähnt, das erst im Jahr 1963 eröffnet wurde. Auch die kunsthistorische Argumentation begann, zu Staub zu zerfallen. Nach monatelangen Untersuchungen waren die Experten des Museums zu dem Schluss gekommen, dass die Statue stilistische Ähnlichkeiten mit dem Kouros von Anavyssos aufwies. Doch je genauer die Kunsthistoriker sich die Plastik ansahen, desto mehr erschien sie ihnen wie eine kuriose Mixtur aus allen möglichen Stilen der verschiedensten Zeiten und Regionen. Mit seiner schlanken Gestalt ähnelte er dem Kouros von Tenea, der in der Glyptothek in München zu sehen ist; sein stilisiertes, geflochtenes Haar erinnerte an die Frisur der Jünglingsstatue im Metropolitan Museum in New York; die Füße dagegen sahen aus wie die einer modernen Plastik. Am meisten ähnelte der Getty-Kouros allerdings einer kleineren, bruchstückhaft erhaltenen Figur, die ein britischer Kunsthistoriker 1990 in der Schweiz entdeckt hatte. Die beiden waren aus demselben Marmor und in ganz ähnlicher Weise gearbeitet. Der Schweizer Kouros stammte jedoch nicht aus dem Griechenland des sechsten vorchristlichen Jahrhunderts, sondern aus einer Fälscherwerkstatt aus dem Rom der achtziger Jahre. Aber was war mit der Aussage des Geologen Stanley Margolis, die Kalzitschicht auf der Oberfläche des Getty-Kouros weise auf ein Alter von Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren hin? Es stellte sich heraus, dass auch dies noch nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen war. Ein anderer Geologe fand nämlich nach weiteren Untersuchungen heraus, dass es durchaus möglich ist, die Oberfläche des Marmors mithilfe eines Kartoffelschimmels innerhalb weniger Monate künstlich altern zu lassen. Im Katalog des Getty-Museums findet sich bis heute ein Foto des Kouros mit der Bildunterschrift »Cirka 530 vor Christus oder moderne Fälschung.«
Es stellt sich also heraus, dass Federico Zeri, Evelyn Harrison, Thomas Hoving, Georgios Dontas und die zahlreichen anderen Experten recht hatten, als sie bei der Betrachtung des Kouros eine »intuitive Abneigung« empfunden hatten. Auf den ersten Blick, innerhalb von zwei Sekunden, wussten sie mehr über das Wesen der Statue als ein Team des Getty-Museums nach vierzehnmonatigen Untersuchungen.
In Blink! geht es um diese ersten beiden Sekunden.
Schnell und einfach
Stellen Sie sich vor, Sie nehmen an einem ganz einfachen Glücksspiel teil. Vor Ihnen liegen vier Stapel mit Spielkarten, zwei rote und zwei blaue. Mit jeder Karte können Sie entweder eine bestimmte Summe Geld gewinnen oder verlieren. Sie sollen nun Karten von Stapeln Ihrer Wahl umdrehen und versuchen, den größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Was Sie jedoch nicht wissen: Die roten Karten sind ein Wespennest. Die Gewinne sind zwar hoch, doch wenn Sie verlieren, dann büßen Sie auf einen Schlag eine große Summe ein. Langfristig können Sie nur Erfolg haben, wenn Sie Karten von den blauen Stapeln nehmen, wo sich die Gewinne zwar vergleichsweise bescheiden ausnehmen, wo sich aber vor allem die Verluste in Grenzen halten. Die Frage ist: Wie viel Zeit werden Sie benötigen, um das herauszufinden?
Dieses Experiment wurde von einer Gruppe von Wissenschaftlern der Universität Iowa durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass es den meisten von uns nach rund 50 Karten zu dämmern beginnt, wie der Hase läuft. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir zwar noch nicht genau, warum wir die blauen Karten bevorzugen, aber wir haben eine unbestimmte Ahnung, dass wir mit diesen beiden Stapeln besser fahren. Nach 80 Karten haben wir das Spiel durchschaut und können erklären, warum wir besser die Finger von den roten Stapeln lassen. So weit, so gut. Wir haben Erfahrungen gesammelt, wir haben eine Theorie entwickelt und schließlich zählen wir eins und eins zusammen. Im Grunde läuft jeder Lernprozess so oder so ähnlich ab.
Doch die Wissenschaftler der Universität Iowa beließen es nicht dabei, und nun beginnt das Experiment interessant zu werden. Sie schlossen nämlich jede der Testpersonen an einen Apparat an, mit dessen Hilfe sie die Schweißbildung an den Handflächen messen konnten. Wie die meisten unserer Schweißdrüsen reagieren auch die der Handfläche nicht nur auf die Außentemperatur, sondern auch auf Stress und psychische Belastung – aus diesem Grund bekommen wir feuchte Hände, wenn wir nervös sind. Mithilfe ihrer Messungen fanden die Wissenschaftler heraus, dass die Testpersonen bereits bei der zehnten Karte begannen, Stresssymptome zu zeigen – 40 Karten bevor es ihnen dämmerte, dass etwas mit den roten Karten nicht stimmte. Noch wichtiger ist, dass sich zu diesem Zeitpunkt auch bereits das Verhalten der Spieler änderte: Sie begannen, die blauen Stapel zu favorisieren und immer weniger Karten von den roten zu nehmen. Mit anderen Worten, die Testpersonen hatten das Spiel verstanden, lange bevor ihnen klar wurde, dass sie es verstanden hatten: Unbewusst hatten sie ihr Verhalten verändert, bevor sie sich auf einer bewussten Ebene klar gemacht hatten, wie sie sich verhalten sollten.
Natürlich handelt es sich bei diesem Experiment nur um ein einfaches Kartenspiel mit einer Hand voll Testpersonen und einem Apparat, der die Aktivität von Schweißdrüsen misst. Trotzdem zeigt es uns eindrucksvoll, wie unser Gehirn arbeitet. Es handelt sich um eine Situation, in der einiges auf dem Spiel steht, schnelles Handeln gefragt ist und die Teilnehmer innerhalb kurzer Zeit eine Menge neuer und verwirrender Informationen verarbeiten müssen. Aus diesem Experiment können wir lernen, dass unser Gehirn zwei verschiedene Strategien verfolgt, um eine Situation zu verstehen. Die erste kennen wir sehr gut: Es ist die bewusste Strategie. Wir denken über unsere Erfahrung nach und kommen schließlich zu einem Ergebnis. Diese Strategie verfährt logisch und zielgerichtet. Wir benötigen allerdings 80 Karten, um an diesen Punkt zu gelangen. Es gibt jedoch noch eine zweite Strategie, die die Lage sehr viel schneller erfasst. Sie ist intelligenter als die erste, denn mit ihrer Hilfe versteht man fast augenblicklich, dass die roten Karten problematisch sind, und sie zeigt bereits nach zehn Karten Wirkung. Der Nachteil dieser Strategie ist, dass sie zumindest anfangs vollständig unter der Oberfläche unseres Bewusstseins, nämlich im Unbewussten operiert. Das Unbewusste schickt seine Botschaften durch undurchsichtige Kanäle und wirkt indirekt, zum Beispiel auf die Schweißdrüsen der Handflächen. Auf diese Weise kommt unser Gehirn zu bestimmten Schlüssen, ohne uns direkt darüber zu informieren, dass es gerade dabei ist, Schlüsse zu ziehen, oder gar, welche das sind.
Diese zweite Strategie ist diejenige, die Evelyn Harrison, Thomas Hoving und die griechischen Experten anwendeten. Sie wogen nicht die verschiedensten Beweise und Gegenbeweise gegeneinander ab. Stattdessen bezogen sie nur das ein, was sie auf einen Blick wahrnehmen konnten. Diese Denkweise beschreibt Gerd Gigerenzer, Kognitionspsychologe und Leiter des Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, als »schnell und einfach«. Sie warfen einfach einen kurzen Blick auf die Statue, und irgendwo in ihrem Gehirn lief augenblicklich eine Reihe von Prozessen ab. Noch bevor sie einen bewussten Gedanken formuliert hatten, spürten sie etwas, ähnlich wie die Testpersonen, die plötzlich feuchte Hände bekamen. Im Falle von Thomas Hoving war es das unpassende Wort »frisch«, das ihm plötzlich in den Sinn kam. Im Falle von Angelos Delivorrias äußerte es sich als ein Gefühl »intuitiver Abneigung«. Georgios Dontas schließlich spürte eine unsichtbare Wand zwischen sich und dem angeblichen Kouros. Sie wussten nicht, warum sie es wussten. Aber sie wussten es.
Der innere Computer
Der Teil unseres Gehirns, der diese schnellen und einfachen Schlüsse zieht, nennt sich auch adaptives Unbewusstes, und die Erforschung dieser Entscheidungsprozesse ist eines der wichtigsten Gebiete der modernen Psychologie. Dieses adaptive Unbewusste hat nichts mit dem zu tun, was Sigmund Freud das Unbewusste oder Unterbewusstsein nannte und mit dem er einen mysteriösen und düsteren Ort voller Begierden, Erinnerungen und Fantasien meinte, die uns zu sehr verstören, als dass wir uns auf einer bewussten Ebene mit ihnen auseinandersetzen wollten. Stattdessen können wir uns dieses adaptive Unbewusste als eine Art Supercomputer vorstellen, der schnell und leise all die Unmengen von Daten verarbeitet, die auf uns einströmen und die wir zum Überleben benötigen. Wenn Sie zum Beispiel das Haus verlassen und plötzlich bemerken, dass ein Lastwagen auf Sie zu rast, dann haben Sie keine Zeit, lange darüber nachzudenken, wie Sie wohl am besten reagieren. Der einzige Grund, weshalb die menschliche Spezies so lange überleben konnte, ist, dass wir im Laufe der Evolution einen Entscheidungsapparat entwickelt haben, mit dessen Hilfe wir eine Situation auch mit wenig Informationen schnell einschätzen können. Der Psychologe Timothy D. Wilson beschreibt dies in seinem Buch Strangers to Ourselves so: »Das Gehirn arbeitet hocheffizient, indem es einen großen Teil des komplexen Denkens an das Unbewusste delegiert, so wie ein modernes Linienflugzeug in der Lage ist, mittels Autopilot zu fliegen, mit wenig oder keinem Input von Seiten des menschlichen oder ›bewussten‹ Piloten. Das adaptive Unbewusste versteht es hervorragend, die Umwelt einzuschätzen, Menschen vor Gefahren zu warnen, Ziele zu setzen und Handlungen in intelligenter und effizienter Weise einzuleiten.«
Wilson beschreibt, wie wir je nach Situation zwischen dem bewussten und dem unbewussten Denken hin- und herschalten. Wenn Sie sich entscheiden, eine Kollegin oder einen Kollegen zum Abendessen einzuladen, dann findet diese Entscheidung auf der bewussten Ebene statt. Sie denken darüber nach, stellen sich vor, dass es ein schöner Abend werden könnte, und laden ihn oder sie ein. Die spontane Entscheidung, mit demselben Kollegen einen Streit vom Zaun zu brechen, wird allerdings unbewusst getroffen, von einem anderen Teil des Gehirns und von einem anderen Teil Ihrer Persönlichkeit.
Jedes Mal wenn wir einen neuen Menschen kennenlernen, wenn wir einen Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch treffen, wenn wir mit einem neuen Vorschlag konfrontiert werden oder wenn wir rasch und unter Druck eine Entscheidung fällen müssen, dann benutzen wir diesen anderen Teil unseres Gehirns. Wie lange haben Sie beispielsweise an der Universität oder in der Schule gebraucht, um festzustellen, ob ein neuer Professor oder Lehrer etwas taugt oder nicht? Eine Unterrichtsstunde? Zwei? Ein Semester lang? Die Psychologin Nalini Ambady von der Universität Harvard machte ein Experiment mit Studenten, in dem sie ihnen drei Videoclips eines Professors vorspielte, jeweils zehn Sekunden lang und ohne Ton. Die Studenten konnten problemlos ein Urteil über die Effizienz dieses Professors abgeben. Ambady verkürzte die Clips auf fünf Sekunden, und die Ergebnisse blieben dieselben. Auch als Ambady die Videosequenzen auf zwei Sekunden verkürzte, ergaben sich noch weitgehend dieselben Antworten. Dann verglich Ambady diese Spontanentscheidungen mit den Evaluationsbögen, die Studenten am Ende eines Semesters ausgefüllt hatten, und stellte fest, dass die Bewertungen nahezu übereinstimmten. Das heißt, eine Person, die eine zwei Sekunden lange Videosequenz eines Professors sieht, den er oder sie nie kennengelernt hat, kommt zu denselben Schlüssen wie Studenten, die ein Semester lang Gelegenheit hatten, die Qualität des Unterrichts zu beurteilen. So viel leistet unser adaptives Unbewusstes.
Ob Sie es bemerkt haben oder nicht: Auch Sie haben diesen Prozess in Gang gesetzt, als Sie dieses Buch im Laden in die Hand genommen haben. Wie lange haben Sie sich dafür Zeit genommen? Zwei Sekunden? Doch diese kurze Zeit hat völlig ausgereicht, damit das Cover, Ihre Assoziationen mit dem Titel und meinem Namen und vielleicht noch die ersten Sätze über den Kouros einen Eindruck bei Ihnen hinterlassen haben. Und diese rasche Folge von Gedanken, Bildern und Erwartungen hat großen Einfluss darauf, wie Sie dieses Einleitungskapitel bisher wahrgenommen haben. Würde es Sie nicht brennend interessieren, was in diesen beiden Sekunden passiert ist?
Ich nehme an, die meisten von uns betrachten diese Spontanurteile mit einem gewissen Argwohn. Wir haben gelernt, dass die Qualität einer Entscheidung direkt damit zusammenhängt, wie viel Zeit wir darauf verwenden. Wenn Ärzte eine schwierige Diagnose stellen müssen, dann führen sie zusätzliche Untersuchungen durch, und wenn wir unsererseits unsicher sind, ob die Diagnose auch stimmt, dann holen wir eine zweite Meinung ein. Unseren Kindern bläuen wir dasselbe ein: Eile mit Weile. Erst denken, dann handeln. Der Schein trügt. Wir glauben, dass wir gut beraten sind, so viel Information wie möglich zusammenzutragen und so lange wie möglich über eine Entscheidung nachzudenken. Wir vertrauen nur unseren bewussten Urteilen. Doch es gibt Momente, besonders wenn wir unter Druck stehen, in denen wir ohne Weile eilen und in denen unsere Spontanurteile und ersten Eindrücke uns sehr viel besser helfen, unsere Umwelt zu verstehen. Deshalb wird es das erste Anliegen dieses Buches sein, Sie von dieser einfachen Tatsache zu überzeugen: Entscheidungen können sehr schnell gefällt werden und sind deshalb keinen Deut schlechter als Entscheidungen, die am Ende eines langen Für und Wider stehen.
Es geht mir jedoch nicht allein darum, Ihnen zu zeigen, wie effektiv der erste Blick sein kann. Genauso interessieren mich die Momente, in denen unser Instinkt sich irrt. Wie konnte es beispielsweise passieren, dass sich das Getty-Museum auf den Kauf des Kouros einließ, wenn doch so offensichtlich etwas nicht mit ihm stimmte? Warum hatten die Experten des Museums während ihrer vierzehnmonatigen Untersuchung der Plastik nicht dasselbe Gefühl der intuitiven Ablehnung wie die externen Kunsthistoriker? Diese Frage haben sich natürlich viele gestellt. Die Antwort ist, dass diese Gefühle des Misstrauens aus dem einen oder anderen Grund unterdrückt wurden. Zum einen schien der wissenschaftliche Nachweis absolut hieb- und stichfest – der Geologe Stanley Margolis war selbst derart überzeugt von seiner Analyse, dass er seine Methode in einem langen Artikel im Scientific American darstellte. Aber der Hauptgrund war vermutlich, dass die Mitarbeiter des Getty-Museums einfach wollten, dass die Statue echt war. Es handelt sich um ein relatives junges Museum, das sich möglichst schnell eine Sammlung von Weltrang aufbauen will, und der Kouros schien eine so außergewöhnlich gute Gelegenheit, dass die Begeisterung alles andere überlagerte.
Der Kunsthistoriker George Ortiz erhielt einmal von Ernst Langlotz, einem der weltweit erfahrensten Experten in antiker Kunst, eine kleine Bronzestatue zum Kauf angeboten. Ortiz sah sich das Objekt an und zuckte zusammen: Er erkannte es auf den ersten Blick als schlechte Fälschung. Die Widersprüche und Fehler schienen ihm so offensichtlich, dass sie nur ein Amateur übersehen konnte. Wie konnte es sein, dass ein Mann wie Langlotz, der vielleicht mehr über antike Kunst wusste als irgendjemand sonst, auf dieses billige Imitat hereingefallen war? Ortiz konnte es sich nur so erklären, dass Langlotz die Figur in jungen Jahren gekauft hatte, ehe er sein Expertenwissen erworben hatte. »Ich nehme an, dass Langlotz sich in das Stück verliebt hatte. Wenn man jung ist, verliebt man sich in seinen ersten großen Kauf, und vielleicht war diese Figur seine erste große Liebe. Trotz seines unglaublichen Wissens war er offenbar nicht in der Lage, seine erste Einschätzung zu hinterfragen.«
Diese Erklärung ist gar nicht so weit hergeholt. Sie verrät uns etwas Grundlegendes über unsere Denkprozesse. Unser Unbewusstes ist eine mächtige Instanz – aber es kann sich auch irren. Unser innerer Computer erkennt nicht automatisch die Wahrheit. Er kann auf dem falschen Fuß erwischt oder abgelenkt werden. Unsere intuitiven Reaktionen stehen oft in Widerspruch zu allen möglichen anderen Interessen, Wünschen oder Gefühlen. Wann also sollten wir unseren Instinkten vertrauen, und wann sollten wir uns vor ihnen in Acht nehmen? Die Antwort auf diese Frage ist das zweite große Anliegen von Blink. Wenn unsere Spontanentscheidungen in die falsche Richtung gehen, dann tun sie das aus ganz bestimmten und immer wiederkehrenden Gründen, und diese Gründe können wir erkennen und verstehen. Wir können lernen, wann wir unseren Instinkten vertrauen dürfen, und wann es nötig ist, auf der Hut zu sein.
Das dritte und wichtigste Anliegen dieses Buches ist es, Sie zu überzeugen, dass Sie Ihre Spontanurteile und ersten Eindrücke verfeinern und für sich nutzen können. Vielleicht erscheint Ihnen das jetzt als ein Widerspruch. Harrison, Hoving und die anderen Kunstexperten haben in äußerst komplexer Weise auf den Getty-Kouros reagiert – aber sind ihre Ansichten nicht einfach ungebeten aus dem Unbewussten heraufgestiegen? Wie sollten wir in der Lage sein, diese mysteriösen Vorgänge in den Griff zu bekommen? Aber wir können es tatsächlich. So wie wir gelernt haben, logisch und zielgerichtet zu denken, können wir auch lernen, bessere Spontanurteile zu fällen. In diesem Buch werden Ihnen Ärzte, Generäle, Trainer, Designer, Musiker, Schauspieler, Verkäufer und zahllose andere Menschen begegnen, die allesamt Experten auf ihrem Gebiet sind und die ihren Erfolg zu einem guten Teil ihrer Fähigkeit verdanken, unbewusste Reaktionen verfeinert und für sich nutzbar gemacht zu haben. Die Fähigkeit, etwas innerhalb der ersten beiden Sekunden zu erkennen, ist keine magische Gabe einer Handvoll Auserwählter. Es ist eine Fähigkeit, die wir alle erlernen können.
Eine neue und bessere Welt
Viele Bücher nehmen sich große Themen vor und analysieren die Welt aus der Vogelperspektive. Dies ist keines davon. In Blink geht es um die allerkleinsten Bausteine unseres Alltagslebens: Es geht um unsere ersten Eindrücke und spontanen Reaktionen bei Begegnungen mit neuen Menschen, in komplizierten Situationen oder wenn wir unter Druck Entscheidungen fällen müssen. Und es geht darum, wie diese Eindrücke zustande kommen. Wenn wir versuchen, uns selbst und unsere Welt zu verstehen, dann achten wir zu oft auf die sogenannten großen Themen und zu selten auf die Details des flüchtigen Augenblicks. Wie wäre es, wenn wir zur Abwechslung einmal nicht den Horizont absuchen, sondern das Fernglas zur Seite legen und stattdessen ein Mikroskop auf unsere Entscheidungsprozesse und unser Verhalten richten? Es könnte einen profunden Einfluss haben auf die Auswahl von Mitarbeitern in Unternehmen, die Beratung von Ehepaaren, die Produkte in den Regalen der Supermärkte, die Produktion von Kinofilmen, die Ausbildung von Polizisten, die Kriegsführung und so weiter und so fort. Vielleicht klingt es vermessen, doch all diese kleinen Veränderungen zusammen könnten am Ende vielleicht eine andere und bessere Welt ergeben. Wenn wir uns selbst und unser Verhalten besser verstehen wollen, dann müssen wir uns eingestehen, dass eine Spontanentscheidung genauso gut sein kann wie monatelange rationale Analyse. Dies ist meine Überzeugung, und ich hoffe, dass Sie am Ende des Buches derselben Ansicht sind.
»Ich war immer der Überzeugung, dass wissenschaftliche Analyse objektiver sei als ein ästhetisches Urteil«, sagte die Getty-Kuratorin Marion True, nachdem die Wahrheit über die Herkunft des Kouros ans Licht gekommen war. »Jetzt muss ich feststellen, dass ich mich geirrt habe.«
Kapitel 1
Die Theorie der dünnen Scheibchen
Warum wir mit wenig Wissen weit kommen
Vor einigen Jahren kam ein junges Ehepaar an die Universität Washington, um im Labor des Psychologen John Gottman an einem Test teilzunehmen. Beide waren Ende 20, blond und blauäugig, trugen modisch zerzauste Frisuren und poppige Brillen. Die Mitarbeiter des Labors sagten später, es sei die Art von Paar gewesen, die einem auf Anhieb sympathisch ist: Beide hätten intelligent, attraktiv und aufgeweckt gewirkt, und das auf eine entspannte, selbstironische Art. Wer sich nachher die Videoaufnahmen ansah, die Gottman von den beiden machte, bekam denselben Eindruck. Der Ehemann, den ich hier Bill nennen will, hat einen gewinnenden und ein wenig verspielten Charme, seine Frau Susan einen scharfzüngigen und schlagfertigen Wortwitz.
Die beiden wurden in einen kleinen Raum im zweiten Stock eines unscheinbaren Bürogebäudes geführt, in dem Gottmans Labor untergebracht ist. Auf einer kleinen Bühne setzten sie sich in zwei Metern Abstand zueinander auf Bürostühle. Dann wurden ihnen Elektroden und Sensoren an den Fingern und Ohrläppchen angebracht, um ihre Herzfrequenz, Schweißausschüttung und Hauttemperatur zu messen. Unter jedem der Stühle war ein »Zappelmeter« angebracht, der messen sollte, wie sehr jeder der beiden auf seinem Stuhl hin- und herrutschte. Zwei Kameras, eine für jede der beiden Personen, nahmen alles auf, was sie sagten und taten. 15 Minuten lang waren die beiden allein vor den laufenden Kameras und hatten lediglich die Anweisung, ein Thema zu diskutieren, das sich in ihrer Beziehung zu einem Streitpunkt entwickelt hatte. Für Bill und Susan war es der Hund. Susan mochte ihn, Bill dagegen nicht. 15 Minuten lang diskutierten sie, wie es mit dem Vierbeiner weitergehen sollte.
Zumindest oberflächlich unterscheidet sich das Video dieses Gesprächs zwischen Bill und Susan kaum von den zahllosen Gesprächen, wie sie täglich zwischen zwei Ehepartnern stattfinden. Keiner der beiden wird sonderlich wütend, es gibt keine Szene, keine Zusammenbrüche, keine plötzlichen Erleuchtungen. In gelassenem Tonfall sagt Bill zu Anfang: »Ich bin halt kein Hundefreund.« Dann beschwert er sich ein bisschen, aber über den Hund, nicht über Susan. Sie bringt ihrerseits einige Klagen vor, aber es gibt auch Momente, in denen die beiden schlicht zu vergessen scheinen, dass sie sich eigentlich streiten sollten. Als sie zum Beispiel auf den Geruch des Hundes zu sprechen kommen, nimmt das Gespräch eine beinahe komödiantische Wende, und Bill und Susan lachen sich an.
Susan: Süßer! Sie riecht nicht!
Bill: Hast du heute mal an ihr gerochen?
Susan: Klar habe ich an ihr gerochen. Sie riecht gut. Ich habe sie gestreichelt, und meine Hände haben kein bisschen gerochen. Und sie haben sich auch nicht schmierig angefühlt. Gib’s doch zu, deine Hände haben sich auch nie schmierig angefühlt.
Bill: Doch, Chef.
Susan: Ich hab meinen Hund nie schmierig werden lassen.
Bill: Doch, Chef. Sie ist ein Hund.
Susan: Pass auf, du! Mein Hund ist nicht schmierig.
Bill: Nein, du pass auf!
Susan: Nein, du pass auf! Nenn meinen Hund nicht schmierig, Junge!
Das Liebeslabor
Was meinen Sie: Wie viel können wir über die Ehe von Susan und Bill herausfinden, wenn wir uns dieses fünfzehnminütige Video ansehen, das John Gottman von ihnen aufgezeichnet hat? Können wir daraus Schlüsse ziehen, wie glücklich oder unglücklich ihre Ehe ist? Man sollte meinen, dass uns dieses Hin und Her über ein Haustier kaum etwas über die Beziehung zweier Menschen verrät. Es ist viel zu kurz, werden die meisten sagen, und in einer Ehe geht es doch um viel wichtigere Dinge wie Geld, Sex, die Kinder, die Schwiegereltern oder den Job. An manchen Tagen harmonieren Paare miteinander, an anderen streiten sie sich eben. Es gibt Tage, da wollen sie einander an die Gurgel fahren, und ein paar Wochen später machen sie zusammen Urlaub und fühlen sich wieder wie in den Flitterwochen. Als Außenstehende haben wir das Gefühl, um ein Paar wirklich zu kennen, müssten wir Wochen und Monate mit ihnen verbringen und sie in den verschiedensten Situationen erleben – glücklich, müde, ärgerlich, gereizt, froh, angespannt und so weiter – und nicht nur in dieser relativ entspannten Plauderstimmung, in der sich Bill und Susan über ihren Hund unterhielten. Wir glauben, um uns eine Vorhersage darüber erlauben zu können, ob die Ehe Bestand haben wird oder nicht, müssten wir so viele Informationen aus so vielen unterschiedlichen Lebenssituationen wie möglich zusammentragen.
John Gottman ist jedoch anderer Ansicht. Mit seinen Experimenten hat er bewiesen, dass wir keineswegs viel Zeit mit einem Paar verbringen müssen, um einschätzen zu können, ob die Beziehung eine Zukunft hat oder nicht. In den achtziger Jahren begann er mit seinen Untersuchungen im »Liebeslabor« in der Nähe des Campus der Universität Washington, und seither hat er rund 3000 Ehepaare wie Bill und Susan befragt. Jedes Paar wurde auf Video aufgezeichnet und anschließend mit einer Methode analysiert, die Gottman SPAFF (spezifischer Affekt) nennt. SPAFF ist ein Kodierungssystem mit 20 verschiedenen Kategorien, die jeder möglichen Stimmung eines Ehepaares entsprechen. Ekel hat zum Beispiel die Ziffer 1, Verachtung die 2, Ärger die 7, Verteidigungshaltung die 10, Gejammer die 11, Traurigkeit die 12, Blockadehaltung die 13, ein neutrales Gefühl die 14 und so weiter. Gottman hat seine Mitarbeiter geschult, jede noch so kleine Gefühlsäußerung in der Gestik und Mimik der Testpersonen zu erkennen und jeden scheinbar noch so vieldeutigen Wortwechsel eindeutig zu interpretieren. Während die Mitarbeiter ein Video analysieren, weisen sie jeder der beiden Personen für jede Sekunde eine SPAFF-Ziffer zu. Am Ende eines fünfzehnminütigen Videos stehen 1800 Ziffern, 900 für den Mann, 900 für die Frau. Eine Folge »7, 7, 14, 10, 11, 11« verrät uns zum Beispiel, dass eine der beiden Personen während eines Zeitraums von sechs Sekunden zunächst ärgerlich war, sich kurz neutral gefühlt hat, dann in eine Verteidigungshaltung übergegangen ist und schließlich begonnen hat zu jammern. Zu den Videobildern kommen die Daten der Elektroden und Sensoren, sodass die Auswerter wissen, wann sich die Pulsfrequenz des Ehemanns erhöht hat oder wann die Ehefrau auf ihrem Stuhl herumgerutscht ist. Auch diese Informationen fließen in die Ermittlung der SPAFF-Ziffer ein.
Mit seinen Berechnungen gelang Gottman ein bemerkenswerter Beweis. Nach der Analyse eines sechzigminütigen Gesprächs zwischen Mann und Frau kann er mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob das Paar in 15 Jahren noch verheiratet sein wird oder nicht. Wenn er ein Paar nur 15 Minuten lang beobachtet, dann liegt seine Erfolgsquote immer noch bei 90 Prozent. Und bei dem Versuch, einen neuen Test zu entwickeln, entdeckte Sybil Carrère, eine Kollegin von John Gottman, dass selbst drei Minuten einer solchen Videoaufnahme schon ausreichen, um mit hinreichender Verlässlichkeit vorhersagen zu können, ob ein Ehepaar zusammenbleiben wird oder nicht. Um zu wissen, wie es um eine Ehe bestellt ist, brauchen wir also viel weniger Zeit, als wir uns je hätten träumen lassen.
John Gottman ist nicht besonders groß, er hat eulenhafte Augen, silbergraues Haar und einen gepflegten Bart. Er ist ein sehr charmanter Mann, und wenn er über etwas spricht, was ihn bewegt – und ihn bewegt fast alles –, dann leuchten seine Augen und werden noch größer. Während des Vietnamkriegs verweigerte er den Kriegsdienst, und bis heute umgibt ihn ein gewisses Hippie-Flair, besonders wenn er seine Mao-Mütze aufsetzt. Von Haus aus ist Gottman Psychologe. Nebenbei studierte er jedoch Mathematik am Massachusetts Institute of Technology (MIT), und in seinen Arbeiten spielt die methodische Strenge der Mathematik eine mindestens ebenso große Rolle wie die Psychologie. Als ich Gottman traf, hatte er gerade eine fünfhundertseitige Abhandlung mit dem Titel The Mathematics of Marriage veröffentlicht. Er gab sich große Mühe, mir einen Eindruck von seiner Arbeit zu vermitteln, und kritzelte Formeln und Kurven auf verschiedene Zettel, bis mir schwindlig wurde.
John Gottman scheint nicht so recht in ein Buch zu passen, in dem es um Gedanken und Entscheidungen geht, die aus dem Unbewussten hervorsprudeln. Sein Ansatz hat nichts mit Instinkt und Intuition zu tun. Gottman fällt keine Spontanurteile. Stattdessen sitzt er vor dem Bildschirm seines Rechners und analysiert mit wissenschaftlicher Exaktheit Videoaufzeichnungen, Sekunde für Sekunde. Er scheint die klassische Verkörperung des bewussten und zielgerichteten Denkens zu sein. Trotzdem können wir von Gottman eine Menge über eine Methode der schnellen Entscheidungsfindung lernen. Diese Methode nennt sich »thin-slicing«, wörtlich »in dünne Scheibchen schneiden«, was nichts anderes beschreibt als die Fähigkeit unseres Unbewussten, auf Grundlage extrem dünner Scheibchen von Erfahrungen bestimmte Muster in Situationen und Verhaltensweisen zu entdecken. Als Evelyn Harrison einen Blick auf den Kouros warf und herausplatzte: »Es tut mir leid, das zu hören«, schnitt sie ihre Erfahrung genauso in dünne Scheibchen wie die Testpersonen der Universität Iowa, die beim Gedanken an rote Karten feuchte Hände bekamen.
Dass unser Unbewusstes in der Lage ist, kleinste Einzelmomente aus unseren Erfahrungen herauszupräparieren, macht es so faszinierend. Allerdings ist das auch genau der Punkt, den wir an unseren Spontanurteilen oft als Nachteil empfinden. Wie kann es möglich sein, dass wir innerhalb ganz kurzer Zeit genügend Informationen für ein fundiertes Urteil bekommen? Die Antwort ist einfach: Wenn unser Unbewusstes aus unseren Eindrücken dünne Scheibchen herausschneidet, dann passiert im Grunde nichts anderes als in Gottmans Videoanalysen, nur automatisch, beschleunigt und unbewusst. Können wir einer Paarbeziehung wirklich in nur einer einzigen fünfzehnminütigen Sitzung auf den Grund kommen? Ja das können wir, und nicht nur einer Beziehung, sondern vielen anderen scheinbar komplexen Situationen. Und von John Gottman können wir lernen, wie das geht.
Der Morsecode der Ehe
Ich sah mir die Aufzeichnung von Bill und Susan zusammen mit Amber Tabares an, einer Studentin, die in John Gottmans Labor arbeitet und von ihm gelernt hat, Videos mit dem SPAFF-Code zu analysieren. Wir saßen in demselben Raum, in dem Bill und Susan ihre Unterhaltung geführt hatten, und sahen uns das Band an. Das Gespräch begann mit Bill. Er sagte, er habe ihren alten Hund gut leiden können, aber den neuen möge er nicht. Er machte dabei weder einen ärgerlichen noch einen feindseligen Eindruck, er schien ganz ehrlich seine Gefühle darlegen zu wollen.
Wenn wir aber genau hinhörten, erklärte mir Amber, dann werde deutlich, dass Bill eine Verteidigungshaltung einnehme. In SPAFF-Codes gesprochen beschwerte er sich und verwendete eine »Ja, aber«-Taktik, das heißt, er schien Susan zuzustimmen, nahm jedoch seine Zustimmung im nächsten Moment wieder zurück. Dem Protokoll konnten wir entnehmen, dass Bill 40 der ersten 66 Sekunden lang in dieser Verteidigungshaltung verharrte. Susans Reaktionen in dieser ersten Minute waren ebenfalls sehr aufschlussreich. Während Bill redete, verdrehte sie mehr als einmal die Augen – ein klassisches Zeichen für Verachtung, wie Amber mir erläuterte. Als Bill auf das Hundekörbchen zu sprechen kam, schloss Susan die Augen und antwortete mit herablassender, belehrender Stimme. Und als Bill ausführte, dass er keinen Zaun im Wohnzimmer wolle, antwortete Susan: »Darüber will ich mich nicht mit dir streiten« und verdrehte wieder die Augen. »Schauen Sie genau hin«, sagte Amber. »Wieder ein Zeichen für Verachtung. Das Gespräch hat kaum angefangen, und er war die ganze Zeit in Verteidigungshaltung, und sie hat mehrmals die Augen verdreht.«
Weder Bill noch Susan gaben offene Anzeichen von Feindseligkeit zu erkennen. Es gab jedoch immer wieder subtile Signale, die Amber veranlassten, das Band anzuhalten und mich darauf hinzuweisen. Es gibt Paare, die sich richtig in die Wolle bekommen, wenn sie streiten. Bei Bill und Susan spielte sich vieles unter der Oberfläche ab. Bill beklagte sich, der Hund würde ihr Sozialleben beeinträchtigen, weil sie immer früh nach Hause kommen müssten, aus Angst, der Hund könnte in der Wohnung irgendetwas anstellen. Susan antwortete, das sei gar nicht wahr, und erklärte: »Wenn sie anfängt, an etwas herumzukauen, dann macht sie das eine Viertelstunde, nachdem wir zur Tür raus sind.« Es sah so aus, als würde Bill dem zustimmen. Er sagte »Ja, klar«, doch dann fügte er hinzu: »Ich behaupte ja gar nicht, dass es rational ist. Ich will einfach keinen Hund.«
Amber zeigte auf den Bildschirm. »Er fängt an mit einer Zustimmung, ›ja, klar‹, aber eigentlich ist es ein ›ja, aber‹. Er stimmt ihr zwar zunächst zu, nimmt diese Zustimmung aber im nächsten Moment zurück und sagt, dass er den Hund nicht mag. Er ist die ganze Zeit in Verteidigungshaltung. Ich habe am Anfang gedacht, er ist so ein Netter, er bestätigt sie immer wieder. Bis ich gemerkt habe, dass er eigentlich immer ›ja, aber‹ sagt. Auf so etwas fällt man ziemlich leicht herein.«
Im Video fuhr Bill fort: »Ich werde immer besser, das musst du zugeben. Diese Woche schon besser als letzte und als die Woche davor.«
Erneut hielt Amber das Band an. »In einer Studie haben wir uns frisch vermählte Ehepaare angesehen. Bei Paaren, die sich später scheiden ließen, war es oft so, dass einer der beiden Partner nach Bestätigung suchte und der andere sie ihm nicht gab. Bei den glücklicheren Paaren sagte der andere leichter auch mal: ›Ja, du hast recht.‹ Das fällt auf. Wenn sie nicken und ›aha‹ oder ›ja‹ sagen, dann sind das Zeichen der Zustimmung. Susan macht das nicht ein einziges Mal in der ganzen Aufzeichnung. Das ist uns erst aufgefallen, als wir das Band Sekunde für Sekunde analysiert haben.«
»Es ist merkwürdig«, fuhr Amber fort. »Wenn die beiden zur Tür hereinkommen, hat man nicht das Gefühl, dass es ein unglückliches Paar ist. Und am Ende, als sie sich gemeinsam das Band angeschaut haben, fanden sie es zum Totlachen. Nach außen hin sieht alles wunderbar aus. Aber ich weiß nicht so recht. Sie sind noch nicht so lange verheiratet und sind noch in der Flitterphase. Aber Tatsache ist, dass sie völlig unnachgiebig ist. Sie streiten sich hier nur über einen Hund, aber schon daraus können wir erkennen, dass sie in jeder Auseinandersetzung absolut halsstarrig reagiert. Das ist ein Punkt, der langfristig eine Menge Schaden anrichten kann. Mich würde interessieren, ob sie es schaffen, länger als die magischen sieben Jahre zusammenzubleiben. Ich frage mich, ob die beiden genug an positiven Gefühlen haben. Denn wenn man genau hinschaut, ist alles, was positiv aussieht, plötzlich alles andere als positiv.«
Wonach suchte Amber Tabares im Verhalten dieses Paares? Einerseits und auf einer technischen Ebene vergleicht sie die Anzahl der positiven und der negativen Gefühle, denn nach einer Erkenntnis von John Gottman müssen bei einem Paar, das sich nicht scheiden lässt, die positiven und die negativen Gefühle im Verhältnis von mindestens 5 : 1 stehen. Auf einer anderen Ebene suchte Amber in dieser viertelstündigen Diskussion über den Hund nach einem Muster für die Ehe von Bill und Susan, denn nach einer der wichtigsten Theorien Gottmans hat jede Ehe ein erkennbares Muster, eine Art Ehe-DNS, die in jeder Interaktion zwischen den beiden Partnern zum Ausdruck kommt. Aus diesem Grund bittet Gottman jedes Paar, zu erzählen, wie sie sich kennengelernt haben, denn er hat festgestellt, dass dieses Muster sofort auftaucht, wenn die beiden Partner vom wichtigsten Ereignis in ihrer gemeinsamen Beziehung erzählen.
»Es ist ziemlich einfach«, sagt Gottman. »Erst gestern habe ich mir ein Band angesehen, in dem die Frau erzählt: ›Wir haben uns an einem Ski-Wochenende kennengelernt. Er war mit einer Gruppe von Freunden da. Er hat mir gleich gefallen, und wir haben uns verabredet. Aber dann hat er zu viel getrunken und ist wie ein Stein ins Bett gefallen, und ich habe drei Stunden auf ihn gewartet. Ich bin dann zu ihm aufs Zimmer und hab’ ihn aufgeweckt und zu ihm gesagt: Ich mag es nicht, wenn man mich so behandelt. Das ist nicht nett von dir. Und er sagte, ja, Mann, ich hab’ echt ›ne Menge getrunken‹.« Schon in der allerersten Begegnung taucht ein besorgniserregendes Muster auf, und die traurige Wahrheit ist, dass sich dieses Muster wie ein roter Faden durch die gesamte Beziehung der beiden zieht. Gottman fuhr fort: »Als ich mit den Interviews angefangen habe, habe ich mich gefragt: Was ist, wenn wir die Leute an einem Scheißtag erwischen? Aber wir haben festgestellt, dass das gar nichts an unseren Vorhersagen ändert. Wenn Sie die Aufnahme an einem anderen Tag wiederholen, bekommen Sie immer und immer wieder dasselbe Muster.«
Um besser zu verstehen, was John Gottman mit der Ehe-DNS meint, will ich von einem Phänomen aus der Welt der Morsefunker erzählen, das man unter Funkern eine Handschrift nennt. Morsezeichen bestehen aus Punkten und Strichen beziehungsweise langen und kurzen Signalen. Jedes Signal hat eine vorgeschriebene Länge, aber natürlich kann niemand diese Längen immer perfekt einhalten. Wenn Funker eine Nachricht verschicken, insbesondere wenn sie einen alten Apparat mit Morsetaste verwenden, dann ist bei jedem die Länge der Punkte, Striche und Zwischenräume anders, und jeder verbindet Punkte, Striche und Zwischenräume auf ganz charakteristische Weise miteinander. Morsen ist wie Sprechen: Jeder Funker hat seine eigene, unverwechselbare Stimme.
Im Zweiten Weltkrieg spielte das Abfangen und die Entschlüsselung von feindlichen Nachrichten eine wichtige Rolle. Die britische Armee beschäftigte Tausende von Frauen, um Tag und Nacht die Funknachrichten der verschiedenen deutschen Einheiten abzuhören. Natürlich sendeten die Deutschen verschlüsselte Nachrichten, sodass die Briten zumindest in den ersten Kriegsjahren nicht verstanden, was gesendet wurde. Das war aber nicht immer notwendig, denn es dauerte gar nicht lange, bis die Frauen allein vom Zuhören in der Lage waren, die unterschiedlichen Handschriften der deutschen Funker zu erkennen. Damit hatten sie schon eine ganz wichtige Information: Sie wussten, wer eine Nachricht schickte. »Wenn man lange genug zuhörte, dann konnte man erkennen, dass eine Einheit vielleicht drei oder vier Funker hatte, die in Schichten eingeteilt waren. Jeder hatte seine ganz speziellen Eigenheiten«, erzählt Nigel West, ein britischer Militärhistoriker.
»Und natürlich gab es vor der eigentlichen Nachricht immer ein Vorgeplänkel, obwohl privater Austausch streng verboten war. Wie läuft’s bei euch? Was macht die Freundin? Wie ist das Wetter in München? Das schreiben Sie alles auf eine Karteikarte. Es dauert gar nicht lange, und Sie haben so etwas wie eine Beziehung zu diesem Funker.«
Die Frauen, die mit dem Abhören der Funknachrichten betraut waren, fanden rasch Beschreibungen für die Handschriften und Eigenheiten der Funker. Sie gaben ihnen Namen und erstellten ausführliche Persönlichkeitsprofile. Nachdem sie die Person identifiziert hatten, die eine Nachricht verschickte, orteten sie den Standort des Senders. Damit hatten sie eine weitere Information: Sie wussten, wer sich wo aufhielt. West erzählt weiter:
»Die Frauen hatten ein derartig gutes Händchen, die Eigenheiten der deutschen Funker herauszufinden, dass sie ihnen quer durch Europa folgen konnten, egal wohin sie verlegt wurden. Das waren natürlich unglaublich wertvolle Informationen, wenn es darum ging, Einsätze zu planen und festzustellen, welche Einheit sich wo aufhält und was sie dort treibt. Wenn ein bestimmter Funker bei einer bestimmten Einheit ist und aus Florenz sendet und Sie drei Wochen später denselben Funker wieder entdecken, diesmal aber in Linz, dann können Sie davon ausgehen, dass seine Einheit von Italien an die Ostfront verlegt wird. Oder Sie stellen fest, dass ein bestimmter Funker bei einer Nachschubeinheit ist und sich immer Punkt zwölf Uhr meldet. Wenn aber nach einem größeren Einsatz derselbe Funker plötzlich nicht mehr nur noch um zwölf Uhr sendet, sondern zusätzlich um zehn Uhr morgens, um vier Uhr nachmittags und um sieben Uhr abends, dann können Sie sich ausmalen, dass seine Einheit alle Hände voll zu tun hat. Wenn nun in einem kritischen Moment jemand aus der Kommandozentrale zu Ihnen kommt und Sie fragt: ›Sind Sie absolut sicher, dass dieses und jenes Fliegerkorps der Luftwaffe vor Tobruk stationiert ist und nicht mehr in Italien?‹, dann können Sie sagen: ›Ja, Oskar hat von dort gefunkt, wir sind uns absolut sicher.‹«